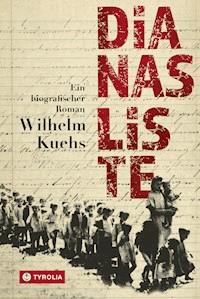14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dachbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die griechische Insel Zakynthos wird im Zweiten Weltkrieg zum Inbegriff des Widerstands. Angeführt vom Bürgermeister und dem Bischof, setzt die Bevölkerung alle Hebel in Bewegung, um ihre 275 jüdischen Mitmenschen vor dem KZ zu bewahren. Die unbarmherzigen Besatzer jedoch stellen sie Tag für Tag härter auf die Probe, sodass bald niemand mehr sicher ist. Episodenhaft werden die Geschehnisse der Zeit nacherzählt, gespickt mit historischen Figuren, die mehr oder weniger miteinander zu tun haben, wie die Herren Bürgermeister, Bischof und Rabbi, ein jüdisches Liebespaar im Widerstand, Bäuerinnen und Bauern, Tagelöhner, Schmuggler, Adlige sowie Soldaten aus den verschiedenen Lagern. Ihre Geschichten verwebt der Autor zu einem bewegenden, spannungsreichen Roman. Einnehmend von der ersten bis zur letzten Seite, begeistert das grandios recherchierte Werk mit seiner klaren und zugleich klangvollen Sprache. Eine Empfehlung für alle, die an den Lebensumständen und menschlichen Schicksalen im Zweiten Weltkrieg interessiert sind. »Ein beinahe vergessenes Stück Zeitgeschichte, verpackt in einen mitreißenden Roman.« – Markus Frey/APA-Online
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Wilhelm Kuehs
Kein Mensch ist eine Insel
Wilhelm Kuehs
Kein
Mensch
ist eine
Insel
Historischer
Roman
Dachbuch Verlag
1. Auflage: September 2022Veröffentlicht von Dachbuch Verlag GmbH, Wien
ISBN: 978-3-903263-45-1EPUB ISBN: 978-3-903263-46-8
Copyright © 2022 Dachbuch Verlag GmbH, WienAlle Rechte vorbehalten
Autor: Wilhelm Kuehs
Lektorat: Nikolai UzelacKorrektorat: Rotkel e. K.Satz: Daniel UzelacUmschlaggestaltung: Katharina NetolitzkyDruck und Bindearbeiten: Rotografika, SuboticaPrinted in Serbia
Besuchen Sie uns im Internet:www.dachbuch.at
No man is an island, entire of itself;every man is a piece of the continent, a part of the main. If a clod be washed away by the sea, Europe is the less, as well as if a promontory were, as well as if a manor of thy friend’s or of thine own were. Any man’s death diminishes me, because I am involved in mankind; and therefore never send to know for whom the bell tolls; it tolls for thee.
Kein Mensch ist eine Insel, nur für sich; jeder Mensch ist ein Stück des Kontinents, ein Teil des Festlandes; Wenn eine Scholle ins Meer gespült wird, wird Europa weniger,genauso, als wäre es eine Landzunge oder ein Landgut deines Freundes oder dein eigenes; Jedes Menschen Tod ist mein Verlust, denn ich bin Teil der Menschheit;Und darum verlange nie zu wissen,wem die Stunde schlägt; sie schlägt dir selbst.
John Donne, »Devotions upon Emergent Occasions«, 1624
»Singe mir, Muse, die Taten der heldenhaften Griechen, welche sich ohne Furcht für die Freiheit opferten, viele Schlachten schlugen und sich großen Ruhm erwarben.«
Die Verse fanden einen Moment der Stille zwischen den Rufen der Spieler und Zuschauer, die sich an diesem Sonntagvormittag am Dionysios-Solomos-Platz versammelt hatten, und drangen bis zu Anastasios Tetradis, der mit verschränkten Armen dastand und das Fußballspiel der italienischen Soldaten beobachtete. Anastasios hatte gar nicht vorgehabt, hier haltzumachen. Eigentlich wollte er weiter auf den Markusplatz und dann linker Hand bis zum alten Judenviertel, wo sich der Laden seines Freundes Avraam Matzas befand. Aber jetzt stand er neben dem Podest mit der Statue des Dichters Dionysios Solomos und folgte dem Hin und Her der Männer, die sich erst vor dem Tor drängten und dann wieder dem Ball nach auf die Gegenseite hasteten.
Auf den Gesichtern glitzerte der Schweiß. Körper prallten aneinander. Von einem Ellbogen im Magen getroffen, stöhnte einer der Spieler auf und ging zu Boden. Der Schiedsrichter pfiff und konnte sich in all dem Geschrei kaum durchsetzen. Einer von der gegnerischen Mannschaft hielt dem Gestürzten die Hand hin und half ihm hoch. Am Boden blieb ein Schweißfleck für Momente sichtbar.
Der Ball schlitterte über das Pflaster und wurde von einem Spieler gestoppt. Mit der Fußschaufel kickte er den Ball hoch und beförderte ihn in die andere Spielfeldhälfte. Dort erwartete ein Mitspieler den Ball, brachte ihn durch eine geschickte Bewegung seiner Beine unter Kontrolle und ließ ihn mit Wucht auf das aus Eisenstangen zusammengeschweißte Tor zurasen. Die Zuschauer warfen die Hände in die Höhe und raunten, als der Torwart den Ball mit den Fingerspitzen berührte und ihn so ablenkte, dass er knapp an der Torstange vorbeizischte.
In die wenigen Sekunden hinein, die es brauchte, damit die Spieler wieder Atem schöpfen konnten und einer sich aufmachte, dem Ball hinterherzulaufen, drängte sich eine Stimme. »Kotzioulas, das ist ein wunderbarer Anfang«, sagte jemand, und Anastasios glaubte, den Sprecher zu erkennen. Er drehte sich um, und tatsächlich saß Graf Alexander Roma mit einem jungen Mann auf der Terrasse des Cafés. Gerade beugte sich Roma vor, um das kleine Glas Cognac mit Daumen und Zeigefinger hochzuheben. Er prostete Kotzioulas zu. »Mein Lieber, es kommen stürmische Zeiten auf uns zu. Ja, wir stecken schon mittendrin. Da brauchen wir …« Der Rest des Satzes ging im Gejohle unter. Einer der Soldaten hatte den Ball gleich nach dem Abstoß per Kopfball zurückbefördert, und diesmal erreichte ihn der Tormann nicht. Der Ball stieg hoch und beschrieb eine Kurve, flog durchs Tor und blieb in der Hecke dahinter hängen.
Der Soldat an der Schiefertafel radierte den Sechser aus und schrieb eine Sieben hin. Die Mannschaft ohne Leibchen führte jetzt mit zwei Toren Vorsprung. Nicht nur die Kinder feuerten die Spieler an, auch die Leute, die gerade aus der Kirche kamen, und ein paar andere Passanten wie Anastasios waren stehen geblieben und verfolgten das Match, das nun in die zweite Halbzeit ging. Ein Soldat hatte sich nach hinten fallen lassen und den Ball mit gestrecktem Bein aus der Luft gefischt. Anstatt mit dem Rücken auf dem Pflaster aufzuschlagen, stützte er sich im Fallen mit einer Hand ab, drehte sich und landete auf den Füßen. Die akrobatische Einlage brachte ihm anerkennende Pfiffe ein. Er richtete sich auf, deutete eine Verbeugung an und spielte weiter.
Unter all den Rufen und dem Klatschen, das wie Sturmböen über den Platz ging, verwehte die Unterhaltung des Grafen Roma mit dem Schriftsteller Giorgos Kotzioulas beinahe, und Anastasios wandte sich nun um, weil er doch neugierig geworden war und wissen wollte, ob Kotzioulas noch mehr Verse zum Besten geben würde oder ob es sonst etwas Besonderes zu hören gab. Anastasios hatte so eine Ahnung, als er die beiden Männer an dem Tisch sitzen sah. Er vermutete, dass Kotzioulas vom Festland kam. In Zeiten des Krieges und der Besatzung aber wagte man diese Reise nicht ohne triftigen Grund. Es musste jedenfalls mehr dahinterstecken als ein Gedicht zu Ehren der tapferen Griechen. Doch im Moment konnte Anastasios kein Wort verstehen, denn schon wieder stürzte ein Spieler. Er blieb verkrümmt liegen, hielt den Arm, als sei er gebrochen. Der Schiedsrichter rannte zu ihm hin und winkte ein paar Soldaten herbei, die am Rand des Spielfeldes standen. Sie halfen dem Mann hoch. An seinem Unterarm wurde eine große Schürfwunde sichtbar, und noch ehe der Schiedsrichter den Ball aufnehmen konnte, um das Spiel fortzusetzen, gerieten die Spieler aneinander.
Ein durchdringender Pfiff. Die Spieler hielten sich immer noch an den Hosen und Leibchen fest, hatten die Fäuste erhoben, aber sie wandten die Köpfe und verstummten.
»Glauben Sie mir. Niemand kann uns befreien, außer wir selbst«, sagte Kotzioulas und ballte die Faust. »Wer auch immer …« Ein Schrei verschluckte den Rest des Satzes.
Anastasios verließ seinen Platz am Podest des Dichters und drängte sich durch die Reihen nach hinten. Nur ein paar Schritte, ganz unauffällig, sodass er in der Nähe des Cafés zu stehen kam. Von hier aus konnte er zwar das Spielfeld nicht sehen, aber vielleicht noch ein paar Fetzen der Unterhaltung aufschnappen. Alexander Roma hob kurz den Blick. Es schien Anastasios für einen Moment, als würde ihn der Graf direkt ansehen. Sein Herz schlug wie wild. Es war gar nicht auszudenken, wenn der Graf ihn bemerkte. Aber Romas Blick glitt an ihm ab, als stünde hier nicht Anastasios Tetradis, sondern nur ein Topf mit einer Palme.
Giorgos Kotzioulas erhob sich und reichte Graf Roma die Hand. Die Unterhaltung war beendet, und Anastasios hatte sich ganz umsonst nach hinten durchgekämpft. Es gab nun nichts anderes mehr zu belauschen als Graf Romas Schweigen.
Das Spiel war weitergegangen, aber Anastasios konnte von hier nicht einmal die Schiefertafel mit dem Spielstand ausmachen. Nun, eigentlich war es gut so. Er war nicht wegen des Spieles in die Stadt gekommen, sondern wegen seines Tabaks. Sollten die Italiener doch ihren Ball über den Solomos-Platz kicken und glauben, sie hätten den Krieg gewonnen.
Anastasios wollte sich abwenden, ließ seinen Blick noch einmal über die Menge streifen. Er sah hinauf zur Statue des Dichters. Dionysios Solomos, der 1823, mitten im Krieg gegen die Türken, die Freiheitshymne verfasst hatte. Anastasios summte die Melodie vor sich hin, und wie von selbst formten sich die Verse in seinem Mund.
»Aus der Achaier Asche bist dunun wutentbrannt entsprossenschüttelst ab das SklavenjochHeil dir, Freiheit, sei gegrüßt.«
Genau so würde es am Ende kommen. Sie würden die Italiener davonjagen, und auch die Deutschen, die sich in Athen und Thessaloniki breitgemacht hatten. Vielleicht dauerte es ein paar Monate, vielleicht sogar ein Jahr oder länger. Aber am Ende würden die Griechen wieder frei und stolz die Herren in ihrem eigenen Land sein. Davon war Anastasios überzeugt, und er sah hinauf zum Standbild des Dichters. Dabei irritierte ihn etwas.
Anastasios kannte die Statue ganz genau. Jedes Mal, wenn er in die Stadt kam und über den Solomos-Platz ging, betrachtete er das Lockenhaupt des Dichters, das von einem Lorbeerkranz gekrönt wurde. Eben damit stimmte aber heute etwas nicht. Der Lorbeer war an seinem Platz, doch darunter klaffte ein Loch. Das Ohr des Dichters fehlte.
Wie von selbst senkte sich Anastasios’ Blick. Natürlich, wenn das Ohr abgebrochen war, musste es auf den Boden gefallen sein. Wirklich entdeckte Anastasios Marmorstaub auf den Stufen des Podests und darunter auf dem Pflaster ein Fragment des abgeschlagenen Ohres. Für Anastasios bestand kein Zweifel, was sich hier zugetragen hatte: Die italienischen Soldaten hatten dem großen Dichter Dionysios Solomos ein Ohr abgeschossen.
Er hob das Fragment auf, barg es wie einen verletzten Vogel in der Handfläche und verlor mit einem Mal jede Scheu. So trat er auf Graf Roma zu und hielt ihm das verstümmelte Marmorohr des Dichters entgegen.
»Das haben sie uns angetan«, sagte Anastasios.
Graf Roma nahm das Marmorfragment und besah es sich genau. Für einen Moment weilte sein Blick auf Anastasios’ Gesicht, und jetzt sah er ihn wirklich, diesen Bauern, der mit Tränen in den Augen vor ihm stand, weil jemand die Statue des Nationaldichters beschädigt hatte.
»Es waren die Italiener«, sagte Anastasios laut, und nun drehten sich die Leute zu ihm um. Er streckte den Arm aus und zeigte auf die Statue des Dichters. »Sie haben ihm das Ohr abgeschossen. Seht nur her, der Graf hält es in seiner Hand!«
Einige Leute folgten seiner Geste, sahen zum Standbild des Dichters auf und bemerkten den hellen Fleck, die ausgebrochene Scharte, wo zuvor das linke Ohr des Dichters halb versteckt unter den Locken gewesen war. Sie zeigten mit den Fingern auf die Stelle, und sie murmelten. Dann tippte einer dem Schiedsrichter auf die Schulter und fragte ihn, ob er das gesehen hätte und was er denn dazu zu sagen habe, wenn seine Spieler, seine Soldaten, wie die Barbaren mit Fußbällen auf Statuen schossen. Sei das einer Nation wie der italienischen denn angemessen? Doch wohl nicht, wenn man sich damit brüste, das einzig wahre Kulturvolk Europas zu sein, und meinen, Griechenland nicht besetzt, sondern endlich gerettet zu haben.
Der Schiedsrichter, gleichzeitig Kommandant der Einheit, die das Fußballspiel austrug, blies in seine Trillerpfeife, dass sich der Ton überschlug, und brüllte über den Platz, die Soldaten hätten sich in Reih und Glied aufzustellen und auf weitere Befehle zu warten.
Nur Augenblicke später standen die Soldaten mit herausgedrückter Brust, immer noch nach Luft ringend, stramm und hielten den Blick geradeaus. Es war ihnen nicht anzusehen, ob sie ahnten, was hinter der Unterbrechung steckte, dem plötzlich harschen Ton des Offiziers.
Ohne seine Männer weiter zu beachten, ging der Schiedsrichter auf die Statue des Dichters zu. Die Menge wich vor ihm zur Seite, sodass nun Anastasios und Graf Roma dastanden wie ein Empfangskomitee.
»Die Soldaten haben …«, begann Anastasios. Aber als er den Gesichtsausdruck des Offiziers sah, verstummte er.
»Colonnello Francesco Sforza, Kommandant der 4. Abteilung der Divisione Acqui auf Zante«, stellte sich der Offizier vor und salutierte vor Graf Roma. »Ich habe mit Graf Alexander Roma die Ehre, wenn ich mich nicht irre?«
Roma neigte nur leicht den Kopf und lenkte damit Sforzas Blick auf das Marmorfragment in seiner Hand.
»Es ist abgebrochen«, sagte Anastasios leise.
»Das habe ich gesehen, Bauer«, antwortete Sforza scharf. »Und du behauptest, das seien meine Männer gewesen?«
Anastasios hielt dem Blick des Offiziers nicht stand.
»Das meinst du doch?«, setzte Sforza nach.
»Es ist aus logischen Gründen nicht ganz von der Hand zu weisen«, sagte Graf Roma. »Sehen wir uns die Situation doch einmal an. Wir haben hier ein abgebrochenes Stück Marmor, das sich vor Kurzem noch da oben an der Statue befand. Um diesen Schaden zu verursachen, muss ein Gegenstand mit großer Wucht gegen die Statue geprallt sein. Das könnte selbstverständlich sehr vieles gewesen sein. Ein Stein, der vom Himmel fällt, eine Stange, die ein unachtsamer Arbeiter über den Platz getragen hat. Aber überlegen wir einmal: Haben Sie, mein lieber Sforza, heute schon einen Stein vom Himmel fallen gesehen? Oder einen Arbeiter mit einer fünf Meter langen Stange, der über den Solomos-Platz geht? Nein, ich glaube nicht. Doch wir alle haben das Fußballspiel gesehen. Also, was schließen Sie daraus?«
»Ist das überhaupt von Bedeutung?«, fragte Sforza.
»Nun, für uns ist es das«, antwortete Roma.
Ohne ein weiteres Wort drehte Sforza auf den Fersen um und ging zu seinen Männern zurück. Er baute sich vor ihnen auf. »Wer hat zu dieser Angelegenheit etwas zu sagen?«, fragte er in schneidendem Ton.
Die Männer rührten sich nicht.
»Kann es sein, dass ein Soldat der italienischen Armee so selbstvergessen und ehrlos ist, ein Kunstwerk zu beschädigen und darüber nicht sofort Bericht zu erstatten?«
Noch immer meldete sich niemand, aber die Zuseher am Rand des Spielfeldes wurden unruhig. Sie hatten jetzt alle verstanden, worum es hier ging, und keiner zweifelte daran, dass die italienischen Soldaten absichtlich auf den Nationaldichter der Griechen geschossen hatten. Um ihn zu verhöhnen, um zu zeigen, wie wenig er und seine Griechen sich gegen die Okkupation wehren konnten. Von Freiheit zu singen war das eine, aber sie zu besitzen etwas ganz anderes. Und nun, nach etwas mehr als hundert Jahren, in denen die Griechen die Freiheit gekostet hatten, kamen neue Herren und machten aus freien Männern Untertanen.
»Gebt es doch zu«, rief jemand vom südlichen Ende des Platzes.
»Genau«, stimmte ein anderer ein. »Zuerst die Helden spielen und dann zu feig, es zuzugeben.« »Es ist ein Skandal!«
Von irgendwo, man konnte es nicht genau sagen, erhob sich ein Summen. Eine Melodie, die immer lauter wurde. Anastasios stimmte ein und sang von Freiheit und von Tod. Sforza blies in seine Trillerpfeife, aber das schreckte die Männer nicht sehr. Nur kurz unterbrachen sie die griechische Nationalhymne, und als Sforza sah und hörte, dass auch Graf Roma, leise zwar, aber immerhin, mitsang, brüllte er los: »Verhaften! Auf der Stelle. Den«, er zeigte auf Anastasios, »und den dort auch. Los!«
Anastasios sah zwei Soldaten auf sich zustürmen. Er hatte gar keine Zeit zu reagieren, fand sich am Boden wieder, einen Stiefel im Genick.
Der Tumult erfasste den Platz. Wer konnte, flüchtete in die Seitengassen oder hinaus auf die Mole. Nur Graf Roma blieb, wo er war, das abgeschlagene Ohr des Dichters in der Hand. Aber auch er hatte aufgehört zu singen.
Weder Graf Roma noch sonst jemand hatte den Jungen bemerkt, der mit anderen Kindern lange Zeit am Rand des Spielfeldes gestanden war. Jetzt waren der Junge und seine Freunde verschwunden. Aber er war nicht einfach blindlings davongelaufen wie die meisten Erwachsenen. Er flitzte den Hafen entlang auf dem schnellsten Weg zur Kirche des Heiligen Dionysios. Die Sonntagsmesse war schon seit mehr als einer Stunde zu Ende, aber wenn Demetrios Glück hatte, dann hielt sich Bischof Chrysostomos noch in der Kirche auf. Es musste schnell gehen, denn die Italiener zögerten nicht lange. Sie würden die zehn Männer einfach erschießen. Damit drohten sie schon, seit sie vor ein paar Wochen auf der Insel gelandet waren. »Wenn ihr euch gegen uns auflehnt, dann werden wir ein Exempel statuieren«, hatte ihr Kommandant Luigi Gianni verkündet, als er auf dem Solomos-Platz bekannt gab, dass Zakynthos nun nicht länger zu Griechenland, sondern zu Italien gehöre. Im Namen des Königs Vittorio Emanuele III. nehme er diese Insel nun in Besitz.
Demetrios hatte nicht verstanden, was ein Exempel sein sollte, nur dass es nichts Gutes war, das hatte er gleich begriffen. Er musste den Bischof verständigen, sonst gab es noch Tote. Tatsächlich fand Demetrios den Bischof und Pater Giorgos im Kloster hinter der Kirche. Wie immer wischte Demetrios einfach am Portier vorbei und rannte in den Aufenthaltsraum. Niemand kümmerte sich darum, denn jeder wusste, dass Demetrios der kleine Liebling des Bischofs war. Vor zwei oder sogar schon drei Jahren war der Junge aufgetaucht und nicht mehr von der Seite des Bischofs gewichen.
Bischof Chrysostomos hörte den Bericht nicht zu Ende, stand auf und hastete aus dem Kloster. Demetrios folgte ihm im Laufschritt. Der schwarze Umhang wehte um den massigen Körper des Bischofs, als er die Hafenstraße entlangrannte, seinen schwarzen Hut mit der Hand auf seinem Kopf festhielt und Demetrios schnaufend Anweisungen gab. Der Junge solle vorauslaufen und, wenn möglich, den Bürgermeister verständigen. Die Lage sei ernst, solle er ihm sagen, todernst. Die Italiener hätten nur auf eine Gelegenheit wie diese gewartet.
Als Chrysostomos auf dem Solomos-Platz eintraf, hatten die italienischen Soldaten die zehn Gefangenen schon von der Menge isoliert, hatten sie ganz nahe beim Podest der Statue festgesetzt und hielten sie mit Gewehren in Schach.
Graf Alexander Roma unterhielt sich mit dem Offizier, der immer wieder auf die Gefangenen zeigte und seine Antworten schreiend erteilte. Sie bemerkten Bischof Chrysostomos erst, als er schon neben ihnen stand.
»Eure Exzellenz«, sagte Graf Roma und beugte sich vor, um die Hand des Bischofs zu küssen. »Welch Fügung Gottes, dass Sie gerade jetzt zu Hilfe eilen.«
Chrysostomos ließ die Huldigung über sich ergehen und sah dann den italienischen Offizier an. »Was werfen Sie den Leuten vor, die Sie verhaftet haben?«
»Wie ich schon Graf Roma erklärt habe, geht es nicht um das abgeschlagene Ohr, sondern darum, dass die Leute zum Widerstand gegen die Besatzungsmacht aufgerufen haben.«
»Die keine Besatzungsmacht sein möchte«, wandte Graf Roma ein. »Wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind wir jetzt Teil des italienischen Königreichs.«
»Sie haben das verstanden«, sagte Sforza. »Aber diese Bauern hier nicht.«
»Und deshalb lassen Sie zehn Leute verhaften?«, fragte Chrysostomos. »Was soll nun mit ihnen geschehen?«
»Sie werden vor ein Kriegsgericht gestellt. Aber ich kann Ihnen jetzt schon sagen, wie die Sache ausgeht«, meinte Sforza. »Sie werden alle erschossen. Man wird sie hier auf diesem Platz aufstellen und am Ort ihres Verbrechens hinrichten.«
»Worin genau besteht das Verbrechen?«, fragte Chrysostomos. »Doch wohl nicht darin, dass die Vermutung aufkam, die italienischen Soldaten hätten dem großen Sohn unserer Insel, dem weithin bekannten und verehrten Dichter Dionysios Solomos, ein Ohr abgeschossen?«
»Darauf läuft es wohl hinaus«, sagte Graf Roma. »Wenn die Soldaten ihre Schuld eingestanden hätten, hätte niemand die Freiheitshymne angestimmt. Das aber will Colonnello Sforza nun wohl als Beweis für Hochverrat und Anstiftung zum offenen Aufstand auslegen.«
»Aber das ist doch ganz nebensächlich«, sagte Sforza. »Und außerdem haben meine Soldaten die Statue nicht beschädigt.«
»Das ist eine Frage, die man unbedingt klären sollte«, sagte Bischof Chrysostomos. »Denn an ihr hängt doch, ob sich die Männer schuldig gemacht haben oder ob ihre Empörung über eine Ungerechtigkeit und Lüge zu einer Reaktion geführt hat, die vielleicht etwas übertrieben war, aber keineswegs gleich als offener Widerstand gegen die Okkupation gelten kann.«
»Ich habe die Soldaten schon befragt. Sie leugnen es«, sagte Sforza.
»Aber irgendwer muss die Statue beschädigt haben«, insistierte Chrysostomos. »Das Ohr ist dem Dichter nicht von selbst abgefallen.«
»Das ist es doch, was ich die ganze Zeit sage«, sprang Graf Roma dem Bischof bei. »Aber Colonnello Sforza verweigert eine Befragung der Soldaten durch mich.«
»Das steht Ihnen auch nicht zu. Sie bekleiden kein offizielles Amt und haben daher kein Recht, eine Untersuchung zu führen«, sagte Sforza.
»Wir wollen doch nur höflich fragen, ob sich vielleicht jemand daran erinnert, was sich zugetragen hat. Ganz ohne Verhör oder Zwang.« Chrysostomos lächelte und breitete die Arme aus, als wolle er Sforza und seine Soldaten umarmen.
Mittlerweile war Demetrios zurückgekommen. Im Schlepptau hatte er Bürgermeister Loukas Karrer.
»Nun, hier haben Sie Ihren offiziellen Vertreter«, sagte Graf Roma an Sforza gewandt.
»Ich bin unterrichtet«, kam Karrer dem Offizier zuvor, der offensichtlich zu einer neuerlichen Erklärung ansetzen wollte. »Der Junge hat mir erzählt, was vorgefallen ist.«
»Wir wollten gerade die Soldaten befragen«, sagte Chrysostomos.
»Ja, dann machen wir das«, antwortete Karrer.
»Aber das ist keine Angelegenheit der zivilen Verwaltung«, wehrte sich Sforza.
»Da bin ich anderer Meinung«, sagte Karrer.
»Sie dürfen die Soldaten gar nicht offiziell befragen.«
»Dann plaudern wir nur«, sagte Karrer und folgte dem Bischof, der schon bei den Soldaten stand und sich mit ihnen unterhielt.
»Wir? Warum sollten wir auf die Statue schießen?«, hörte er einen Soldaten sagen.
»Es ist nicht die Frage warum, sondern ob«, sagte Chrysostomos. »Vielleicht war es ja ein Versehen. Jemand hat den Ball nicht richtig erwischt, und dann ist er in die falsche Richtung geflogen, und schon war das Unglück passiert.«
»Aber nein«, sagte der Soldat. »Wir haben nur hier auf dem Platz gespielt, und der Ball ist nie höher geflogen als drei Meter. Wir waren das nicht.«
»Es ist aber eine unbestreitbare Tatsache, dass dem Dichter nun ein Ohr fehlt.«
»Ach, um Himmels willen«, sagte ein anderer Soldat. »Jetzt rückt halt endlich heraus mit der Sprache. Ich verstehe überhaupt nicht, warum wir hier herumstehen und so tun, als wüssten wir nicht, was geschehen ist.«
»Also dann«, wandte sich Chrysostomos an den Soldaten. »Bringen Sie Licht in die Angelegenheit.«
»Es ist ja nicht besonders mysteriös«, begann der Soldat. »Bevor wir mit dem Spiel angefangen haben, haben wir uns ein bisschen aufgewärmt. Sind herumgelaufen und so, und währenddessen haben wir den Ball den Kindern überlassen. Die haben damit gespielt, und dabei ist es dann halt passiert. Keine Ahnung, wer es war. Ich habe nicht hingeschaut. Aber einer der Jungen hat den Ball wohl falsch auf die Fußspitze bekommen, und schon ist er abgezogen. Direkt auf die Statue zu. Ein Volltreffer.«
»Sie wollen sagen, die Kinder haben die Statue beschädigt?«, fragte Bürgermeister Karrer. »Ja, genau so war es.«
Die umstehenden Männer, Gefangene und Zuschauer, murrten. Einige traten vor, als wollten sie auf die Soldaten losgehen, aber Chrysostomos hob die Hand und gebot ihnen Einhalt. »Das ist eine Frage, die sich klären lässt«, sagte er und winkte Demetrios herbei. Er ging in die Hocke und fasste den Jungen an der Schulter. »Du warst doch die ganze Zeit über hier. Du hast die Messe vorzeitig verlassen, um das Spiel zu sehen, nicht?«
»Dafür entschuldige ich mich«, sagte Demetrios und senkte den Blick.
Chrysostomos strich dem Jungen über die Wange. »Manchmal locken die Dinge der Welt, und wenn es nur ein Fußballspiel ist, ist nichts Schlimmes geschehen. Vielleicht sogar im Gegenteil. Demetrios, du warst also schon ganz früh hier. Noch bevor das Spiel anfing?«
Demetrios nickte.
»Also hast du gesehen, was sich vor dem Spiel zugetragen hat?«
Demetrios nickte abermals.
»Stimmt es, dass die Soldaten ihren Ball euch Kindern überließen?«
»Ja«, sagte Demetrios jetzt aufgeregt. »Aber das mit dem Ohr waren wir nicht.«
»Sondern?«
»Die Soldaten werden böse, wenn ich die Wahrheit sage«, meinte Demetrios und schaute von unten herauf, ob ihn jemand bedrohte. »Sie haben den armen Mann zu Boden gerissen und ihn geschlagen. Ich habe Angst vor den Soldaten.«
»Du musst keine Angst haben«, sagte Chrysostomos. »Du weißt doch, du stehst unter meinem Schutz.«
Demetrios schien zu überlegen.
»Weißt du noch, welche Geschichten ich dir über die Märtyrer des wahren Glaubens erzählt habe?« Chrysostomos fasste die Schulter des Jungen fester. »Sie sind für die Wahrheit eingetreten und haben sich immer schützend vor jene gestellt, die zu Unrecht beschuldigt wurden. Möchtest du nicht ihrem Vorbild folgen?«
»Es waren die Soldaten«, sagte Demetrios nach einer Weile leise.
»Das ist eine Lüge«, rief Sforza. »Der Junge erzählt eine Geschichte, um die Männer vor dem Erschießungskommando zu retten. Noch ein Wort, und ich lasse auch ihn verhaften.«
»Nein«, sagte Chrysostomos und stand auf. »Der Junge lügt nicht. Das würde er nicht wagen. Ich kenne ihn, und ich vertraue ihm.«
»Das Wort eines kleinen Rotzlöffels gilt Ihnen also mehr als das eines italienischen Offiziers?«
»Wenn es so war, wie Demetrios erzählt, dann haben sich die Leute doch zu Recht empört«, sagte Chrysostomos.
»Aber es war nicht so«, beharrte Sforza. »Doch selbst wenn, gibt ihnen das noch lange nicht das Recht, sich offen gegen die Staatsmacht aufzulehnen.«
»Indem sie ein Lied singen?«, fragte Chrysostomos.
»Sie wissen sehr gut, dass die Freiheitshymne nicht einfach ein Lied ist. Sie ist ein Aufruf zu Verrat und bewaffnetem Aufstand.«
»Nun, sie ist aber auch, und vor allem, ein Gedicht, das Dionysios Solomos, der große Sohn unserer Insel, verfasst hat«, sagte Chrysostomos. »Ich finde jetzt nichts Aufrührerisches dabei, wenn die Leute es ihm zu Ehren singen.«
»Abführen«, befahl Sforza seinen Soldaten. »Sie können sich beim Inselkommandanten beschweren. Das Kriegsgericht wird morgen tagen, und bei dieser Gelegenheit werden mögliche Einwände der zivilen Verwaltung gebührend berücksichtigt.«
Anastasios Tetradis lehnte sich an die Wand der Gefängniszelle und schloss die Augen. Draußen auf dem Platz hatte er geglaubt, dies sei seine letzte Stunde. Selbst als der Bischof und der Bürgermeister aufgetaucht waren, hatte er keine große Hoffnung gehabt. Aber dieser Bengel, der dem Bischof immer hinterherlief, hatte sie alle gerettet. Ein mutiger kleiner Mann, ein richtiger Grieche, fand Anastasios. Auf den konnte man stolz sein. Es war nur die Frage, wie lange der Stolz andauerte. Wenn sie morgen vors Gericht gezerrt und verurteilt würden, war das wohl nicht mehr lang. Denn die Italiener würden nicht zögern, es war eine zu gute Gelegenheit, um ihre Macht zu demonstrieren.
»Wir haben sie noch diesen Winter zum Teufel gejagt, und jetzt glauben sie, sie können mit uns machen, was sie wollen«, sagte einer der Männer. Anastasios beugte sich ein wenig vor, um sein Gesicht besser sehen zu können.
»Vor ein paar Monaten noch, sind sie vor uns davongelaufen, die Siena, Ferrara und Centauri. Durch den Schlamm und die Kälte sind sie getürmt wie Diebe, die man im Hühnerstall erwischt hat.«
Jetzt sah Anastasios, wer da sprach. Es war Nikolaos Katevatis, und Katevatis wusste Bescheid. Immerhin hatte er selbst von Anbeginn des Krieges im Oktober 1940 an der albanischen Front gegen die Italiener gekämpft.
Nikolaos Katevatis war einer der Ersten auf Zakynthos, die sich freiwillig meldeten und mit der Fähre nach Mesolongi fuhren. Von dort reiste er mit dem Bus weiter nach Norden, um sich in Ioannina bei der 8. Infanteriedivision des griechischen Heeres unter Generalmajor Charalambos Katsimitros zu melden. Doch als er dort ankam, war die Einheit schon längst ausgerückt und befand sich auf dem Weg nach Kalpaki, einer kleinen Gemeinde weit im Norden des Epirus, direkt an der albanisch-griechischen Grenze.
»Die Italiener glaubten, das wird ein Spaziergang für sie«, sagte Katevatis. »Die Bauern haben mir erzählt, sie hätten die Soldaten auf ihren Motorrädern vorbeifahren gesehen, und einer hätte laut gerufen, den Nachmittagskaffee würde er schon in Ioannina trinken.«
Aus dem schnellen Vormarsch wurde nichts. Bereits an der Grambala, einer Anhöhe am Pindos-Gebirge, empfing die 8. Infanteriedivision der griechischen Armee das 25. Armeekorps der Italiener.
»Sie versuchten es mit Luftunterstützung. Die Italiener bombardierten unsere Stellungen, um uns mürbe zu machen. Aber als sie dann die Infanterie schickten, bekamen sie eine Antwort, mit der sie nicht gerechnet hatten«, fuhr Katevatis in seiner Erzählung fort. »Ich kam am 1. November an der Front an. Da hatten die Italiener die Anhöhe mit einem Überraschungsangriff erobert. Ein wütendes Gewitter war losgebrochen. Es stürmte, und eiskalter Regen wirbelte uns entgegen. Selbst wir, die wir wild entschlossen waren, den Italienern an die Kehle zu springen, konnten nicht weiter. Überall Schlamm und Dreck, und der Regen durchnässte unsere Kleider. Aber bei der ersten Gelegenheit schlugen wir los. An meinem ersten Tag an der Front jagten wir die Italiener zum ersten Mal zum Teufel.«
Das war nicht die einzige Geschichte aus dem Krieg, die Anastasios an diesem Sonntag hörte. Immer ging es darum, dass die Italiener eine Schlacht nach der anderen verloren hatten. Jede dieser Erzählungen war wahr. An keiner Front, in keinem Kampf konnten die Italiener einen Sieg erringen, und dennoch hatten sie den Krieg gewonnen.
Aber eben nicht aus eigener Kraft. Erst als die 12. Armee der deutschen Wehrmacht am 6. April 1941 die bulgarisch-griechische Grenze überschritt und auf Thessaloniki marschierte, wendete sich das Kriegsglück der Griechen. Es dauerte keinen Monat, bis General Georgios Tsolakoglou am 20. April 1941 vor der deutschen Wehrmacht kapitulierte.
Ein paar Wochen später erreichte die neue Ordnung auch Zakynthos. Ein Schiff, mit Fahnen und Wimpeln geschmückt, hatte sich durch die Fahrrinne in den Hafen geschoben an jenem 1. Mai 1941. Anastasios war zufällig in der Nähe gewesen, hatte seinen Eselskarren angehalten und sich hingesetzt, um die Ankunft der italienischen Besatzer zu beobachten. Die Fischer, die an der Mole ihre Netze sortierten, waren die einzigen anderen Zeugen dieses angeblich so historischen Moments.
Wenn der Kommandant der Divisione Acqui ein Empfangskomitee erwartet hatte, wurde er jedenfalls enttäuscht. Er schritt in militärischer Haltung über die Landungsbrücke. Die anderen Offiziere zögerten. Einer machte ein paar Schritte nach vor, stand schon fast auf dem Steg, drehte aber wieder um, als wäre er sich nicht sicher, ob es erlaubt war, das Land zu betreten. Auch der Kommandant hielt kurz inne, als er sah, dass außer den Fischern und einem Bauern mit seinem Eselskarren niemand da war, um ihn zu begrüßen. Er fasste sich aber und steuerte auf das Rathaus zu.
So hatte die italienische Besatzung begonnen. Luigi Gianni, der neue militärische Befehlshaber auf Zakynthos, klopfte an die Tür des Rathauses und wartete, dass ihm jemand öffnete. Doch so höflich blieben die Italiener nicht. Auch wenn sie immer behaupteten, Zakynthos sei gar kein besetztes Gebiet, man habe die Insel lediglich zurück ins italienische Reich geholt, benahmen sich die Soldaten wie eine Kriegsmacht und konfiszierten Essen und Kleidung, fragten nicht, bezahlten nicht und drohten jedem, der ihnen entgegentrat, mit dem Kriegsgericht.
Wie konnte denn Kriegsrecht gelten, wenn die Insel gar nicht zu den besetzten Gebieten gehörte, hätte Anastasios den Kommandanten Gianni gern gefragt. Aber dazu würde er jetzt wohl keine Gelegenheit mehr haben. Die Verhandlungen des Bischofs und des Bürgermeisters waren gescheitert. Morgen würde er zum letzten Mal den Solomos-Platz betreten. Dieses Mal, um dort zu sterben.
In der engen Zelle fand kaum jemand Schlaf. Hockend, mit dem Rücken zur Wand, dösten die Männer ein wenig. Zwei oder drei ließen ihr Komboloi durch die Finger gleiten. Die Kugeln klackten rhythmisch aneinander. Draußen spielten die Italiener Karten und johlten und schrien dabei. Um die Gefangenen kümmerten sie sich nicht. Sie hatten ihnen einen Blecheimer mit einem Deckel als Toilette hingestellt. Zu essen und zu trinken gab es nichts.
Anastasios dachte darüber nach, wie seine Frau sich wohl fühlen musste. Hoffentlich hatte ihr jemand Nachricht gebracht. Dann wusste sie wenigstens, dass er im Gefängnis saß. Aber dann wusste sie auch, was morgen geschehen würde. So oder so stellte sich Rubini sicher gerade das Schlimmste vor. Was würden sie und die Kinder ohne ihn machen? Sie würden das Haus verkaufen müssen und den wenigen Grund, den sie hatten. Den Vertrag mit dem Grafen Roma über die Bewirtschaftung der Olivenhaine konnte Rubini allein nicht erfüllen. Die Kinder halfen zwar mit, aber das würde niemals reichen, um die viele schwere Arbeit zu erledigen.
Hätte er besser den Mund gehalten und das Ohr dort liegen gelassen, wo es hingefallen war. Es konnte ihm doch egal sein, ob die Italiener die Solomos-Statue demolierten, und wenn sie sie mit Vorschlaghämmern zerkleinerten. Was musste er sich darüber aufregen?
Aber er konnte nicht anders. Die italienischen Soldaten machten ihn wütend. Jedes Mal, wenn er einen von ihnen sah, geriet er in Rage. Die Griechen hatten hart für ihre Freiheit gekämpft, und nun sollten sie sich einer Macht beugen, die den Krieg nur mit Hilfe der Deutschen gewonnen hatte?
Das Kriegsgericht tagte in der Morgendämmerung. Vom Meer her wehte der Geruch nach Salz und frisch gefangenen Fischen. Anastasios sog die Luft ein und blinzelte in die Sonne. Seine Hände waren hinter dem Rücken gefesselt, und er stolperte, als ein Soldat ihn von der Seite her anrempelte. Er sah in das Gesicht des Italieners. Es war das Gesicht eines jungen Mannes. Dem Anschein nach war er noch keine zwanzig Jahre alt. Auf seinen Wangen zeigte sich der erste dunkle Flaum, und auf seiner Stirn hatte die Welt noch keine Spuren hinterlassen.
»Wie heißt du?«, fragte Anastasios.
»Was geht es dich an?«
»Ich will es nur wissen. Was macht es schon aus, wenn du mir deinen Namen sagst?«
»Paolo.«
»Paolo also. Das werde ich mir merken.«
»Wozu? Du wirst kaum noch zwei Stunden leben.«
»Ich muss doch wissen, wer mir eine Kugel durch den Kopf jagt«, sagte Anastasios. »Und außerdem vertraue ich auf das Gericht und auf Gott. Ich habe nichts falsch gemacht.«
»Das interessiert niemanden, ob du etwas falsch gemacht hast. Es geht nur darum, euch zu zeigen, wer hier die neuen Herren sind.«
Damit war ihr Gespräch beendet, denn nun mussten die zehn Gefangenen vor das Kriegsgericht treten. Beim Rathaus hatte man einen großen Tisch aufgestellt, und dort saß in der Mitte der Inselkommandant Luigi Gianni, flankiert von ebenso bedeutend aussehenden Offizieren. Bischof Chrysostomos und Bürgermeister Loukas Karrer hatten nur zwei Stühle zur Verfügung. Sie mussten ohne Tisch auskommen.
Francesco Sforza verlas die Anklage. Sie lautete auf Aufruf zum offenen Widerstand und Hochverrat. Anastasios’ Blick wanderte die ganze Zeit zwischen Sforza und Bischof Chrysostomos hin und her. Kaum hatte Sforza geendet, erhob sich Chrysostomos. Als sich der Bischof den Gefangenen zuwandte, lächelte er.
»Die Ausführungen unseres verehrten Colonnello Sforza waren überaus gelehrt, und sicher sind sie wohlüberlegt, und sicherlich kennt Colonnello Sforza die Gesetze des italienischen Staates ganz vorzüglich«, sagte Chrysostomos und drehte sich dabei zum Inselkommandanten Gianni um. »Aber glauben wir wirklich, dass diese Bauern und Arbeiter, diese einfachen Männer, einen Aufstand planten?« Chrysostomos runzelte die Stirn und schüttelte dabei leicht den Kopf. »Ich kenne sie alle. Jeden Einzelnen von ihnen.« Chrysostomos zeigte auf die Gefangenen. »Unter ihnen ist kein Achill oder Leonidas. Kein griechischer Krieger. Nein«, sagte er sanft. »Sie sind nur die Hüter der Erde. Sie sind es, die die Äcker bestellen und dafür sorgen, dass Männer wie Sie«, er verbeugte sich leicht vor Gianni, »ihre Heldentaten vollbringen können.«
»Und doch haben sie die Hymne Griechenlands gesungen«, sagte Gianni.
»Das berühmteste Gedicht von Dionysios Solomos, dem großen Sohn unserer Insel, und das sangen sie wohl nicht, weil sie einen Aufstand planten, sondern weil die Statue des Dichters beschädigt wurde.«
»Von spielenden Kindern«, meldete sich Sforza.
»Ja, so wird es wohl gewesen sein«, sagte Chrysostomos. »Müssen wir aus diesem kleinen Zwischenfall ein tödliches Drama machen? Ich bin sicher, die Männer haben ihre Lektion gelernt.«
»Sie meinen also, wir sollen sie laufen lassen?«, fragte Gianni.
»Eine Nacht im Gefängnis scheint mir angemessen«, antwortete Chrysostomos. »Sie zu erschießen, ist nicht nur übertrieben. Es könnte auch eine ganz und gar verheerende Wirkung haben. Sind die Menschen jetzt noch bereit, sich mit der neuen Situation abzufinden, werden sich nach einer Hinrichtung sicher einige fragen, wie gerecht und wie friedlich die neuen Machthaber wirklich sind und wie sehr sie uns tatsächlich als ihresgleichen und nicht als Gefangene ansehen.«
»Soll das eine Drohung sein?«, fragte Gianni und erhob sich.
»Aber nein.« Chrysostomos senkte beschwichtigend die Arme. »Nicht doch. Niemand droht hier. Aber seien Sie doch klug, verehrter Herr Kommandant. Bedenken Sie die möglichen Konsequenzen, die eintreten könnten.«
Die Debatte wogte noch eine Weile hin und her, und Anastasios versuchte, den Argumenten zu folgen. Er fühlte sich geehrt, dass der Bischof vor das Gericht trat, um ihn zu verteidigen. Selbst der Bürgermeister, den er doch gar nicht persönlich kannte, war gekommen, um für ihn zu sprechen. Immer wieder betonte der Bischof, dass niemand die italienische Herrschaft infrage stelle, und wenn auch die Freiheitshymne vielleicht Anstoß erregen könne, so sei doch der Dichter, um den es hier gehe, zweifellos ein Beispiel für die Jahrhunderte währende Bruderschaft des italienischen und des griechischen Volkes.
Wie aufs Stichwort setzte hier Bürgermeister Karrer ein. »Dionysios Solomos entstammt einer alten venezianischen Familie«, erzählte er. »Weit zurück in die Dunkelheit der Geschichte reicht dieser Stammbaum von Händlern, Politikern und Dichtern. Seine Wurzeln aber hat er in Venedig, und wie einst die venezianische Herrschaft, so trieb auch der Stammbaum dieser Familie Zweige und Äste, die das ganze Mittelmeer umfassen. Als die Osmanen 1669 Kreta eroberten, flüchtete die Familie Solomos nach Zakynthos und fand hier wie viele andere eine neue Heimat. Sie blieben aber weiterhin ihren italienischen Vorfahren verpflichtet. Ist es nicht so, dass Dionysios Solomos ohne seine italienischen Wurzeln niemals die Hymne an die Freiheit hätte schreiben können? Ist es nicht so, dass er, der die Hälfte seines Werkes auf Italienisch und die andere Hälfte auf Griechisch verfasste, uns alle hier eint? Die Italiener und jene, die von Italienern abstammen, wie auch meine Familie, und die Griechen? Hat er uns nicht, gleich einem Propheten, die neue Freiheit gewiesen?«
Anastasios war verwirrt. Er verstand nicht ganz, worauf der Bürgermeister hinauswollte, aber es war jedenfalls eine mitreißende Ansprache, die irgendwie auch den Inselkommandanten zu bewegen schien.
»Also lassen wir die Huldigung unseres großen gemeinsamen Dichters durch diese einfachen Männer nicht mit einer Hinrichtung enden«, setzte Karrer seine Rede fort. »Das würde unser gemeinsames Erbe entehren und wäre doch viel schlimmer als das abgeschlagene Ohr einer Statue. Nein, wir sollten froh sein und uns freuen, dass die Liebe zur Dichtung so tief in unseren Völkern wurzelt.«
Gianni kam auf Karrer zu und umarmte ihn. Er schüttelte ihm die Hand, und dann entließ er die Gefangenen mit einer Handbewegung. »Lasst sie frei«, sagte er. »Bürgermeister Karrer hat recht. Wir sind die Völker, aus denen Europas Zivilisation entstanden ist, und wir sind es, die Europa jetzt wieder erneuern. Die Männer haben nur ihrem wahren Empfinden nachgegeben. Das kann man ihnen nicht zum Vorwurf machen.«
Anastasios schnaufte vor Erleichterung, als ihm Paolo die Fesseln abnahm. Er lächelte und klopfte dem jungen Soldaten auf die Schulter. »Siehst du, nun musst du mich doch nicht erschießen.« Damit verließ er den Platz, drehte sich kein einziges Mal um und verschwand in den Gassen, die zum ehemaligen Judenviertel führten.
Er fand seinen Freund Avraam Matzas in seinem Geschäft und nahm dankbar die Zigarette, die Avraam ihm gleich anbot. Bei einer Tasse Kaffee plauderten sie ein wenig, aber keiner der beiden kam auf die Vorfälle des gestrigen Tages zu sprechen. Avraam schien davon nichts mitbekommen zu haben. Oder aber er schwieg darüber, um Anastasios nicht in Verlegenheit zu bringen. Auf dem Heimweg, er roch immer wieder an dem Tabak, den er gerade gekauft hatte, ließ Anastasios seine Gedanken schweifen. Er wollte im nächsten Jahr auch wieder einmal ein wenig Tabak anbauen. Das hatte er gerade mit Avraam besprochen. Nicht, dass er den Tabak verkaufen wollte, nur so aus Spaß und um herauszufinden, ob sie gemeinsam eine Tabakmischung kreieren konnten, die den Orienttabaken aus Thessaloniki nahekam.
Anastasios achtete nicht auf den Weg, seine Füße würden ihn schon in die richtige Richtung lenken. Aber sie brachten ihn zurück auf den Solomos-Platz, und das erkannte er erst, als er vor der Statue des Dichters stand.
Mit Schrecken sah Anastasios sich um. Das Gericht war verschwunden. Den Tisch und die Sessel hatte man längst wieder ins Rathaus getragen, und nur dort drüben an der Ecke standen noch ein paar Soldaten. Sie hatten eine Leiter dabei, und gerade eben lehnten sie sie an eine Hauswand. Anastasios sah zu, wie einer der Männer hochstieg und das Straßenschild abmontierte. Er reichte es dem Soldaten unter ihm und nahm ein neues Schild entgegen. Das schraubte er an die Hauswand und stieg wieder von der Leiter. Dieses Schauspiel wiederholte sich an der nächsten Hausecke und an der übernächsten. Anastasios fand das sehr kurios, und deshalb ging er auf die erste Hausecke zu und sah nach oben.
Anastasios stand auf dem Solomos-Platz und das Straßenschild hatte das auch immer bestätigt. Da hätte stehen müssen: Πλατεια Διονυσιου Σολωμου – Platia Dionysiou Solomou. Aber das stand dort nicht mehr. Auf dem neuen Schild war zu lesen: Piazza Benito Mussolini.
An diesem Morgen erwachte die Stadt nur langsam. Während sich sonst im ersten Dämmerlicht schon das Leben regte, die Frauen mit ihren Krügen zum Brunnen gingen und die Händler damit begannen, ihre Maulesel zu beladen, brütete heute die Stille über den Häusern. Noch war kein Hämmern aus den Werkstätten entlang der Straßen zu hören. Die Milchmädchen hatten sich verspätet, und das Werkzeug der Zinnschmiede ruhte in den Schubladen und Kästen. Im Ovriaki, dem ehemaligen jüdischen Ghetto, hätte schon längst das Gespräch der Mütter anheben müssen, das die Häuser über die Gassen hinweg in ein Netz aus Zurufen und Ratschlägen einwob. Auch von den Kindern war noch nichts zu sehen und zu hören. Kamen sie doch sonst schon mit den Mägden in aller Frühe heraus auf die Straßen und Plätze und erfüllten die Stadt mit ihrem Lachen und ihrem Geschrei.
Raphael Konstantini erwachte in der Stille und spürte sein Herz schlagen. Es pochte in seiner Brust, als ob ihn ein Schrecken erfasst hätte. Aber er fürchtete sich nicht. Erst als er sich aufsetzte und sein Hemd überstreifte, fiel ihm auf, dass etwas nicht stimmte.
Sein Bruder murrte, als Raphael ihn anstieß, drehte sich um und zog sich die Decke bis über die Nase. In der Küche begegnete Raphael seiner Mutter, die mit verschlafenen Augen die Glut im Herd anfachte und vorsichtig einen Holzspan nach dem anderen auflegte.
»Musst du nicht längst zur Arbeit?«, fragte sie ihn, schöpfte Wasser aus einem Eimer und setzte den Kaffee auf.
»Ich weiß nicht«, sagte Raphael und streckte sich. »Ich glaube, es ist noch viel zu früh. Es schlafen doch noch alle.«
»Die Turmuhr hat schon sieben geschlagen.«
»Aber ist das nicht seltsam? Schon so spät, und kein Laut ist zu hören?«, fragte Raphael. »Heute ist doch nicht Sabbat, dass alle Leute in den Häusern bleiben.« Er trat vor die Tür und sah die Straße entlang. Zuerst auf die eine, dann auf die andere Seite. Es war niemand zu sehen.
»Der Sommer beginnt«, sagte die Mutter. »Also verkriechen sich die Menschen vor der Hitze.«
»Ja, zu Mittag«, sagte Raphael. »Aber doch nicht schon jetzt.« Er nahm seiner Mutter den Messbecher aus Blech ab, tauchte ihn in den Wassereimer und trank ihn dann leer. »Auf den Kaffee kann ich nicht warten«, sagte er schon im Gehen und winkte seiner Mutter noch zu.
Hätte er, wie noch vor ein paar Wochen, bei Ilias Mordos in der Werkstatt gearbeitet, hätte er es nicht so eilig gehabt. Wenn die ganze Stadt vor sich hin döste, war auch Herr Mordos sicher noch nicht auf den Beinen. Doch kurz nach der Ankunft der italienischen Soldaten war Raphael mit anderen jungen Männern auf dem Solomos-Platz gestanden und hatte die Panzerwagen bewundert, die vor dem Rathaus Aufstellung genommen hatten. Dabei hatte ihn ein Soldat angesprochen. Der Adjutant des Inselkommandanten, wie sich später herausstellte. Dieser Maggiore Stefano Lazzari suchte nach kräftigen Burschen, die den Soldaten zur Hand gehen konnten.
»Meldet euch freiwillig«, hatte Lazzari gesagt. »Jetzt zahlen wir noch etwas für eure Arbeit. Ein paar Lire werden es schon sein, und wenn etwas vom Essen übrig bleibt, könnt ihr es mit nach Hause nehmen. Aber bald werden andere Zeiten kommen.«
Raphael war unter den Ersten, die ihren Namen auf die Liste setzten. Sein Vater Jakob war damit nicht einverstanden. Er hatte als Marinesoldat gedient, hatte gegen die Italiener gekämpft. Er meinte, die Griechen hätten auch mit Leichtigkeit gewonnen, hätten sich nicht die Deutschen eingemischt. Er sehe es nicht gern, sagte er, wenn sein ältester Sohn diesen feigen Hunden nachlaufe und für ein paar Münzen seine Würde verkaufe.
Die Mutter hatte Raphael in Schutz genommen. Es gehe bei der ganzen Angelegenheit nicht um Würde, sondern ums Essen. Sein Vater hatte geschwiegen. Am folgenden Tag war er aufgebrochen. Er hatte oben in den Bergdörfern Arbeit gefunden. Seitdem hatte Raphael seinen Vater nicht mehr gesehen.
Wie jeden Morgen lief Raphael also auch heute die Straße hinunter Richtung Rathaus. Es war immer noch viel zu still. Nur hier und da regte sich in den Tiefen der Häuser etwas. Jemand hustete, eine Ziege scharrte mit den Hufen an einer Tür und meckerte leise. Es schien wie im Märchen, wenn ein Zauber über ein Schloss fällt und alle darin erstarren und erst wieder zu atmen beginnen, wenn ein Prinz die schlafende Prinzessin erlöst.
Der Platz vor dem Rathaus lag verlassen. Die Panzerwagen standen mit offenen Türen, und Raphael sah, wie das Metall im Inneren schimmerte. Dort im Halbschatten unter dem Verdeck lag die Munitionskiste. Man müsste sie nur mit einem Brecheisen aufhebeln und das Band in das Maschinengewehr einlegen. Das war kinderleicht. Zu gern hätte Raphael das einmal ausprobiert. Doch die Soldaten ließen ihn nicht einmal in die Nähe.
Heute hätte er Gelegenheit gehabt, den Wagen ganz genau in Augenschein zu nehmen, aber viel dringender als die Inspektion des Maschinengewehrs schien Raphael nun die Suche nach einem menschlichen Wesen.
Vielleicht fand er jemanden im Rathaus. Bürgermeister Karrer kam pünktlich jeden Morgen um halb sieben, und damit schon alles für ihn bereit war, begann sein Sekretär seinen Dienst eine halbe Stunde früher. Zur gleichen Zeit, also um sechs Uhr morgens, fand sich auch Adjutant Lazzari ein. Normalerweise sollte eine Wache vor dem Rathaus stehen und im Eingangsbereich eine weitere. Aber als Raphael das Tor aufstieß, trat er in einen verlassenen Raum. Raphael war noch nie im ersten Stock des Rathauses gewesen. Dort befanden sich die Büros der Mächtigen. Diese Männer in ihren Anzügen und Uniformen flößten Raphael Respekt ein, und er blieb ihnen lieber fern. Doch jetzt wollte er herausfinden, was hier vor sich ging, und dazu musste er vielleicht sogar mit dem Inselkommandanten Gianni reden.
Bevor Raphael die Stiege in Angriff nahm, atmete er tief durch. Er konzentrierte sich, versuchte sich zu beruhigen. Dabei hörte er die Schritte nicht, die sich ihm näherten, und als der Mann vor ihm stand, fuhr Raphael wie von einer Wespe gestochen auf und begann zu schreien.
»Was machst du hier?«, herrschte Lazzari ihn an. »Du und alle anderen solltet schon längst draußen in Akrotiri sein. Hat dir das niemand gesagt?«
»Ich … ich …«, stammelte Raphael und versuchte, den Weg frei zu machen, strauchelte und fiel hin.
»Worauf wartest du?« Lazzari ging an Raphael vorbei und öffnete das Tor. »Wir haben nicht ewig Zeit.«
Raphael konnte sich vor Schreck immer noch nicht bewegen. Es war ihm, als hätten sich seine Arme und Beine in Luft aufgelöst. Alles, was er spürte, war dieses heftige Atmen und der Herzschlag, der ihm in der Kehle saß.
»Der Kommandant wartet.« Lazzari stampfte mit dem Fuß auf. Es hallte durch die Arkaden, und mit einem Mal, er wusste nicht wie, war Raphael auf den Beinen und rannte an Lazzari vorbei.
»So ist es gut«, sagte der und ließ das Tor hinter sich zufallen, klopfte sich mit der Reitgerte an die Stiefel und zeigte auf den Panzerwagen. »Wir nehmen gleich den.«
Raphael musste sich beeilen, um auf das Trittbrett zu springen, bevor der Wagen losbrauste, eine scharfe Kurve vor dem Denkmal des Dichters vollführte und dann auf die Küstenstraße einbog.
Die Räder hinterließen kaum Spuren auf dem festgefahrenen Untergrund, aber der feine Staub bauschte sich in gelblichen Wolken hinter dem Panzerwagen. Raphael kniff die Augen zusammen und klammerte sich an den Überrollbügel, während ihm der Fahrtwind das Haar aus dem Gesicht blies.
Noch immer hatte er keine Ahnung, was hier vor sich ging, und er konnte Lazzari über den Motorlärm hinweg nicht fragen. Er hätte es auch nicht gewagt. Lazzari saß mit steinerner Miene hinter dem Steuer, sah geradeaus und schien Raphaels Anwesenheit gar nicht zu bemerken. Als er scharf nach links lenkte, hätte Raphael beinahe das Gleichgewicht verloren und schrie vor Schreck auf. Aber selbst das hörte Lazzari nicht, oder er ignorierte es.
Als sie stehen blieben und Lazzari aus dem Wagen sprang, winkte er Raphael. Vor ihnen lag die Ebene von Akrotiri, ein Feld, vielleicht ein oder zwei oder sogar drei Kilometer lang und ein paar Hundert Meter breit. Hier gab es kaum Häuser, nur ein Olivenhain schloss sich an den anderen. Gerade schlangen Soldaten eine Kette um den Stamm eines Olivenbaumes, fixierten sie mit einem Karabiner und gaben dem Mann im Panzer ein Zeichen. Die Kette straffte sich, der Motor heulte auf. Ächzend gab der Olivenbaum nach. Seine Wurzeln knackten, als sie aus dem steinigen Boden gezogen wurden, und mit einem letzten Aufrauschen der Blätter sank der Hunderte Jahre alte Baum und starb.
Raphael blieb stehen und vergaß Lazzari und die wilde Fahrt im Panzerwagen. Erstarrt vor Schreck beobachtete er, wie Motorsägen gestartet wurden und sich die rotierenden Sägeketten in das Holz fraßen.
Wie konnten sie es wagen, einen Olivenbaum zu fällen? Nur wenn ein Baum so alt war, dass er von selbst die Blätter abwarf und keine neuen Triebe mehr ansetzte, durfte man sein Holz nehmen. Aber die Soldaten schlangen die Kette schon um den nächsten Baum. Stammabschnitte wurden an Seile gebunden und mit Maultieren weggeschleift, und kaum war der Platz frei, kamen Männer mit Harken und Schaufeln und gruben die Wurzeln aus.
Aus der Ferne konnte es Raphael nicht genau sagen, aber er glaubte, diese Männer zu kennen. Es waren Handwerker aus seinem Viertel, und dort drüben standen ein paar Fischer, die damit beschäftigt waren, Kies von einem Laster zu schaufeln.
»Bist du angewachsen?«, brüllte Lazzari. »Die Männer brauchen Wasser.« Er deutete mit der Reitgerte auf einen Kanister. »Lauf los und hol welches.«
Als Raphael ihn fragend ansah, zog Lazzari wütend die Brauen zusammen. »Ihr seid wirklich für alles zu blöd«, sagte er. »Dort drüben ist die Villa des Bürgermeisters, und dort ist ein Brunnen. Also, worauf wartest du noch?«
Den Kanister unter dem Arm lief Raphael los. Er wusste, wo sich die Villa des Bürgermeisters befand. Ein zweistöckiges Gebäude mit einer großen Terrasse zur Straßenseite und dahinter ein Olivenhain. Normalerweise war das schmiedeeiserne Tor verschlossen. Raphael hatte es schon oft bewundert. Die eleganten Schwünge des Metalls, die sorgfältig ausgeführten Lanzenspitzen an der Oberseite. So etwas wollte er auch einmal können. Oft stellte er sich vor, wie es wohl wäre, nicht nur das Blech zu Rohren und Bechern zu klopfen, wie er es in der Werkstatt von Herrn Mordos lernte, sondern Metall über dem Feuer zum Glühen zu bringen und dann mit gut gezielten Schlägen eine neue Form aus dem Eisen zu schmieden. Irgendwann würde er das lernen, das hatte er sich fest vorgenommen. Jetzt drückte er das Eisentor mit der Schulter auf, und nach wenigen Schritten stellte er den Kanister am Rand des Brunnens ab.
Die steinerne Einfassung war mit einem Holzdeckel versehen. Raphael musste die Klappe hochstemmen und oben an einem Querbalken fixieren. An der Winde über dem Brunnen fehlte das Seil, aber das Wasser stand hoch, und so brauchte sich Raphael nur vorzubeugen und den Kanister ins Wasser zu drücken. Das Wasser schwappte über den Rand, benetzte Raphaels Hand, und als der Kanister vollgelaufen war, zog Raphael ihn mit einem Ruck nach oben.
Zurück bei den Soldaten konnte Raphael den Kanister kaum abstellen, schon war er von Männern umringt, um ihre Blechtassen mit Wasser zu füllen. Er trat ein paar Schritte zur Seite, um nicht im Weg zu stehen, wischte sich den Schweiß von der Stirn und sah, dass während seiner kurzen Abwesenheit zwei weitere Olivenbäume aus dem Boden gezogen und mit Motorsägen zerteilt worden waren.
Lazzari schlug mit seiner Reitgerte auf die Motorhaube eines Geländewagens. Neben ihm standen der Inselkommandant Luigi Gianni und noch ein paar Offiziere. Raphael verstand nicht, worüber sie redeten, aber er konnte sehen, wie sie die Arme ausstreckten, einmal zum Meer hin zeigten und dann wieder ins Inselinnere.
Jemand klopfte Raphael auf die Schulter. Er drehte sich um. Vor ihm stand Nikolaos Katevatis, der für gewöhnlich in Frack und Zylinder die Mole entlangflanierte, der aber seit Kurzem auch für seinen Kampf gegen die Italiener an der albanischen Grenze bekannt war.
»Hast du Wasser für mich?«, fragte Katevatis, und Raphael sah ihm an, wie schwer ihm diese Worte über die Lippen kamen. Der Mann konnte sich kaum aufrecht halten, und als Raphael ihm eine Schale reichte, zitterten seine Hände so sehr, dass er das meiste verschüttete, bevor er trinken konnte.
»Trinken Sie langsam«, sagte Raphael und hielt ihm die Schale. »Wie kommen Sie hierher? Was passiert hier überhaupt? Und warum reißen die Soldaten die Olivenbäume aus dem Boden?«
Katevatis ließ sich an der Karosserie eines Geländewagens zu Boden gleiten und bedeutete Raphael, sich neben ihn zu setzen. Er trank noch einen Schluck und reichte die Tasse dann an Raphael zurück.
»Sie sind in aller Frühe gekommen. Von Tür zu Tür sind sie gegangen und haben alle Männer mitgenommen«, sagte er.
»Bei uns waren sie nicht.«
»Oh doch, sie waren auch im Judenviertel. Siehst du die Männer dort drüben?« Katevatis streckte seinen zitternden Arm aus. »Das sind Samolino Fortes und Avraam Matzas. Und da auf der anderen Seite, der Mann mit der Spitzhacke, das ist der Rabbi selbst. Eine Schande ist das. Neben ihm, in der schwarzen Kutte, das ist Pater Giorgos. Sie haben sie beide mitgenommen und zur Zwangsarbeit eingeteilt.«
»Den Rabbi und den Pater?«, fragte Raphael.
»Angeblich haben sie bis in die frühen Morgenstunden in der Synagoge miteinander diskutiert, und dann kamen die Soldaten.«
Raphael raffte sich auf, nahm den leeren Kanister und trabte los. Die Hitze hatte nun von der Ebene Besitz ergriffen, und der Wind war zur Ruhe gekommen. Der Schweiß sammelte sich in Raphaels Nacken und rann das Rückgrat hinunter, durchnässte sein Hemd und ließ es wie eine dünne Haut an seinem Rücken kleben.
Nun, in der Hitze des Vormittags, stand die Terrassentür der Villa offen. Ein Vorhang verwehrte den Blick ins Innere, aber Raphael konnte hören, wie jemand Tassen auf eine harte Oberfläche stellte, und undeutlich drangen Stimmen ins Freie.
Diesmal hatte Raphael ein Seil dabei. Er untersuchte die Winde, die zentral über der Brunnenöffnung angebracht war, und fand ein Loch, das durch die Winde hindurchging. Hier fädelte er das Seil ein und zurrte es fest.
Das müsste halten, dachte er und knotete das andere Ende des Seiles um einen Eimer, den er im Olivenhain gefunden hatte. Er hoffte, das Behältnis war dicht.
Mittlerweile war eine Frau auf die Terrasse getreten. Sie stellte ein Tablett mit einer Karaffe und Gläsern ab, verschwand dann wieder hinter dem Vorhang und ließ das in der Sonne glitzernde Stillleben auf dem Tisch zurück.
Den Mann, der nun im weißen Sommeranzug ins Freie kam, kannte Raphael. Es war Bürgermeister Loukas Karrer. Hinter ihm wurde eine weitere Gestalt sichtbar. Ein breitschultriger Mann in Hemdsärmeln, der sich mit einem Taschentuch den Schweiß von der Stirn tupfte.
»Mein verehrter Kotzioulas«, hörte Raphael den Bürgermeister sagen. »Das sind ja schlimme Neuigkeiten, die Sie aus Athen zu berichten haben.«
»Am Sonntag, den 27. April haben die Deutschen die Hakenkreuzfahne auf der Akropolis gehisst. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen.«
»Eine Schande«, sagte Karrer und bot seinem Gast Platz an.
»Aber in der Niederlage zeigt das griechische Volk noch, welche Ehre und welch Widerstandsgeist in ihm stecken.«
»Eine Niederlage ist eine Niederlage, und umso schändlicher ist die Kapitulation vor den Italienern, da wir sie ja eigentlich besiegt haben«, wandte Karrer ein.
»Ja, das ist eine Wunde, die noch lange bluten wird«, gab ihm Kotzioulas recht. »Aber Griechenland hat auch gezeigt, dass es zwar geschlagen, aber nicht ohne Hoffnung ist.«
In den Morgenstunden des 27. April fuhren die ersten Motorräder der deutschen Wehrmacht durch die Straßen Athens. Es war eine Einheit der Panzerjäger-Abteilung 47 der 6. Gebirgsdivision. Anders als erwartet, hielten die Fahrer nicht am Syntagma-Platz, sondern fuhren weiter nach Süden und schwenkten auf der Höhe des Olympieion nach Westen ab. Das war der schnellste Weg zur Akropolis. Die Wachen dort erwarteten die deutschen Soldaten schon und leisteten keinen Widerstand. Das wäre in dieser Situation auch völlig aussichtslos gewesen.
Einer der Evzones, der Elitesoldaten, die mit der Bewachung der Akropolis beauftragt waren, hieß Konstantinos Koukidis. Er hatte sein Gewehr geschultert, stand stramm, den Blick geradeaus gerichtet, und wartete, bis die deutschen Soldaten herangekommen waren. Auch als der deutsche Soldat sich über seine Fustanella, den weißen, gefalteten Rock, lustig machte, rührte sich Koukidis nicht von der Stelle. Erst als die Deutschen an ihm vorbeigingen und den Aufstieg auf die Akropolis begannen, machte er eine Kehrtwendung und folgte ihnen.
Seiner Aufgabe, der Bewachung der Akropolis und der griechischen Fahne auf dem Aussichtspunkt am östlichen Ende des Hügels, war er mit der Ankunft der Wehrmacht entbunden. Auch wenn es keinen offiziellen Befehl gab, bestand kein Zweifel, dass das griechische Heer kapituliert hatte. Es ging nur mehr darum, die Wache ordnungsgemäß an die Besatzer zu übergeben.
Mit steinerner Miene beobachtete Koukidis, wie die Deutschen am Parthenon vorbeimarschierten und zielstrebig auf die Plattform mit der Fahne zuhielten. Zwar konnte er es nicht sehen, aber er nahm an, dass sie in der Feldtasche, die der eine über der Schulter trug, die Hakenkreuzfahne des Deutschen Reiches bei sich führten.
Koukidis beschleunigte seinen Schritt, um vor den Deutschen beim Fahnenmast zu sein. Er löste die Schnur und holte die griechische Flagge ein.
Die Deutschen sahen ihm mit verschränkten Armen zu. Der Wind fuhr noch einmal in den Stoff, blähte ihn in der Mitte und ließ dann von der Fahne ab. Koukidis griff nach ihr, holte sie heran und legte sie sich über den Unterarm. Mit beiden Händen hielt er die Fahne fest und sah die deutschen Soldaten an. Dann begann Konstantinos Koukidis, sich im Kreis zu drehen. Sein weißer Faltenrock bauschte sich und die Quasten auf seinen Schuhen hüpften auf und ab. Der Stoff der Fahne legte sich um seinen Körper, und Koukidis drehte sich weiter und weiter. Mit zwei Schritten war er am Rand des Akropolishügels. Von hier ging es hundert Meter und mehr in die Tiefe.
Konstantinos Koukidis wandte sich nicht mehr um. Die Luft trug ihn nicht, und er stürzte wie ein flügellahmer Ikarus in die Felsen.
Noch am selben Tag erfüllten Stiefelpoltern und Motorenlärm die Stadt. Zwei Abteilungen der Leibstandarte SS Adolf Hitler marschierten in exakt abgezirkelter Formation durch die Panepistimiou-Straße auf den Syntagma-Platz zu. Alle Fenster entlang der Route blieben geschlossen, niemand winkte von den Balkonen, und die einzigen Sieg-Heil-Rufe kamen von den eigenen Soldaten.
Mit großer Schnelligkeit übernahmen die deutschen Besatzer die Büros und brachten die Verwaltung unter ihre Kontrolle. Sie schüchterten Beamte ein, verhafteten Leute, die sich ihnen widersetzten, und das Gefängnis begann sich mit jenen zu füllen, die es wagten, ihren Unmut auch nur anzudeuten.
In der Nacht des 30. Mai aber nutzten zwei Männer die Dunkelheit, um sich auf verborgenen Pfaden der Akropolis zu nähern. Manolis Glezos und Apostolos Santas, Studenten der Universität Athen, hatten schon Tage zuvor den Hügel ausgekundschaftet. Sie wussten, wo die Wachen standen, wann sie abgelöst wurden. So eine Wachablöse nutzten Glezos und Santas, um sich an den Deutschen vorbeizuschleichen.
Ein aufmerksamerer Beobachter als die deutschen Soldaten hätte die beiden Gestalten dunkel gegen die Felsen ausmachen können, hätte gesehen, wie sie an den Säulen der Propyläen vorbeihuschten und beim Heiligtum der Artemis Schutz suchten. Auf dem steinigen Untergrund waren ihre Schritte kaum zu hören. Nur wenn sie die Füße nicht sorgfältig auf die Felsen setzten und abrutschten, gab es ein wischendes Geräusch, das aber nicht bis zu den Wachposten drang.
Am Parthenon vorbei, geduckt im Schatten der Säulen, liefen sie auf die Plattform am äußersten Ende des Hügels zu. Dort stand der Flaggenmast, und dort wehte die Hakenkreuzfahne. Direkt an der Plattform hatten die Deutschen keine Wachen aufgestellt. Sie wähnten sich sicher, dass niemand am Posten bei den Propyläen vorbeikam oder den Aufstieg über die Felsen wagte.
Glezos und Santos blickten zur Fahne hinauf. Sie zögerten nicht länger. Das Seil quietschte kurz auf, und sie hielten inne. Sie sahen sich um. Kein deutscher Soldat war zu sehen. Kein Schuss fiel. Es dauerte nur Sekunden, die Fahne vollständig einzuholen und sie vom Seil zu lösen. Manolis Glezos schlang die Fahne um seinen Arm, und schon rannten beide los. Diesmal nahmen sie den steilen Pfad an der Ostseite der Akropolis, verschwanden in der Düsternis der Nacht und erreichten bald den Hain am Fuße des Hügels, wo sie fürs Erste in Sicherheit waren.
Noch in der Nacht bemerkten die Wachen das Fehlen der Hakenkreuzfahne. Sie schlugen Alarm, und mehrere Trupps durchkämmten die Stadt auf der Suche nach den Tätern.
Doch die Fahne blieb verschwunden. Das Gerücht über die Heldentat allerdings verbreitete sich von Mund zu Mund. Die Geschichte tauchte irgendwann auch am Omonia-Platz auf. Die Händler schwatzten miteinander und erzählten es ihren Kunden, und bald wusste ganz Athen Bescheid.
Manolis Glezos und Apostolos Santas, diese Namen kannte binnen Tagesfrist jeder in Athen, und bis nach Thessaloniki drang die Kunde. Dort verstand man die Botschaft, und wenige Tage später flog das erste Munitionslager der deutschen Wehrmacht in die Luft.