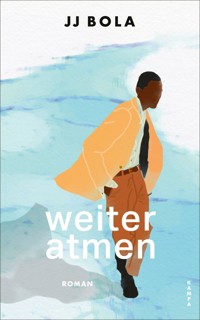Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn man wie Jean aus dem Kongo nach England geflüchtet ist und auf eine neue Schule kommt, ist es nicht leicht, sich einzufügen. Ein Kumpel wie James ist dann das Beste, was einem passieren kann. James mag ein Rowdy sein, der Jean zu lauter Dummheiten anstiftet – Schlägereien, Diebstähle, solche Sachen –, aber seine Freundschaft verschafft Respekt, und den kann Jean mit seinem Akzent und den gefälschten Markenklamotten gut gebrauchen. Zu Hause machen seine Eltern ihm die Hölle heiß: Jean soll sich auf die Schule kon zentrieren wie seine kleine Schwester. Normalerweise ist Marie Jean mehr als lästig, aber als er suspendiert wird, ist sie es, die ihm hilft, den Schulverweis geheim zu halten. Und ihre Eltern haben noch ganz andere Sorgen: die Ungewissheit, ob sie in England bleiben können, zum Beispiel. Die viele Arbeit und dass das Geld trotzdem nie reicht. Und Tonton, ein Schürzenjäger und Tunichtgut, der bei ihnen eingezogen ist. Immerhin nimmt Tonton die Familie mit in seine Kirche, in die Gemeinschaft ihrer Landsleute, unter denen sie sich weniger alleine fühlen. Aber wird es je gelingen, in London ein Zuhause zu finden?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 393
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
JJ Bola
Kein Ort für ein Zuhause
Roman
Kampa
Ata butu soki e yindi, togo eko tana.
Wie dunkel die Nacht auch werden mag, die Sonne wird aufgehen.
Teil I
1
Jeans Lächeln breitete sich aus, wie Arme sich zu einerherzlichen Begrüßung ausbreiten. Warm und einnehmend lockte es, lud zum Verweilen ein wie ein schönes Haus mit offener Tür. Es zeigte sich nicht häufig, dieses Lächeln, aber wenn, dann war es wie Frühling nach einem langen Winter, eine blühende Sonnenblume oder ein strahlendes Licht. Auch Jeans Arme öffneten sich weit, als hätte er sie seine ganze Kindheit über nach Dingen ausgestreckt, die er nicht erreichen konnte. Seine Hände waren überproportional groß. Als seine Eltern ihn das erste Mal im Arm hielten und es bemerkten, sagte Papa: »Vielleicht wird er mal Torhüter. Die haben nämlich große Hände«, woraufhin Mami erwiderte: »Vielleicht hat er auch einfach nur einen festen Griff. Brauchen wird er ihn.«
Jean kam um 8:15 Uhr an seiner neuen Schule an und wartete im Empfangsbereich auf seinen Tutor. Weil er die Orientierungsveranstaltung verpasst hatte, nachdem er sich die ganze Nacht vor Aufregung übergeben hatte, wusste er nicht, wie Mr David aussah, und lächelte daher jeden an, der ihm entgegenkam. Er wartete eine Viertelstunde, und als seine Gesichtsmuskeln langsam erlahmten, tauchte der Tutor schließlich auf.
»Hallo Jean, ich bin Mr David.« Der Mann sah etwas derangiert aus: den obersten Hemdknopf offen, die Krawatte leicht gelockert, zerknitterte Hose, abgenutzte Schuhe und angedeutete Dreadlocks, die aussahen, als gehörten sie eigentlich auf den Kopf eines anderen. Er sah schlecht aus, als hätte er den Arbeitstag bereits hinter und nicht erst vor sich, war aber freundlich; ein Lächeln hatte seine Lippen fest im Griff. Jean ging auf den Mann zu, der ihn um einiges überragte, und blieb verlegen stehen, unsicher, wie er ihn begrüßen sollte. Er war weder sein tonton, der zum Essen nach Hause kam, noch Papas bester Freund, noch der Postbote, der die Geschenke ihrer tantine aus Frankreich überbrachte. Mehr Erwachsene kannte Jean nicht. Mr David klopfte ihm auf den Rücken und führte ihn den Flur entlang und die Treppe hinauf ins Hauptgebäude der Schule.
In den Gängen herrschte auffällige Stille, eine morbide Mattheit, die eher an einen Kliniktrakt für Todkranke als an eine Schule für aufgeweckte kleine Hoffnungsträger erinnerte. Trotzdem betrachtete Jean die Schule mit einem frischen Blick. Sie war neue Nahrung nach wochenlangem Hunger, Wasser, an dem er seinen Durst stillen konnte, ein Farbstreif in seinem Grau.
»Hier ist die Bibliothek. Wenn du Bücher magst, wird es dir hier gefallen«, war die einzige von Mr Davids Erläuterungen, die er richtig hörte. Er wünschte, sie wären hineingegangen und hätten sich umgesehen. Gläubige können nicht an einem Tempel vorbeigehen, ohne zu beten.
»Boni class, eleki bien?«, erkundigte sich Papa, wie es gelaufen war, als Jean von seinem ersten Schultag nach Hause kam. Zu Hause sprachen sie vor allem Lingala und Englisch. »Linglisch«, wie sie es scherzhaft nannten. Manchmal auch Französisch und Lingala, das hieß dann »Frangala«. Ab und zu mischten sie auch alle drei Sprachen zu einem ganz neuen, noch namenlosen Hybrid. Ihre che waren ein großer Mischmasch, ein komplizierter Tanz, ein Hin und Her zu einem Lied, dessen Melodie sich auf einer sich im Kreis drehenden Schallplatte bewegte. Ein wenig waren sie auch wie Kochen. Ein sorgfältig bereitetes Mahl, scharf gewürzt, ein wohlvertrauter Geschmack, für den sich jedoch nicht jeder begeistern konnte.
»Elekaki bien«, erwiderte Jean, ohne weiter auszuholen. Seine Antwort stellte Papa zufrieden. Er lächelte.
»Kongo!«, erinnerte Papa seine Kinder energisch an ihre Herkunft, als drohe ihnen eine Amnesie. Er sagte immer Kongo und nicht Zaire – denn »Zaire ist nicht der Name, den unsere Ahnen dem Land gegeben haben« –, wann immer er sich mit ihnen hinsetzte und große Geschichten von Dorfobersten, den Schlachten tapferer Krieger, uralten Königreichen und Mitgliedern der Herrscherfamilien erzählte. Als Kind hatte Jean die Geschichten unterhaltsam gefunden. Besonders die vom jungen Prinzen Mbikudi, der nach einem verheerenden Überraschungsangriff auf sein Dorf ganz alleine eine Mauer errichtet hatte, um sein Volk zu beschützen und zu verteidigen. Jeden Tag legte er an der Außenseite des Dorfes einen Stein ab. Die Dorfbewohner schauten den kleinen Prinzen an, als hätte er seinen Verstand im Fluss versenkt oder den Schattenwölfen zum Fraß vorgeworfen. Doch der Prinz wurde älter und stärker, und schaffte es schließlich, die Steine weit genug emporzuheben, um eine zweite, dritte, vierte und fünfte Schicht zu errichten, bis der Schutzwall so hoch war wie die Hütten. Tausende und Abertausende Tage und Tausende und Abertausende Steine später folgte Mbikudi dann seinem Vater nach, verteidigte sein Volk vor einem ähnlichen Angriff wie dem, bei dem sein Vater ums Leben gekommen war, und blieb seinem Land als größter und weitsichtigster Herrscher in Erinnerung.
Jean wohnte zusammen mit Papa und Mami, seiner kleinen Schwester Marie und seinem Tonton in einer Dreizimmerwohnung im siebten Stock eines zwölfstöckigen rotbraunen Backsteinbaus in einer Wohnsiedlung in Nord-London, in der Nähe des Hauses an der Brücke, auf dessen Fassade eine große gelbe Schnecke gemalt war, von der keiner wusste, woher sie kam. Er teilte sich ein Zimmer mit Tonton. Er schlief oben im Stockbett, sein Onkel unten. Im Schlaf drang immer irgendetwas von unten zu Jean herauf. Das leise Flüstern eines nächtlichen Gesprächs, die Erschütterung des Bettes und eine vage Ahnung von Alkoholgestank, die sich bestätigte, wenn er beim Aufstehen über eine schlecht versteckte Bierdose stolperte, bevor er sich für die Schule fertig machte, während sein Onkel noch tief und fest schlief. Nach der Schule waren die Dosen immer verschwunden.
Dass seine kleine Schwester Marie ihr eigenes Zimmer hatte, machte Jean immer noch wütend, so sehr er sich inzwischen auch daran gewöhnt haben mochte.
»Das ist nicht fair. Nur, weil sie ein Mädchen ist …«, protestierte er, als wäre ihm eine große Ungerechtigkeit widerfahren.
»Ganz genau«, antwortete Mami dann mit fester Stimme. »Weil sie ein Mädchen ist.«
Verwirrt und auf der Suche nach männlicher Solidarität sah Jean Papa an, dessen Gesicht sichtlich darauf konzentriert war, weder in die eine noch die andere Richtung Loyalität auszustrahlen. Marie streckte ihrem geschlagenen älteren Bruder triumphierend die Zunge heraus.
Alle sagten Marie immer: »Du hast das Gesicht deiner Mutter.« Sie glich ihrer Mutter sowohl äußerlich als auch charakterlich. Ihre pechschwarzen, seidigen, eng gewundenen Locken trug sie straff zu zwei symmetrischen Knoten gebunden, wie sie es auf Mamis alten Kinderfotos gesehen hatte. Sie war laut, aber nicht laut wie ein ungezogenes Kind. Genau wie ihre Mutter hatte sie einfach immer etwas zu sagen.
»Das ist kein Kind«, sagten Gäste, wenn sie ihr zuhörten. Sie beherrschte den Raum, zog alle Aufmerksamkeit auf sich.
»Die Jungen werden sie nicht mögen«, war ein weiterer häufiger Kommentar, besonders vonseiten der verheirateten afrikanischen aunties. »Schon in Ordnung«, erwiderte Mami dann. »Mein Mann hat mich auch nicht geheiratet, weil ich so still bin.« Dabei lächelte sie ein wenig süffisant, besonders in Richtung derjenigen, die noch unverheiratet waren, obwohl sie in der Hoffnung auf einen Ehemann schon so lange still waren.
Wenn die Familie gemeinsam zu Abend aß, so selten das auch vorkam, war allein das – in einem neuen Haus, einem neuen Land, einer neuen Stadt, einem neuen Leben – ein Erinnern und Feiern der gemeinsamen Reise. Einer Reise von Sicherheit in Unwägbarkeit, von Status und Identität zu Fingerabdrücken, Unterschriften und Profilfotos vor kalten Steinmauern, von geläufiger Sprache zum starken Akzent, von der Norm zum anderen, auf der Suche nach Frieden, fort von dem Konflikt tief in ihrem Innern.
Papa arbeitete und arbeitete und arbeitete. Er hielt das für seine Pflicht. Wenn möglich arbeitete er rund um die Uhr, verzichtete auf Schlaf und auf seine Lieblingsbeschäftigung, nämlich die Füße auf dem Sofa hochzulegen und Kassetten mit Live-Aufnahmen der klassischen kongolesischen Rumba zu hören, Franco & OK Jazz oder Zaiko Langa Langa. Für viel mehr interessierte er sich nicht, weder für Alkohol noch für fremde Frauen, wie so viele der anderen Männer. Diese Musik jedoch liebte er von ganzem Herzen. Es lag an all den Erinnerungen, die sie weckte, daran, wie sie ihn in einen bestimmten Moment in der Vergangenheit zurückversetzte, diesen Moment in der Stille einer melodiösen Andacht wiederaufleben ließ. Zeit brauchte Papa nur zum Arbeiten und für seine Familie. Das war nicht immer so gewesen. Papa hatte nur schwer einen Job gefunden, und länger als ihm lieb gewesen war, hatte die Familie vom buku gelebt, den Sozialleistungen, die nie lange genug reichten.
Nachdem er sich durch ein Vorstellungsgespräch nach dem anderen gestottert hatte – das Gewicht sprachlicher Gewandtheit lastete zu schwer auf seiner Zunge, als dass er diese neue Sprache richtig beherrscht hätte –, fand er schließlich eine Stelle. Zuerst arbeitete er als Reinigungskraft. Fünf Tage die Woche verließ er das Haus, bevor die Sonne durch die Wolken brach, putzte die Büros einer Firma und wurde unsichtbar. Die meisten der müden, vor Kälte zitternden Gesichter, denen er an der Bushaltestelle begegnete, erzählten die Geschichte einer Reise, einer Sehnsucht und einer Suche nach Hoffnung auf ein besseres Leben. Dann kam der nächste Job, und während für den Rest des Landes der Tag gerade erst begann, machte er sich auf den Weg durch die Stadt, um als Sicherheitsmann für ein beliebtes Schuhgeschäft in Finsbury Park zu arbeiten, dem vernachlässigten Teil von Nord-London. Ein Geschäft, das die Leute mit leeren Händen betraten und mit vollen Tüten wieder verließen.
Mami hingegen blieb anfangs zu Hause und kümmerte sich um die beiden Kinder – und oft auch um Tonton. Erziehung, Hausarbeit und Kochen sind ein undankbarer Beruf. Schlimmer noch, ein unbezahlter. Mami sagte immer, dass Frauen seit Jahrhunderten umsonst arbeiteten und mehr als die Hälfte vom Kuchen verdient hätten.
Als Jean schließlich den Mut aufbrachte, allein zur Schule zu gehen wie Marie, die diesen Mut mit ihrer kryptischen Kenntnis der Londoner Buslinien noch nährte, fing Mami ihren ersten Job in diesem neuen Land an und bekam ihr Kuchenstück. Sogar Krümel gehen als Mahlzeit durch, wenn man hungrig ist. Sie arbeitete Teilzeit in der Kantine von Maries Grundschule. Zum einen, weil es einfach war, in einer vertrauten Umgebung in der Nähe zu arbeiten, und weil der A4-Ausdruck des Stellenangebots an der Scheibe der Rezeption – Kantinenfrauen dringend gesucht – sie zuversichtlich stimmte, dass man sie nicht ablehnen würde, obwohl sie die Sprache kaum sprach. Zum anderen und in erster Linie arbeitete Mami jedoch dort, weil sie, obwohl Marie ihre Reife durch ihre profunden Kenntnisse des öffentlichen Nahverkehrs bewiesen hatte, noch immer nicht ganz bereit war, sie alleine gehen zu lassen. So konnte sie zumindest ein wachsames Auge auf sie haben, sie hin und wieder selbstständig zur Schule oder nach Hause gehen lassen, meistens jedoch unauffällig und aus der Ferne ihren prüfenden Blick auf sie richten.
Mamis Fürsorge war auf strenge Art herzlich, ihre Hand mal zur Liebkosung, mal zur Ohrfeige ausgestreckt, aber letztlich ging es ihr immer um die Kinder. Ihre Liebe war aufopferungsvoll. Ihren letzten Laib Brot hätte sie nicht halbiert und geteilt, sondern halbiert, um ihnen die eine Hälfte gleich zu essen zu geben, und wenn sie wieder hungrig waren, die zweite.
Sie war eine gläubige Frau. Sie glaubte daran, dass die Liebe, die sie schenkte, nur ein Tropfen im Ozean der Liebe war, mit der sie bedacht wurde.
In den stillsten Momenten ihres Tages fanden Mami und Papa Zeit, einander im Sturm ihrer täglichen Mühen Frieden zu spenden; in Gesprächen über Mieten und Rückstände, Rechnungen, letzte Mahnungen und all die anderen Pflichten. So zeigten sie, dass sie füreinander da waren. Sie trugen die Bürde, nicht nur ihre eigene Familie in London zu versorgen, sondern auch die Familie zu Hause. Am Monatsende reichten ihre mageren Gehälter nie, um für alles aufzukommen. Sie schafften es kaum, genug zusammenzukratzen, um selbst über die Runden zu kommen, von all den anderen, die von ihnen abhängig waren, ganz zu schweigen. Medikamente gegen Bluthochdruck und geschwollene Füße für Koko, die Schulgebühren für Nichten und Neffen, billige Markenklamotten (gefälschte Nike-Shirts und solche von Adidas mit vier Streifen – denn falsche Marken waren immer noch ein besserer Schutz gegen soziale Exklusion als gar keine) und die Unterstützung der älteren Männer, die sich so sehr daran gewöhnt hatten, Geld zu bekommen, dass sie schließlich davon abhängig geworden waren und gar nicht mehr versuchten zu arbeiten. Papa konnte das verstehen. Er gab ihnen trotzdem. In den Augen der Verwandten zu Hause hatten Mami und Papa es trotz ihres täglichen Kampfes geschafft. Ihnen fehlte es an nichts. Europa, poto, war in ihren Augen das Gelobte Land, lola, der Himmel. Die Straßen waren mit Gold gepflastert, in den Flüssen strömten Milch und Honig. Das Leben glich dem feinsten Champagner, sprudelnd und süß. So stellten sie es sich zumindest vor.
Für Mami und Papa verging kein Tag, an dem sie nicht ihr Leben aufrechneten. Papas Vorgesetzter bei der Sicherheitsfirma, ein Mann namens Steve, der sich etwas zu viel auf seinen mittleren Schulabschluss einbildete, nannte Papa »Junge«, was sich weder auf seine Jugend bezog (denn er war älter als Steve), noch auf sein Geschlecht (denn Männer waren sie beide). Es war vielmehr eine Überlegenheitsgeste. Er glaubte über Papa zu stehen, obwohl er ihm nur bis zur Brust reichte und den Kopf in den Nacken legen musste, um ihm in die Augen zu sehen.
Eines Tages telefonierte Papa während der Arbeit in einem ruhigen Moment mit Mami. Die Mittagspause war keine zwei Minuten vorbei, als Steve mit seinem Bierbauch unter dem notgedrungen aus der Hose hängenden Hemd und seinen über den zurückweichenden Haaransatz gekämmten Strähnen in die Küche gestürmt kam, ihm den Hörer aus der Hand riss, auflegte und ihm ins Ohr brüllte: »Junge! Kannst du die Uhrzeit nicht lesen, oder was? Zurück an die Arbeit.« In Papas Herz brach ein Vulkan aus, aber er ließ den Zorn verrauchen, als er an seine Familie dachte, an seine Frau und seine Kinder und seine Lieben zu Hause.
»Manchmal muss man eben sein Leben aufrechnen«, antwortete er Mami, als sie ihn am Abend im Bett fragte, warum er so abrupt aufgelegt hatte. Seine Philosophie: Wenn Gefahr droht, behalte dein ganzes Leben im Hinterkopf und triff die Entscheidung, die nicht nur am besten für dich, sondern auch für alle um dich herum ist. Das war ihre Liebe, ein Opfer. Mami brachte Papa zur Ruhe, er richtete sie auf. Ein in sich selbst zurückfließender, niemals versiegender Strom vollständig erwiderter Liebe.
2
Ein Mädchenname?«
»Nein! Ich heiße Jean!«
»Und warum schreibt man dich dann J-e-a-n?«
»Weil es eben J-e-a-n geschrieben wird.«
»Also schreibt man es wie einen Mädchennamen, und du sprichst deinen eigenen Namen falsch aus? Warum sagst du John und schreibst Jean? Du sagst doch auch nicht, du hast neue Johns an, sondern neue Jeans.«
»Hä?«
»Oder nimm den Michael-Jackson-Song! Der singt auch nicht ›Billy John’s not my lover‹, sondern ›Billy Jean‹. Das weiß doch jeder.«
»Mein Name ist Jean.«
»Dein Name ist Gene, akzeptier es doch einfach.«
»Wie ich gerade auf der Klassenliste sehe … haben wir einen neuen Schüler. Jean, bist du heute da? Hebst du mal bitte die Hand?«, sagte der Lehrer bestimmt.
»Ja, Sir.« Jean meldete sich zögerlich. »Es wird ›John‹ ausgesprochen.«
»Für mich sieht es aus wie Jean!«
James brach in unkontrolliertes Lachen aus, und der Lehrer, der sie über den Brillenrand hinweg musterte, mahnte ihn mit einem vielsagend ausgestreckten Zeigefinger zum Schweigen.
»Tschuldigung, Sir«, antwortete James. »Siehst du, Gene? Was hab ich dir gesagt?«, flüsterte er Jean zu und kicherte leise zu Ende.
Jean und James wurden so dicke Freunde, dass sie sich fühlten wie Brüder mit verschiedenen Eltern. James war ein gescheiter Junge, allerdings unverbesserlich faul. Seine Aufmerksamkeitsspanne war so kurz, dass man ihn sogar daran erinnern musste, in welcher Schulstunde er gerade saß. Er war ein typischer Spross der englischen Arbeiterklasse, mit einem Akzent wie aus Oliver Twist, Sneakers in Größe 42 mit einem seitlich aufgestickten kleinen Union Jack und der passenden Jogginghose mit den drei Streifen. Das einzige Kind seiner Eltern, die ihre Samstage in ihrem persönlichen Äquivalent eines Gotteshauses verbrachten – sie waren stolze Besitzer einer Saisonkarte im Stadion der Tottenham Hotspurs – und ihre Sonntage beim Sunday Roast im Pub. Sein Dad, ein Klempner, der James gefragt hatte: »Na, hast du dir einen kleinen afrikanischen Freund angelacht?«, als der Jean einmal zum Tee mitgebracht hatte, war blass und rundlich wie eine geschälte Kartoffel. James’ Mum war eine zuckersüße, gutmütige Lady, die nach vielen Jahren als Hausfrau und Mutter gerade wieder anfing, in der Kinderbetreuung zu arbeiten. Ein ungleiches Paar, und doch trug James bei allem, was er tat, stets beide mit sich.
Jeans Ohren konnten gar nicht so schnell zuhören, wie James’ Mund sprach. Es fiel ihm nicht leicht, seinen begeisterten Geschichten und Scherzen in den Pausen und beim Mittagessen zu folgen. Oft scharte sich eine Traube Mitschüler um James, und er bot eine Show, als würde er dafür bezahlt.
»Hey Leute, hört mal.« In einer sonnigen Mittagspause im Herbst versammelte sich die Gruppe Jungs ganz am Ende des Pausenhofs, abseits der neugierigen, misstrauischen Blicke der Lehrer und der Schüler, die sich aufführten wie Lehrer. Sie waren eine kuriose Truppe: Ola, der einen beim Reden nicht ansah, sondern immer irgendwo hinter einem in die Ferne blickte – ob er schielte oder sich nur langweilte, war schwer zu sagen; Ahmed, der immer an Naseem dranhing; Naseem, der immer versuchte, Ahmed abzuschütteln; Danny, auch genannt BBC, weil er immer über alle Neuigkeiten Bescheid wusste; Chris, das chinesische Mathegenie, das noch nicht richtig Anschluss gefunden hatte; und Jamil, der immer einen schier unerschöpflichen Vorrat an Schokolade und Süßigkeiten anschleppte, ohne dass jemand wusste, woher eigentlich.
»Da ist dieses neue Chick in der Klasse von Mrs Seresa. Ziemlich süß, die Kleine …« James quasselte weiter, die Worte sprudelten in einem wilden Schwall aus ihm hervor. Jean gab sich alle Mühe, ihm zu folgen, aber als seine Ohren nicht mehr mit der Geschwindigkeit mithalten konnten, gab er sich damit zufrieden, zu schweigen und an denselben Stellen zu lachen wie die anderen. Diese Fähigkeit sollte Jean in den kommenden Jahren perfektionieren: die hohe Kunst, angemessen zu reagieren, ohne das Gegenüber wirklich verstanden zu haben.
»… okay, dann wisst ihr alle, was zu tun ist.« James beendete seine Predigt, und die Gemeinde, der verwirrte Jean eingeschlossen, stimmte ein bestätigendes Jubeln an. »Morgen, Leute. Morgen«, verkündete James, watschelte o-beinig und armschlenkernd los und hatte, auch ohne sich umzudrehen, vollstes Vertrauen darauf, dass seine Entourage ihm folgte.
Am nächsten Tag saß Jean in Mathe neben Chris, von dem er oft abschrieb, als ihm von hinten ein Zettel zugesteckt wurde: Treffen auf dem Junxklo in der Pause. Jean mochte Mathe (die Herausforderung reizte ihn) und war nicht begeistert über die Ablenkung, aber weil er noch weniger Lust darauf hatte, ein sozialer Außenseiter zu sein, und genau wusste, von wem die Botschaft kam – James –, heuchelte er Interesse und bestätigte den Erhalt der Nachricht. Die Gruppe stürzte aus dem Klassenzimmer und rannte am mahnenden »Auf dem Flur wird nicht gerannt!« der allgegenwärtigen Pausenaufsicht (die man nur hörte, aber nicht sah) vorbei, die Jungs verlegten sich auf ein schnelles Gehen, als wollten sie sich für die Olympischen Spiele in Barcelona qualifizieren, und hielten, zu einem Pulk zusammengedrängt, auf die Kantine zu. Auf der anderen Seite standen ein paar Mädchen, darunter auch die Neue, von der James so begeistert berichtet hatte. Sie hieß Jasmine, war himmellang, ihre Haut glänzte in einem Ton zwischen Kupfer und schimmerndem Gold, und ihre pechschwarzen Haare kringelten sich wie die Fibonacci-Folge. Jean starrte sie staunend an. Alle anderen Jungen ebenso.
»Sag ich doch!«, rief James. »Mann, sie ist echt hot.« Die Jungs starrten weiter und stießen einander aufgeregt mit den Ellbogen an, als James die Grenze durchbrach, auf die Mädchen zuging und sie ansprach.
»Na, Ladys? Es ist mir eine Freude, euch zu sehen …«
»Hau ab, James …«, zischte Ayesha (wenn Jasmine Will Smith war, war sie Carlton Banks) misstrauisch.
»Bis auf dich.« James warf ihr einen verächtlichen Blick zu und kam zurück.
»Was war denn?«, fragten die anderen.
»Ach nichts, keine Sorge, nur ein kleines …«, spielte James seine Niederlage herunter. »He, BBC, du denkst an unseren Plan von gestern, oder?«, drängte er. Danny wirkte plötzlich unschlüssig und nervös.
»Jetzt komm schon, Junge!«, verstärkte die Gruppe den Druck. Jean stimmte mit ein, ohne recht zu wissen, was genau er da eigentlich unterstützte. Danny klappte zusammen und weigerte sich.
»Du kannst doch jetzt nicht kneifen! Also, irgendjemand muss es machen.« Noch immer hinter den Mädchen in der langsam vorrückenden Essensschlange packten sie Dannys Hand und wollten ihn zum Handeln zwingen, doch er entwand sich zappelnd ihrem Griff. Jean, dem jetzt dämmerte, was der Plan war, sah seine Chance auf Ruhm, Anerkennung und Akzeptanz gekommen und war bereit, sie zu ergreifen.
Er löste sich aus der Gruppe der Jungen, streckte langsam die Hand aus und fasste der Neuen an den Hintern. Dann lief alles wie in Zeitlupe. Die Berührung dauerte nur einen Sekundenbruchteil, kam ihm aber vor wie eine Ewigkeit; etwa so lang, wie sich Papas Geschichten anfühlten, wenn er lieber draußen Fußball spielen wollte. Jasmine stieß ein hohes Japsen aus und fuhr herum. Er nahm kaum wahr, wie groß sie war, wie weit sie ihn überragte, doch ihre Augen, mit denen sie ihn wutentbrannt anstarrte, waren unendlich und tief wie der Nachthimmel. Er war hingerissen und voller Reue, dieses heilige Wesen mit seinen Händen beschmutzt zu haben. Sichtlich aufgebracht schlug sie ihn mit ihrer Umhängetasche, schrie: »WASSOLLDAS?«, und lief vorbei am mahnenden »Auf dem Flur wird nicht gerannt!« der allgegenwärtigen Pausenaufsicht (die man hörte, aber nicht sah). Jean war hingefallen und lag ausgestreckt auf dem Boden, wurde aber von den anderen Jungen unter Jubelschreien wieder auf die Beine gehievt. »Wie krass! Hammer! Du bist der Shit!«, riefen sie. Ayesha kam mit einem Gesicht wie ein verknittertes Stück Papier auf sie zu, richtete drohend den Finger auf Jean, brüllte: »WARTNURAB!«, und dampfte knurrend ab. Jean blieb verwirrt zurück, in einer Mischung aus freudiger Aufregung und Angst.
Dank seinem vorläufigen Triumph war Jean nun lich in die Ingroup aufgenommen. Weder sein Akzent, der ihn wie ein Dorn in der Zunge in die Rolle des Zuhörers zwang, noch die Tatsache, dass er nicht die neuesten Sportklamotten trug und nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr raus durfte, während die anderen auf der Straße herumhingen, spielte noch eine Rolle. Fürs Erste gehörte er dazu, war einer von ihnen. Die gleichzeitige Angst rührte von dem Wissen, etwas Falsches getan und in der Stimme eines jungen Mädchens einen Akkord der Angst ausgelöst zu haben, der tief in seinem Herzen nachklang. Er dachte darüber nach, um Verzeihung zu bitten, spürte aufrichtiges Bedauern. Aber er wusste nur zu gut, dass eine Entschuldigung die Verbannung aus der Ingroup bedeuten und außerdem von Schwäche zeugen würde, also setzte er trotz des inneren Bebens eine stoische, gleichgültige Miene auf.
Noch war der Schultag nicht zu Ende. Jean saß tagträumend eine Doppelstunde Geographie über Wolken bei Mr Pastorini aus, ohne dessen kratziger, monotoner Stimme richtig zu lauschen, denn wozu sollte es gut sein, sich den Unterschied zwischen Cirrus, Cumulus und all den anderen Wolkenarten zu merken? Regnen tun sie alle gleich.
Schließlich wurden sie entlassen, und Jean verließ das Klassenzimmer mit einem niedergeschlagenen Gefühl, als hinge nach einem spontanen Wetterumschwung eine von Mr Pastorinis dunklen Wolken über ihm statt dem eben noch so klaren Himmel. Er ging allein vor sich hin; sah weder seine Freunde noch (zu seinem Glück) die Mädchen, die inzwischen mit ziemlicher Sicherheit ihre Rache ausgeheckt und dabei Dartpfeile auf ein Poster mit seinem Gesicht geschleudert hatten. Stattdessen ging er ans Ende des Pausenhofs, um in Ruhe sein Sandwich zu essen. Eigentlich war es schon für die Mittagspause vorgesehen wesen, aber da hatte sein Magen nach dem ganzen Drama noch verrücktgespielt. Außerdem wollte er in seinem neuen Buch lesen, Alles zerfällt von Chinua Achebe (nach dem er in der Bibliothek gegriffen hatte, weil das Gesicht auf dem Umschlag aussah wie seins), abseits der neugierigen, misstrauischen Blicke der Lehrer und der Schüler, die sich aufführten wie Lehrer. Beim Umblättern spürte Jean einen plötzlichen Temperaturabfall, die helle Sonne über ihm wurde von einem drohenden Schatten blockiert. Er ließ den Kopf gesenkt und erblickte ein makelloses Paar strahlend weißer Air Force 1 in Größe 46 mit zum Loop geschnürten Schuhbändern. Hinter den Sneakers lag ein so tiefer Wald aus Beinen, dass der Pausenhof dahinter verschwand. Jean wünschte, er hätte sie kommen sehen; wie Ninjas hatten sie sich angeschlichen. Oder er war einfach zu vertieft in sein Buch gewesen. Zwei Hände, groß wie Baseballhandschuhe, packten ihn und hoben ihn mit baumelnden Füßen in die Luft.
»Du bist also der Hosenscheißer, der denkt, er kann meine kleine Schwester begrabschen?«, knurrte eine scharfe, grimmige Stimme. Das war Jerome. Jerome eilte ein Ruf voraus; niemand wusste so recht was für einer, aber alle waren sich einig, dass es kein guter Ruf war. Oft stolzierte er auf dem Schulgelände herum, als gehörte er hierher, wurde aber nie im Unterricht oder auch nur in Schuluniform gesichtet. Keiner wusste, ob er überhaupt zur Schule ging, und wenn, auf welche. Er war nie allein unterwegs, sondern immer umringt von einer ganzen Entourage, wie ein Rockstar oder ein gefeierter Underground-Rapper auf dem Weg zum Dreh seines neusten Musikvideos. Seine Crowd folgte ihm auch jetzt auf dem Fuß und heizte die Stimmung an wie die Zuschauer, die sich bei einem Titelkampf um den Ring scharen.
»Na, was ist?«, knurrte Jerome jetzt und hob Jean noch etwas höher. Jean schüttelte energisch den Kopf, um alles auszudrücken, was sein vor Angst gelähmter Mund nicht herausbrachte. Sein Herz pochte so heftig, dass es ihm aus der Brust sprang und im Hals stecken blieb; er versuchte, es wieder runterzuschlucken. In seiner Hilflosigkeit hörte er plötzlich, laut und deutlich, mit einer fast göttlichen Präsenz, die Stimme seines Vaters in seinem Kopf und erinnerte sich an den Rat, den Papa ihm erteilt hatte, als er das erste Mal in der Schule drangsaliert worden war: »Soki obeti ye te, ngai nako beta yo«, hallte es in ihm wider: »Wenn du ihn nicht schlägst, schlage ich dich.«
Es graute ihm davor, nach Hause zu gehen und Papa zu beichten, dass er verprügelt worden war, und so nahm er allen Mut zusammen, öffnete die Augen und betrachtete den Rächer. Ein flachgesichtiger Brutalo mit ungepflegtem Haar, in grauem Jogginganzug und Wollmütze. Sein Gesicht war noch gemeiner als seine Stimme. Es war das erste Mal, dass er Jerome wirklich ins Gesicht sah. Wenn man keinen Stress mit ihm wollte, vermied man Augenkontakt. Wenn er sich näherte, hielt man den Blick gesenkt oder in den Himmel gerichtet.
Im Bruchteil einer Sekunde schwang sich Jean nach vorne, packte Jerome mit aller Kraft seiner beiden Hände am Hals und trat nach ihm. Augenblicklich ließ Jerome ihn fallen. Die Jungen um sie herum hoben zu einem lauten Gebrüll an – »Fight! Fight, Fight« –, aber Jean hörte nur Papas Stimme in seinem Kopf und das Hämmern seines Herzens. Jerome war außer sich. Er ließ den Rucksack fallen, riss sich den Pullover vom Leib und enthüllte einen von zahllosen Liegestützen gestählten, semimuskulösen Oberkörper in einem weißen Achselshirt. Was als sanfte Warnung geplant gewesen war, drohte sich zu einem terten Kampf auszuwachsen. Jerome war bereit, zum Angriff überzugehen wie ein wildgewordener Stier, aber Jean stählte seine Nerven wie ein Matador und versuchte, das Zittern seiner Knie zu verbergen. Jerome stürzte sich mit bestialischer Geschwindigkeit auf ihn, als wie durch göttliches Eingreifen eine donnernde Faust vom Himmel niederkrachte, Jerome direkt ins Gesicht traf und zu Boden gehen ließ. James. Jean und er sahen sich an und begannen dann, einhellig auf den am Boden liegenden Jerome einzutreten wie beim Fußballtraining, während dieser schützend die Arme um sich legte. Die Menge war erschrocken verstummt. Erst als Jerome sich aufrappelte, stimmten sie ihr »Fight! Fight! Fight!« wieder an. Jean und James sahen sich erneut an.
»RENN!«
»James!«
»Jean! Renn, du Trottel!« Und dann rannten sie. Mit olympiareifer Geschwindigkeit rannten sie über den ganzen Pausenhof und durch das Eingangstor des Schulgeländes. Hinter ihnen ertönte ein gewaltiges Brüllen. Jean sah sich kein einziges Mal um. Sich umzusehen bedeutete langsamer zu werden, und langsamer zu werden bedeutete erwischt zu werden, und erwischt zu werden hätte ein sehr viel schlimmeres Schicksal zur Folge gehabt als jenes, dem er soeben knapp entronnen war. Erwischt zu werden bedeutete den sicheren Tod oder zumindest garantierte Erniedrigung, und für einen Teenager konnte Erniedrigung schlimmer sein als der Tod.
Für einen dürren Jungen, der sich hauptsächlich von Fish and Chips ernährte, war James ziemlich schnell. Immer wieder winkte er Jean hinter sich her, forderte ihn auf, zu ihm aufzuschließen. James rannte mit heraushängender Zunge und irren Augen, ein Reh, das noch im werferlicht auf das Auto zuhielt. Fast schon rechnete Jean damit, James würde jeden Moment stehen bleiben, kehrtmachen und sich der hinter ihnen herjagenden Meute stellen. Aber ich renne weiter; man muss schauen, wo man bleibt.
Sie rannten. Im Slalom schlängelten sie sich zwischen den Passanten in der Einkaufsstraße durch, bogen in eine Abzweigung und erreichten schließlich das Ende der Straße. Es war still. Sie hatten ihre Verfolger abgeschüttelt.
»Bist du bescheuert, James?«, fragte Jean mit zitternder Stimme und war sicher, seine Lunge würde gleich explodieren.
»Schon möglich, ja«, lachte James. Sie lehnten sich nach vorne, stemmten die Hände auf die Knie und rangen um Luft.
»Aber es war ja nicht deine Schuld, sondern meine«, fuhr James fort. »Es war meine dumme Idee, also musste ich dazwischengehen.«
»Das war nicht nötig. Ich hätte das …«
»Hättest was?«
»Jerome, Mann. Das war Jerome!«, keuchte Jean außer Atem und schnappte nach Luft.
»Keine Sorge, Junge. Kannst dich auf mich verlassen.«
3
Panisch kam Jean zu Hause an, klapperte beim Aufsperren nervös mit dem Schlüssel und knallte die Wohnungstür hinter sich zu. Marie entdeckte ihn als Erste. Sie registrierte jede Veränderung sofort und beobachtete misstrauisch vom anderen Ende des Flurs aus, wie er sich luftschnappend gegen die Tür lehnte. Als er sie bemerkte, richtete er sich schnell auf. Marie schwieg, doch ihr Gesicht war voller Fragen. Fragen, die Jean sich zu beantworten genötigt fühlte, bis ihm einfiel, dass sie seine kleine Schwester und er ihr keine Rechenschaft schuldig war.
»Was?«, fragte er, wobei es weniger wie eine Frage als eine Feststellung klang.
»Was denn? Ich sag doch gar nichts«, antwortete sie.
»Was stehst du dann da rum?«
»Aus dem gleichen Grund wie du auch.«
Patt. Frustriert sammelte Jean Rucksack und Jacke auf, die er achtlos auf den Boden gepfeffert hatte, und ging an seiner kleinen Schwester vorbei, während sie ihn weiterhin fixierte wie eine strenge, misstrauische Erziehungsberechtigte. Als er ins Wohnzimmer kam, saß dort zu seiner Überraschung Papa auf dem Sofa und sah fern. Mami war einkaufen, Tonton war unterwegs.
»Hallo, Dad«, grüßte er knapp.
»Ah, du bist zu Hause. Zieh dich um, wir gehen noch mal raus.« Jeans Herz machte einen Hüpfer. Raus? Er wollte nicht wieder da raus. Der einzig sichere Ort für ihn war zu Hause, in seinem Zimmer, unter der Bettdecke. Dort würde ihn niemand finden. Aber ein Nein, das wusste er, war keine Option.
»Mir geht’s nicht so gut, Dad …«
»Eure Mutter ist nicht da, also müsst ihr mit. Du hast zehn Minuten. Mach dich fertig«, antwortete Papa. Jean stieß einen lauten, resignierten Seufzer aus und ging in sein Zimmer, um sich umzuziehen. »Sala noki«, fügte Papa hinzu, als er merkte, dass sein Sohn sich mit der Schwerfälligkeit eines von einer großen Last gebeugten Mannes bewegte.
Sehr kurze zehn Minuten später verließen Marie und ein missmutiger Jean das Haus. Statt seiner Schuluniform trug Jean jetzt ein Sweatshirt mit tief ins Gesicht gezogener Kapuze, die Papa ihm jedoch immer wieder herunterriss. Im Treppenhaus – Papa hatte Angst in geschlossenen Räumen, weswegen er Aufzugfahren als »faul« verteufelte – begegneten sie ihren Nachbarn, einer Mutter mit ihren zwei Söhnen. Sie kamen aus Bosnien und wohnten entweder im Stockwerk über oder unter ihnen, ganz sicher wussten sie das nicht, denn sie trafen sie immer nur auf der Treppe. Papa kannte den Namen der Frau nicht, begrüßte sie aber so freundlich, als würde ihn mehr mit ihr verbinden als die gelegentliche Bitte um etwas Zucker oder ein Winken aus der Ferne. Jean kannte den älteren Sohn vom Sehen. Wo er zur Schule ging, wusste er nicht, doch sie hatten in ihrem gebrochenen Englisch Geschichten ausgetauscht, über Dinge, die sie gesehen hatten, zu groß für ihre Augen und zu schwer für ihre Herzen. Jean fiel auf, dass die Stimme des Jungen viel tiefer klang, gebrochen, wie von zahllosen Schreien strapaziert. Vielleicht, dachte er, klang seine eigene Stimme für andere auch so.
Papa ging schnell, so schnell, dass sie neben ihm hätten herlaufen müssen, hätten sie Schritt halten wollen. rend Marie das (erfolglos) versuchte, gab sich Jean gar nicht erst Mühe und trottete hinterher. An der Bushaltestelle blieben sie stehen. Die Kinder wussten, dass Papa sie nicht gerne allein zu Hause ließ, und so waren sie es inzwischen gewohnt, an alle möglichen unbekannten Orte mitgeschleppt zu werden. Im Bus setzte sich Marie auf einen der vorderen Plätze des Oberdecks neben Papa. Jean nahm weiter hinten Platz, als würde er sie gar nicht kennen. Als sie die geschäftige Einkaufsstraße mit all den Bummlern, Passanten und Schülern in verschiedenen Uniformen kreuzten, packte Jean wieder die Angst. Er drückte sich tief in den Sitz, damit man ihn durchs Fenster nicht sehen konnte. Irgendwann stiegen sie aus und nahmen einen unbekannten Zug. Genauso wenig wie sie alleine zu Hause bleiben durften, ließen Papa und Mami sie alleine weiter wegfahren. Jean und Marie folgten einfach, wohin man sie führte. Jean gab sich betont unauffällig, doch wann immer er eine Gruppe junger Leute sah, deren Gesichter er nicht kannte, wurde er so unruhig, dass sogar Papa es bemerkte und ihn mit ernstem Blick beäugte.
Im Zug saßen sie alle nebeneinander; Vater, Tochter und Sohn. Papa starrte ins Leere, Marie war in ihr Buch vertieft, und Jean, mit Stöpseln im Ohr, hörte auf seinem Walkman eine Kassette seines Lieblingsrappers Tupac Shakur – »›It’s time to fight back‹, that’s what Huey said. Two shots in the dark now Huey’s dead« – und nickte im Rhythmus mit dem Kopf, ohne einen Schimmer, wer dieser Huey eigentlich war.
Sie erreichten die Station, von der keines der Kinder gewusst hatte, dass sie ihr Ziel war, doch als Papa »Tokeyi« sagte und aufstand, folgten sie ihm. Jean las das Schild am Bahnsteig – East Croydon. Er hatte keine Ahnung, in was für einer Gegend sie waren, kannte nicht einmal den teil, aber alleine zurückkommen würde er an diesen abgelegenen Ort sowieso nicht. Sie verließen den Bahnhof und folgten Papa, der im Stechschritt die Straße entlangeilte, vorbei an herumhängenden Leuten, vorbei an einem anderen Grau als dem, aus dem sie selbst kamen, vorbei an Gebäuden, deren Namen Jean nicht kannte. McDonald’s?, dachte Jean völlig verwirrt, als sie den Imbiss betraten.
»Wartet hier.« Papa forderte sie auf, sich hinzusetzen, und kam etwa fünf Minuten später mit Essen zurück. Zwei Big-Mac-Menüs. »Ich habe was zu erledigen. In zehn Minuten bin ich wieder da. Geht nicht weg. Ihr bleibt hier, bis ich zurück bin, okay?« Es folgte eine Pause. Weder Jean noch Marie sagten ein Wort.
»Okay?«, wiederholte Papa eindringlich, woraufhin beide einstimmig »Ja, Dad« antworteten. Papa entfernte sich mit demselben Stechschritt, mit dem er sie hierhergebracht hatte.
»Wo sind wir überhaupt?«, fragte Jean.
»Bei McDonald’s«, erwiderte Marie nüchtern.
»Du weißt schon, was ich meine. Was machen wir hier?«
»Dad muss anscheinend irgendwohin, und wir konnten nicht alleine zu Hause bleiben, also mussten wir mit.«
»Das weiß ich alles«, sagte Jean verächtlich. »Ich will wissen, warum wir hier sind. Wo muss Dad hin?«
»Da fragst du die Falsche. Warten wir einfach.«
»Isst du das nicht?«
»Nein. Ich mag kein McDonald’s. Willst du …?« Noch bevor Marie ihre Frage beenden und von ihrem Buch aufschauen konnte, hatte Jean den Burger bereits verschlungen. »Ja«, antwortete er mit vollen Backen und Mayonnaise in den Mundwinkeln. Ungeduldig warteten sie.
»Tokeyi«, sagte Papa kurz angebunden, als er viel später als versprochen den McDonald’s wieder betrat. Marie las immer noch, Jean hatte den Kopf in den Armen vergraben und hörte Walkman, dessen Batterie zur Neige ging, sodass er lallte wie ein Betrunkener. Papa drehte sich um und ging wieder. Marie zog Jean das Buch über den Kopf, und er schreckte verwirrt hoch, sammelte seine Sachen zusammen und folgte den beiden hinaus. Papa lief im Stechschritt vor ihnen her zurück zum Bahnhof, der jetzt viel näher wirkte als zuvor. Als sie ankamen, dauerte es noch lange, bis der nächste Zug fuhr.
»Aaah, zwanzig Minuten«, stöhnte Jean, was ihm missbilligende Blicke von Papa und Marie einbrachte. Schweigend saßen sie an der kalten, grauen Station an diesem kalten, grauen Ort und warteten.
Nachdem sie dieselben Haltestellen hinter sich gelassen hatten wie zuvor, ertönte vom anderen Ende des Abteils eine Stimme.
»Die Fahrscheine bitte.«
Papas Herz machte einen Satz, als er die Kontrolleure in Begleitung der British Transport Police mit ihren grellen Westen, Funkgeräten und Handschellen am Gürtel entdeckte. So leer, wie der Zug war, kamen sie schnell näher. Papas Atem ging flach. Er schielte auf Jean, der kopfnickend Musik hörte, und die noch immer lesende Marie. Sie befanden sich genau zwischen zwei Stationen. Die Kontrolleure waren zu dicht dran, als dass Papa unauffällig hätte aufstehen und den Zug entlanggehen können, und noch zu weit weg, als dass sie ihn schon nach den Fahrscheinen hätten fragen können. Einer von ihnen sah Papa direkt an und hielt seinen Blick, als könnte er ihm die Angst vom Gesicht ablesen. Papa schaute weg. Der Zug wurde langsamer. Jetzt war nur noch eine Person zwischen ihnen und den Kontrolleuren.
»Ja, also, ich hab keine Karte, aber …«, holte der zauste Typ aus. Der Zug fuhr in die nächste Station und kam quietschend zum Stehen. Die Türen öffneten sich. Papa stand auf und winkte Jean und Marie eilig aus dem Zug.
»Warum steigen wir aus?«, wollte Jean wissen.
»Wir steigen in den Bus um.«
»Aber das dauert doch eeeewig.«
»Sei still«, schnauzte Papa. »Wir nehmen den Bus.«
»Bowumeli«, sagte Mami zu Papa, als sie nach Hause kamen, erschrocken, wie lange sie weggewesen waren. Sie legte den Telefonhörer auf, den sie zwischen Kinn und Schulter gehalten hatte. Es war schon spät. Marie und Jean verschwanden direkt in ihre Zimmer und gingen vor Erschöpfung früh schlafen.
»Wo warst du denn?«, fragte Papa. »Du wolltest auf sie aufpassen.«
»Ich weiß, es tut mir leid. Der Bus war viel zu spät.«
»Ist ja auch egal«, sagte Papa zerstreut.
»Ist alles in Ordnung?«
Papa versank in ein Schweigen, das noch tiefer war als seine Sorgen.
»Was ist denn passiert?« Mami spürte, dass etwas nicht stimmte.
»Nichts. Nur ein Termin bei der Einwanderungsbehörde. Diese Leute haben keine Seele.« Er seufzte tief. »Und auf dem Heimweg waren dann ba gando im Zug, ezalaki ya ko banga.«
»Hab keine Angst«, tröstete Mami ihn. »Wir haben es so weit geschafft. Nehmen wir jeden Tag, wie er kommt.«
Einen ruhigen Moment lang spendeten sie einander Trost, sprangen in Gedanken in die Zukunft, weit weg von ihren gegenwärtigen Problemen. In Zeiten wie diesen zogen sie es häufig vor zu schweigen, denn das bedeutete zumindest keine schlechten Neuigkeiten.
»Es ist ein Brief für dich gekommen.« Mami reichte Papa einen braunen Umschlag.
Papa betrachtete ihn argwöhnisch, voller Angst. Er griff nach einem Messer, als müsste er sich verteidigen, setzte ihn unter der Lasche an und schlitzte den Umschlag sorgfältig auf. Er zog den weißen Bogen Papier hervor, auf dem oben das Hoheitszeichen und der Schriftzug Regierung Ihrer Majestät prangte. Der Briefkopf brachte Papas Herz zum Rasen, bevor er auch nur die erste Zeile gelesen hatte. Alles Offizielle hatte diesen Effekt auf ihn: Briefe, Telefonate, die Polizei. Er befürchtete immer das Schlimmste – dass der endgültige Moment gekommen war und man sie abschieben würde – und ging allem aus dem Weg, was mit den Behörden zu tun hatte. Er versuchte, sich zu beruhigen und las langsam und sehr aufmerksam den Brief, achtete auf jedes Detail.
»Worum geht es?«, fragte Mami.
»Ach, um nichts, es …«, er hielt inne, »es ist nicht wichtig.« Er stammelte irgendetwas, faltete den Brief wieder zusammen und steckte ihn in die Tasche seiner dunkelblauen Cargojeans. Mami sah ihn an, aber Papa gab sich alle Mühe, sie zu beschwichtigen und zum Schweigen zu bringen.
4
In den ersten Monaten des Schuljahrs wurden sich Jeanund James immer ähnlicher. Es war eine Art Mimikry. Jean wurde jetzt viel mehr miteinbezogen, traute sich, die Aufmerksamkeit der anderen Jungen mit witzigen Anekdoten auf sich zu ziehen, während James gelegentlich den Sidekick gab. Sie traten als Tandem auf und tauschten bei Gelegenheit die Rolle. Sie gingen zusammen von der Schule nach Hause und machten häufig einen Umweg über die Einkaufsstraße oder nahmen sogar den Bus in die Innenstadt. Sie gingen ins Einkaufszentrum und spielten Videospiele, in den Supermarkt, wo sie sich oft zu einem Fünffingerdiscount verhalfen, oder in den Sportladen, der die Trainingshosen mit den Streifen und die Sneaker mit dem Haken verkaufte, die genauso viel kosteten wie ein paar Monate Strom. Alles an diesen Orten erinnerte Jean an James – denn er hatte sie ihm gezeigt –, sogar die Schaufensterpuppen. Es war schwer zu sagen, wer hier eigentlich wen imitierte. Am liebsten jedoch verbrachten sie die gemeinsame Zeit vor dem Computer. Sie gingen zu James und spielten stundenlang Street Fighter oder Pro Evolution Soccer, bis Jean beim Blick auf die Uhr einen Riesenschreck bekam und den ganzen Weg nach Hause rannte.
Kam er ungewöhnlich spät dort an, wurde er mit Fragen behelligt, vor allem von Mami, die wissen wollte, wo er sich herumgetrieben hatte.
»Referatsgruppe.« »Schulprojekt.« »Fußballtraining.« Auf seine Antworten reagierte Mami meist mit dienstmäßigem Misstrauen und Papa mit argloser Zurückhaltung. Jean musste kreativer werden, was seine Ausreden nicht glaubwürdiger machte: »In der Einkaufsstraße gab es einen Banküberfall.« »Ein Fuchs hat mich gejagt.« »Mein Freund hat sich verletzt.«
James hingegen wurde kaum registriert, wenn er die Wohnung betrat. Niemand stellte Fragen. Häufig empfingen ihn das laute Dröhnen und der grelle Schein des Fernsehers, der seine Eltern im Zombiemodus gefangen hielt.
Jean und James standen vor einer Tankstelle in der Straße der Schule. Viele Schüler und Schülerinnen kamen hierher, um Süßigkeiten zu kaufen.
»Das ist viel zu offensichtlich.«
»Nein, die merken nichts.«
»Da hängt doch direkt eine Kamera.«
»Ja, aber da sind nicht mal Batterien drin. Die ist nicht echt, nur fake. Um uns Angst zu machen … hast du etwa Angst?«
»Nein!«, erwiderte Jean wenig überzeugend. Sie hatten etwas ausgeheckt. Die Überwachungskamera hielt die meisten Kinder erfolgreich vom Klauen ab, aber ein paar besonders Wagemutige gab es immer. Weder die Aussicht auf eine Festnahme noch die Schimpftirade, die ihn zu Hause erwartete, wenn seine Eltern davon erfuhren, waren abschreckend genug, dass sie Jean in diesem Moment davor bewahrt hätten, dem starken Gruppenzwang zu erliegen.
»Ich habe keine Angst«, wiederholte er, mehr an sich selbst als an James gerichtet.
»Dann beweis es«, antwortete James. Der Handschuh war hingeworfen. »Also, der Plan sieht so aus. Du machst die Seitentasche von deinem Rucksack auf. Wir gehen zusammen zur Kasse. Ich lenke ihn ab und kaufe einen von diesen Dreißig-Pence-Riegeln. Während ich mit ihm rede, lädst du die Tasche voll, und dann teilen wir. Verstanden?«
»Verstanden.«
Sie betraten den Laden und stellten sich an. Zwei weitere Schüler waren noch vor ihnen dran. Jeans Herz schlug heftig gegen die Rippen, das Adrenalin schoss ihm durch die Adern. Er betrachtete James, der ruhig und gefasst wirkte, als hätte er das schon Tausende Male gemacht, wovon Jean auch ausging. Jetzt waren sie dran.
»Tag, Chef«, grüßte James mit unschuldiger Munterkeit. »Einmal den hier, bitte.«
»Hallo. Das macht dann bitte dreißig Pence«, erwiderte der Kassierer mit starkem Akzent. Er trug einen schlichten weißen Turban und hatte einen mit vereinzelten silbernen Strähnen durchsetzten seidigen schwarzen Bart. James kramte in seinen Hosentaschen und merkte, dass Jean wie angewurzelt stehen geblieben war. Er rempelte ihn herausfordernd an. Dann gab er dem Kassierer das Geld, indem er es zunächst auf den Tresen legte. Jean begann, die Seitentasche mit so vielen Schokoriegeln zu füllen, wie er greifen konnte, ließ einen nach dem anderen hineinfallen. Die Tasche schien unendlich, ein gigantischer Abgrund, der sich niemals füllte.
»Chef, was kosten die?«, fragte James, lenkte ab, schindete Zeit.
»Fünfzig Pence«, sagte der Verkäufer mit strenger Miene.
»Ah ja … Und die da?«
»Zwanzig Pence.«
»Und das?«
»Zehn Pence.«
»Ach, echt?«
Der Mann antwortete nicht. Stattdessen beäugte er Jean, dessen lange Finger von hinter dem Tresen nicht zu sehen waren. Jean schien es, als stünde auf seiner Stirn Dieb geschrieben.
»Alles klar, man sieht sich, Chef«, sagte James.
»Danke, und beehrt uns bald wieder.«
Jean schulterte schwungvoll den Rucksack, und die beiden bewegten sich tollpatschig quer durch den Laden auf den Ausgang zu wie zwei Clowns auf Rollschuhen. Der Reißverschluss der Seitentasche ging auf, und alle Schokoriegel verteilten sich auf dem Boden.
»He, du!«, rief der Verkäufer.
Jean erstarrte. »Wer, ich?«, antwortete er, doch da zog James ihn schon hinter sich her.
»Renn«, schrie James. Sie sprinteten aus dem Laden und die Straße hinunter. Sie bogen um die Ecke und verlangsamten ihren Schritt zu einem schnellen Gehen, um keine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. James hatte ein aufgeregtes Grinsen im Gesicht, während Jean sich, überwältigt von Paranoia, wie ein gesuchter Verbrecher auf der Flucht vorkam. Er blickte in den Himmel, entdeckte einen Hubschrauber und stellte sich für einen kurzen Moment vor, wie sich ein Scheinwerferkegel auf sie richtete und eine dröhnende Stimme ertönte: Stopp! Schokolade fallen lassen! Ihr seid verhaftet. Allein der Gedanke erfüllte ihn mit einer solchen Angst, dass seine Knie zu zittern anfingen und fast unter seinem Gewicht nachgaben. Am liebsten hätte er die Hände hochgerissen und sich auf den Boden geworfen.
»Was war das denn, Junge?«, prustete James los, als sie in Sicherheit waren, weit genug vom Tatort entfernt.
»Hast du Schiss gekriegt, oder was?«
»Nein, du hast es verkackt, so sieht’s aus«, antwortete Jean verächtlich.
»Hä?«
»Und was kostet das? Und das? Und das da?«, äffte Jean nach. »Du warst viel zu offensichtlich. War ja klar, dass wir erwischt werden.«
»Ich offensichtlich?«, rief James, noch immer hysterisch vor Lachen. »Wer von uns ist ohne Scheiß stehen geblieben und hat gefragt: ›Wer, ich?‹« Sein schallendes Lachen begann Jean zu nerven, machte ihn sogar wütend. Besonders, weil er wusste, dass James recht hatte. Er hatte Angst gehabt. Aber auch, weil er etwas gegen seinen Willen getan hatte und jetzt auch noch veralbert wurde.
»Haben wir noch Schokoriegel?«
»Nein. Sie sind rausgefallen«, antwortete Jean geknickt.
»Alle?«, fragte James, immer noch lachend. Jean schubste ihn, fest genug, dass seine Wut zum Ausdruck kam, aber nicht so fest, dass er hinfiel. Obwohl er ihn am liebsten in den Boden gestampft hätte.
»Lass mich in Ruhe, Mann. Ich geh nach Hause.«
»Komm schon, Junge. War doch nur Spaß.«
»Schon gut, ich bin einfach müde.«
Mit den bleiernen Schritten eines Verurteilten auf dem Weg ins Verderben machte Jean sich auf den Heimweg. Er war überzeugt, dass Mami und Papa bereits Bescheid wussten. Er hatte keine Ahnung, woher, aber sie wussten es. Vielleicht hatte das mit dem Sprichwort zu tun, das Papa ihm immer wieder einbläute: Matoyi ekoyokaka oyo misu emonaka te. Jean ließ sich den Satz durch den Kopf gehen – »Die Ohren hören, was die Augen nicht sehen« – und murmelte ihn leise vor sich hin. »Was soll das überhaupt bedeuten?«, sagte er laut, während er die Straße entlangging. Schließlich kam er zu Hause an und betrat mit schweren Schritten das Treppenhaus.
»