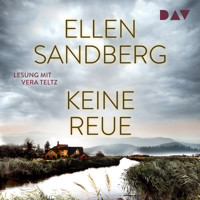17,99 €
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Wenn das Vergangene besser verborgen bleibt, können Erinnerungen gefährlich sein
Eigentlich könnte man Barbara Maienfeld beneiden. Sie lebt in einer schönen Stuttgarter Altbauwohnung, mit dem Mann, den sie seit Studententagen liebt. Niemand ahnt, dass ein Verrat ihrem Glück zugrunde liegt. Doch nun stehen die Maienfelds kurz davor, alles zu verlieren. Und der einzige Weg, der sie retten kann, stößt die Tür zu ihrer Vergangenheit auf – mit der sie längst abgeschlossen hatten. Damals, Ende der 80er Jahre, wohnten die Maienfelds mit ihren Kindern zurückgezogen in der Eifel. Scheinbar genossen sie dort die ländliche Idylle – doch tatsächlich versteckten sie sich vor dem Verfassungsschutz. Bis zu einem verhängnisvollen Tag.
Jetzt, Jahrzehnte später, erkennt Barbara, dass das Vergangene nie wirklich vorbei ist. Und schon bald balancieren die Maienfelds zum zweiten Mal in ihrem Leben am Rande eines Abgrunds …
»Meisterhafte Erzählkunst verbindet sich bei dieser Autorin mit psychologischer Spannung.« Süddeutsche Zeitung
Ellen Sandberg. Jeder Roman ein fesselndes Leseerlebnis.
Lesen Sie auch:
Die Schweigende
Das Geheimnis
Das Unrecht
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 515
Ähnliche
ELLEN SANDBERG arbeitete zunächst in der Werbebranche, ehe sie sich ganz dem Schreiben widmete – mit riesigem Erfolg: Ihre psychologischen Spannungs- und Familienromane, die immer monatelang auf der SPIEGEL-Bestsellerliste stehen und denen immer ein wichtiges Thema unserer deutschen Vergangenheit zugrunde liegt, bewegen und begeistern zahllose Leserinnen und Leser – wie zuletzt »Die Schweigende«, »Das Geheimnis« und »Das Unrecht«. 2022 bekam die Autorin den Verfassungsorden des Freistaats Bayern verliehen. Unter ihrem bürgerlichen Namen Inge Löhnig veröffentlicht sie erfolgreiche Kriminalromane.
Eigentlich könnte man Barbara Maienfeld beneiden. Sie lebt in einer schönen Stuttgarter Altbauwohnung, mit dem Mann, den sie seit Studententagen liebt. Niemand ahnt, dass ein Verrat ihrem Glück zugrunde liegt. Doch nun stehen die Maienfelds kurz davor, alles zu verlieren. Und der einzige Weg, der sie retten kann, stößt die Tür zu ihrer Vergangenheit auf – mit der sie längst abgeschlossen hatten. Damals, Ende der 80er Jahre, wohnten die Maienfelds mit ihren Kindern zurückgezogen in der Eifel. Scheinbar genossen sie dort die ländliche Idylle – doch tatsächlich versteckten sie sich vor dem Verfassungsschutz. Bis zu einem verhängnisvollen Tag.
Jetzt, Jahrzehnte später, erkennt Barbara, dass das Vergangene nie wirklich vorbei ist. Und schon bald balancieren die Maienfelds zum zweiten Mal in ihrem Leben am Rande eines Abgrunds …
»Inge Löhnig gelingt es, durch die Gestaltung ihrer Figuren, deren Umfeld und der sich zum Teil über mehrere Generationen entwickelnden Erzählfäden etwa die problematischen Aspekte der deutschen Geschichte wie Euthanasie einem breiten Publikum anschaulich und anrührend zu vermitteln.«Aus der Würdigung zur Verleihung des Bayerischen Verfassungsordens 2022
»Ellen Sandberg versteht es, in ihren spannenden Familienromanen meisterlich, glaubwürdige und authentische Figuren zu erschaffen. Sie recherchiert genau und legt größten Wert auf Detailtreue.«Merkur.deüber Das Unrecht
»Ein Familienroman voller psychologischer Abgründe um Ereignisse aus der Vergangenheit.«BILD der FRAU über Die Schweigende
ELLEN SANDBERG
KEINE REUE
ROMAN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2023 Penguin Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die
AVA international GmbH Autoren- und Verlagsagentur, München.
www.ava-international.de
Umschlaggestaltung: Favoritbüro
Umschlagabbildung: © Ebru Sidar/Arcangel; © cameilia/shutterstock; © Kevin Eaves/shutterstock; © Helen Hotson/shutterstock; © Daan Photography/shutterstock; © brickrena/shutterstock; © Corri Seizinger/shutterstock
Umsetzung eBook: Greiner &Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-27178-7V002
www.penguin-verlag.de
Dies ist ein Roman. Etwaige Ähnlichkeiten zu Geschehnissen im realen Leben oder zu lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt, jedenfalls aber von der grundgesetzlich geschützten Freiheit der Kunst umfasst.
Dienstag, 19. November 2019
Barbara
Als Barbara Maienfeld an diesem Morgen im November den Tisch in der Essecke deckte, lag das Schreiben der Bank noch immer auf dem Sideboard, und für einen Moment stieg Angst in ihr auf. Sie würden die Wohnung verlieren, wenn Gernot nicht endlich etwas unternahm.
Entschlossen rang sie diese Vorstellung nieder. Das Problem musste sich lösen lassen. Wie jedes andere auch. Die Alternative war undenkbar.
Vor der Glasfront pladderten Regen und Graupel auf die Dachterrasse. Barbara kehrte in die Küche zurück und löffelte frisch gemahlenes Kaffeepulver in die Stabfilterkanne. Sie ließ das Wasser ein wenig abkühlen, bevor sie den Kaffee aufgoss, stellte den Timer auf neunzig Sekunden und warf so lange einen Blick aus dem Fenster. Eine graue Wolkendecke hing über dem Heusteigviertel von Stuttgart. Unten auf der Straße eilten die Menschen vorüber. Gegenüber öffnete die Bank, und Barbara dachte an Brecht. »Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank?« Vielleicht sollten sie einen Banküberfall als Ultima Ratio in Erwägung ziehen. Sie lachte auf.
Im Fenster war ihr Spiegelbild wie ein Schemen zu erkennen. Noch immer war sie eine attraktive Frau und wurde regelmäßig auf etwa fünfzig geschätzt, dabei war sie jenseits der sechzig. Sie war schlank und sportlich. Die guten Gene ihrer Mutter hatten sie lange vor Falten bewahrt. Das schulterlange Haar ließ sie, seit es grau wurde, im ursprünglichen Mahagonibraun färben. Sie achtete auf ihre Figur und ging freitags zum Yoga. Und noch immer trug sie am liebsten Jeans und dazu heute einen cremefarbenen Kaschmirpullover.
Der Timer bimmelte. Barbara rührte den Kaffee um, setzte den Deckel auf und drückte den Satz mit dem integrierten Filter auf den Boden. Mit der Kanne kehrte sie an den Frühstückstisch zurück.
Sie hörte, wie Gernot ins Bad ging, während sie sich Kaffee einschenkte, und zögerte, ob sie erst konkret, die taz oder den SPIEGEL lesen sollte. Sie griff zu konkret. Der Anschlag von Halle und die antisemitische Bedrohung durch extrem Rechte waren Titelthema. Der SPIEGEL machte mit Friedrich Merz auf, der seit Wochen die Kanzlerin attackierte und hoffte, damit auf dem CDU-Parteitag zu punkten. Sollten sich die Schwarzen ruhig gegenseitig metzeln. Es gefiel ihr. Die taz befasste sich mit Neonazis und der AfD. Noch immer gab es einen braunen Bodensatz in diesem Land der Täter, und jährlich wurde er dicker. Barbara warf die Zeitung auf den Tisch, die Sorgen kehrten zurück.
Gestern hatte sie die Kinder angerufen und um finanzielle Hilfe gebeten, obwohl sie wusste, dass das ein nahezu aussichtsloses Unterfangen war. Zuerst Leon, der eine gut bezahlte Position als Ausbilder bei der Luftwaffe hatte. Ausgerechnet zur Bundeswehr war er gegangen. Sie wusste nicht, weshalb er diesen Beruf gewählt hatte. Vielleicht um sie zu ärgern. Auszuschließen war das nicht. Das Gespräch hatte nicht lange gedauert. Er hatte sich das Problem mit der Hypothek ruhig angehört und sie schließlich ihre Bitte um finanzielle Unterstützung vorbringen lassen. Anstatt das von sich aus anzubieten, wie sie insgeheim gehofft hatte. »Tut mir leid, Barbara. Wie du weißt, haben Meike und ich letztes Jahr ein Haus gekauft und uns für die nächsten dreißig Jahre verschuldet. Ich kann euch nicht helfen. Ich frage mich allerdings, wie ihr auf die Idee kommt, dass ich es tun würde, wenn ich könnte.«
Ihr nächster Anruf hatte Luise gegolten. Die hatte gelacht. »Du spinnst. Wieso denkst du, dass ich was auf der hohen Kante habe? Außerdem schulde ich euch nichts. Ciao.« Luise hatte aufgelegt, bevor Barbara etwas erwidern konnte. Lediglich Ben, der Manager bei einem Versicherungskonzern in München war und gut verdiente, wollte es sich überlegen und sich in den nächsten Tagen melden. Er war schon immer der Vernünftigste von den dreien gewesen.
Sie schenkte sich Kaffee nach und fragte sich auf einmal, ob es nicht besser gewesen wäre, sich vor beinahe dreißig Jahren nicht von Gernot breitschlagen zu lassen, das Erbe ihrer Eltern anzunehmen. Dann müsste sie jetzt auf nichts verzichten. Denn sie hätte dieses Leben in Wohlstand nie kennengelernt. Ein Leben, das ihr früher gegen den Strich gegangen war. Anfangs mehr, dann kaum noch und inzwischen gar nicht mehr. Sie hatte sich daran gewöhnt und wollte es nicht aufgeben.
Ohne Gernots Überredungskünste hätten sie die Wohnung nicht gekauft und würden nicht zwischen Designermöbeln leben. Würden ihren Kaffee nicht in Ritualen zubereiten, geschweige denn teuren Wein aus Frankreich und Italien kaufen, Kaschmirpullover tragen und zwei große Autos fahren. Sie waren zu bourgeoisen Salonlinken verkommen, die Wasser predigten und Merlot tranken. Sprich: den Kapitalismus für das Elend der Welt verantwortlich machten, sich aber gemütlich darin eingerichtet hatten. Einmal hatte Gernot sogar an der Börse spekuliert und ihr einen Verlust gestanden. Sie war ausgeflippt. Nicht wegen des verlorenen Geldes, sondern weil er damit ihre Ideale verraten hatte. Ihr Mann, ein Börsenspekulant! Doch Gernot war es auch damals, nachdem einige Tage Eiszeit zwischen ihnen geherrscht hatte, gelungen, ihr das schönzureden.
Dieses besudelte Erbe ihrer Eltern. Sie hätte es nicht annehmen sollen. Natürlich hatte sie viel davon gespendet. Unzählige Projekte in Lateinamerika und Afrika hatte sie unterstützt, ebenso wie Kampagnen gegen Krieg und Folter. Doch unterm Strich betrachtet war das der deutlich kleinere Teil gewesen.
Barbara sah hinaus in den grauen Himmel über Stuttgart. Mit einem Umzug hatte Gernot sie damals herumgekriegt. Weg aus der Eifel, zurück in die Stadt. »Frankfurt. München. Stuttgart. Egal. Such dir aus, wo du leben willst. Ich kann überall arbeiten.« Es war verlockend, das Landidyll hinter sich zu lassen. So hatte sie das alte Haus in Buchsweiler ironisch genannt, in dem sie damals lebten. Nicht weil es so heruntergekommen war – zu jener Zeit hatte ihr Komfort nichts bedeutet –, sondern die Menschen so kleinbürgerlich und spießig. So neugierig und engstirnig. In diesem dörflichen Gefüge hatte jeder seinen Platz, nur sie nicht. Sie, die Anwältin des »linken Gesindels«. Gernot, der Publizist, der seit Jahren gegen die Ungleichheit und die Auswüchse des Kapitalismus anschrieb. Die Bewohner von Buchsweiler wurden mit ihnen, den Intellektuellen aus der Stadt, die sich die marode Mühle hatten andrehen lassen, nicht warm und umgekehrt. Es war das Gegenteil einer Idylle. Sieben endlos lange Jahre Dorfleben lagen hinter ihr, als ihre Eltern 1989 kurz nacheinander starben. Sie war zu keiner der Beisetzungen gefahren. Der Bruch war so endgültig, dass ihre Eltern ihre Enkelkinder nicht kannten. Und dann war eines Tages das Schreiben des Nachlassgerichts gekommen. Ihre Eltern hatten ihr zwar mit Enterbung gedroht, hatten das aber nie in die Wege geleitet. Plötzlich stand ihr ein Teil des Millionenvermögens zu, dessen Grundstock im Dritten Reich gelegt worden war. Die Ausbeutung von Zwangsarbeitern hatte der Textilfabrik ihrer Eltern grandiose Gewinne beschert. Die Verschleppten nähten die Uniformen ihrer Peiniger. Sie hungerten und froren. Sie schufteten sich zu Tode, und ihre Eltern rissen die rechten Arme hoch, brüllten »Sieg Heil!« und scheffelten schamlos das Blutgeld.
Barbara war bereits zwanzig gewesen und studierte in Heidelberg, als sie das herausfand. Sie versuchte ihre Eltern zur Rede zu stellen, was man ihr aber verweigerte. Das alles gehe sie nichts an. Man sei weder ihr noch den »Gammlern und Hippies« Rechenschaft schuldig, die von nichts eine Ahnung hatten, aber Krawall machten. Es seien damals andere Zeiten gewesen. Basta. Und dann das Erbe. Es kam völlig unerwartet. Aus heiterem Himmel.
Für einen Moment sah Barbara sich wieder an dem Küchentisch in Buchsweiler sitzen, an diesem Tag, der alles veränderte.
*
Es war ein sonniger Septembertag 1989. Vor ihr lag die Akte eines ehemaligen Fürsorgezöglings, den man mit einer illegalen Waffe erwischt hatte und der sich nun wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vor Gericht verantworten sollte. Die Staatsanwaltschaft hatte keinerlei Beweise. Sie stützte ihre Anklage auf die Tatsache, dass der Mann Fürsorgezögling gewesen war, und von denen hätten sich ja einige der RAF angeschlossen. Eine unhaltbare These. Diese Argumentation ließ sich mit Leichtigkeit demontieren. Doch verdienen würde sie damit nichts. Denn diesen Mandanten betreute sie ehrenamtlich für das Forum gegen Folter.
Sie saß also mit seiner Akte an diesem warmen Spätsommertag am Küchentisch und war zuversichtlich, einen Freispruch zu erreichen. Gernot schrieb oben im Arbeitszimmer einen Artikel über die deutsch-südafrikanische U-Boot-Affäre. Das Ermittlungsverfahren und der Untersuchungsausschuss des Bundestags schleppten sich nun schon seit drei Jahren dahin, weil die Machthaber in Bonn den ermittelnden Staatsanwalt am ausgestreckten Arm verhungern ließen.
Sie hörte die Tastatur oben in Gernots Arbeitszimmer klappern, als sie den Postboten auf dem Weg zu ihrem Haus bemerkte. Er wich mit seinem gelben Wagen den Kindern aus, die sich ein Floß aus alten Brettern gebaut hatten, das sie nun Richtung Weiher schleppen wollten. Ben übernahm das Kommando. »Wenn ich ›Hau ruck‹ sage, heben wir alle gleichzeitig an.« Er war zehn und der Älteste. Ein stiller Junge. Viel zu ernst, aber auch verantwortungsbewusst. Leon und Luise, ihre zwei Jahre jüngeren Zwillinge, postierten sich auf der einen Seite, Ben auf der anderen. Er gab das Kommando. Sie hoben das Floß an, das nicht groß genug für drei war und nicht sehr stabil aussah, und marschierten los.
Der Postbote sah ihnen nach und kam dann mit einem Einschreiben zu ihr in die Küche. Sie bestätigte den Empfang, und er fragte, ob sie die Kinder etwa allein zum Weiher lasse.
»Sie können schwimmen. Was soll also passieren?«
Der Mann zog die Schultern hoch. »Ich würde meine jedenfalls nicht unbeaufsichtigt lassen.«
Sie hatte nicht die Absicht, dem Mann das Prinzip der antiautoritären Erziehung zu erklären, und auch nicht, dass Kontrolle einer gesunden kindlichen Entwicklung im Weg stand. Anfangs hatte sie das versucht, doch eine der Bäuerinnen hatte gekontert, dass dieser Erziehungsstil schon wieder out sei. Er habe sich nicht bewährt, und das, was sie, Barbara, da mache, habe wenig mit antiautoritärer Erziehung zu tun, sondern mehr mit Gleichgültigkeit.
Barbara dankte noch einmal für die Zustellung des Briefs. Der Mann verabschiedete sich, und sie öffnete das Schreiben. Es kam vom Amtsgericht Essen und enthielt das Testament, das ihre Eltern dort hinterlegt hatten, als Barbara gerade das Abi bestanden hatte und fürs Medizinstudium in Heidelberg zugelassen worden war. Man konnte auch sagen: Als sie noch auf familiärem Kurs gewesen war. Die Firma ging an ihren Bruder, ein gewaltiger Batzen Barvermögen an sie.
Überrascht ließ sie die Seiten auf den Tisch fallen. Was sollte das? Sie wollte nichts von diesem Geld. Das hatten ihre Eltern gewusst.
Dieses Erbe war also ein letzter Angriff auf sie. Auf ihre politische Einstellung. Auf ihre Arbeit als Anwältin für dieses »Geschmeiß, das alle gleichmachen will und uns am nächsten Baum aufknüpfen würde, sollte es je die Macht an sich reißen. Was Gott verhindern möge!« Ihr erster Impuls war, den Wisch zu verbrennen, mit dem ihre Eltern sie posthum verführen wollten, ihre Ideale aufzugeben und auf die Seite des Kapitals zu wechseln. Doch sie zögerte. Vielleicht war das Erbe kein Angriff, sondern eine verspätete Liebeserklärung an die missratene Tochter? Und falls nicht Liebe das Motiv war, dann möglicherweise Anerkennung oder wenigstens Achtung. Während sie noch zögerte, verstummte oben in Gernots Arbeitszimmer das Klappern der PC-Tastatur. Kurz darauf hörte sie seine Schritte auf der Holztreppe. Er kam in die Küche, nahm sich einen Apfel aus der Schale und biss hinein. »Mein Artikel über den U-Boot-Skandal ist fertig. Wie findest du folgenden Absatz?« Gernot schluckte den Apfelbissen hinunter. »Genschers Mitarbeiter verfolgen in dieser Sache nach wie vor nur ein Ziel: Nachforschungen zu sabotieren. Auch auf die neue Anfrage aus Kiel wird man im Auswärtigen Amt Antworten schuldig bleiben, denn die Hinweise verdichten sich, dass auf der Werft in Südafrika mit deutscher Billigung und Unterstützung U-Boote gebaut werden.«
Er ließ das Blatt sinken. »Wie findest du das?«
»Du könntest das ruhig schärfer formulieren. Die Mittäter schützen die Täter. Die deutsche Regierung unterläuft das Waffenembargo der UN und unterstützt heimlich Bothas Apartheid-Regime. Als sie aufzufliegen drohen, boykottieren sie staatsanwaltliche Ermittlungen.«
Gernot nickte. »Du hast recht. Ich sollte das zuspitzen. Was hast du da?« Er hatte das Schreiben bemerkt, nahm es vom Tisch und las. Sie beobachtete, wie ein überraschtes Leuchten auf seinem Gesicht erschien, dabei hatte sie Abscheu erwartet. »Das ist ja … Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.«
»Infam. Das ist das passende Wort«, sagte sie. »Es ist eine Gemeinheit. Sie wollen übers Grab hinaus recht behalten. Sie denken, dass ich einknicke, die Kohle nehme und ein Leben wie sie führe.« Inzwischen hatte sie sich entschieden, den Letzten Willen ihrer Eltern nicht als Zeichen der Versöhnung zu deuten. »Ich werde das Erbe ausschlagen. Und zwar sofort. Kann ich an den PC?« Sie teilten sich den Windows-Rechner, was dazu führte, dass sie oft nachts arbeitete.
Sie nahm den Brief vom Küchentisch und wollte damit nach oben, doch Gernot hielt sie auf. »Überstürz das nicht.«
»Was gibt es da zu überlegen?«
»Eine Menge«, sagte er. Und dann hatte er losgelegt mit seiner Überzeugungsarbeit. Hatte alle nur erdenklichen Argumente ins Feld geführt. Wie viel Gutes sich mit dem Geld bewerkstelligen ließe. Dass sie einen Teil davon für die Erforschung der Rolle der Zwangsarbeiter im Dritten Reich spenden könnte. Ihre Eltern würden im Grab rotieren. Das Forum gegen Folter, in dem sie sich beide engagierten, litt an permanenter Geldnot. Mit einer Spende könnten Computer angeschafft werden. Irgendwann kam er dann auf das ausschlaggebende Argument: Mit dem Erbe könnten sie sich eine kleine Wohnung in Stuttgart leisten. Oder in Frankfurt oder München. Auch Heidelberg, falls sie dorthin zurückwolle. Ein ganzes Wochenende lang redete er auf sie ein, bis sie einwilligte. Die Aussicht, wieder in einer Stadt zu leben, war zu verlockend.
Aus der kleinen Wohnung war dann eine große geworden. Gernot wollte das Arbeitszimmer nicht länger mit ihr teilen, also benötigte sie auch eines für sich. Dazu Wohnzimmer, Schlafzimmer und ein Zimmer für die Kinder. Hundertdreißig Quadratmeter plus Dachterrasse, Küche und Bad in einem alternativen Viertel Stuttgarts. Widerwillig hatte sie zugestimmt, weil Gernot sich in die Wohnung und in die Lage verliebt hatte. Hier könne er seine Gedanken frei entfalten. Eine großzügige Spende an ein Institut, das zum Thema Zwangsarbeit im Dritten Reich forschte, beruhigte ihr Gewissen.
Und so war es weitergegangen. Gernot brauchte einen neuen PC, natürlich den mit dem Apfel-Logo. Möbel mussten angeschafft werden, selbstverständlich die Bauhaus-Design-Klassiker. Auch dafür fand Gernot Argumente, ebenso für den Sportwagen, den er als Publizist benötigte. Da sie ihn liebte, schlug sie ihm die Wünsche nicht ab, kompensierte die Ausgaben aber mit Spenden, bis ihr das zu viel wurde. Sie wollte mit diesem belasteten Vermögen nichts zu tun haben. Sie wollte vergessen, dass es existierte. Sollte Gernot sich doch darum kümmern.
Das war ein Fehler, dachte Barbara nun. Gernot hatte im Laufe der Jahre mehr Geld ausgegeben, als sie mit ihrer Arbeit einnahmen. Irgendwann war das Erbe weg gewesen. Zu der Zeit war sein Ein-Mann-Verlag in den roten Zahlen, er musste ihn schließen, bevor er bankrottging. Schließlich blieben ihnen nur zwei Möglichkeiten: die Wohnung zu verkaufen oder sie mit einer Hypothek zu belasten. Ausgerechnet eine Hypothek! Am Ende hatte das Erbe sie in Kapitalisten verwandelt. Ihre Eltern gingen als Sieger aus dem posthumen Kampf vom Platz, und das ärgerte Barbara beinahe am meisten. Sie hatte ihre Seele verkauft für eine Wohnung und das neueste iPhone.
*
Die Tür ging auf. Gernot kam herein, und wie immer, wenn sie ihn sah, wurde ihr Herz ein wenig weiter, auch nach so vielen Jahren noch.
Ihr erstes Zusammentreffen würde sie nie vergessen. Es war 1974 in Heidelberg gewesen. Sie hatte das Medizinstudium zum Entsetzen ihrer Eltern geschmissen und zu Jura gewechselt. Denn sie wollte daran mitwirken, die Gesellschaft und das politische System zu verändern. Als Anwältin konnte sie mehr erreichen als als Ärztin. Außerdem schämte sie sich für ihre Eltern und musste sich von ihnen unabhängig machen. Sich mit dem Blutgeld der Zwangsarbeiter das Studium finanzieren zu lassen verursachte ihr Ekel. Deshalb suchte sie sich einen Job als Kellnerin in einer Studentenkneipe und schickte den monatlichen Scheck so lange zurück, bis ihre Eltern endlich kapierten, dass sie es ernst meinte. Die kleine Wohnung in der Heidelberger Innenstadt konnte sie sich nicht länger leisten. Sie sah sich nach einem WG-Zimmer um und besichtigte schließlich eines in einem von Studenten besetzten Haus.
Udo, ein Kommilitone, der dort lebte und sie als Mitbewohnerin empfohlen hatte, zeigte ihr das freie Zimmer. Dafür mussten sie durch eine Küche in der zweiten Etage, und dort stand Gernot splitterfasernackt unter der Dusche. Ihre Blicke trafen sich, während er sich abseifte und damit weitermachte, als sei es das Selbstverständlichste der Welt, vor anderen zu duschen. Dieser eine Blick genügte. Es war wie ein gegenseitiges Erkennen. Und das war noch immer so.
Er beugte sich zu ihr und gab ihr einen Kuss. »Guten Morgen, Babs. Gut geschlafen?«
»Nicht wirklich. Die Kinder werden uns bei dem Problem mit der Bank nicht helfen. Auch Ben nicht, obwohl er es sich angeblich überlegen will. Wir brauchen einen Plan B.«
Gernot nahm sich eine Scheibe Toast aus dem Toasthalter, und Barbara sah dieses überflüssige Teil, als sähe sie es zum ersten Mal. Was war nur aus ihnen geworden? Vielleicht war es ein Zeichen des Schicksals, wenn sie nun alles verloren und auf der Straße landeten. In diesem Fall könnten sie wieder ein Haus besetzen. Beinahe hätte sie gelacht. Back to the roots. Doch es war nicht lustig und sie keine fünfundzwanzig mehr. Sie konnte nicht auf der Straße leben. Oder in einem heruntergekommenen, einsturzgefährdeten Haus. Fünfzehn Jahre ihres Lebens hatte sie so verbracht. Erst in Heidelberg, dann im Landidyll. Das war genug.
»Vielleicht löst sich das Problem von selbst«, meinte Gernot.
»Einfach so? Hokuspokus Fidibus?«
Er lächelte. »Ich habe gerade meine Mails gecheckt. Es gibt eine Anfrage vom Weigele-Verlag. Ob wir Interesse haben, eine Biografie über Lukas zu schreiben.«
Ihre erste Reaktion war Ablehnung. »Ausgerechnet über ihn? Warum?«
»Weil wir Brüder sind.«
»Halbbrüder.«
»Wir sind neben Sabine die beiden Menschen, die ihn am besten kennen und beurteilen können, wie er damals drauf war, wie er getickt hat.«
Ihr gefiel die Sache nicht. Es war besser, dieses Thema ruhen zu lassen: die dritte Generation der RAF, von der manche behaupteten, es habe sie nie gegeben. Trotzdem fragte sie, was der Verlag an Honorar bot.
»Nicht so viel, wie wir brauchen. Es sei denn, das Buch würde ein Sensationserfolg. Wir könnten aber auch Walter und Dagmar auffliegen lassen. Ein Enthüllungsbuch.«
»Bist du verrückt! Wir sind keine Denunzianten. Außerdem brauchen wir die beiden vielleicht noch.« So, nun hatte sie den Gedanken ausgesprochen, der seit einigen Tagen durch ihren Hinterkopf geisterte.
Überrascht ließ Gernot das Messer sinken. »Du meinst …?«
Sie nickte. »Wir waren immer für sie da, wenn sie uns brauchten.«
»Das letzte Mal ist aber lange her. Willst du sie etwa erpressen?«
»Nein, natürlich nicht. Ich erwarte einen Gefallen von ihnen. Wie oft haben wir ihnen geholfen? Jetzt könnten sie ihre Kompetenzen mal für uns einsetzen.«
»Etwa einen Geldtransporter überfallen?« Gernot klang amüsiert.
»Damit bestreiten sie ihre Rente. Sie können das. Im Gegensatz zu uns.« Es war sowohl bizarr als auch folgerichtig, dass die beiden sich auf diese Weise den Lebensabend finanzierten. Für gesuchte Terroristen gab es nun mal keine soziale Hängematte. Irgendwie mussten sie über die Runden kommen. Jeder neue Überfall auf einen Geldtransporter oder Supermarkt sorgte für Schlagzeilen, und die Medien schwankten, ob sie die Gefährlichkeit der Ex-Terroristen in den Vordergrund stellen oder sie als lächerliche Rentnergang verkaufen sollten.
»Du meinst das tatsächlich ernst.« Mit einer Hand rieb Gernot sich die Stirn. »Sie könnten das schon als Erpressung auffassen.«
»Es kommt darauf an, wie du ihnen das erklärst. Alles eine Frage der Rhetorik. Wir waren immer solidarisch. Jetzt sind sie dran.«
Mittwoch, 20. November 2019
Ben
Ihm war unfassbar kalt. Er wollte die Decke über sich ziehen und griff ins Leere. Jemand tätschelte seine Wange.
»Hallo. Aufwachen.«
Hatte er verschlafen? Wieso war es so lausig kalt? Und warum wackelte sein Bett, als ob er damit auf einer Eisscholle durchs Weddellmeer trieb? Ein Albtraum. Er tastete nach dem Wecker. Plötzlich hielt er eine Hand in seiner. Warm und weich. Nicht unangenehm. Wo kam die denn her? Der Klang eines Martinshorns und ein hohes gleichmäßiges Fiepen drangen in sein Bewusstsein. Vorsichtig öffnete er die Augen, gleißendes Licht blendete ihn. Er schloss sie gleich wieder.
»Da sind Sie ja. Herzlich willkommen zurück.«
Sein Mund war trocken, die Lippen rissig. Ein dumpfer Schmerz pochte in seinem Innersten. Wo war er? Was war passiert? Er brachte nur ein Krächzen heraus.
»Kein Grund zur Sorge. Sie sind in guten Händen. Ich bin Notärztin. Wir bringen Sie jetzt ins Krankenhaus.« Auch die Stimme war warm und weich, beruhigend. »Alles wird gut. Sie überstehen das.«
Mühsam suchte er die Worte zusammen. »Was … ist … passiert?«
»Wissen Sie das nicht?«
In seinem Kopf herrschte Leere. Langsam drehte er ihn nach links und rechts und bekam endlich die Augen auf. Im Rettungswagen war es hell, es roch nach Klinik. Vor den Fenstern zerhackte blaues Licht die Dunkelheit. Bens Blick verfing sich in warmen braunen Augen, die ihn musterten.
Der Kopf eines Sanitäters drängte sich ins Bild. »Ist Ihnen kalt?«
»Scheiß … kalt«, brachte er mit klappernden Zähnen hervor.
»Das ist der Schock.« Eine warme Decke wurde über ihn gebreitet. Ein dünner Plastikschlauch führte von seinem linken Arm zu einem Infusionsbeutel. Eine Manschette am anderen zog sich brummend zusammen, etwas klebte auf seiner Brust. Elektroden? Ein Verband? Er konnte es nicht sehen, nur spüren »Ein … Unfall?«
»Sie erinnern sich wirklich nicht?« Über den braunen Augen der Ärztin legte sich die Stirn in Falten.
Kaffee war das Letzte, das ihm einfiel. Er war aufgestanden wie jeden Morgen, hatte sich für die Joggingrunde fertig gemacht, in der Küche einen Latte macchiato getrunken und dazu einen Powerbar gegessen, Proteine, Kohlenhydrate. Alles wie immer. Danach musste er die Wohnung verlassen haben und durchs Treppenhaus nach unten gelaufen sein, denn er benutzte nie den Lift. Er musste auf die Straße getreten und losgelaufen sein. Aber er konnte sich nicht daran erinnern. War er auf der Treppe gestürzt? Das Bild des Küchentischs mit dem Frühstück war das letzte auf seiner Festplatte. Wieder schüttelte er den Kopf. »Ich wollte … joggen. Mehr weiß … ich … nicht.« Er versuchte zu lächeln, doch mit dem noch immer schlotternden Unterkiefer gelang ihm das nicht.
»Um fünf Uhr morgens?«
Er nickte. Erklären konnte er das jetzt nicht, außerdem ging sie das nichts an. Diese latente Wut, die in ihm saß, schon immer, seit er denken konnte. Oder präziser gesagt, seit seiner Pubertät. Er bekam sie in den Griff, wenn er sich auspowerte. Am besten morgens vor der Arbeit, danach war er ruhig und gelassen, sozial kompatibel.
»Sie waren sehr mutig. Oder sehr unvorsichtig. Es ist eine Frage der Perspektive«, erklärte die Ärztin. »Ich würde mich jedenfalls nicht in einen Streit einmischen, wenn einer der Kontrahenten mit einem Messer bewaffnet ist.«
Überrascht sah er sie an. »Das … habe ich … getan?«
Sie nickte. »Dabei hat es Sie erwischt. Sie haben drei Stiche abbekommen. In die Schulter, in den Oberarm. Und einen in den Bauchraum. Das sieht nach einer reinen Fleischwunde aus, muss aber schnellstens abgeklärt werden. Außerdem haben Sie sich eine Platzwunde am Hinterkopf zugezogen, als Sie aufs Pflaster gestürzt sind. Deshalb waren Sie bewusstlos.«
Charlie
Boris fuhr wieder einmal, als wäre er des Lebens überdrüssig. Preschte mit Blaulicht und jaulendem Martinshorn durch München, über eine rote Ampel, nahm mit quietschenden Reifen die Kurve von der Ganghofer- auf die Ridlerstraße und gab Vollgas. Der Deckel des Bechers flog davon, heißer Kaffee schwappte über. Direkt auf Charlies Jeans. Na großartig! »Kannst du vielleicht ein wenig zivilisierter fahren?«
»Erst wenn ich in Pension bin.« Boris sah zu ihr hinüber. »Wach?«
»Jetzt schon.« Vor gefühlten drei Minuten hatte ihr Handy sie aus dem Halbschlaf gerissen. Eine halbe Stunde vor dem regulären Aufstehen. Normalerweise genoss sie diese Phase des langsamen Erwachens. Es waren kostbare Minuten, die ihr Kraft für den Tag gaben. Daher schätzte sie es nicht, wenn ihr auch nur eine davon genommen wurde. Was leider berufsbedingt häufig geschah. So wie heute, als Boris anrief, etwas von einer Messerstecherei sagte, und dass er quasi schon vor ihrer Tür stand. Sie hatte sich in Windeseile angezogen, einen Kaffee aus der Maschine gelassen und war vors Haus gelaufen, wo ihr Partner schon wartete.
»Was wissen wir bisher?«
»Mord und Mordversuch im Westend. Eine Anwohnerin in der Gollierstraße wurde durch Schreie geweckt und ist ans Fenster. Unten auf dem Gehweg stach ein Kerl auf eine Frau ein. Ein Jogger ging dazwischen und wurde vom Angreifer attackiert. Die Frau ist noch am Tatort gestorben. Unser Held ist auf dem Weg in die Klinik.«
»Held? Ich weiß ja nicht.«
»Ich bitte dich. Das nenne ich mal Zivilcourage.«
»Wie geht’s ihm?«
»Als der Notarzt kam, war er nicht ansprechbar.«
»Na super.«
Boris bog auf den Gollierplatz ein. Durch die kahlen Bäume und Büsche der Grünanlage war der Tatort auf der anderen Seite gut zu erkennen. Zuckende Blaulichter, flatterndes Absperrband, eine Ansammlung uniformierter Kollegen. Das Team der Kriminaltechnik war schon da. Boris umrundete den Platz und stoppte den Wagen auf dem Gehweg neben einem Streifenwagen.
Charlie schlug die Tür hinter sich zu und den Jackenkragen hoch. Der Wind war eiskalt. Er riss ihr weiße Atemfahnen vom Mund. In den Bäumen saß Raureif, als wären die Äste verzuckert. Noch fünf Wochen bis Weihnachten. Sie hatte keine Idee, wie sie die Feiertage hinter sich bringen sollte. Vielleicht meldete sie sich freiwillig zum Dauerdienst. Das war auf alle Fälle besser, als allein daheim Tatsächlich Liebe zu gucken.
Boris beobachtete sie. »Alles okay?«
»Ne, ich übergebe mich vermutlich gleich beim Anblick einer Leiche. Mache ich ja immer.«
»Gnädigste sind heute wohl mit dem falschen Fuß zuerst aufgestanden.«
»Entschuldige.« Versöhnlich strich sie ihm über den Arm. »Mir liegt Weihnachten im Magen.«
Sie hob das Absperrband für Boris hoch und schlüpfte nach ihm darunter hindurch. Die erleuchtete Auslage einer Buchhandlung erhellte die Szenerie auf dem Gehweg. Im Schaufenster lagen reihenweise Krimis. Charlie sah sich nach einer Überwachungskamera um und entdeckte eine über der Eingangstür des Ladens. Sie deutete darauf, und Boris nickte. »Wird erledigt.«
Einen Augenblick brauchte sie noch, dann wandte sie sich um. Vor ihr auf dem Pflaster lag die Tote ausgestreckt auf dem Rücken, die Arme ausgebreitet, als ob sie einen Schneeengel machen wollte. Nur gab es keinen Schnee. Das Haar verbarg ein schwarzes Bonnet. Der Mund war geöffnet, der Blick der dunklen Augen gebrochen. Nadira starrte ins Leere. Charlie erkannte sie sofort und konnte es doch nicht glauben. Eine Welle Mitleid überrollte sie. Was für ein beschissenes Ende. Tränen stiegen ihr in die Augen, verstohlen wischte sie sie weg. Mit der zweiten Welle kam der Zorn. Das konnte nur Yasin getan haben. Dieser miese Macho, der dachte, Ehefrauen wären Eigentum, mit dem man machen konnte, was man wollte. Überhaupt Frauen. Ihr Magen verkrampfte sich, unwillkürlich ballte sie die Fäuste, bis sich die Nägel ins Fleisch gruben. Dafür würde er bezahlen. Damit würde er nicht durchkommen. Diesmal nicht!
Boris bückte sich nach der Handtasche und suchte nach dem Ausweis. »Nadira Turan, dreiunddreißig Jahre alt, wohnhaft in der Schwanthalerstraße.«
Nadiras Mantel stand offen. Charlie ging in die Hocke.
Ein Riss klaffte auf Herzhöhe in der mintgrünen Tunika, ein dunkelroter, feucht schimmernder Fleck hatte sich gebildet. Nicht sehr groß. Sie musste sofort tot gewesen sein. »Was hast du um diese Zeit hier gemacht?« Charlie sagte es halblaut, mehr zu sich selbst.
»Vielleicht war sie auf dem Weg zu einer morgendlichen Putzstelle.« Boris durchsuchte weiter die Handtasche. »Alles da. Ein Raubmord ist das nicht.«
»Immer schön die Vorurteile pflegen, gell. Türkische Frauen putzen unseren Dreck weg. Was auch sonst?«
»Du bist heute schräg drauf, weißt du das?«
»Ja, vielleicht. Sorry. Nadira war jedenfalls nicht auf dem Weg zur Arbeit. Das hatte sie nicht nötig, und ihr Mann hätte das auch nicht erlaubt.«
»Du kennst sie?«, fragte Boris.
Charlie erhob sich aus der Hocke. »Sie ist die Frau von Yasin Turan.«
»Äh … Ja? Sollte ich den kennen?«
Boris hatte nie in einer anderen Abteilung gearbeitet. Er hatte bei der Mordkommission angefangen und würde dort in Pension gehen, während sie selbst auch nach einem Jahr noch die Neue war. »Seine Familie hat zwei Hauptgeschäftszweige. Drogen- und Fahrzeughandel. Wobei sie die Autos sehr günstig einkaufen. Getarnt wird das Ganze mit Waschsalons, Obst- und Gemüsehandel und einem Laden für Im- und Export von Elektronikartikeln. Ich habe im Rauschgiftdezernat mit Yasin zu tun gehabt und später auch bei Diebstahl und Betrug.«
»Ein Clan?«, fragte Boris.
»Ein Clänchen. Nicht wie in Berlin. Es sind so um die dreißig Personen. Eltern, Tanten, Onkel, Cousins und Cousinen und die dazugehörigen Partner. Ich wette, Yasin besorgt sich jetzt gerade ein Alibi. Gut, dass wir einen Zeugen haben.«
»Du meinst, ihr Mann war das?«
»Natürlich war er das.«
»Wieso bist du dir so sicher?«
»Weil er denkt, seine Frau ist sein Besitz. Vor anderthalb Jahren hat er sie krankenhausreif geschlagen. Damals war sie so kurz davor, ihn zu verlassen und ins Frauenhaus zu gehen.« Charlie zeigte mit zwei Fingern Millimeterabstand. »Vielleicht war sie jetzt ja so weit.«
Boris grinste. »Immer schön die Vorurteile pflegen, gell. Türkische Männer stechen ihre Frauen ab, wenn es um die Ehre geht. Was auch sonst? Dabei haben wir noch keinen blassen Schimmer, worum es hier geht.«
Charlie blickte auf Nadira un dann zu Boris. »Eins zu null für dich. Aber ich weiß trotzdem, dass er das war.«
»Guck mal. Der steckte in der Innentasche.« Boris hielt mit einer Hand einen einzelnen Schlüssel mit einem silbernen Anhänger hoch und mit der anderen Nadiras Schlüsselbund. »Wo der wohl passt? Vielleicht hatte sie eine heimliche Zweitwohnung.«
»Oder einen Lover.« Dann wäre Nadira ganz schön mutig gewesen oder sehr verzweifelt. Denn sie wusste, dass Yasin ihr weder das eine noch das andere durchgehen lassen würde. »Wir werden es herausfinden.«
»Kennst du sie näher?«
»Eigentlich nicht.«
»Weil du beinahe losgeheult hast.«
»Du hast eine lebhafte Fantasie.« Sie durfte nicht zugeben, dass sie Nadira und Yasin seit ihrer Kindheit in Frankfurt kannte. Sie waren in derselben Hood aufgewachsen, hatten dieselbe Schule besucht. Yasin schon damals ein Macho. Einer, der sich nahm, was er wollte. Der bereits mit fünfzehn eine Gang um sich geschart hatte. Er war gefährlich. Sie hatte es am eigenen Leib erfahren. Ein bitterer Geschmack stieg ihr in den Mund.
Ihr Boss würde ihr den Fall wegnehmen, wenn er von ihrer offenen Rechnung mit Yasin erfuhr. Seinetwegen war sie Polizistin geworden. Seinetwegen hatte sie sich nach München versetzen lassen. Ihm nach, als er hier ins Geschäft eines Onkels eingestiegen war. Früher oder später würde sie ihn kriegen. Ganz legal. Mit den Mitteln des Rechtsstaats. Denn Selbstjustiz war keine Option. Dann wäre sie nicht einen Deut besser als er.
Ben
Als Ben aus der Narkose aufwachte, war ihm wohlig warm. Ein Krankenpfleger kontrollierte die Geräte, fragte, wie er sich fühlte, und verschwand wieder. Die Verletzungen an Schulter und Oberarm waren gesäubert und genäht worden. Der Stich in den Bauch war nicht tief. Er hatte keine Organe verletzt, aber das Zwerchfell. Das hatten sie operieren müssen.
Ben dämmerte wieder weg und wurde erst wach, als ein Pfleger die Arretierung des Bettes löste und ihn auf Station brachte. In ein Einzelzimmer mit Blick auf die kahlen Bäume des Innenhofs. Seine Zusatzversicherung zahlte sich aus. Damit hatte er so früh nicht gerechnet.
Wieso hatte er sich in den Streit eingemischt? Vermutlich, weil er die Gefahr nicht erkannt hatte. Er war zwar hilfsbereit, aber nicht lebensmüde.
Eine Schwester kam herein und fragte, ob sie seine Sachen in den Schrank räumen sollte. Sie lagen in einem Plastikbeutel am Fußende des Bettes. Er nickte und bat sie, ihm das Handy zu geben. Es war schon nach zehn. Im Büro würde man sich fragen, wo er blieb.
Vor vier Monaten war er zum »Head of Department« in einem großen Versicherungskonzern berufen worden. Dieser Karriereschritt hatte ihn seltsam kaltgelassen. Und jetzt ergriff ihn für einen Moment sogar Erleichterung. Heute musste er nicht an seinen Schreibtisch, die ganze Woche nicht. Vielleicht auch zwei. Anschließend konnte er auf Reha gehen. Wieso dachte er das? Ihm ging es doch prima. Er hatte alles erreicht. Hatte sich durchgebissen. Das Abitur nachgeholt. Ein Studium absolviert, seine Karriere lief gut. Es gab keinen Grund, unzufrieden zu sein. Er hatte es zu etwas gebracht. Obwohl es seinen Eltern nicht gefiel, dass er fürs Großkapital arbeitete, für die Ausbeuter. Doch selbst wenn er sich in einer NGO für die Rettung der Welt engagieren würde, wäre ihnen das ziemlich sicher egal.
Er wählte Ulrikes Nummer und erklärte seiner Assistentin, dass er vorläufig ausfiel. Vermutlich für zwei Wochen, vielleicht sogar drei, weil er im Krankenhaus lag. Nein, kein Herzinfarkt und auch kein Unfall. Er sagte etwas von einem Zwischenfall, sie bohrte nach und zog ihm die Würmer aus der Nase, bis er die Geschichte erzählte, an die er sich nicht erinnern konnte. Sie war schon in den Medien. Ulrike hatte auf dem Weg zur Arbeit im Autoradio von dem Mord im Westend gehört und war nun ganz aus dem Häuschen, dass er so mutig eingeschritten war und sein Leben für eine Fremde riskiert hatte. Wenn auch vergeblich. Er sei ein Held. Vielleicht war er das. Er wusste es nicht. Ihm fiel nichts dazu ein. Die Frau war tot. Er hatte ihr nicht helfen können. Doch es traf ihn nicht mehr als jede andere Nachricht über einen Mord in den Medien. Es lag daran, dass er sich nicht an die Situation erinnern konnte.
Eine Stunde später brachte ein Kurier eine Flasche Champagner für »unseren Helden«, Blumen und Genesungswünsche seines Vorgesetzten und der ganzen Abteilung. Er solle sich gut erholen. Man sei stolz auf ihn. Er sei ein leuchtendes Beispiel fürs Unternehmen, das sich Solidarität auf die Fahnen geschrieben hatte. Das Einstehen der Starken für die Schwachen. In diesem Geist habe er gehandelt, und das sei »einfach nur großartig«. Einen Moment fühlte er sich tatsächlich wie ein Held und im nächsten kraftlos. Mit der Solidarität war es im Konzern nicht weit her. Das Hauptaugenmerk der Schadensabteilung, die er seit Kurzem leitete, lag darauf, durchaus berechtigte Anträge auf Versicherungsleistungen abzuwehren.
Einige Nachrichten waren auf seinem Handy eingegangen, er las sie endlich. Eine besorgte von Luise war darunter.
Mensch, Ben! Was machst du für Sachen? Melde dich, wenn du wieder wach bist. Brauchst du was? Soll ich kommen?
Die nächste war von Leon.
He, Superman. Wahnsinn! Ruf mich an, sobald du kannst.
Wieso wussten seine Geschwister Bescheid? Es dauerte einen Moment, bis er daraufkam. Bei der Aufnahme hatte man ihn um die Kontaktdaten eines Angehörigen gebeten, und er hatte die seiner Schwester genannt. Offenbar hatte man sie informiert, und Luise hatte natürlich sofort Leon Bescheid gesagt. Als Kinder hatte kein Blatt Papier zwischen sie gepasst, und ihre Beziehung war auch heute noch sehr eng. Das »rote Gesindel« hielt noch immer zusammen. Wie damals, als sie die Außenseiter in Buchsweiler gewesen waren und sich selbst genug. Drei, die keine Freunde fanden und auch keine brauchten, denn sie hatten sich. Drei, die jede abfällige Bemerkung, jeder Spott und jeder misstrauische Blick noch ein wenig mehr zusammenschweißten.
*
Ein Geräusch holte Ben aus dem Halbschlaf. Der Arzt kam herein, der ihn operiert und dessen Namen er sich nicht gemerkt hatte. »Na, wieder munter?«
»Geht so.«
Der Mann begutachtete den Verband, sah nach der Infusion und schien zufrieden. Er war jung und hatte etwas von einem Streber an sich. Glatt rasiert. Makellose Haut. Seitenscheitel. »Irgendwelche Beschwerden?«
Ben verneinte. »Nur ein wenig Kopfschmerzen.«
»Die kommen von der Gehirnerschütterung. Der Eingriff ist problemlos verlaufen. Sie sind stabil. Sieht alles gut aus.«
Vor sechs Stunden hatte er topfit seine Wohnung verlassen, nun lag er im Krankenhaus. Niedergestochen, dem Tod grad noch entwischt. Und alles sah gut aus?
»Was mir Sorgen macht, ist Ihr Gedächtnisverlust. Sie wissen nicht, was passiert ist?«
»Ja, leider.« In dem Moment, als er das sagte, blitzte eine Erinnerung auf. Fahles Licht fiel durch ein Fenster. Ein Klickern wie von Glasmurmeln. Du hast nichts gesehen. Vergiss das gleich wieder.
»Passiert es häufiger, dass Ihr Gedächtnis Sie im Stich lässt? Dann sollte man das neurologisch abklären.«
»Manchmal«, räumte Ben ein. »Aber das hat keine neurologischen Ursachen.«
Abwartend sah der Arzt ihn an. »Sondern?«
»Eher psychische Gründe.«
»Wurde das schon mal fachärztlich untersucht?«
Das Gespräch begann Ben unangenehm zu werden. Seine Gedächtnislücken gingen niemanden etwas an. »Ist nicht nötig. Ich bin einfach nur sehr gut darin, Belastendes zu vergessen. Das ist menschlich.«
Der Arzt fuhr sich mit dem Zeigefinger über den Nasenrücken. »Sie meinen verdrängen. Später erinnern Sie sich?«
»Ja, natürlich«, sagte Ben, obwohl das nicht stimmte. Er verdrängte nicht. Er vergaß manches tatsächlich, als wäre es nie geschehen. So wie damals, als sie zu dritt mit ihren frisierten Mofas in der Kiesgrube Motocross gefahren waren. Er, Leon und sein Kumpel Paul. Seit sie ihre Maschinen aufgebohrt hatten, brachten sie über fünfzig Sachen auf den Asphalt. Es war so geil. Sie waren die Kings, auch wenn sie nur in der verlassenen Kiesgrube richtig aufdrehen konnten. Und das taten sie einen Sommer lang bei jeder Gelegenheit. Bis dann die Sache mit Leon passierte. Er wäre beinahe draufgegangen. Was geschehen war, wusste Ben nur aus Pauls und Leons Erzählungen. Obwohl er dabei gewesen war.
An jenem Tag hatten sie mit ihren Maschinen schon etliche Male eine Kuppe übersprungen. Wer sprang höher, wer weiter? Manchmal stürzten sie und rappelten sich lachend oder fluchend auf. Bis eine Kieslawine Leon unter sich begrub und Ben zur Salzsäule erstarrte, während Paul zur Telefonzelle vorne an der Straße rannte, den Notruf wählte und dann Leon auszubuddeln begann, bis Feuerwehr, Polizei und Notarzt eintrafen. Bens Erinnerungen an diesen Tag wiesen ein mehrstündiges Loch auf. Der ganze Nachmittag fehlte.
Und dann war da noch die Sache mit dem Freibad, zwei Jahre später. Er war schon einmal zum Helden geworden, doch auch daran erinnerte er sich nicht. Immerhin war er angesichts der Gefahr nicht wieder zu Stein geworden. Er hatte einen Jungen aus dem Wasser gezogen, der im großen Becken sang- und klanglos untergegangen war. Niemand hatte es bemerkt, außer ihm. Doch auch daran hatte er bis heute keine Erinnerung. Ihm fehlten die entscheidenden Minuten von der Beobachtung, dass da etwas nicht stimmte, bis zu dem Moment, als ein fremder Mann vor ihm auf die Knie ging und unverständliches Zeug stammelte. Eine wirre Dankesrede. Was will der Irre? Das hatte er gedacht.
Und dann noch Evis Schwangerschaft. Auch die hatte er vergessen. Die Aussicht, Vater zu werden, hatte ihn überfordert. Zu der Zeit musste er sich mit drei Jobs das Studium finanzieren. Dennoch reichte die Kohle oft vorne und hinten nicht. Dann ging er containern, holte Lebensmittel, die noch essbar waren, aus den Abfallbehältern der Supermärkte, verzichtete auf die Öffis und lief zur Uni und zur Arbeit. Damals war das Joggen extrem geworden und war es bis heute geblieben. Jedenfalls musste Evi ihm eines Tages den positiven Schwangerschaftstest unter die Nase gehalten haben, und er hatte mit einer Panikattacke darauf reagiert und sich am nächsten Tag an nichts mehr erinnert. Er hatte das einfach gelöscht und sie ratlos angesehen, als sie wissen wollte, wie er nun dazu stand. Evi konnte nicht fassen, dass er ihre Schwangerschaft ausgeblendet hatte. Ein heftiger Streit war die Folge.
Das Kind hatte Evi wenige Wochen später verloren, ein Abgang. Noch heute schämte er sich, weil er so erleichtert gewesen war.
Der Arzt nickte. »Ihre Amnesie ist verständlich. Das war ein traumatisches Erlebnis. Ich nehme an, dass Ihre Erinnerungen zurückkehren werden.« Ben nahm an, dass das nicht passieren würde, und plötzlich fragte er sich, ob es mehr als diese drei – seit heute vier – Ereignisse gab, von denen er nur deshalb wusste, weil andere es ihm erzählt hatten.
*
Am Nachmittag kam Evi. Er hatte sie angerufen und gebeten, ein paar Sachen aus seiner Wohnung zu holen.
Im Jahr nach der Fehlgeburt hatten sie sich getrennt. Sie waren kein Paar mehr, aber noch Freunde. Obendrein wohnte Evi im selben Haus. Nach der Trennung war sie in eine frei gewordene Wohnung zwei Etagen höher gezogen und hütete seinen Ersatzschlüssel, so wie er ihren.
»Mannomann, du bist so ein Idiot! Du könntest tot sein.« Sie warf beide Arme um ihn und drückte ihn an sich.
»Wie schön, dass du das H-Wort nicht in den Mund genommen hast. Ich kann es nicht mehr hören.«
»Du meinst hirnloser Gutmensch?« Evi lächelte. »Schön, dass du schon wieder Scherze machen kannst.« Sie räumte seine Waschsachen ins Bad, legte Kleidung und Unterwäsche in den Schrank und hängte den Bademantel auf den Bügel. Dann ließ sie sich die ganze Geschichte erzählen, zog schließlich eine Tafel Schokolade aus der Handtasche, seine Lieblingssorte mit ganzen Mandeln, die im Mund so schön knackten, und verabschiedete sich. Sie musste zurück an ihren Schreibtisch. Ein eiliger Auftrag. Evi war freiberufliche Übersetzerin und hatte ihr Büro in der Fensternische ihrer kleinen Wohnung untergebracht. Nach Küsschen rechts und links auf seine Wangen verschwand sie aus dem Krankenzimmer.
Die Müdigkeit kroch wieder in ihm hoch, er dämmerte weg, bis er spürte, dass jemand neben dem Bett stand, obwohl er die Tür nicht gehört hatte. Wer hatte sich da angeschlichen?
Es war eine Frau, etwa in seinem Alter. Sie trug Jeans und eine zu große abgewetzte Lederjacke, die aussah, als wäre sie zwanzig Jahre älter als ihre Trägerin. Hellgraue Augen, kurzes weißblond gefärbtes Haar. Drahtige Figur. Eine, die sich beim Sport auspowerte. »Lassen Sie mich raten«, sagte er. »Sie sind von der Kripo.«
»War auch nicht schwer.« Sie zog den Stuhl heran und setzte sich. »Wie geht es Ihnen?«
»Wie sagt man so schön? Den Umständen entsprechend.«
»Das hätte auch anders ausgehen können. Dann lägen Sie jetzt in einem Kühlfach der Rechtsmedizin. Charlotte Bodmer.« Sie reichte ihm die Hand. »Ich bearbeite den Fall.«
»Ben Maienfeld. Die Frau ist wirklich tot?«
»Yep.«
»Wer tut so etwas?«
In den Augen der Kommissarin blitzte ein Funke auf. »Warum sind Sie dazwischengegangen?«
»Ich weiß nicht. Vermutlich habe ich das Messer nicht gesehen.«
Ihre Augen weiteten sich. »Sie wissen das nicht?«
Ben hob entschuldigend die Hände. »Ich erinnere mich nicht.«
»An das Messer?«
»An alles. Da ist nichts auf der Festplatte.«
Ungläubig sah sie ihn an. »Sie verschaukeln mich.«
»Warum sollte ich?«
Er sah, wie sie die Kiefer aufeinanderpresste und dann durchatmete. »Wissen Sie was: Ich hole mir jetzt mal einen Kaffee, und Sie durchforsten in der Zwischenzeit Ihr Gedächtnis. Ich brauche Sie. Sie sind mein einziger Zeuge.«
»Tut mir leid, aber ich erinnere mich wirklich nicht.«
»Sie haben es ja noch nicht mal versucht. Strengen Sie sich an. Bis gleich.«
Die Kommissarin verließ das Krankenzimmer, und er rechnete beinahe damit, dass sie die Tür hinter sich zuschlagen würde. Sie tat es nicht, und ihr zuliebe schloss er die Augen und versuchte die frühen Morgenstunden heraufzubeschwören. Er kam wieder nur bis zum Powerbar.
Ein paar Minuten später kehrte Charlotte Bodmer mit einem Plastikbecher Kaffee zurück. »Sorry. Ich habe gar nicht gefragt, ob Sie auch einen wollen.«
»Macht nichts. Ich glaube nicht, dass ich den jetzt vertragen würde.«
Ein Lächeln erschien auf ihrem Gesicht. »Glaub ich sofort. Sie sehen aus wie einmal ausgespuckt. War nicht Ihr Tag heute.« Sie nahm Platz und sah ihn erwartungsvoll an. »Na, wie sieht es aus? Irgendwas haben Sie doch für mich.«
»Leider nicht. Das Letzte, an das ich mich erinnere, ist mein Frühstück.«
Für einen Moment hatte er den Eindruck, dass sie gleich die Augen verdrehen würde. »Also gut, fangen wir mit Aufstehen und Zähneputzen an und arbeiten uns voran. Einverstanden?«
Er zuckte die Schultern. Es war ihre Zeit, die sie verschwendete.
»Was gab es denn?«
»Milchkaffee und einen Powerbar.«
»Komische Kombi.«
»Ich wollte joggen. Und ich weiß, dass Sie jetzt gleich fragen: Was? Um fünf Uhr morgens? Das ist nun mal meine Zeit. Bevor ich ins Büro gehe, laufe ich. Nicht jeden Tag, aber drei bis vier Mal pro Woche.«
»Immer dieselbe Runde über den Gollierplatz und zur Grünanlage?«
»Ja.«
»Also auch heute.«
»Ich nehme es an. Aber ich kann mich nicht daran erinnern.«
Die Kommissarin schlug ein Bein übers andere. »Sie waren da. Eine Überwachungskamera hat Ihre Heldentat aufgezeichnet, und außerdem hat der Notarzt Sie dort vom Pflaster geklaubt.«
»Das ist mir klar. Aber ich weiß nicht, wie ich dorthin gekommen bin und warum ich mich eingemischt habe.«
»Ich nehme an, weil Sie helfen wollten. Hat die Frau um Hilfe gerufen? Hat Yasin irgendwas gesagt?«
»Wer ist Yasin?«
»Der mutmaßliche Täter«, sagte sie.
Er schloss die Augen und versuchte erneut, sich zu erinnern. Doch es gelang nicht. »Ich weiß es nicht.«
Sie seufzte und zog ihr Handy hervor. »Ich zeige Ihnen jetzt ein Überwachungsvideo. Vielleicht macht es dann ja klick.« Sie startete die Aufnahme und reichte ihm das Handy. Krisselige Schwarz-Weiß-Bilder zeigten einen Mann und eine Frau vor der Buchhandlung im Gespräch. Die Körpersprache war aggressiv und suggerierte Streit. Mit einem Mal griff der Mann in die Tasche, zog etwas heraus und stieß es der Frau in die Brust. Das Messer sah Ben nicht. Aber sich selbst im selben Moment ins Bild springen. Ohne Sinn und Verstand warf er sich zwischen die beiden. Jetzt sah er das Messer. Kurz blitzte es auf, einmal und noch einmal. Es bohrte sich in seinen Körper, während die Frau zu Boden ging. Der Täter hielt inne, sah nach oben und rannte weg. In der Zwischenzeit war auch Ben zu Boden gegangen. Das Video war zu Ende. Er gab das Handy zurück.
»Und?«
»Schrecklich.« Die Frau war tot. Innerhalb von Sekunden war alles vorbei. Und er selbst hatte verdammtes Glück gehabt. Ben wollte wissen, welchem Umstand er sein Leben verdankte. »Der Mann hat nach oben gesehen und ist dann weggelaufen. Was war da los?«
»Eine Anwohnerin hat die Tat beobachtet und gerufen, dass er aufhören soll, die Polizei wäre schon unterwegs.«
»Dann haben Sie ja doch mehr als einen Zeugen.«
»Leider nicht. Sie war zu weit weg, um den Täter identifizieren zu können. Bisher hat sich auch kein weiterer Zeuge gemeldet. Die Befragung der Nachbarschaft ist ergebnislos verlaufen. Ich brauche Sie, Herr Maienfeld.«
»Auf dem Video ist er nur von hinten zu sehen.«
»Ja. Ist mir auch schon aufgefallen.« Sie schob das Handy in die Hosentasche und zog es gleich wieder heraus. »Ich zeige Ihnen jetzt ein Foto des Verdächtigen. Vielleicht erinnern Sie sich ja, wenn Sie ihn sehen.« Ihre Finger huschten übers Display, dann hielt sie ihm das Handy unter die Nase. Pflichtschuldig sah er sich das Bild länger als nötig an. »Tut mir leid. Den Mann habe ich nie gesehen. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste.«
»Haben Sie etwa Angst vor ihm? Bedroht er Sie?«
»Wieso sollte er?«
Sie stand auf und schob die Hände in die Gesäßtaschen ihrer Jeans. »Echt jetzt?« Ungläubig sah sie ihn an. »Vielleicht, weil Sie der einzige Zeuge des Mordes an seiner Frau sind. Außerdem ist er Mitglied eines kriminellen Clans, falls ich das noch nicht erwähnt haben sollte. Es wäre besser, wenn Sie Ihr Gedächtnis in Gang bringen.«
»Ich kann doch nicht behaupten, dass er es war, wenn ich es nicht weiß.« Im selben Moment ging die Tür auf. Ein Mann kam herein. Schwarze Lederjacke, schwarze Jeans. Doc Martens. Dreitagebart. Ben hoffte, dass das ihr Kollege war, der ihn von ihr erlösen würde. Er gab ihr das Handy zurück. »Tag, Herr Maienfeld.« Der Mann nickte ihm zu.
»Mein Kollege Boris Knepper«, sagte die Kommissarin. »Was gibt’s denn?«
»Ich habe den Durchsuchungsbeschluss und dachte, da wärst du gerne dabei.«
»Yep.« Charlotte Bodmer verabschiedete sich endlich. Im Rausgehen wandte sie sich noch einmal nach Ben um. »Ich werde Personenschutz für Sie beantragen. Nicht, dass mein einziger Zeuge gekillt wird.« Mit diesen Worten verschwand sie aus seinem Blickfeld und er schob den Anflug von aufsteigender Angst erst einmal beiseite.
Das Gespräch hatte ihn erschöpft. Ben versuchte zu schlafen, doch plötzlich fiel ihm Barbaras Anruf ein. Er musste sich bei ihr melden. Später. Seine Mutter wartete auf Antwort. Er war so müde, dass er einnickte und vom Landidyll träumte. Es war Herbst und er ein kleiner Junge. Er saß hoch oben im Apfelbaum und blickte auf die Welt unter sich. Alles sah so klein aus. Wie Spielzeug. Das Fachwerkhaus mit dem weißen Putz und den schwarzen Balken. Mit den winzigen Fenstern und von Moos und Flechten überzogenen Dachschindeln. Das alte Mühlengebäude, in dem der Kollergang seit Jahrzehnten stillstand. Der wacklige Steg über den Bach. Das moosige Mühlrad, das Jahr für Jahr morscher wurde. Die Schleuse, die sich nicht schließen ließ, weil das Wasserrad festgerostet war. Der Bach, der zum Weiher führte. Der Weg hinauf zu den Trollen im Wald und weiter zu seiner geheimen Hütte. Im Hof Barbaras oranger Corsa, klein wie ein Matchbox-Auto. Der ehemalige Hühnerstall mit Leons und Luises Geheimversteck. Der alte Holzschuppen. Die Streuobstwiese hinter dem Haus, in der Brennnesseln und Löwenzahn blühten. Die hohe Hecke, die all das von drei Seiten umgab, und vorne der Zaun und das Tor, das immer offen war. Der Himmel über ihm war weit, er spannte sich endlos übers Firmament. Weiße Wolken segelten dahin. Auf einmal wuchsen ihm Flügel. Versuchsweise spreizte er das ungewohnte Gefieder. Eine Windbö packte ihn, und er ließ sich von ihr forttragen, glitt auf ihr dahin. Er konnte fliegen! Es war herrlich. Bis der Wind erstarb und er wie ein Stein der Erde entgegensauste. Mit aller Macht stemmte er sich dagegen, doch es half nichts. Das Spielzeugland unter ihm kam rasend schnell näher. Er würde zerschellen, in tausend Stücke zerbersten. Er schrie um Hilfe, und plötzlich verlangsamte sich das Geschehen, als wäre es ein Film, der auf einmal in Zeitlupe lief. Unten stand Onkel Lukas und fing ihn auf.
Ben schreckte aus dem Traum hoch. Sein Herz raste. Angst lag wie ein kalter Stein in seinem Magen, und er wusste nicht, wieso. War doch gut gegangen. Und es war auch nur ein Traum.
Onkel Lukas mit seinem Taxi. Er hatte ihnen immer etwas mitgebracht, wenn er nach Buchsweiler kam. Seifenblasen, Schokolade, einen Spielzeugcolt für Fasching und für Luise einmal einen Zauberstab. Damit hatte Ben sie eines Tages unten am Bach beim Mühlrad beobachtet. Seine kleine Schwester stand dort in ihrem Nachthemd, das in jenem Sommer ihr Lieblingskleid gewesen war, schwang den Zauberstab gen Himmel und schloss die Augen. »Simsalabim. Barbara soll eine richtige Mama sein. Hex, hex.«
Rheinland, Frühling 1988
Lukas Isensee
Lukas Isensee betrat das Gelände des Behindertenheims wie immer durch die Pforte an einer Nebenstraße. Seit neun Jahren ging er diesen Weg, wenn er Sabine besuchte. Die Frau, mit der er sein Leben hatte verbringen wollen.
Anfangs war er ständig bei ihr gewesen. Erst im Krankenhaus, anschließend während der Reha, schließlich hier. Zunächst jeden Tag, dann wöchentlich, jetzt wenigstens einmal im Monat.
Als er an diesem Sonntagnachmittag Ende März die weitläufige Anlage auf einer Anhöhe über Bonn betrat, standen die Forsythien und Zierkirschen in voller Blüte, Bienen summten darin. Es war ein verfluchtes gelb und rosa schäumendes Meer an Verheißung und Hoffnung. Ein Versprechen auf ein erfülltes Leben, auf Entfaltung. Auf alles, was Sabine verwehrt blieb. Unwillkürlich ballte Lukas die Fäuste. Er senkte den Kopf, weil er den blauen Himmel über sich nicht sehen wollte. Und auch den Rhein unten im Tal nicht mit seinen Ausflugsschiffen, auf denen sich die Menschen amüsierten, sich die Bäuche mit Torte vollschlugen. Gefräßig, gierig, niemals satt. Die es einfach nicht durchschauten. Noch immer dieselbe Masche von Brot und Spielen. Wer satt und wessen Geist eingelullt war, zettelte keine Revolution an. Die da unten im Bonner Regierungsviertel hatten ebenso wenig zu befürchten wie die modernen Sklavenhalter in den Chefetagen der Konzerne. Jedenfalls nicht von denen, die auf ihren Sofas vor der Glotze hingen und sich den Verstand vernebeln ließen. Die den Mist der Springer-Presse glaubten und die Macht gar nicht haben wollten, die von ihnen ausging: dem Volk.
Lukas erreichte die Pforte, nickte dem alten Mann zu, der hinter einer Sichtscheibe Dienst tat und ihn grüßte. »Tach, Herr Isensee. Sie sind eine treue Seele, wenn ich das einmal so sagen darf.«
Der Weg durch die Flure war ihm vertraut. Bei schönem Wetter war Sabine oft draußen. Sie liebte die Natur, den Sonnenschein, die frische Luft. Er durchquerte die Cafeteria, erwiderte die Grüße der Mitarbeiterinnen und ging hinaus auf die Terrasse. Die Tische unter der Markise waren alle besetzt. Sabine konnte er nicht entdecken. Er ging in den Garten und fand sie unter der Trauerweide. Sie saß in ihrem Rollstuhl am Rand des kleinen Sees. Den Kopf hatte sie in den Nacken gelegt und blickte in den Himmel. Das rotbraune Haar war zu einem Zopf geflochten und fiel ihr über die Schulter. Neben ihr stand eine Betreuerin und arretierte den Rollstuhl. Sie musste neu sein. Lukas kannte sie nicht. Ihr Haar hatte beinahe dieselbe Farbe wie Sabines, allerdings war es kurz geschnitten. Zahlreiche Sommersprossen verteilten sich auf Nase und Stirn. Das Blau der Augen irritierte ihn. Die Farbe schien nicht zu passen. Wie ein kalter Kontrapunkt in einer warmen Harmonie. Mit einer Hand strich sie den weißen Kittel glatt. »Sie sind sicher Lukas. Sabine hat mir von Ihnen erzählt.«
Erzählt?, dachte er. Eher geradebrecht, gestottert, genuschelt. Die Worte irgendwie herausgebracht. Verständlich nur für jemanden, der Übung darin hatte. Sie hatten diese wunderbare, intelligente und lebensfrohe Frau auf das intellektuelle Niveau eines Kleinkindes zurückgeprügelt. »Stimmt«, sagte er. »Ich bin Lukas.«
Sie streckte ihm die Hand entgegen. »Hedwig. Ich arbeite erst seit drei Wochen hier.«
Sabine warf den Kopf in den Nacken und lachte. »Hallo Bine.« Er gab ihr einen Kuss auf die Stirn. Auf den Mund küsste er sie schon lange nicht mehr. Irgendwann hatte sich das eingeschlichen. Es war nicht mehr Liebe, die sie verband, sondern Freundschaft.
»Ich wollte gerade Kaffee und Kuchen holen. Kann ich Ihnen etwas mitbringen?«, fragte Hedwig.
»Ich bin nicht so der Kuchentyp.«
»Vielleicht einen Kaffee?« Abwartend musterte sie ihn, und wieder irritierte ihn das klare Blau ihrer Augen. Der Kontrast zwischen kühl und warm zog ihn an.
»Gerne. Schwarz und ohne Zucker.« Er sah ihr einen Moment nach, als sie Richtung Cafeteria verschwand, nahm sich dann einen der weißen Kunststoffstühle und setzte sich zu Sabine. Sie hatte das Gesicht der Sonne zugewandt. Er stellte sich die farbigen Reflexe vor, die das Licht durch die geschlossenen Lider auf ihre Netzhaut projizierte, und was sie dabei empfand. Eine kindliche Freude, vermutete er. Denn sie wirkte zufrieden. Er nahm ihre Hände in seine, und sie lachte. »Sönn. Du da bist. Du Liba.«
»Gehtʼs dir gut?«
Sie nickte, und ein lang gezogenes »Ja« verließ ihren Mund. Wieder einmal erfasste ihn Ärger auf diese Zufriedenheit. Die Welt hätte ihr als Biologin offen gestanden. In einer Umweltschutzorganisation oder einem Forschungsinstitut. Und nun gab sie sich mit frischer Luft zufrieden. Mit einem Blinzeln in die Sonne. Freute sich, wenn ihr ein Wachsmalbild gelang oder in der Adventszeit selbst gedrehte Kerzen aus Bienenwachsplatten. Er rang die Verbitterung nieder. Wie hatte ihre Mutter gesagt? »Es ist nun einmal so, wie es ist. Wir müssen uns damit arrangieren. Wichtig ist, dass sie nicht verzweifelt, sondern zufrieden ist. Sonst wäre das ja gar nicht auszuhalten.«
Lukas erzählte Bine die Anekdoten der letzten Wochen. Als Taxifahrer erlebte er allerlei, daher gingen ihm die Geschichten nie aus. Sie bemerkte sein verändertes Äußeres und fragte, wo der Bart geblieben war. »Abrasiert. War zu lästig in der Pflege. Außerdem juckt er.« Das war zwar nicht der Grund, aber er wollte Sabine nicht beunruhigen. Am Dienstag würden auch die langen Zotteln fallen. Für das Vorstellungsgespräch am Mittwoch musste sein Erscheinungsbild den Erwartungen entsprechen.
Die Bewerbung war Gernots Idee gewesen. Vor zwei Wochen hatte er ihn angerufen, es gebe etwas zu besprechen. Nicht am Telefon. Also war Lukas nach Buchsweiler gefahren. Barbara war in der Kanzlei in Bonn gewesen, die Kinder in der Schule. Gernot empfing ihn in der Küche. Die Bialetti stand röchelnd auf dem Gasherd und spuckte Espresso in den oberen Teil der Kanne. Gernot nahm zwei dickwandige Tassen aus dem Schrank und stellte eine Dose mit braunem Zucker dazu. Eine besondere Sorte, erklärte er. Er hebe den Geschmack hervor. Seit einiger Zeit zeigte sein Bruder bourgeoise Anflüge von Großkotzigkeit. Für seine Auftritte bei Talkshows und Podiumsdiskussionen hatte er sich zwei Anzüge gekauft, dazu Hemden und Krawatten. Man müsse das System mit seinen eigenen Mitteln schlagen. Wenn er sich mit Jeans, Turnschuhen und ausgeleiertem Rollkragenpullover ins Fernsehen setze, würde ihn niemand ernst nehmen. Die Schotten der Vorurteile rauschten herunter, noch bevor er den ersten Satz gesagt habe. Man hörte ihm nicht zu. Setzte er sich hingegen in ihrer Verkleidung zu ihnen, war das anders.
Auf dem Tisch lag DIEZEIT. Der Stellenteil war aufgeschlagen und eine Annonce mit Kugelschreiber umrandet.
Gernot rührte Zucker in seinen Espresso. »Darum geht es.« Er schob die Zeitung zu Lukas. Das Bundesfinanzministerium suchte einen Fahrer. »Kannst du dir vorstellen, dich zu bewerben?«
Gernot wusste, dass es nur eine Antwort gab, nämlich Nein. Er als Staatsdiener? Am Ende vielleicht noch als Beamter? Ein Knecht des Systems? Niemals. Warum fragte Gernot also? »Was steckt dahinter?«
»Ich weiß, für wen sie einen Fahrer suchen.«
»Etwa für Stoltenberg?«
»Für einen seiner Staatssekretäre. Ludger Rombach.«
Okay, dachte Lukas, als er erkannte, welche Möglichkeit sich auftat. Und es gefiel ihm auch, dass sein Bruder, der große Zampano, ihm das zutraute. »Im Prinzip schon. Ist das deine Idee?«
»Ich koordiniere das nur. Du bist dabei?«
Einen Moment hatte er noch überlegt und dann genickt.
Hedwig kehrte mit Kaffee und Kuchen zurück und stellte das Tablett auf dem Kunststofftisch ab. »Ist es okay, wenn ich auf einen Kaffee bleibe? Oder störe ich?«
»Stöst nid«, stieß Bine hervor.
»Das ist schon in Ordnung.« Lukas schloss sich an. Sabine mochte Hedwig, also mochte auch er sie. Mehr noch: Sie gefiel ihm.