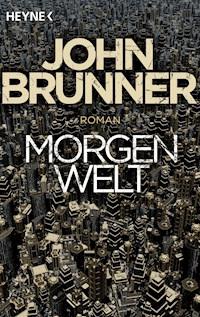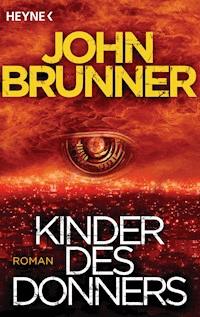
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Sie sorgen selbst für ihre Zukunft
Die Kinder des Donners denken an ihre Zukunft: Sie wollen es nicht hinnehmen, wie ihre Eltern – wir – die Erde weiterhin zerstören aus kurzsichtiger Profitgier und gedankenlosem Streben nach Luxus. Sie wachsen verstreut an verschiedenen Orten Großbritanniens auf und haben zwei Dinge gemeinsam: Ihre Mütter wurden künstlich befruchtet. Und sie haben die unheimliche Gabe, ihre Mitmenschen selbst gegen ihren Willen von etwas zu überzeugen und mitzureißen. Davon machen die Kinder des Donners auch gnadenlosen Gebrauch, um zu überleben – erst alleine, später als Gruppe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 705
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
JOHN BRUNNER
KINDER DES DONNERS
Roman
Für
WENDY MINTON,
weil sie ein guter Kumpel ist
Anmerkung des Autors
Bei den Recherchen zu diesem Roman erhielt ich
viele hilfreiche Informationen
von Dr. Louis Hughes, Harley Street, London,
TEIL EINS
»Vielleicht liebt Little John, genau wie die Söhne Belials, das Böse um seiner selbst willen; vielleicht hasst er es, nett zu anderen zu sein, begreift es jedoch als Preis, den er zu bezahlen hat, wenn er ihnen später überlegen sein will, und vielleicht berechnet er sehr genau die Zugeständnisse, die er um des Bösen willen an die Nettigkeit machen muss.«
Aus »Was gut für uns ist«
von ALAN RYAN
(
Der Swimmingpool war leer, abgesehen von dem Abfall, den der Wind hergeweht hatte. Die meisten privaten Schwimmbecken im Silicon Valley wurden in diesem Jahr nicht benutzt, trotz der Hitze des kalifornischen Sommers. Zu viele Industriechemikalien hatten das Grundwasser der Gegend verunreinigt, und der Preis für Kläranlagen, die geeignet waren, sie herauszufiltern, hatte sich in den vergangenen drei Monaten verdreifacht.
Trotzdem – vielleicht, weil sie erst vor zu kurzer Zeit aus Großbritannien angekommen waren, um nicht jeden Sonnentag so auszukosten, als ob es morgen schneien könnte – hatten Harry und Alice Shay die langweilige alte Nervensäge von einem Besuch am Swimmingpool empfangen, in Segeltuchstühlen mit ihren Namen in Schablonenschrift auf den Rückenlehnen.
Von seinem persönlichen kleinen Reich im Privatflügel des Hauses aus belauerte sie David, der beinah vierzehn Jahre alt war, durch die Schlitze einer Jalousie. Aus dieser Entfernung konnte er nichts hören, doch wusste er viele sachkundige Mutmaßungen über die Unterhaltung anzustellen. Shaytronix Inc. machte etwas durch, das man höflicherweise als ›Liquidationskrise‹ bezeichnete, und der Besucher war Herman Goldfarb, der Oberbuchhalter der Firma, ein gediegener, Brille tragender Mittfünfziger und das typische Musterexemplar eines widerlichen alten Sacks, der dauernd sagte: »Ich kann mich noch erinnern, als …«
Aus mindestens zwei Gründen machte er den Eindruck, als ob ihm äußerst unbehaglich zumute wäre. Sein dunkler Anzug war zweifellos angemessen für ein Büro, in dem die Klimaanlage auf höchster Stufe lief, doch fürs Freie war er lächerlich, und daran änderte auch nichts, dass ihm ein großes Erfrischungsgetränk und der Schatten eines gestreiften Sonnenschirms angeboten worden war. Bis jetzt hatte er noch nicht einmal das Jackett abgelegt, und was noch erschwerend hinzukam …
Der an der Westküste seit langem gepflegte Kult der schönen nackten Körper entwickelte sich wegen der immer stärker werdenden Strahlen, die durch die beschädigte Ozonschicht der Erde drangen, zu einem Risiko. Dessen ungeachtet huldigten die Shays ihm immer noch mit Hingabe. Obwohl er fast im gleichen Alter war wie Goldfarb und bereits bis zur Brustbehaarung hin grau wurde, hatte sich Harry hervorragend in Form gehalten und machte sich nichts daraus, wenn jemand sein Alter kannte. Er trug einen winzigen französischen Badeslip und eine dunkle Sonnenbrille. Desgleichen Alice – ergänzt durch eine glänzende Schicht Sonnencreme. Harry gefiel es, wenn sie bewundert wurde. Er war über alle Maßen stolz darauf, dass er sie geheiratet hatte, als er vierzig war und sie gerade zwanzig.
Er neigte dazu, leichten Sinnes über die Tatsache hinwegzusehen, dass er seine erste Frau und zwei halbwüchsige Kinder verlassen hatte, um dieses Vorhaben durchzuführen.
Eine Zeitlang machte es David – der überhaupt nichts anhatte – Spaß zu beobachten, wie Goldfarb so tat, als würde er den Busen seiner Mutter nicht anstarren. Doch der Spaß ließ bald nach, und er wandte sich wieder seinem Computer zu. Er war an einem Modem angeschlossen, der ihm den Zugriff auf ein internationales Datennetz ermöglichte, und er arbeitete mit einem Programm, das er sich selbst ausgearbeitet hatte und von denn er sich interessante Ergebnisse versprach.
Dieser große, kühle, niedrige Raum, der im rechten Winkel an den älteren Hauptteil des Hauses angebaut war, war sein persönliches Königreich. Ein Vorhang vor einer Nische verbarg sein Bett und die Tür zum angrenzenden Badezimmer. Regale an allen Wänden waren vollgepackt mit Büchern und Tonbändern, so dass kaum noch Platz blieb für seine Stereoanlage und den Fernsehapparat; der letztere murmelte mit heruntergedrehter Lautstärke vor sich hin. In der Mitte der Fläche stand ein Schreibtisch mit seinem Computer darauf; aus den halb aufgezogenen Schubladen quollen unordentlich Papiere. Der übrige Raum war zum größten Teil angefüllt mit Erinnerungsstücken an vergangene und gegenwärtige Interessen: entlang einer Wand ein umfangreiches Heimlabor, einschließlich eines gebraucht erstandenen Elektronik-Mikroskops und einer Ausrüstung zur Genanalyse und Bastelei mit Enzymen und Ribozymen; auf einer anderen Seite eine Werkbank mit einer Reihe von versenkten Holzbearbeitungswerkzeugen; an einer anderen Stelle ein zusammengebrochener Heimroboter, den er halbwegs repariert und abgewandelt hatte; in der hintersten Ecke eine Staffelei mit einem verlassenen Porträt und daneben Gläser mit Pinseln, an denen die Farbe vor etwa sechs Monaten getrocknet war …
Die Luft war angefüllt mit sanfter Musik. Aus einer Laune heraus hatte er seinem Auto-Composer eingegeben, eine Fuge nach einem eigenen Thema unter Benutzung der traditionellen Instrumente einer Dixieland-Jazzband zu erschaffen. Das Ergebnis, so fand er, war ziemlich eindrucksvoll.
Das Computerprogramm schien noch ein ganzes Stück vom Ende seines Durchlaufs entfernt zu sein. Als der Fernsehapparat etwas kaum Hörbares erzählte von Aufständen in einem halben Dutzend Großstädten, blickte David gelangweilt zum Bildschirm. Eine Meute, die sich hauptsächlich aus jugendlichen Farbigen zusammensetzte, schleuderte Steine in ein Schaufenster. Als er mit der Fernbedienung den Ton lauter stellte, schnappte er den Namen eines Softdrinks auf und kräuselte die Lippen. Sie protestierten also gegen den Erlass der Food And Drug Administration, mit dem CrusAde verboten worden war. Dummheit auf der ganzen Linie! Etwas an der Art, wie für das Zeug geworben worden war, hatte ihn stutzig gemacht, und es war nicht nur die Behauptung, dass man durch den Kauf eine gottgefällige Sache unterstützte – angeblich floss die Hälfte des Gewinns einer Fundamentalistenkirche zu, die inzwischen schon so viel wert war wie eine Fußballmannschaft der Unterliga. Daraufhin hatte er sich eine Dose gekauft, nicht etwa zum Trinken, sondern zum Analysieren, und einige Wochen zuvor hatten die Prüfer der FDA die darin enthaltene Spur einer Designer-Droge gefunden; es handelte sich dabei weniger um ein Aufputsch- als um ein reines Suchtmittel.
Er hatte keine Mühe, die Droge zu identifizieren. Es war eine seiner eigenen Erfindungen und erfreute sich bei den Dealern, die er damit belieferte, besonderer Beliebtheit, weil es die Verbraucher fast genauso schnell abhängig machte wie Crack – fast so schnell, um genau zu sein, wie das legendäre (nach Davids Ansicht zum Mythos hochstilisierte) Big L.
Wie sich die Hersteller von CrusAde jemals einbilden konnten, ungeschoren davonzukommen, das mochte der Himmel wissen. Vielleicht hatten sie einfach darauf gehofft, sich den Vorteil des ständig wachsenden Misstrauens der Bevölkerung zur Regierung und deren Unbeliebtheit zunutze machen zu können.
Und/oder die immer weiter reichende Immunität, die die Kirchen durch das Inkrafttreten eines neuen Gesetzes genossen.
Der Computer piepte. Er drehte sich wieder zu ihm um. Und raufte sich wütend die Haare. Entweder enthielt sein Programm einen Haken, was er bezweifelte, oder die Daten, auf die er scharf war, waren einfach nicht zu knacken. Oder, das konnte natürlich auch sein, sie waren on-line nicht verfügbar. Das letztere erschien ihm am wahrscheinlichsten, wenn man bedachte, welch vertraulicher Natur sie waren.
Nun, damit war die Sache besiegelt. Harry Shay musste mit seiner Familie für eine gewisse Weile wieder nach Großbritannien zurückkehren, ob das nun die totale Pleite für Shaytronix Inc. zur Folge hatte oder nicht. Tatsächlich, das war Davids Meinung, würde es dem alten Kotzbrocken recht geschehen, wenn seine Herrschaft über die Firma, die er gegründet hatte, zu Ende wäre. Er wäre dann immer noch ein sehr wohlhabender Mann, denn er war gut im Errichten von – nun – Sicherheitspolstern. Was er sagen würde, wenn er dahinterkäme, dass es ihm David während der vergangenen achtzehn Monate nachgemacht hatte, indem er die Einkünfte aus seiner Drogenerfindung in eine Bank auf den Bahamas hatte fließen lassen, war unmöglich zu erraten. Doch wenn sich eine entsprechende Notwendigkeit ergäbe, könnte durch eine Enthüllung ein gewisser Druck ausgeübt werden; da er minderjährig war, hatte er das Geld auf den Namen seiner Eltern deponieren müssen, mit Referenzen, die Mitglieder der Geschäftsleitung von Shaytronix ohne ihr Wissen gegeben hatten, und was er getan hatte, war so offensichtlich legal, da er sich mit Fug und Recht darauf berufen konnte, dass seine neue Droge ein durch Genmanipulation gewonnenes Sekret aus Hefe war und kein synthetisches Produkt, dass diese Nachricht sofort die Aufmerksamkeit des FBI und vielleicht auch der Sicherheitspolizei auf die Firma lenken würde. Tatsächlich war das erstere bereits auf David aufmerksam geworden, wenn auch nicht auf die Firma. Doch die betreffende Abteilung würde keine Schwierigkeiten mehr machen, oder auf jeden Fall diese ganz speziellen Beamten nicht mehr … Angesichts dieser Bedrohung hätte Harry keine andere Wahl, als zu verkaufen und einer Rückkehr nach England zuzustimmen.
Doch es war wahrscheinlich gar nicht nötig, dass es soweit käme. David hegte buchstäbliches Vertrauen in seine Überredungskraft, ganz besonders nach dem Zoff, den er mit dem FBI gehabt hatte. Wenn es jedoch hart auf hart gehen sollte, hätte er keine Bedenken, diese Art von Druck auf seinen Vater auszuüben.
Er kippte seinen Stuhl nach hinten und stieß einen Seufzer aus, während er dachte: Vater – Sohn …
Seit er zehn war, hatte er einen gewissen Verdacht, und seit er zwölf war, wusste er genau, dass Harry nicht sein Vater war. Jedenfalls, wenn man seine Blutgruppe in Betracht zog, sprach alles dagegen. Harry wies mit Vorliebe darauf hin, dass sich die Biotechnik von ihren gegenwärtigen Rückschlägen wieder erholen würde und sich in der nächsten Zeit sogar zu einem blühenden Industriezweig entwickeln könnte, wenn erst einmal die Computer der fünften Generation verkraftet wären. Demzufolge war er entzückt, als sich David zu seinem zwölften Geburtstag eine Biologie-Ausrüstung wünschte – eine ganz spezielle, die sich der Junge sorgsam ausgesucht hatte, weil die Möglichkeit einer Blutgruppenanalyse in der Liste der durchführbaren Experimente aufgeführt war. Erst später las er den Hinweis, dass dafür echte Blutproben zur Verfügung stehen mussten, und eines Morgens, als sich Harry beim Rasieren geschnitten hatte, kramte David ein Kosmetiktuch aus dem Abfalleimer des Badezimmers. Ein gebrauchtes Tampon seiner Mutter war leichter aufzutreiben, wenn auch hinterher schwerer auf diskrete Art verschwinden zu lassen.
Und mehr als einmal, als er einen Blick auf seinen nackten Vater erhaschte, hatte er etwas bemerkt, das verdächtig wie eine Vasektomie-Narbe aussah …
Er war ein sehr kühles, sehr vernünftiges Kind. Er wäre ganz zufrieden gewesen, wenn Harry und Alice von Anfang an auf gleicher Ebene mit ihm umgegangen wären, oder zumindest ab dem Alter, in dem er die Antworten auf diesbezügliche Fragen verstehen konnte. Was in ihm einen tiefen und eisigen Zorn entfachte, war die Tatsache, dass ihn seine Eltern belogen. Schlimmer noch: Sie scheuten keine Peinlichkeit, um ihre Lüge nicht nur direkt, sondern auch indirekt zu bekräftigen. So zum Beispiel gefiel es seiner Mutter, andere Leute zu fragen: »Finden Sie nicht, dass David seinem Vater ungeheuer ähnlich sieht?«
Vielleicht tue ich das. Wenn ich nur wüsste, wer mein Vater ist, könnte ich es sagen.
Ein zaghaftes Klopfen klang von der Tür her. Da ihm bewusst war, was das ankündigte, schlich er sich lautlos zurück ans Fenster. Seine Eltern diskutierten immer noch mit Goldfarb, der jetzt endlich sein Jackett ausgezogen hatte, und es hatte den Anschein, dass die Unterhaltung so hitzig geführt wurde, wie ihm zumute war. Das würde bestimmt noch eine halbe Stunde so weitergehen – mindestens.
Also wartete er; sein Gesicht verzog sich zu einem gemeinen Grinsen.
Nach einer Weile wurde die Tür geöffnet, und Bethsaida trat behutsam ein; sie war gekommen, um sein Bett zu machen und die Handtücher zu wechseln. Sie war die philippinische Köchin und Haushälterin der Shays: hübsch, plump, verheiratet mit einem Mann, der als Steward auf einem Kreuzfahrtdampfer arbeitete, und die tugendhafte katholische Mutter von drei Kindern – und sie hoffte inständig, der Sohn ihrer Arbeitgeber möge nicht hier im Zimmer sein.
Als sie merkte, dass er es doch war, und noch dazu nackt, japste sie und wollte davonrennen, doch er war zu schnell. Er schoss an ihr vorbei, schob die Tür hinter ihr mit dem Fuß zu und umfasste sie von hinten, indem er die kleinen, blassen Hände um ihre Brüste legte und ihren Nacken mit dem Mund liebkoste. Sie hielt ihren Widerstand einen Moment lang aufrecht, dann wirkte der Zauber. Er öffnete den Reißverschluss ihres Rocks und ließ ihn zu Boden fallen, gefolgt von ihrem Slip; danach warf er sie halb bekleidet auf das zerwühlte Bett und begann sie zu rammeln. Sie stöhnte ein wenig ängstlich, als er sie befriedigte, doch sie konnte nicht anders, als sich ihm hinzugeben.
Es war gut zwei Jahre her, dass sich irgend jemand geweigert hatte, das zu tun, was David wollte, und wann er es wollte.
Jetzt wollte er nichts mehr auf der Welt, als den Grund herauszufinden, warum das so war.
Hier ist das Programm TV-Plus. Es folgen die Nachrichten.
Nach dem Verzehr von Gemüse, das aus dem Garten eines Hauses stammte, das auf einer ehemaligen Mülldeponie errichtet worden war, kam ein Kind in Scoutwood, Country Durham, ums Leben, und dreizehn Personen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Arthur Smalley, einunddreißig, arbeitslos, der das Gemüse angebaut und verkauft hat, dem Vernehmen nach jedoch selbst Angst davor hatte, es zu essen, wird beschuldigt, das ihm daraus zugeflossene Einkommen nicht angegeben zu haben, und er wird sich morgen vor Gericht verantworten müssen.
General Sir Hampton Thrower, der aus Protest gegen den Rückzug von Mittelstrecken-Atomraketen von seinem Amt als Befehlshabender NATO-Beauftragter zurückgetreten ist, empfahl in Salisbury einer jubelnden Menge von Briten, ihren Ansichten Nachdruck zu verleihen und …
Der freiberuflich arbeitende Wissenschaftsredakteur Peter Levin kehrte in seine Dreizimmerwohnung im obersten Stock eines Hauses im Londoner Stadtteil Islington zurück; er war spät dran und schlecht gelaunt.
Er hatte den Tag damit zugebracht, einer Konferenz über Computer-Sicherheit als Berichterstatter beizuwohnen. Die Sache versprach einiges an Nachrichtenwert herzugeben. Zwei Monate zuvor war eine Logo-Bombe in einen Computer der British Gas eingeschlagen – ohne Zweifel das Werk eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin, der oder die über eine zu geringe Ausschüttung an Anteilen verstimmt war; die Folge davon war, dass jedem Kunden im Großraum London die Rechnung zugesandt wurde, die eigentlich für den nächsten in der Liste bestimmt war, woraufhin alle Daten über fällige Zahlungen gelöscht wurden. Nach diesem Vorfall waren derartige Dinge in den Brennpunkt des öffentlichen Interesses gerückt.
Trotzdem hatte Peter das ungute Gefühl, dass der Chefredakteur des Comet, der ihm den Auftrag erteilt hatte, über die Ausbeute nicht glücklich sein würde. Die Zeitung, die vor zwei Jahren gegründet worden war, war in Wirklichkeit ein Sensationsnachrichtenblatt, dessen Zielgruppe Leute waren, die zwar intellektuelle Ansprüche stellten, deren Interessenreizschwelle jedoch von den Kurzmeldungen im Rundfunk und im Fernsehen geprägt war, und was der Typ tatsächlich wollte, war eine Reihe von aufsehenerregenden Hämmern: wie die Intimsphäre der Leser verletzt wird, wie ein paar schwarze Schafe unter den Programmierern berühmte Firmen erpressen, wie Saboteure sich den Zugang ins Hauptquartier des Geheimdienstes oder des Verteidigungsministeriums ergaunern … Doch der Großteil des Materials, das Peter mitgebracht hatte, bestand aus trockenen mathematischen Analysen, denn vor allem hatten die Verschlüsselungsexperten den Verlauf der Konferenz bestimmt. Schlimmer noch: die interessanteste Sitzung war unter Ausschluss der Presse abgehalten worden, und niemand außer den Mitgliedern der geldgebenden Gesellschaft war zugelassen.
Und dann, um das Fass zum Überlaufen zu bringen, musste er noch erleben, dass wieder einmal ein seit ewigen Zeiten nicht reparierter U-Bahn-Schacht zusammengebrochen und die Strecke in sein Viertel stillgelegt worden war, so dass er mit dem Bus fahren musste; und während er an der Haltestelle wartete, hatte es auch noch angefangen zu regnen.
Unter lauten Verwünschungen knallte er seine Aktentasche mit dem Packen Konferenzunterlagen und Werbematerial auf einen Stuhl, breitete seine feuchte Jacke über die Lehne, damit sie dort trocknete, und schleuderte die Schuhe von den Füßen; auch sie waren patschnass, weil er gleich in eine der ersten Pfützen des Unwetters getappt war. Auf Socken schlurfte er zu der türlosen Wandnische, die ihm als Küche diente, fand eine halbvolle Flasche Whiskey und goss viel davon auf wenig Eis. Nach dem zweiten Schluck beruhigte er sich etwas. Es gab einen Aspekt, den er ausbauen konnte, wenn er auch alles andere als ideal war. Einer der Redner – der einzige mit einem gewissen Sinn für Humor – hatte einen Teil seiner Rede der Aufklärung gewidmet, mit welchem Unverständnis immer noch viele laienhafte Computerbenutzer reagierten, wenn sie mit der Notwendigkeit konfrontiert wurden, einen Sicherheitscode einzurichten. Die meisten der Zuhörer waren ernst dreinblickende junge Männer und Frauen (eine unerwartet große Anzahl der letzteren, was ebenfalls einer Erwähnung wert wäre), denen es mehr um die mathematischen Gesichtspunkte ihrer Arbeit ging als um den Wert für die Firmen, die versuchten, Industriespione davon abzuhalten, sich Zugriff auf ihre Forschungsdaten zu verschaffen, doch einige der vorgebrachten Beispiele hatten selbst sie zu höhnischem Gelächter hingerissen. Ganz besonders dieser eine Fall von dem Generaldirektor einer Firma …
Doch es war an der Zeit, mit dem Denken aufzuhören und mit dem Schreiben zu beginnen! Die Uhr in seinem Computer zeigte halb acht an, und er war mit Nachdruck ermahnt worden, dass sein Artikel via Modem vor neun eingehen musste, wenn er noch in den Ausgaben Schottland und West Country erscheinen sollte. Trotz des Umstandes, dass sich die Geschäftsleitung des Comet rühmte, die fortschrittlichste Technologie aller Zeitungen in Großbritannien zu besitzen, übernahmen die Außenbüros die Manuskripte aus London noch lange nicht, ohne sie mit entsprechendem Zeitaufwand für ihre lokale Leserschaft redaktionell zu bearbeiten. Vielleicht war das die Erklärung dafür, dass die Zeitung die angestrebte Auflage nie erreicht hatte und dass über sie das Gerücht ging, sie bewege sich am Rande des Ruins.
Voller Abscheu bei dem Gedanken, welchen Machenschaften durch unfundiertes pseudowissenschaftliches Gewäsch der Weg geebnet werden könnte, kramte Peter seinen Taschenmerker aus der Jacke, übertrug dessen Inhalt in den Computer und machte sich daran, grobe Notizen in eine brauchbare Story umzuwandeln. Der Regen, der auf das Schieferdach trommelte, bildete einen trostlosen Kontrapunkt zum Klacken der Tasten.
Zu guter Letzt unterschritt er seinen Abgabetermin um ein angenehmes Maß. Er war sogar einigermaßen zufrieden mit der Art, wie er die Schwerpunkte der durchaus witzigen Rede dargestellt und die mathematische Seite heruntergespielt hatte, ohne sie ganz zu ignorieren. Er feierte das Ergebnis, indem er sich noch einen Drink eingoss, und dann wanderte er auf und ab, um sich die Beine zu vertreten. Er war nicht nur vom langen Sitzen an der Computertastatur steif geworden, sondern auch davon, dass er den Großteil des Tages auf Plastikstühlen verbracht hatte, die offenbar für den Australopithecus konstruiert waren. Aber ganz sicher würde er noch einen Anruf bekommen, sobald der Chefredakteur Zeit gefunden hatte, seinen Text zu lesen, so dass er es trotz stärker werdender Hungeranfälle nicht wagte auszugehen, um irgendwo noch einen Bissen zu essen.
Das Warten wurde jedoch ein langes Warten, und unterdessen kehrte seine vorherige Stimmung der Depression und Frustration zurück. Er war jetzt Ende Dreißig und hatte seiner Meinung nach etwas Besseres verdient als diese Wohnung hier. Die höflichste Bezeichnung, mit der man diese Unterkunft beschreiben konnte, war ›kompakt‹: dieser Raum, in dem er arbeitete, mit seinem Computer und der Bibliothek mit den Nachschlagewerken; ein Schlafzimmer, in das wie mit einem Schuhlöffel noch eine Dusche und Toilette hineingezwängt waren und das so eng war, dass er sich seitlich um das Bett herumquetschen musste, wenn er es frisch beziehen wollte; und was er als sein ›Pseudo- oder auch Wohnzimmer‹ bezeichnete, war trotz einer Wand voller Elektronik mit Fernsehapparat, Stereoanlage samt Kassettendeck und Radio-Tuner kaum dazu angetan, seine Besucher vom Hocker zu reißen, schon gar nicht seine weiblichen.
Nein, das war nicht wahr – seine Verbitterung war lediglich das Ergebnis eines schlechten Tages und des schlechten Wetters. In Wirklichkeit fehlte es ihm nicht an vorzeigbaren Freundinnen, obwohl er selbst auch bei wohlwollendster Bemühung der Phantasie nicht als gutaussehend eingestuft werden konnte. Er war mittelgroß, einigermaßen schlank, in einem einigermaßen ordentlichen Gesundheitszustand, mit dunklem Haar und braunen Augen. Nichts an ihm war außergewöhnlich, nicht einmal seine Stimme. Es war sogar so, dass er jedes Mal, wenn er sich selbst auf Tonband hörte, einen Schreck bekam, wie sehr sie jeder beliebigen englischen Ansagerstimme im Radio oder Fernsehen glich – der gemeinsame Stimmnenner sozusagen …
Als er ans Fernsehen dachte, fiel ihm ein, dass es Zeit für die Nachrichtensendung war, und er schaltete den Apparat ein; er stellte fest, dass das Hauptthema eine Story war, über die auch er geschrieben hatte – Zustände, die typisch für diese Zeit waren –, bis zu einem gewissen Punkt, als er der Sache überdrüssig wurde. Wieder mal hatte eine Gruppe von schwarzen Flüchtlingen, dem Verhungern und Verzweifeln nahe, den cordon sanitaire, den die Südafrikaner an ihrer nördlichen Grenze immer noch aufrecht erhielten, gewaltsam überschritten und waren gebührend niedergeschossen worden mit der Begründung, sie seien ›Überträger biologischer Kriegswaffen‹ … Es bestand kein Zweifel daran, wer diesen speziellen Zermürbungskrieg gewinnen würde: die Afrikaner besaßen, wie die anderen wohlhabenden, fortschrittlichen Nationen, den Impfstoff gegen AIDS, während ihre Gegner nur AIDS hatten. Zur Zeit wurde der Anteil an Infizierten in Kenia, Uganda und Angola auf fünfzig Prozent geschätzt. Welche Armee konnte gegen einen so unfassbaren und heimtückischen Gegner etwas ausrichten?
Der nächste Beitrag beschäftigte sich mit einer Speisefarbe, von der sich herausgestellt hatte, dass sie die Intelligenz bei Kindern beeinträchtigte – ungefähr zehn Jahre zu spät, um die Opfer noch zu retten. Diesem Thema schenkte er ernste Aufmerksamkeit, machte sich sogar Notizen.
Stories mit einem medizinischen Hintergrund waren das, was die Redaktionen am dringendsten von ihm wollten, aufgrund der Art und Weise, wie er in diesen hochspezialisierten Bereich hineingerutscht war. Mit Anfang Zwanzig war er Student an einer Londoner Lehrklinik gewesen mit der Hoffnung, irgendwann einmal in die allgemeine medizinische Praxis überwechseln zu können. Als er die Halbzeit seines Studiums erreicht hatte, ohne besondere Fortschritte zu machen, lernte er zufällig einen wissenschaftlichen Mitarbeiter von TV-Plus kennen, dem Außenseiter der britischen Fernsehstationen, der eine Einschaltquote von nicht einmal zehn Prozent der Zuschauer hatte, der jedoch andauernd mit großangelegten Stories aufwartete, an die sich die Konkurrenz nicht heranwagte. Der Produzent der Wissenschaftsserie Continuum plante eine Dokumentation über die neuesten Errungenschaften der Medizin. Peter war in der Lage, nützliche Informationen zu liefern, und er verhinderte, dass ein schwerwiegender Fehler auf den Bildschirm gelangte – wofür er in einer Danksagung gebührend Anerkennung erhielt.
Sehr zum Ärger seines Professors, der bei seinen Studenten keine Aktivitäten außerhalb der Universität duldete.
Es folgten Ermahnungen und Tadel und die nicht allzu freundliche Empfehlung, das Studium anderswo fortzusetzen. Als er bei TV-Plus anrief, um sich darüber zu beschweren, was ihm widerfahren war, löste er eine überraschende Reaktion aus: Der Produzent sagte, er sei sehr beeindruckt von der Art, wie Peter selbst schwerverständliche Themen darstellte, und der wissenschaftliche Mitarbeiter, den er kennengelernt hatte, habe gekündigt, so dass jetzt eine Stelle frei sei. Ob er nicht Lust hätte, zu einem Bewerbungsgespräch vorbeizukommen?
Er bekam den Job, und die folgenden acht Jahre arbeitete er mit dem Team zusammen, das Jahr für Jahr in sechsundzwanzig von zweiundfünfzig Wochen die Sendung Continuum zusammenstellte, wobei seine Karriere vom Recherchieren zum Schreiben und schließlich zum Co-Moderieren verlief. Während seiner Mitarbeit gewann die Serie zwei begehrte Preise. Dann verließ der Produzent den Sender, weggelockt durch ein höheres Gehalt, und die Serie wurde eingestellt.
Doch inzwischen hatte Peter Levin einen guten Namen und jede Menge Kontakte zur Presse und den Sendeanstalten. Er beschloss, sich selbständig zu machen, und bis jetzt hatte er es geschafft, immer am Ball zu bleiben. Einmal fungierte er als Berater hier, ein andermal schrieb er einen oder mehrere Beiträge dort, gelegentlich half er beim Konzipieren und Herausgeben eines populärwissenschaftlichen Werkes, und alles in allem war er recht gut im Geschäft. Vor allem hatte er die Möglichkeit, Reisen zu machen, die er sich anders als auf Kosten eines Verlages oder einer Fernsehgesellschaft nie hätte leisten können.
In letzter Zeit jedoch …
Er seufzte. Es war nicht allein sein Problem. Solang computergesteuerte Panik die Börse ständig zum Verrücktspielen brachte, solang Großbritannien von der japanischen Wirtschaftssphäre ausgeschlossen war – was im Klartext bedeutete, solang diese verdammte, dämliche Regierung an der Macht blieb –, konnten die Dinge nur schlimmer werden.
Das Telefon läutete. Überrascht stellte er fest, dass er dem Rest der Nachrichten keinerlei Aufmerksamkeit mehr geschenkt hatte. Während er schnell mit einer Hand den Ton leiser stellte, griff er mit der anderen nach dem Apparat.
»Jake Lafarge für Sie«, sagte das Telefon. Das war der Redakteur, der ihn damit beauftragt hatte, über die heutige Konferenz zu berichten.
»Nun, was halten Sie von meiner Geschichte?«, fragte er mit gespielter Herzlichkeit.
»Geht so«, brummte Lafarge. »Sie muss reichen.«
»Das ist alles? Ich fand sie eigentlich ziemlich geglückt, wenn man bedenkt … Einige der Späßchen …«
»Peter, diese Zeitung heißt Comet, nicht Comic!«, unterbrach ihn Lafarge. »Sollte heute Nachmittag nicht eine geschlossene Sitzung stattfinden?«
»Natürlich.« Peter zwinkerte unruhig. »Sie haben das Programm doch gesehen.«
»Und Sie waren nicht dabei?«
»Was erwarten Sie? Wie hätte ich das anstellen sollen? Mich mit einer gefälschten Teilnehmerkarte einschleichen? Jake, diese Sitzung behandelte Sicherheitsfragen, verdammt noch mal!«
»Sie haben nicht die Gehirne der Teilnehmer angezapft? Sie haben sich keinen einzigen geschnappt und unter Alkohol gesetzt, damit sich seine Zunge löst?«
»Ich habe mit allen gesprochen, die ich erwischen konnte!«, brauste Peter auf. »Ich habe in der Tat so viel Zeit mit dem Anzapfen von Gehirnen zugebracht, dass ich erst nach Hause kam, als es schon …«
Doch es war offenkundig, dass Lafarge nicht in der Stimmung war, sich Ausflüchte anzuhören. Er fuhr fort, als ob Peter überhaupt nichts gesagt hätte.
»Was gäbe ich darum, wenn ich mit einem ordentlichen Skandal klotzen könnte! Was, zum Teufel, nutzt die beste technische Ausrüstung in der Branche, wenn ich es mir nicht leisten kann, die besten Mitarbeiter zu engagieren? Tag für Tag, Woche für Woche sehe ich Stories im Guardian oder Observer, die wir hätten aufreißen müssen – wir sind die stumpfe Klinge auf dem Markt, dabei sollten wir die schärfste sein, verdammt! Wir sitzen bis zum Hals zwischen den raffiniertesten Computern und schaffen es nicht, sie so einzusetzen, dass wir die Art von Schmutz hochschaufeln, die wir – davon bin ich überzeugt – ausfindig machen könnten, wenn wir nur wüssten wie. Wenigstens ist es mir endlich gelungen …«
Er unterbrach sich mitten im Satz. Im Stillen fragte sich Peter, wie lang Lafarge seinen Job wohl noch behalten würde. So wie er sich anhörte, trank er offenbar ganz gern einen über den Durst. Nach einer ganzen Weile sagte er hinterhältig: »Was haben Sie gesagt?«
»Vergessen Sie's!«, schnauzte Lafarge. »Und das meine ich wörtlich!«
Sehr wohl, Baas! Aber das sprach Peter nicht aus. Statt dessen ging er zum wichtigsten anliegenden Punkt über. »Haben Sie mein Honorar angewiesen?«
»Ja, natürlich. Sie werden es morgen auf dem Konto haben. Und« – mit großer Überwindung – »es tut mir leid, dass ich Sie so angefahren habe. Sie können nichts dafür. Aber denken Sie daran, ich meine es durchaus ernst, dass ich einen echten Aufreißer brauche. Ich … Also, wir zahlen Honorare, die sich ohne weiteres vergleichen lassen.«
Hier spricht die Stimme der Verzweiflung. Vielleicht ist etwas dran an den Gerüchten, dass die Zeitung vor dem Bankrott steht.
Mit der Hälfte seines Denkens war Peter mit der Überlegung beschäftigt, wo er diesen speziellen Informationsschnipsel am besten verschachern könnte; mit der anderen Hälfte gab er beschwichtigende Laute von sich und wiegte düster den Telefonhörer in der Hand. Der Comet war nicht der beste Absatzmarkt, doch er war eine ganz brauchbare Stütze, und ohne ihn …
Aber jetzt hatte er einen Bärenhunger, und der Regen hatte nachgelassen. Zeit, sich um etwas zu essen zu kümmern.
Die dreizehnjährige Dymphna Clancy blieb vor dem Büro der Mutter Oberin stehen, wohin sie zu dieser ungewöhnlichen Stunde, die eigentlich die Zeit des Schlafengehens war, bestellt worden war. Sie wünschte, es hätte einen Spiegel in der Nähe gegeben, doch es gab nur sehr wenige davon im Bereich der Klosterschule, da die Betrachtung des eigenen Antlitzes für die Wurzel der Sünde der Eitelkeit gehalten wurde. Aber wenigstens gab es ein Fenster ohne Vorhang, in dem sie einen Blick auf sich erhaschen konnte. Soweit sie es beurteilen konnte, war ihre Uniform einigermaßen gepflegt und ihr dunkles Haar einigermaßen ordentlich. Falls sie sich in der einen oder anderen Hinsicht ein Versäumnis zuschulden hätte kommen lassen, müsste sie natürlich damit rechnen, ermahnt zu werden, und zwar in nicht zu zimperlichen Worten.
Nicht, dass ihr das viel ausgemacht hätte – viel hätte anhaben können. Heute nicht mehr. Trotzdem, dieses Auf-sich-zukommen-Sehen und dann Über-sich-ergehen-Lassen dieser besonderen Art von Gardinenpredigten, die die Nonnen gern auf die Schülerinnen niederprasseln ließen, erzeugten zumindest Unbehagen und trieben ihr den Schweiß in die Handflächen und bewirkten, dass ihr Herz wie ein Hammer klopfte, und allzu oft waren sie in höchstem Maße erschöpfend. Dymphna hielt es für das beste, sich anzupassen, wenigstens nach außen hin.
Sie wünschte, sie würde sich nicht so sehr davor fürchten, dass eine der Schandtaten, die sie sich angewöhnt hatte, im verborgenen zu begehen, irgendwie ans Licht gekommen sein könnte. Doch wie sonst sollte sie sich erklären, dass sie noch zu so später Stunde zur Audienz gerufen wurde?
Während sie sich innerlich für ein langatmiges und unerfreuliches göttliches Tribunal wappnete, klopfte sie an die Tür des Büros. Mutter Aloysia antwortete sofort. »Komm herein, Kind!«
Kind? Warum, um alles in der Welt, sagt sie so was?
Verwirrter denn je, wenn auch eine Spur weniger ängstlich, öffnete Dymphna die Tür.
Mutter Aloysia war nicht allein. Anwesend waren ebenfalls Schwester Ursula, die Nonne, deren Obhut Dymphnas Altersgruppe unter den Schülerinnen anvertraut war, außerdem Vater Rogan, der Geistliche und Beichtvater der Schule, sowie ein Fremder in einem dunklen Anzug: ein rotgesichtiger Mann mit einem Walrossschnauzer, der einen schwarzen Homburg linkisch auf dem Knie balancierte.
In der Mitte stand ein unbesetzter Stuhl.
»Setz dich, Kind!«, hörte Dymphna. Sie folgte und wunderte sich über den unvertrauten Ausdruck in Mutter Aloysias Gesicht. Selten hatte es anders ausgesehen als starr, wie aus Stein gehauen, mit zusammengekniffenen Augen, eingezogenen Wangen, den Mund zu einem schmalen Schlitz gespannt. Genauso wenig hatte sie je den leisesten Anflug von Zärtlichkeit in ihrer kratzigen, doch autoritären Stimme vernommen.
Eine Zeitlang herrschte Schweigen. Dann ergriff die Mutter Oberin wieder das Wort.
»Ich muss dich bitten, stark zu sein, Dymphna. Wir … nun, wir haben eine schlechte Nachricht für dich. Dies ist Mr. Corkran, einer der Partner der Anwaltskanzlei, die das Vermögen deines verstorbenen Vaters verwaltet. Er war so freundlich, sich persönlich hierherzubemühen, anstatt einfach nur anzurufen.«
Ich bin also nicht hier, damit sie mir das Fell über die Ohren ziehen.
Dymphna entspannte sich, wobei sie versuchte, sich ihre Reaktion nicht allzu deutlich anmerken zu lassen, und sich bemühte, die Knie in züchtiger Weise zusammenzudrücken.
Sie konnte sich kaum an ihren Vater erinnern, und man hatte ihr auch nicht viel direkt über ihn erzählt. Doch boshafter Klatsch machte die Runde an der Schule, sowohl bei den Lehrschwestern als auch unter den Schülerinnen, und aus Andeutungen und Beleidigungen hatte sie sich die wesentliche Wahrheit über Brendan Clancy zusammengereimt. Er hatte sich umgebracht. Obwohl das im Zustand eines durch Trunkenheit ausgelösten Weltschmerzes geschehen war, hatte er unzweifelhaft eine Todsünde begangen.
Am Anfang war sie entsetzt. Denn hinterließen die Sünden der Väter nicht ihre Male auf den Kindern, sogar noch in der dritten oder vierten Generation?
Seltsamerweise bekam sie jedoch innerhalb einer verhältnismäßig kurzen Zeit eine andere Einstellung dazu. Inzwischen stellte sie sich diese Umstände ihres Lebens ziemlich romantisch vor und hielt ihre angeseheneren Schulkameradinnen geringschätzig für einfallslos und angepasst. Sie hatte begonnen, Schritt für Schritt die Grenzen ihrer Möglichkeiten an Ungehorsam zu erforschen, indem sie mit kleineren von der Norm abweichenden Handlungen angefangen und sich vor etwa einem Jahr zu Untaten gesteigert hatte, die üblicherweise – das heißt, wenn sie irgendeines der anderen Mädchen begangen hätte – eine Bestrafung erster Größenordnung nach sich gezogen hätte. Wenn zum Beispiel eine von den anderen von der Schüleraufsicht dabei erwischt worden wäre, im Besitz von Fotos zu sein, auf denen Männer und Frauen in nacktem Zustand in verfänglichen Situationen abgebildet waren …
Doch Dymphna besaß viele davon, die sie sich durch Bestechung in Form von Küssen und der gelegentlichen Erlaubnis, ihr in die Bluse zu greifen, vom Laufburschen der Bäckerei beschafft hatte und die sie unter den älteren Schülerinnen herumreichte – gegen ein Entgelt. Während der letzten paar Monate hatte sie darüber hinaus angefangen, echtes Geld zu verdienen. Der Lieferant des Materials war der ältere Bruder des Laufburschen, ein Fernfahrer, der die Möglichkeit hatte, die neuesten Magazine aus Frankreich und Italien einzuschmuggeln. Da er einmal beinah von der Gardia erwischt worden wäre, brauchte er einen sicheren Ort, wo er seine Vorräte verstecken konnte, und er war gewillt, dafür stattlich zu bezahlen. Dymphna tat ihm den Gefallen. Wer würde schon in einem Nonnenkloster nach pornografischen Magazinen suchen? Ganz zu schweigen von Kondomen, die mit einer Gewinnspanne von einigen hundert Prozent verkauft wurden!
Gab es denn keine Grenze, wieweit sie gehen konnte, ohne bestraft zu werden?
Ich glaube, ich schlage meiner Mutter nach.
Von der sie gleichfalls wenig wusste, denn sie trafen sich nur einmal im Monat, am Samstag Nachmittag, wenn eine Krankenschwester Mrs. Imelda Clancy in einem Taxi zur Schule begleitete: eine gebrechliche, unscheinbare Frau, die viel älter aussah, als sie wirklich war, mit einem verkniffenen Gesicht und unordentlichen grauen Haaren, die wenig sprach und anscheinend noch weniger begriff. Jahrelang hatten die anderen Mädchen die Angewohnheit gehabt, sich nach jedem dieser Besuch über Dymphna lustigzumachen, doch in letzter Zeit hatten sie es aufgegeben, vielleicht, weil sie auf irgendeine unbegreifliche Weise neidisch waren auf den Unterschied zwischen ihrem Leben – mit dem Hauch sensationeller Illustrierten-Stories – und ihren eigenen Zukunftsaussichten, so voraussehbar und langweilig.
Man hatte hinter vorgehaltener Hand erklärt, dass ihre Mutter, nachdem ihr Vater sie verlassen hatte, einen Nervenzusammenbruch erlitten habe, was der Grund dafür gewesen sei, dass sie in die Obhut der Nonnen gegeben worden war. Doch das konnte nur ein Teil der Geschichte sein. Weitere Anhaltspunkte, die der allgemeine Klatsch noch auf Lager hatte, kamen ihr zu Ohren, und so fügte sie Stück für Stück zusammen. Angeblich war ihr »Vater« nicht ihr richtiger Vater (obwohl ihr ein bis in alle Einzelheiten gehendes Verständnis für die biologische Elternschaft fehlte, trotz der Verhütungsmittel und Bilder, die sie besaß). Mit anderen Worten, ihre Mutter hatte ihn mit einem anderen Mann betrogen, und Dymphna war die Frucht einer ehebrecherischen Vereinigung.
Es wurde immer romantischer! Sie musste also ein Kind der Liebe sein! Und sie fand, dass es kein schöneres Wort geben könnte.
Wenn sie betete – was sie zu den vorgeschriebenen Zeiten tat, wenn auch ohne Überzeugung, denn sie war alles andere als zufrieden mit der Art, wie sich der Schöpfer nach vollbrachter Tat um sein Werk kümmert –, bat sie nicht um Erlösung, auch nicht um Berufung in den Orden, sondern um etwas, über das die Nonnen in Hysterie ausgebrochen wären. Sie flehte darum, mit ihrem leiblichen Vater vereint zu sein, der sicher noch andere Kinder hatte. Sie wollte ihre Halbschwestern und vor allem ihre Halbbrüder kennenlernen. Sie wollte Jungen kennenlernen, mit denen sie … Doch an diesem Punkt stockte selbst ihre fieberhafte Phantasie. Und überhaupt war jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um an solche Sachen zu denken.
Sie legte ihr Gesicht sorgfältig zu einer Maske zurecht, in der sich Verwirrung und Besorgnis mischten – da es offenbar das war, was man von ihr erwartete –, und wandte sich mit einem Blick, in dem eine wortlose Frage lag, an Mr. Corkran.
Er zog ein Taschentuch aus der Brusttasche seines Jacketts und wischte sich die Stirn, bevor er antwortete.
»Ich möchte nicht lange um die Sache herumreden, Miss Clancy. Es ist meine traurige Pflicht, Ihnen zu eröffnen, dass Ihre Mutter sie nicht mehr besuchen wird.«
»Wollen Sie damit sagen …?«, flüsterte Dymphna mit einer gekonnten Darbietung von banger Sorge, die einer professionellen Schauspielerin alle Ehre gemacht hätte.
Mr. Corkran nickte feierlich. »So ist es in der Tat. Sie schied heute am frühen Abend dahin, nach einem Herzanfall. Alles, was getan werden konnte, wurde getan, das versichere ich Ihnen. Und der Arzt, der gerufen worden war, erklärte, dass sie bestimmt nicht viel leiden musste.«
Eine Zeitlang herrschte Stille. Sie alle starrten sie erwartungsvoll an. Welche Art der Reaktion wollten sie sehen? Sollte sie in Tränen ausbrechen? Mutter Aloysia hatte sie angewiesen, tapfer zu bleiben, das konnte es also wohl nicht sein … – Ach, natürlich!
Als ob sie ein Schluchzen unterdrücken würde, fragte sie gepresst: »Hatte sie noch genügend Zeit, um mit einem Geistlichen zu sprechen?«
Sie entspannten sich. Sie hatte richtig geraten. Mit einem Tonfall noch nie dagewesener Zärtlichkeit antwortete Schwester Ursula – normalerweise die verbissenste Verfechterin einer strengen Erziehung.
»Ich fürchte, meine Liebe, als er kam, war deine Mutter bereits nicht mehr bei Besinnung. Doch uns wurde versichert, dass sie noch vor ganz kurzer Zeit die Beichte abgelegt hatte. Ihre arme, schwache Seele kann also nur mit sehr wenig Sünde beladen gewesen sein.«
»Und übrigens«, murmelte Vater Rogan, »verfährt Gott gnädig mit jenen, die lange Zeit für eine jugendliche Verfehlung sühnen.«
Er bekreuzigte sich; die anderen machten es ihm nach, und Dymphna beeilte sich, es ihnen ebenfalls gleichzutun. Dann senkte sich wieder Schweigen herab.
Was sollte sie jetzt tun? Mehrere Möglichkeiten kamen ihr in den Sinn, und sie entschied sich für jene, die – wie sie annahm – am wahrscheinlichsten Schwester Ursulas Zustimmung finden würde. Mutter Aloysia war im Vergleich zu ihr eine Randfigur, warum die Mädchen auch, wenn sie davon sprachen, in ihr Büro zu gehen, den Ausdruck gebrauchten »Zur Audienz gebeten werden«. Sie beugte sich vor und probierte es auf gut Glück. »Muss ich bitte nicht gleich wieder in den Schlafsaal zurück? Ich …« – sie fügte einen überzeugenden Bruch ihrer Stimme ein – »ich möchte eine Weile allein sein. In der Kapelle.«
Schwester Ursula warf der Mutter Oberin einen Blick zu. Nach kurzem Zögern nickte die letztere.
»Ich denke, unter den gegebenen Umständen ist das angemessen. Sagen wir … äh … eine halbe Stunde? Das übrige können wir morgen früh besprechen: die Vorbereitungen für die Beerdigung und die anderen traurigen Obliegenheiten. Schwester Ursula, bitte begleiten Sie Dymphna in die Kapelle, dann gehen Sie bitte in den Schlafsaal und unterrichten die Kinder über den Vorfall, um zu verhindern, dass irgendwelches törichte Geschwätz entsteht. Erklären Sie ihnen, dass sie in dieser Zeit der Prüfung besonders freundlich zu ihrer Kameradin sein müssen.«
»Ja, Mutter Oberin«, sagte Schwester Ursula und erhob sich. »Komm, mein Kind!«
Auf der Schwelle wandte sich Dymphna um. Fast unhörbar sagte sie: »Vielen Dank, Mr. Corkran, dass sie sich die Mühe gemacht haben, es mir persönlich zu sagen. Ich weiß es zu schätzen.«
Als die Tür zugefallen war, sagte der Rechtsanwalt bewegt: »Sie hat es erstaunlich gut aufgenommen. Ich war ziemlich besorgt, sie würde … Und sie ist überaus höflich, nebenbei bemerkt. Ihr erzieherisches Niveau muss sehr hoch sein.«
Wenn das nicht auch eine ungehörige Manifestation von Stolz gewesen wäre, hätte man fast behaupten können, Mutter Aloysia schwoll bei diesem Kompliment an. Doch sie sagte nur: »Wir tun unser Bestes. Und ich glaube, wir können Dymphna zu unseren Erfolgen zählen, ganz besonders eingedenk ihrer Lebensumstände. Eine ganze Zeit lang war sie – nun – schwierig, doch seit einem oder zwei Jahren habe ich, meine ich, keine einzige Beschwerde mehr über sie gehört. Zumindest keine, die jugendlichem Übermut anzulasten wäre.«
Sie griff nach einem Notizblock und einem Stift. »So« – förmlicher – »welche organisatorischen Schritte müssen wir unternehmen, damit sie an der Beerdigung teilnehmen kann? Wann und wo soll sie stattfinden?«
Die Kapelle lag fast vollkommen im Dunkeln. Während sie Schwester Ursula dankte, sah Dymphna auf die Armbanduhr, die ihrer Mutter gehört hatte. Es war ein altmodisches, vordigitales Modell, das zum Vorgehen neigte, aber immerhin hatte es leuchtende Zeiger. Sobald sich Schwester Ursulas plumpe Schritte außer Hörweite entfernt hatten, begab sie sich in die Ecke, in die am allerwenigsten Licht fiel, und setzte sich auf den Boden; sie schüttelte den Kopf.
Hatten sie wirklich erwartet, dass sie weinen und jammern und schreien würde bei der Mitteilung, dass diese Fastfremde, ihre Mutter, nicht mehr zu diesen angespannten, langweiligen stundenlangen Begegnungen hierhergebracht werden konnte? Wie immer Imelda Clancy gewesen sein mochte, als sie ihr einziges Kind zur Welt brachte, die Erkenntnisse der folgenden Zeit mussten sie stark verändert haben. Es war unmöglich, sich vorzustellen, dass diese hinfällige, fast seelen- und gehirnlose Person ein leidenschaftliches Verhältnis mit einem Mann unterhalten hatte, mit dem sie nicht verheiratet war.
Und dieses Verhältnis war das einzige an ihrer Mutter, das Dymphna jemals bewundert hatte. Genau wie der Selbstmord das einzige war, das sie an ihrem Vater bewunderte.
Sie befragte wieder die Uhr. Fünf Minuten waren vergangen. Schwester Ursula kam möglicherweise fünf Minuten vor Ablauf der zugestandenen Zeit zurück, doch bis dahin …
Sie musste das Beste aus den nächsten zwanzig Minuten machen, denn eine solche Chance würde sich wahrscheinlich so schnell nicht wieder ergeben. Da die Nacht lau war, hätte sie sich am liebsten ganz nackt ausgezogen, aber das war bei weitem zu riskant; es könnte ja passieren, dass sie sich so sehr in ihrem eigenen Entzücken verlieren würde, dass sie Schwester Ursulas polternden Trampelschritt nicht rechtzeitig hören würde, um sich wieder anzuziehen. Sie musste sich also damit zufriedengeben, ihre hässliche, unförmige Unterhose bis zu den Knöcheln hinunterzuziehen, mit der linken Hand unter ihre Bluse und das Unterhemd zu fahren und die Brustwarzen zu streicheln, während sie mit dem rechten Mittelfinger zwischen dem Büschel seidiger Löckchen, das seit dem Einsetzen ihrer Periode am unteren Rand ihres Bauches gesprossen war, herumtastete und die ganz spezielle Stelle ausfindig machte, über die sie die »verdorbene« Caitlin, eine ältere Schülerin, aufgeklärt hatte und der sie, streng genommen, erhebliche Abbitte schuldete sowie tiefe Dankbarkeit dafür, dass sie sie in die verborgenen Freuden ihres Körpers eingeweiht hatte. Um einen Ausdruck zu gebrauchen, den sie aus ihrer verbotenen Lektüre kannte: zum Teufel damit! Caitlin war klug, sie war beliebt und allgemein anerkannt gewesen; trotzdem war sie im letzten Jahr am Tag ihres sechzehnten Geburtstags von der Schule gewiesen worden, weil Schwester Ursula beim Wühlen unter ihrer Matratze ein Pornoheft gefunden hatte. Es war entschieden leichter zu glauben, dass die hübsche, erotische Caitlin es hereingeschmuggelt hatte, als das von einer harmlosen Dreizehnjährigen anzunehmen, noch dazu von einer, die so überzeugend lügen konnte und keinen Pfifferling gab um den guten Ruf einer anderen; Hauptsache, ihr eigener blieb makellos …
Nachdem Dymphna zum Höhepunkt gekommen war, pulte sie das Schloss des Schreins mit einer Haarklammer auf – was sie nicht zum ersten Mal tat –, nahm den Kommunionskelch heraus und pinkelte hinein. Da sie sich, wie üblich, in Vorbereitung auf das Zubettgehen bereits zuvor entleert hatte, brachte sie nur ein paar Tropfen heraus, doch das genügte, um ihr einen Schauder bei der gewaltigen Erregung ob dieser Blasphemie zu verschaffen. Sie goss den Urin aus dem Fenster, das nur angelehnt war, und der Kitzel bei dem Ganzen war so groß, dass sie es schaffte, noch ein zweites Mal zu kommen und anschließend noch ein drittes Mal.
Schwester Ursula rief sie. Blass und erschöpft, trat Dymphna ins Licht. Ihre Kleidung war wieder tadellos geordnet.
»Armes Kind«, sagte Schwester Ursula und legte ihr den knochigen Arm um die Schultern. »Ich habe dein Stöhnen gehört. Lass es dir ein Trost sein: Deine Mutter wurde abberufen, um sich der himmlischen Heerschar zuzugesellen.«
Dymphna antwortete nicht. Doch sie hatte große Mühe, nicht zu kichern, als sie einschlief.
Hier ist das Programm TV-Plus. Es folgen die Nachrichten.
Berichte über die starken Niederschläge an hochbelastetem sauren Regen in großen Teilen Nordwesteuropas während des Nachmittags haben auf dem Börsenmarkt zu erheblichen Kursanstiegen geführt, besonders im Hinblick auf Woll-, Baumwoll- und Leinenprodukte. Die Anteile an Herstellerfirmen von Synthetikfasern verzeichnen ebenfalls Zugewinne. Im Bereich der Forst- und Landwirtschaft hingegen fielen die Aktien um einige Punkte.
General Throwers Haltung wurde von einer Anzahl von Mitgliedern der parlamentarischen Opposition scharf verurteilt; einer der Politiker warf ihm vor, er versuche, den Geist der Schwarzhemden der dreißiger Jahre wieder heraufzubeschwören …
Nachdem sich Peter einen Döner Kebab gekauft und ihn verzehrt und schließlich mit einer Dose Lagerbier nachgespült hatte, war es zehn Uhr, doch er fühlte sich eher ruhelos als müde. Er erwog, eine Bekannte anzurufen, die ganz in der Nähe wohnte, und sie zu fragen, ob er noch auf einen Bums vorbeikommen könnte, gelangte aber zu dem Schluss, dass ihn der Tag bereits zuviel Kraft gekostet hatte. Und außerdem sie hatte ihm zwar mal ihr AIDS-Zertifikat gezeigt, doch er war nicht sicher, ob er der Sache trauen konnte. Gerüchten zufolge hatten sich einige der Impfaktionen des vergangenen Jahres als Fehlschläge erwiesen.
Es war noch Fernsehzeit, also beschloss er, Senderoulett zu spielen. Schon beim ersten Druck auf einen Knopf seiner Fernbedienung fiel ihm jedoch ein, dass er weder seinen Anrufbeantworter abgehört noch seine Bildschirmpost angefordert hatte, obwohl er das bereits von unterwegs aus nach Verlassen der Konferenz beziehungsweise gleich, nachdem er zu Hause angekommen war, hätte tun sollen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!