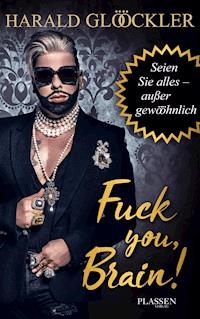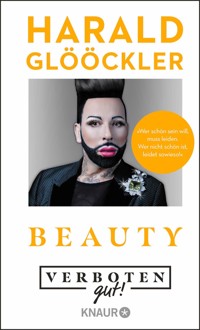Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gerth Medien
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Er gehört zu den schillerndsten Persönlichkeiten Deutschlands: Kaum ein anderer ist so bekannt für Glamour und spektakuläre Auftritte wie der "Prince of POMPÖÖS" Harald Glööckler. Doch er hat auch eine unbekanntere Seite: Wie so viele glaubte Harald Glööckler als Kind an Gott - doch ein unsensibler Pfarrer schreckte ihn ebenso davon ab, diesen Gott in der Kirche zu suchen, wie so mancher Kirchgänger, der Wasser predigte und Wein trank. Und so suchte er sich seinen ganz eigenen Weg zum Glauben. Dennoch ist er überzeugt: Die Kirche hat die beste Botschaft der Welt und könnte unzähligen Menschen Halt und Hoffnung bieten - sie müsste sich nur endlich besser verkaufen. Und wenn jemand weiß, wie das geht, dann Harald Glööckler! Lassen Sie sich von seinen ebenso herausfordernden wie überzeugenden Ansätzen überraschen. Die Kirche hat die beste Botschaft der Welt - sie müsste sie nur endlich besser verkaufen! Wir brauchen eine Kirche, die uns auffängt, wenn wir stürzen, die uns hält, wenn wir stolpern, die uns wärmt, wenn wir an der Kälte der Welt frieren, die uns zu essen gibt, wenn wir hungern, und die uns umarmt, wenn wir versagt haben. Harald Glööckler
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Dank und Widmung
Einleitung
Kapitel 1:Nein zur Kirche, ja zu Gott!
Kapitel 2:Träume und Sehnsüchte
Kapitel 3:Homosexualität und Kirche
Kapitel 4:Sexualität und Zölibat
Kapitel 5:Gott steht über der Moral
Kapitel 6:Der Himmel ist in uns
Kapitel 7:Kirche und Dekadenz
Kapitel 8:Ist Gott eine Frau?
Kapitel 9:Ist die Kirche im Schlussverkauf?
Kapitel 10:Alle Wege führen nach Rom
Kapitel 11:Über Judas zu Jesus
Kapitel 12:Toleranz der Religionen
Kapitel 13:Die Bibel – das Kochbuch des Lebens
Kapitel 14:Ich suchte Gott … und fand mich
Kapitel 15:Verändere dich und dann die Welt!
Kapitel 16:Der Reichtum Gottes – oder: Würde Jesus rote Schuhe von Prada tragen?
Kapitel 17:Die Seele!
Kapitel 18:Mein Traum vom Paradies
Quellenangaben
Dank und Widmung
ch widme dieses Buch all den wunderbaren Menschen, die in diesem großartigen Experiment Leben auf der Suche sind nach mehr. Nach einem Sinn, nach dem Wohin und Woher. Die sich die großen Fragen stellen:
„Wer bin ich, wer könnte ich sein, oder wer sollte ich sein? Bin ich wertvoll oder nutzlos, und wer entscheidet das? Gibt es einen Gott, und wenn ja, wie sieht er aus, wo ist er, wo lebt er? Existiert die Hölle, existiert das Paradies? Kann man als Jungfrau vom Heiligen Geist ein Kind bekommen? Ist die Kirche unfehlbar, ist die Kirche notwendig, ist die Kirche unnötig? Hat Jesus wirklich gelebt oder ist das ein Märchen. Ist er tatsächlich gestorben und auferstanden? Wenn Jesus am Kreuz gestorben sein sollte, sind damit unsere Sünden vergeben? Und ist das eine Blankovollmacht, ein Freibrief zum Sündigen? Wie kann Gott zulassen, dass ein Mensch stirbt, damit die Sünden der anderen vergeben werden? Was ist das für ein Gott, und wieso kann er uns unsere Sünden nicht einfach so vergeben, wenn er doch so gütig ist? Oder ist es am Ende ein rachsüchtiger Gott, der uns erschaffen hat? Wieso hat er uns sündig erschaffen, wenn die Sünde dann vergeben werden muss? Sind Priester bessere Menschen, oder verkaufen sie sich einfach nur besser?“
Fragen über Fragen, denen ich in diesem Buch nachgehen möchte.
Ich wurde so erzogen, dass man bestimmte Dinge überhaupt nicht infrage stellen soll. Wieso aber soll man, wenn man an einer Sache interessiert ist, nicht nachhaken, nachfragen und Dinge auch mal anzweifeln dürfen?!
„Man stellt Gott und die Kirche nicht infrage, Kind, versündige dich nicht!“, hörte ich die Erwachsenen abwiegeln, wann immer ich etwas genauer wissen wollte. „Das ist eben so, darüber diskutiert man nicht!“, das war die Standardantwort.
Wie überrascht war ich da eines Tages, als im Fernsehen eine imposante Dame in einem mintgrünen Lederkostüm auftrat und sich lauthals über die katholische Kirche und ihre Machenschaften echauffierte! Auf meine Nachfrage, wer denn die Dame sei, erfuhr ich, dass sie die Tochter des Bundespräsidenten Heinemann war, Frau Professor Uta Ranke-Heinemann. Die Dame imponierte mir, wenngleich mich ihre mitunter doch sehr aufgebrachte Art erstaunte. Auf jeden Fall war ich sehr dankbar, auf einen Erwachsenen zu treffen, und sei es auch nur im Fernsehen, der es wagte, kritisch über Gott und die Kirche zu sprechen und die Fragen zu stellen, die ich auch mit mir trug.
Frau Ranke-Heinemann hat mich inspiriert, weiterzufragen und mutig nach Antworten zu suchen. Dass ich jedoch eines Tages ein Buch schreiben würde über die Kirche und über Gott, das hätte ich nicht zu träumen gewagt.
Ich möchte in und mit diesem Buch allen Menschen danken, die mir Glauben vermittelt und Gott nahegebracht haben. Des Weiteren danke ich all den großartigen Menschen, die ehrenamtlich ohne Zögern ihren Dienst an und in der Kirche versehen und ohne die Kirche nicht möglich wäre. Ich habe allergrößten Respekt vor diesen Menschen und vor jedem, der sein Leben Gott und dem Glauben gewidmet hat. Dieser Dank gilt konfessionsübergreifend.
Ich danke den kirchlichen Institutionen für alles Gute, das sie der Menschheit getan haben. Ich spreche jedoch auch das Problematische an, die Gräuel und das Entsetzliche, das die Kirchen über die Jahrhunderte verursacht haben. Ich schreibe dieses Buch nicht aus Groll. Es ist auch keine Abrechnung mit der Kirche, ganz im Gegenteil.
Es ist vielmehr der Versuch einer Annäherung, der Vorschlag meinerseits eines neuen gemeinsamen Weges, eine Anregung für eine Begegnung der Kirche mit glaubenswilligen Menschen auf Augenhöhe. Offen für ihre Fragen und offen in ihren Antworten. Wäre ich nicht zutiefst überzeugt davon, dass es sich lohnt, aufeinander zuzugehen, hätte ich dieses Buch nicht geschrieben.
Ich freue mich, wenn Sie mich ein Stück des Weges begleiten.
Ihr
Harald Glööckler
Einleitung
eine sehr geehrten Damen und Herren,
ich habe in meinem Leben nie etwas als selbstverständlich angesehen. Die Vorstellung, dass mir Dinge automatisch zufallen müssten und das Leben mir etwas schuldig sei, war mir stets fremd. Ganz im Gegenteil, ich betrachtete das Leben von jeher als ein großartiges Geschenk. Das wahrscheinlich großartigste Geschenk, das uns jemals gemacht wurde und jemals gemacht wird.
Schon seit frühester Kindheit übte ich mich im Beobachten. Einerseits, weil ich das Beobachten schon immer als eine sehr interessante Angelegenheit empfand, zum anderen, weil ich ein sehr scharfsinniges, aufmerksames, in sich gekehrtes Kind war. Dies war eher eine Vorsichtsmaßnahme und in meiner vom Terror des Vaters gezeichneten Kindheit quasi eine Notwendigkeit, um zu überleben. Ich musste ständig auf der Hut sein, in Deckung gehen, um nicht in die Schusslinie zu geraten. Mit Gleichaltrigen konnte ich nie viel anfangen und studierte schon in frühester Kindheit viel lieber die Erwachsenen, deren Allüren, Marotten und Angewohnheiten.
Das Beobachten an sich ist eine ungeheuer wichtige Maßnahme, der leider viel zu wenige Menschen frönen. Ich meine damit vor allem das „Sich-selbst-Beobachten“ und „-Kontrollieren“ – sowohl die eigenen Emotionen als auch die eigenen Handlungen. Die meisten Menschen sind fremdgesteuert und sich ihrer Reaktionshandlung und ihres Selbst nicht bewusst. Viele haben sich selbst nie wirklich beobachtet, geschweige denn eine Innenschau getätigt, und sehen sich so selbst fremd.
Wir leben in einer Dualität und haben immer zwei Möglichkeiten, die Dinge zu sehen. Wie man so schön sagt: „Das Glas ist halb leer oder halb voll“, das Leben ist beschissen oder wunderbar.
Ich bin von Dankbarkeit erfüllt, weil ich mir angewöhnt habe, in allem das Gute zu sehen. Denn warum soll ich das Schlechte sehen, wenn ich das Gute sehen kann? Auch das bedarf der Beobachtung und der Achtsamkeit. Ich bin immer wieder überwältigt davon, in welchem Reichtum wir leben, welche Fülle an Essen wir haben. Wir werden in Restaurants bedient, behandelt wie Könige, und dennoch gibt es immer wieder Menschen, die das nicht zu schätzen wissen, ständig meckern, sich beschweren, denen man rein gar nichts recht machen kann. Verstehen Sie mich nicht falsch, diese Menschen haben das Recht, so zu denken, aber was tun sie sich damit an? Der Nörgler schadet immer nur sich selbst, der Betrüger betrügt immer nur sich selbst. Leider realisieren unehrliche, unbedachte Menschen meist nicht, dass sie grundsätzlich niemandem außer sich selbst schaden. Sie denken, sie könnten ihre Mitmenschen täuschen, doch sie täuschen letztendlich nur sich selbst, denn sie sind schneller demaskiert, als sie denken.
In uns Menschen besteht ein gottgegebenes seelisches „Programm“, wir nennen es Gewissen, das sich nicht täuschen lässt. Damit sind wir zielsicher in der Lage, das Gute vom Schlechten, das Wertlose vom Wertvollen, das Wahre vom Falschen zu trennen. Leider haben viele Menschen völlig den Zugang zu ihrer göttlichen Natur verloren und hören nicht mehr auf diese innere Stimme.
Niemand von uns hat das Recht, über andere den Stab zu brechen und zu urteilen, keiner ist besser als der andere, keiner ist schlechter als der andere. Kein Wunder, dass Jesus so kategorisch sagt: „Richtet nicht!“1 Und doch tun wir es immer wieder, denn wir sind so erzogen: beurteilen, verurteilen, vergleichen und kritisieren.
Irgendwann haben wir damit begonnen, nicht mehr auf unsere innere Stimme und unsere göttliche Intuition zu hören, sondern unsere Außenwelt zum Gott gemacht. Dabei haben wir unsere eigentliche Bestimmung vergessen.
Seither suchen wir das Göttliche nicht mehr in uns, sondern außerhalb von uns, was zu Minderwertigkeitsgefühlen und übersteigertem Geltungsdrang unsererseits führt. Wir können nicht mehr glauben, dass Gott in uns ist, fühlen uns klein und alleingelassen. Wir haben unsere Vorstellungskraft verloren, dass alles möglich ist, und ein Gefühl des Mangels entwickelt. Dadurch entwickelte sich der zwanghafte Drang, alles und jeden zu kontrollieren und anderen Menschen zu misstrauen.
Mit unserem göttlichen Bewusstsein verloren wir auch unsere innere Ruhe und Gelassenheit. Dabei gibt es keinen Grund zu zweifeln oder sich zu sorgen. Gottes Schöpfung ist so großartig und vollkommen, es gibt nichts, was es nicht schon gibt. Wir müssen also gar nicht alles selbst erschaffen, sondern nur all das, was wir uns wünschen, in unser Leben ziehen und dankend annehmen. Ich weiß, das ist nicht einfach zu akzeptieren, aber das ist Glauben. Davon überzeugt zu sein, dass etwas eintritt, auch wenn es keine Beweise dafür gibt. Sonst wäre es kein Glauben, sondern Wissen. Manch einer hat den Glauben an Gott verloren und sagt: „Ich glaube an nichts!“ Das ist ein Irrtum, denn selbst an nichts zu glauben, ist ein Glauben.
In meiner exponierten Stellung komme ich sehr viel in der Welt herum und treffe die verschiedensten Menschen in unterschiedlichsten Lebenssituationen. Dabei fällt mir in Gesprächen immer wieder auf, dass gerade in unserer schnelllebigen und lauten Zeit viele Menschen wieder Fragen stellen und eine große Sehnsucht nach mehr haben – nach dem tieferen Sinn des Lebens, nach einer Hoffnung und einem Glauben an eine hoffentlich vorhandene höhere Macht, die sie bei Bedarf auffängt und stützt.
Doch die Kirche, die ja eigentlich genau dies vermitteln sollte, bietet immer weniger Menschen eine adäquate Anlaufstelle. Sie ist viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, viel zu alltagsfern, zu egozentrisch, zu verstaubt und – sagen wir es doch ehrlich – auch zu langweilig.
Gerade in unserer heutigen Zeit ist der Glaube an eine bessere Welt, an Gott so wichtig, und eine solche Institution könnte, wenn sie ihren wahren Verpflichtungen nachkommen würde, Halt und Orientierung geben. Doch die Kirche „verkauft“ sich so schlecht und ist so wenig einladend, dass Leute auf der Suche nach Halt anderswo hingehen.
Auch an mir selbst hat die Kirche versagt, und ich musste mir andere Wege zu meinem ganz persönlichen Glauben suchen. Doch nicht jeder ist so stark oder entschlossen, sich allein durchzuschlagen, sondern braucht eine Gemeinschaft, die ihn unterstützt. Hier hat die Kirche ihre wichtigste Aufgabe – und nutzt sie nicht einmal ansatzweise so, wie es nötig wäre. Kleingeistigkeit, Kritiksucht und das Denken „Das haben wir immer schon so gemacht“ stehen der wirklichen Annahme von Menschen im Wege. Und wenn man dann noch ein wenig aus dem Rahmen des „Normalen“ fällt, wird es ganz schwierig.
Als gläubiger und empathischer Mensch finde ich diese Entwicklung unsagbar traurig. Ich möchte daher mit diesem Buch eine Diskussion und zum Nachdenken darüber anregen, ob die Kirche überhaupt noch in unsere Zeit passt, ob sie überholt ist und wie sie heute sein müsste, um wieder attraktiv zu sein.
Braucht man eine Kirche zum Glauben? Nein, dazu braucht man sie nicht. Ich habe auch so einen direkten Kontakt zu Gott. Wir brauchen keinen Dolmetscher, vor allem keinen, der uns mit erhobenem Zeigefinger die ihm gerade genehme Version des Glaubens indoktriniert.
Wir brauchen keine Institution, die uns kleinmacht, die uns glauben macht, wir seien nichts ohne sie. Auch keine, welche uns einredet, alle Andersgläubigen seien Ungläubige, und im schlimmsten Fall noch zum Heiligen Krieg, zum Morden und Töten aufruft.
Wenn ein Mensch gefallen ist, sollten wir ihm als gute Christen aufhelfen, ihn aufrichten, und – so er es wünscht – ihm den rechten Weg zeigen, statt Häme und Spott über ihm zu entladen. Es ist unsere göttliche Aufgabe, anderen beizustehen. Und es ist die Aufgabe der Kirche, den Menschen seelsorgerlich in jeder Hinsicht mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, ohne zu beurteilen, zu verurteilen, sondern ihnen die Hand zu reichen mit Verständnis, Liebe und Hingabe.
Wir brauchen eine Kirche, die uns auffängt, wenn wir stürzen, die uns hält, wenn wir stolpern, die uns wärmt, wenn wir an der Kälte der Welt frieren, die uns zu essen gibt, wenn wir hungern, und die uns umarmt, wenn wir versagt haben.
Jesus und Gott lieben uns, wie wir sind, ohne Vorbehalte. Und eine solche Institution oder kirchliche Gemeinschaft wünsche ich mir. Eine Gemeinschaft der allumfassenden Akzeptanz und Liebe.
Kinder werden zur Taufe gebracht wie zur Schluckimpfung.
RUDOLF AUGSTEIN (1923–2002), DEUTSCHER PUBLIZIST
Kapitel 1: Nein zur Kirche, ja zu Gott!
ch bin in einem beschaulichen Ort in Baden-Württemberg mit damals etwa 1000 Einwohnern aufgewachsen. Sowohl mein Elternhaus als auch das Haus der Großeltern väterlicherseits lagen direkt neben der zauberhaften Kirche, also circa zehn Meter entfernt. Diese ehrwürdige Kirche stand mitten im Dorf, sie wurde vor rund 1000 Jahren erbaut, für Nonnen und Mönche, die ein Leben des Gebets, der Lesung und der Arbeit führen wollten. Die Kirche war schlicht; klein, aber fein. Es war keine der opulenten, reich geschmückten Barockkirchen, wie man sie im katholischen Bayern kennt. Sie war puristisch, aber schön.
Ich verbrachte fast jeden Sonntag dort. Es gab einen Kindergottesdienst, an welchem ich immer teilnahm, nicht zuletzt um unserem Haus zu entfliehen, denn mein Zuhause war leider nicht so idyllisch. Mein Vater hatte ein Alkoholproblem, war gewalttätig. Nicht mir, aber meiner Mutter gegenüber. Seine Gewalttätigkeit ging so weit, dass meine Mutter eines Tages nicht mehr aus dem Krankenhaus nach Hause kam.
Ich wurde im lutherischen Glauben erzogen. Allerdings hatte mich niemand danach gefragt, ob ich lutherisch, katholisch oder gar nicht getauft werden wollte. Da ich schon als Kind sehr freidenkerisch und selbstbewusst war, machte ich mir so meine Gedanken, ob die Zugehörigkeit zum evangelischen Glauben am Ende genauso ein Fehlgriff war wie die „Inkarnation“ in meine Familie, in welcher ich mich als Fremder unter Fremden fühlte. In diese Familie passte ich meiner Meinung nach genauso gut wie ein Lamm in ein Wolfsrudel. Also gar nicht.
Doch zurück zur Kirche meiner Kindheit, in der ich auch getauft wurde. Ich muss zugeben, dass mir die Notwendigkeit der Taufe ganz grundsätzlich nicht so recht einleuchtet. Sowohl unser Körper als auch unser Geist sind eine Sensation! Beides sind ausgefeilte Instrumente, die in Perfektion arbeiten und nur von einem allerhöchsten Geist ausgedacht sein können. Ich frage mich: Wieso sollte jemand wie Gott, der in der Lage ist, Unikate in derartiger Präzision zu kreieren, sich im Nachgang einer Institution wie der Kirche bedienen müssen, um sein Werk danach noch segnen zu lassen? Man sollte doch denken, dass ein solcher Schöpfer diesen Akt auch selbsttätig durchführen könnte. Deshalb erscheint es mir eher so, dass die Kirche clever auf den Zug aufgesprungen ist, um Menschen glauben zu machen, es sei eine Notwendigkeit, durch sie, da sie selbst göttlich und quasi der verlängerte Arm Gottes sei, dessen Werk zu vollenden, Handlungen wie die Taufe in seinem Namen durchzuführen.
Die Taufe selbst ist ein einschneidender Akt, welcher das ganze Leben prägt, der meiner Meinung nach nicht einfach so an einem Kind vollzogen werden dürfte, sondern erst an einem Erwachsenen. Eine derart tiefgreifende und einschneidende Handlung sollte von der Person selbst in vollem Bewusstsein abgesegnet worden sein. Da dies einem Kleinkind nicht möglich ist, halte ich die Kindertaufe zumindest für fraglich.
In der Tat wurden in der Anfangszeit und der Urkirche hauptsächlich Erwachsene getauft, da man die Meinung vertrat, dass eine bewusste Entscheidung für den christlichen Glauben vorliegen sollte. Mit der vermehrten Ausbreitung des Christentums im Römischen Reich kam es immer öfter vor, dass sich ganze Familien mit Kindern taufen ließen. So entstand im Laufe des vierten Jahrhunderts letztendlich die Säuglingstaufe, und deren Fortschreiten wurde besonders begünstigt durch die in meinen Augen völlig irrsinnige Lehre der Erbsünde und die Vorstellung, dass diese durch die Taufe weitestgehend getilgt werden könne.
Über die Jahrhunderte hat die Taufe eine vielseitige Entwicklung durchgemacht, welche sich bis heute in den unterschiedlichsten Ausführungen dieses Rituals abzeichnet. Den Ursprung hat die Taufe bereits im Judentum, wo es unterschiedliche Reinigungsrituale gab. Eine wirklich ganz neue Dimension bekam sie dann erst durch Johannes den Täufer.
Die sogenannte Johannes-Taufe hatte das Ziel eines Bekenntnisses der Sünden sowie der Umkehr zur Buße und geschah somit als ein Zeichen zur Vergebung der Sünden. Wenn man den Berichten Glauben schenken möchte, welche in den Evangelien nachzulesen sind, erhielt auch Jesus selbst die Taufe durch Johannes den Täufer:
Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt zu! Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er’s ihm zu.
Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. (Matthäus 3,13-17)
Auch ich wurde also als Kind ungefragt getauft, und zwar in ebendieser besagten Kirche. Das Taufbecken in unserer Kirche war links des Altars, der von riesigen Blumensträußen geschmückt wurde. Je nach Jahreszeit wechselten die Blumen, mal waren es Tulpen, mal Gladiolen.
Dass ich das Thema der Taufe hier so vehement anführe, hat seinen Grund. Mich stört es empfindlich, wenn Einzelpersonen oder Gruppen unüberlegte Handlungen begehen und ohne nachzudenken der Herde folgend etwas machen, nur weil man es eben tut.
Meine Eltern hatten mit dem Glauben an sich und der Kirche nicht viel am Hut. Ich will damit nicht sagen, dass sie ungläubig waren oder dass sie gegen die Kirche waren, aber sie waren auch nicht besonders engagiert. Die Taufe bedeutete ihnen nichts, ganz zu schweigen davon, dass sie in der Lage gewesen wären oder jemals den Versuch gemacht hätten, mir den Sinn der Taufe zu erklären. Ich denke, er war ihnen selbst nicht bewusst. Sie ließen mich eben taufen, weil man das nun mal so tut, ebenso wie man sich später konfirmieren lässt.
Ich hätte mir gewünscht, eine so schwerwiegende und tiefgreifende Sache selbst mitentscheiden zu können. Denn schließlich bin ich die Person, welche dieser Handlung später auch gerecht werden und damit leben muss. Der Akt der Taufe beinhaltet das Versprechen, ein religiöses Leben zu führen, zu welchem der Getaufte als Erwachsener unter Umständen überhaupt nicht bereit ist.
Des Weiteren obliegt nach christlichem Verständnis den Taufpaten und den Eltern die Pflicht, den Täufling später an den Glauben heranzuführen und zu unterrichten. Auch hierzu waren meine Eltern weder fähig noch willens.
Ich möchte nicht falsch verstanden werden: Ich bin der Meinung, dass die Taufe an sich eine großartige Sache ist, aber eben auch mit der entsprechenden Ernsthaftigkeit und Achtsamkeit begangen und gelebt werden sollte.
Den Weg in die Kirche habe ich danach trotz allem und nicht zuletzt über meine Eltern gefunden, wenngleich diese mich auch weniger aus religiösen Gesichtspunkten als aus praktischen Überlegungen in den Kindergottesdienst geschickt haben. Denn damit war ich in dieser Zeit beaufsichtigt und ihnen aus dem Weg.
Die Kirche war umgeben von einer hohen alten Mauer. Diese war bereits in die Jahre gekommen, der Zahn der Zeit nagte auch an ihr, aber sie war sehr romantisch, nicht zuletzt durch die daran emporwachsenden Buschrosen in seidigem zartem Rosa. Der Duft der Blüten war so stark, die Optik so eindrucksvoll, man konnte sie schon von Weitem riechen und sehen. Sie wucherten über die ganze Mauer und bedeckten sie wie ein farbenfrohes Abendkleid bis zum Boden. Es waren kleine, feine, zerbrechliche Wildrosen. Eine sehr alte Sorte, wie uns die Pfarrersfrau erklärte. Genau so stellte ich mir die Rosen von Dornröschen vor. Es waren Prinzessinnen-Rosen.
Als echter Landjunge, der inmitten der Natur aufgewachsen ist, kam ich mit Blumen schon frühzeitig in Kontakt. Meine Großmutter hatte einen wundervollen Garten voll von Bäumen und Rosen. Ich liebte die Rosen besonders, die lang- wie die kurzstieligen, die roten wie die weißen. Vereinzelt gab es sogar welche in Schwarz. Vor allem sie hatten einen außergewöhnlich schweren und verführerischen Duft.
Meine Großmutter und ich hatten eine ganz wunderbare Beziehung zueinander. Sie zeigte mir die schönen Dinge im Leben, lehrte mich aber auch, dass nichts selbstverständlich ist. Als ich sie eines Tages fragte, woher die Tautropfen kommen, antwortete sie, diese seien von den Elfen, die frühmorgens liebevoll die Rosen beträufelten.
„Und die großen Wassertropfen?“, fragte ich neugierig weiter.
„Das sind die Tränen, die die Elfen vergießen, weil die Menschen die Welt langsam, aber sicher zerstören“, antwortete sie einfühlsam.
„Aber zum Glück gibt es die Engel, die die Menschen beschützen“, sagte ich.
Die Rosen meiner Großmutter rochen damals so intensiv und betörend, wie es heute fast keine Rose mehr tut. Heutzutage setzt die Industrie lieber auf Transportfähigkeit als auf einen rosigen Duft. Ich frage mich oft, ob man das, was einem angeboten wird, noch als Blume bezeichnen kann.
„Ich möchte auch einen Rosenstrauch“, sagte ich ganz euphorisch zu meiner Großmutter.
„Den sollst du bekommen“, antwortete sie. „Aber zuerst musst du dir genau überlegen, was für eine Rose du dir wünschst. Überlege dir gut, wie sie aussehen soll, ob du eine Heckenrose, Stielrose oder Buschrose möchtest, und auch, welche Farbe sie haben soll.“
Neben den optischen Komponenten machte sie mir aber auch meine damit verbundene Verantwortung bewusst. „Nimm diese Rose als Beispiel für dein Leben. Wenn du dich gut um sie kümmerst, wird sie blühen und dein Herz erfreuen. Wenn du sie vernachlässigst, wird sie eingehen. Von nichts kommt nichts, alles besteht aus Ursache und Wirkung.“