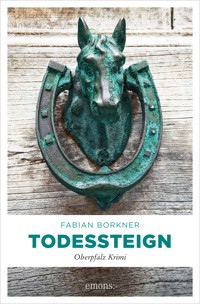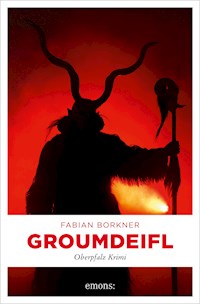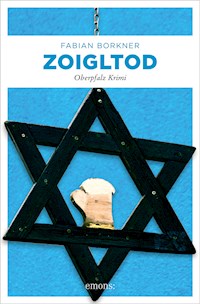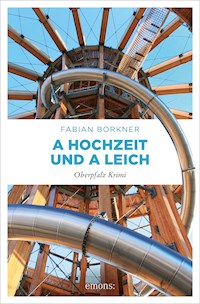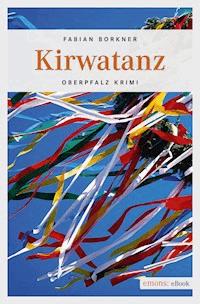
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Agathe Viersen und Gerhard Leitner
- Sprache: Deutsch
Ein Nordlicht ermittelt in Bayernskernigster Region. Als auf der bekanntesten Kirwa im Landkreis eine Leiche im Gülletank gefunden wird, muss Versicherungsdetektivin Agathe Viersen tief in die kriminelle Vergangenheit der Oberpfälzer Kleinstadt eintauchen. Der Zufall führt sie mit dem Musikanten Gerhard Leitner zusammen – und geradewegs in ein dunkles Geflecht aus Erpressung, Drogen und Intrigen ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 445
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fabian Borkner, 1976 in Rosenheim geboren, schlug nach dem Abitur eine Laufbahn als Unterhaltungskünstler ein und tritt bis heute als Sänger mit seiner Gitarre auf. Er schrieb und produzierte mehrere Comedy-Shows für den Rundfunk und arbeitet als freier Redakteur. Er ist Preisträger des BLM-Hörfunkpreises für die beste Comedy und Unterhaltung.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2017 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: mauritius images/Alfred Albinger
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, Tobias Doetsch
Lektorat: Susanne Bartel
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-263-2
Oberpfalz Krimi
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Verlagsagentur Lianne Kolf, München.
Für Tina,die daran glaubte, als ich es nicht tat
Montag
»Oberpfalz?« Agathe Viersen runzelte skeptisch die Stirn. »Nördliches Rheinland, oder was?«, fragte sie patzig.
Agathes Chef lächelte amüsiert, erhob sich aus seinem knautschigen Ledersessel und ging ans Fenster. Er kippte es und ließ die milde Oktoberluft sowie den Münchener Stadtlärm in sein Büro. »Die Oberpfalz liegt nicht im Rheinland, Agathe«, sagte er mit nicht allzu viel Strenge in der Stimme. »Selbst Sie als Nordlicht sollten inzwischen wissen, dass die so bezeichnete Gegend einer der sieben Regierungsbezirke von Bayern ist. Sie sind doch jetzt schon im vierten Jahr bei uns.«
»Aber bayerische Geografie habe ich nicht studiert. Ich bin ja schon froh, dass ich den Unterschied zwischen Pasing und Neuperlach kenne.«
Der Chef unterdrückte ein weiteres Lächeln. Als er in der Diensteinteilung Agathe Viersen für den Auftrag eingeplant hatte, hatte er mit einer schnippischen Antwort von ihr gerechnet.
Zum wiederholten Male blätterte Agathe durch die Unterlagen, die sie eben von ihrem Chef erhalten hatte. Einer der sieben Regierungsbezirke also. Und wieder ein Detail mehr über Bayern, das ihr noch unbekannt gewesen war. Wann immer Agathe seit ihrem Umzug nach Bayern das Gefühl hatte, sich nun ausreichend auszukennen, kam wieder ein bayerisches Schmankerl daher, das sie aussehen ließ wie die dumme Parade-Preußin bei irgendeiner billigen Komödie im Bauerntheater. Wie damals, als sie sich mit ihrer ersten Schweinshaxn abgemüht hatte und die krosse Kruste zuerst gar nicht, dann aber in einem Ruck vom Fleisch hatte lösen können, was dafür sorgte, dass sie sich von oben bis unten mit Soße bekleckerte. Der ältere Herr, der mit am Tisch saß, lachte noch nicht einmal über dieses Missgeschick. Aber als Agathe dann auch noch den Kartoffelknödel säuberlich mit Messer und Gabel zerschnitt, erging sich der Münchener in endlosen Erklärungen darüber, dass ein bayerischer Kloß gerissen und nicht geschnitten gehöre, weil nur so über die Kapillarkräfte ausreichend Soße ins Kloßinnere gelangen könne. Da der Mann nicht zu beruhigen war, hatte Agathe schließlich bezahlt, ohne aufzuessen.
Sie konzentrierte sich wieder auf ihren Beruf. »Wirkendorf, Oberpfalz …«
»Das liegt im Landkreis Schwandorf«, sagte der Chef. »Ist zugegebenermaßen ein bisschen abgelegen.«
»Und wie komme ich dahin? Gibt es dort Autobahnen?«
Ihr Chef grinste mitleidig. »Bei Weitem nicht überall. Ich sagte ja bereits, dass Wirkendorf ein wenig ab vom Schuss liegt. Sie werden sich auf Fahrzeit einstellen müssen.«
Agathe schob lustlos die Unterlippe nach vorn.
Als ihr Chef das bemerkte, meinte er kumpelhaft: »Vor einiger Zeit musste ich mal meinen Schwager da oben besuchen, knapp hundert Kilometer nördlich von Regensburg.«
»Und? Wie war es da so?«, fragte Agathe hoffnungsvoll.
Der Chef suchte nach Worten. »Dort gibt es sehr viel … nun ja, Landschaft.«
Agathes Schultern sanken nach unten.
»Ich will Ihnen nichts vormachen, Agathe. In der Oberpfalz ist tatsächlich nichts los. Rein gar nichts. Da würde ich nicht mal tot über dem Zaun hängen wollen. Trotzdem kann ich nun mal nichts daran ändern, dass sich ausgerechnet dort Arbeit für unsere Gesellschaft ergeben hat.«
Sie ließ ihren Blick genervt über die Unterlagen wandern. »Schon dieser Name … Servatius Hirneis …«
»Klingt wie beim Komödienstadel, ich weiß. Ich könnte mir vorstellen, dass sich dort droben einige Klischees, die Sie über Bayern gehört haben, bestätigen.«
Agathe kniff die Augen zusammen, merkte sich die Adresse in Wirkendorf, um sie später in ihr Navigationsgerät einzutippen, und klappte dann entschlossen den Aktendeckel zu. »Das heißt im Klartext, ich werde nach Gülle stinkenden Landburschen und Bauersfrauen mit Kopftüchern und schmutzigen Händen begegnen und sollte besser keine Armanis, sondern Gummistiefel anziehen?«
Der Chef zog entschuldigend die Schultern hoch und gab einen gespielt hilflosen Seufzer von sich. »Darauf wird’s wohl hinauslaufen …«
Agathe nickte kurz und wandte sich zur Tür.
»Ich weiß, es ist nicht das, was Sie in der Vergangenheit für unsere Gesellschaft getan haben …«
Agathe blieb stehen und drehte sich zu ihrem Vorgesetzten.
»… aber es geht um knapp einhunderttausend Euro. Wenn am Fall Hirneis wirklich etwas faul ist, dann müssen wir das rausfinden. Und das kann bei uns niemand so gut wie Sie.«
Ohne dass sie es wollte, fühlte sich Agathe geschmeichelt. Ihre verkrampften Gesichtsmuskeln entspannten sich, als ihr Chef jovial mit der Hand durch die Luft fuchtelte und weiterredete.
»Ich glaube nicht, dass der Fall besonders arbeitsintensiv wird. Sie werden im Handumdrehen herausfinden, wo der Hase im Pfeffer liegt, und dadurch unserem Haus die Zahlung von einhunderttausend Euro sparen. Und ganz nebenbei können Sie ein paar Tage das ruhige und beschauliche Leben in der Provinz genießen.«
Agathe wusste, dass das unterschwellige Kompliment ernst gemeint war, und hätte es durchaus genießen können, hätte sich der letzte Satz ihres Chefs nicht so furchtbar angehört.
Kurz darauf verließ sie das Hochhaus der Jacortia-Versicherung, seit über drei Jahren ihr Arbeitgeber. In der Tiefgarage des Gebäudes nebenan warf sie die Unterlagen auf den Rücksitz ihres weißen BMW X5 neben ihren kleinen mattsilbernen Hartschalenkoffer. Sie hatte ihn gestern Nacht gepackt, weil ihr Chef ihr die Dienstreise am Freitag noch nach Feierabend telefonisch für heute angekündigt hatte. Agathe war sehr praktisch veranlagt und stellte die Kleidung für Dienstreisen immer nach dem Kriterium der Funktionalität zusammen. Große Schrankkoffer voller modischer Outfits und unnützer Accessoires waren ihr verhasst.
Sie tippte die Zieladresse in das Display des Navis und wartete gespannt, was das Gerät ihr verkünden würde. Genau einhundertfünfundsiebzig Kilometer. Agathe schnaufte tief durch und trat ihre Fahrt an.
Zu ihrem Glück führten insgesamt sogar drei Autobahnen in Richtung Oberpfalz. So stellte die verhältnismäßig kurze Strecke durch die Münchner Innenstadt den beschwerlichsten Teil ihrer Reise dar, bevor sie an diesem Montagmorgen gut zwei Stunden später auf dem Wirkendorfer Dorfplatz den Motor ihres Wagens wieder abstellte. Als sie den BMW verließ, warf sie einen missmutigen Blick nach oben. War das Wetter bei ihrem Aufbruch in München wegen des Alpenföhns noch recht mild gewesen, so tünchten die Wolken im Herzen der Oberpfalz den Himmel in kaltes Grau, und der Nieselregen gehörte zu der widerwärtigen Sorte, die ihren Weg durch sämtliche Kleidungsstücke fand. Agathe fröstelte.
Konzentriert ließ sie ihren Blick umherschweifen, bis er am Dorfwirtshaus hängen blieb. Es wirkte zwar alteingesessen, aber nicht runtergekommen. »Brauereiwirtschaft«, las sie auf dem Schild über der weit offen stehenden Eingangstür, durch die laute Blasmusik auf die Straße drang. Direkt davor hatte man einen mit Kränzen und Fahnen geschmückten Baum aufgestellt. Er musste mindestens dreißig Meter hoch sein, schätzte Agathe. Auf einer kleinen Wiese neben der Wirtschaft drehte sich ein Kinderkarussell. Seine bunten Lichter sowie die an dem Luftgewehrschießstand und der Süßigkeitenbude bemühten sich vergeblich darum, der wetterbedingten Trübheit ein wenig Farbe entgegenzusetzen.
Agathe streifte sich ein grau gemustertes Cape über ihre weiße Bluse und ging in Richtung der Wirtschaft. Verschiedenfarbige Papierfähnchen und -servietten am Boden vermengten sich mit dem Regen zu einem klebrigen Brei, durch den sie sich in schmatzenden Schritten ihren Weg bahnte. Agathe trug zwar keine Armani-Schuhe, hatte aber trotzdem auf Gummistiefel verzichtet. Zu ihren robusten, doch eleganten Blue Jeans hatte sie solide Halbschuhe gewählt.
Während der Autofahrt hatte sie genügend Zeit gehabt, im Geiste das Gespräch mit ihrem Boss nochmals durchzugehen. Die Bilder, die sie sich von der Gegend hier gemacht hatte, hatten an Grobschlächtigkeit und Tristesse nur noch mehr zugenommen. Dass hier an einem Montagmittag offenbar gefeiert wurde, hatte sie nicht erwartet. Sie fasste sich ein Herz und sprang die ersten Treppenstufen zur Brauereiwirtschaft hinauf.
»Da sollten S’ besser nicht raufgehen, Fräulein!«
Agathe blickte über ihre Schulter und sah drei Frauen, die mit dampfenden Tassen am Stehtisch unter dem aufgeklappten Dach einer Holzbude standen. Hinter deren Theke qualmte etwas auf einem unbemannten Gasgrill. Ein Schild verriet, dass dort Bratwurstsemmeln zum Preis von zwei Euro fünfzig angeboten wurden.
»Warum denn nicht?«, fragte Agathe freundlich.
Die drei Frauen verzogen keine Miene, als eine antwortete: »Heut ist Kirwamontag.«
Agathe wartete auf weitere Erklärungen; aber vergeblich. In Wirkendorf genügte es anscheinend, wenn man nur den »Kirwamontag« erwähnte. Für Agathe war das freilich nicht genug. Sie setzte ein verbindliches Lächeln auf, sagte: »Irgendwo in der Ecke werde ich schon noch ein Plätzchen finden«, machte kehrt und ging die restlichen Stufen hinauf.
Als sie in der Tür verschwunden war, blickten die drei Frauen in ihre Tassen. Während sie auf das heiße Getränk pustete, meinte die erste: »Die muss aus der Stadt kommen.«
»Das könnt lustig werden«, sagte die zweite und biss beherzt in eine Schmalznudel, welche in der Oberpfalz »Käichl« hieß. »Am Kirwamontag hat sich schon lang keine Frau mehr in den Saal getraut. Und dann noch a Preißin. Was sagts ihr?«
»Ich geb ihr fünf Minuten.«
Die dritte Frau nahm einen Schluck aus ihrer Tasse, stellte sie auf dem Stehtisch ab und sah auf ihre Armbanduhr. »Gleich Mittag. Die sitzen schon drei Stunden oben.« Kopfschüttelnd ging sie in die Holzbude. »Dann dauert’s keine zwei Minuten. Ich richt amal ein Stamperl Schnaps her. Das wird sie gleich brauchen …«
Über eine steile Holztreppe stieg Agathe zum Saal der Brauereiwirtschaft hinauf. In dem engen Aufgang wuchsen die Geräusche aus dem Saal zu einem gigantischen Brummen an. Agathe öffnete die Schwingtür und hatte das Gefühl, gegen eine Wand zu prallen. Ein Schwall schweiß- und bierdurchtränkter Luft umfing sie, sodass ihr für einige Sekunden der Atem wegblieb. Sauerstoff schien hier drinnen nicht zu existieren. Obwohl das gestrenge Rauchverbot bereits seit anno 2008 in Kraft war, hingen trübe Schwaden in der Luft. Dazu drang Agathe der Geruch von saurem Zwiebelsud in die Nase.
»Oh weh, oh weh, Mäderl! Hast du dir das auch wirklich gut überlegt?«, donnerte eine tiefe Stimme von der Seite.
Agathes Trommelfelle waren kurz davor zu platzen, als sie den dazugehörigen Mann erblickte. Nein, keinen Mann – einen Hünen! Er war knapp zwei Meter groß und hundertfünfzig Kilo schwer. Einen solchen Riesen hatte Agathe noch nie gesehen. Als er auf sie zugewalzt kam, wich sie instinktiv zurück.
Er packte sie am Arm. »Jetzt komm nur rein, wenn du schon da bist!«, brüllte er, bevor er in sadistisches Gelächter ausbrach. Dann schob er sie mit seinen Händen, die Baggerschaufeln ähnelten, in die Mitte des Saals.
Erst jetzt wurde Agathe gewahr, dass sie ausschließlich von Männern umgeben war. Sie fühlte sich wie ein Entdecker im afrikanischen Busch, der von einem Stamm Eingeborener umzingelt ist.
Der Erste rief: »Leck mich doch am Arsch! Ein Weib!«, und wie auf Kommando drehten sich alle Köpfe im Saal zu Agathe. Schrille Pfiffe gellten durch die Luft. »Pfui!« – »Ja, was ist denn das?« – »Seit hundert Jahren hat sich da keine mehr hergetraut!«
Agathe sah sich hilfesuchend um. Die würden hier doch keine Menschenopfer mehr darbringen – oder?
Die Musikanten auf der Bühne hatten gerade Pause und beobachteten belustigt, wie ihr der Lynchprozess gemacht wurde.
Rückwärts suchte Agathe den Weg zum Ausgang, als hinter ihr eine Bedienung mit einem vollen Tablett leerer Gläser im Stechschritt vorbeiging und erbost rief: »Schau, dass du zur Seite gehst, du Trutscherl!«
Als Agathe ihre Flucht beschleunigte, stieß sie mit einem Mann zusammen.
»Jetzt mal schön langsam, Herzerl!«, bellte er. In seiner Hand hatte er eine Holzkiste, die er mit lautem Scheppern auf- und abschüttelte. »Kohle raus!«
»Ich … ich wusste nicht …«, stammelte Agathe.
»Das ist uns wurscht!«, erwiderte der Mann. »Jetzt bist du da, und das kostet was!«
»Jawohl!«, »Pfui!«, »Buh!« und das nicht enden wollende Pfeifkonzert machten jeden Versuch Agathes, einen klaren Gedanken zu fassen, zunichte.
Zur Pause hatte Gerhard Leitner sein Tenorhorn zur Seite gestellt und musste nun die bisher konsumierten dreieinhalb Liter leichten Weißbieres dem Kreislauf der Natur zurückgeben. Auf dem Münchner Oktoberfest nach einem Heimspiel FC Bayern gegen Dortmund, das, sagen wir, 3:1 ausgegangen war, hätten die Toiletten nicht überlaufener sein können als jetzt, mittags in der Wirkendorfer Brauereiwirtschaft. Auf dem Fußboden hatten sich bereits Rinnsale gebildet, die von den einzelnen Pissoirs in die Mitte des Raums liefen, um sich am Abfluss schließlich zu einer großen Lache zu vereinigen.
An einem der Pinkelterminals erblickte Leitner Franz Grabacek und musste grinsen. Grabacek hob gerade zu einer seiner Reden an, für die er in Wirkendorf bekannt war. Ein Gerücht besagte, dass, wenn man einen Abend lang neben Grabacek gesessen hatte, einem am Schluss ein Ohr und zwei Stunden fehlten, in denen man an anderen Gesprächen nicht mehr hatte teilnehmen können. Im Augenblick war sein Thema Jura.
»Das ist ein Kaufvertrag!«, schrie er seinen Nachbarn an. »Wenn du ein Bier bestellst, dann ist das Paragraf 433 fortfolgende!«
»Jaja, passt schon«, erwiderte der Nebenstehende und drückte die Spülung.
Leitner nutzte die Chance, einen freien Platz zu ergattern, und quetschte sich neben Grabacek.
Dem war generell egal, wer in den Genuss seiner Vorlesung kam, und so schrie er nun Leitner an: »Erfüllung Zug um Zug! Du bestellst, und die Johanna bringt es dir! Synallagma, so nennt man das!«
»Ach, so ist das also«, erwiderte Leitner mit gespieltem Interesse, denn er kannte Grabacek lange genug, um zu wissen, wie der reagieren würde.
»Gegenseitige Erfüllung! Im Gegensatz zu Darlehen und Leihe! Paragraf 488! Paragraf 598! Kannst du vergessen!«
Leitner drückte die Spülung. »Dann leih ich mir das Bier immer bloß, weil ich’s dem Wirt gleich wieder dalass?«
»Ihr habts ja alle keine Ahnung«, hörte Leitner den Grabacek noch schimpfen, als dieser die Toilette verließ, um vor der Eingangstür der Wirtschaft eine seiner HBs zu rauchen.
Leitner wusch sich die Hände und trat in den Korridor. Dort schrien sich zwei junge Männer um die zwanzig erbost an.
»Das geht dich einen Scheißdreck an! Wenn wir’s ausgemacht haben, gehe ich da auch hin, ganz einfach!«
»Super! Toll! Ist ja wurscht, wenn ihr am Samstag so viel sauft, dass ihr am Sonntag nicht mehr gerade auf dem Platz stehen könnt! Dann braucht ihr am besten überhaupt nicht mehr ins Training kommen! Dann schenken wir den Pokal einfach gleich den Jungs aus Gleiritsch und sperren zu!«
»Lass mir halt meine Ruhe!« Der Kleinere der beiden versetzte dem anderen einen gehörigen Rempler an die Schulter, sodass dieser gegen die Bilderrahmen an der Korridorwand knallte.
»Meine Herren!«, mischte sich Leitner mit ruhiger Stimme ein. »Bitte um etwas mehr Beherrschung!«
Seine natürliche Autorität – er war der Dirigent und Leiter der Kirwamusikanten – bewirkte, dass die beiden Männer ihre Meinungsverschiedenheiten sofort beilegten. Stattdessen sahen sie nun fast so aus, als würden sie sich vor Leitner schämen. Der trat an einen der Bilderrahmen und rückte ihn wieder gerade. »So geht man nicht mit den Sachen um. Das sind schließlich historische Dokumente.«
Die beiden Streithähne blickten unsicher zu den alten Zeitungsausschnitten, die der Wirt eingerahmt hatte.
»So, jetzt passt’s wieder«, sagte Leitner und war mit seinem Werk zufrieden. »Und ihr geht jetzt zurück in den Saal zu eurem Bier. Heute ist Kirwa und nicht Fußball. Nach dem Frühschoppen würdet ihr beide nicht mal gegen Dachelhofen ein Tor schießen, selbst wenn der Torwart mit der Syphilis zu Hause liegen tät.«
Die zwei Männer maulten freilich noch ein bisschen, trollten sich aber wieder in Richtung Saal. Auch Leitner machte sich auf den Weg zurück zur Bühne, als er Pfiffe und Buh-Rufe hörte. Kurz blieb er auf der Treppe stehen, weil ihm der Geräuschpegel selbst für den traditionellen Männerfrühschoppen am Kirwamontag zu hoch war. Normalerweise wurden an diesem Tag keine Pfiffe ausgestoßen. Das konnte eigentlich nur eines bedeuten …
»Da wird sich doch nicht etwa eine Frau …«, murmelte er, nahm zwei Stufen auf einmal und riss die Tür auf. Tatsächlich sah er eine Frau im Saal stehen, die – wie hätte es anders sein sollen – von den Männern belagert wurde. Der Kleidung nach stammte sie nicht aus dem Dorf, sondern aus der Stadt, und hatte sich in den Raubtierkäfig verirrt! Leitner wusste, dass nach drei Stunden Frühschoppen eine gewaltige Portion Übermut im Saal herrschte, gegen die sich das arme Hascherl wahrscheinlich nicht zur Wehr würde setzen können. Flink bahnte er sich seinen Weg zu der Verängstigten, packte sie am Arm und flüsterte ihr zu: »Ich lenk die ab, und dann schauen Sie, dass Sie von hier verschwinden, sonst sitzen Sie gleich ziemlich in der Scheiße.«
Sein entschlossener Tonfall gab Agathe wieder einen gewissen Rückhalt. »Okay, mach ich.«
Leitner sprang auf die Bühne, griff sein Tenorhorn, schnappte sich vom Schlagzeuger einen Stick und schlug damit dreimal fest auf eins der Becken.
Die Meute wurde tatsächlich ein wenig ruhiger.
»Jetzt hörts einmal alle her!«, rief Leitner.
Die Männer befolgten seine Anweisung.
»Das erste Mal seit Jahrhunderten haben wir heute wieder einmal Damenbesuch am Kirwamontag!«
Die Menge grunzte wieder ein »Pfui!«, jedoch ein nicht mehr ganz so lautes wie noch vor wenigen Minuten. »Bisher war die einzige Dame, die am Kirwamontag den Saal betreten durfte, die alte Gräfin!«
»Und wir!«, rief eine Bedienung zur Bühne hinauf.
»Damen, hab ich gesagt!«
Der ganze Saal lachte.
»Na warte, dein nächstes Bier kannst du dir selbst holen!«, drohte die Kellnerin in gespieltem Zorn und hob ihre Faust.
Leitner fuhr fort: »Wie gesagt, bis jetzt galt diese Ausnahme nur für die alte Frau Gräfin, aber heute haben wir sogar eine Frau Preißin unter uns! Und die werden wir nun mit lautem Gesang verabschieden. Zwei, drei, vier!« Leitner spielte die ersten Takte von »Muss i denn, muss i denn« an, woraufhin seine Band-Kollegen sofort mit einstimmten. Schließlich fing der ganze Saal an zu klatschen und grölte den Text mit.
Agathe nutzte die Chance und schlüpfte geschwind zur Schwingtür hinaus.
Sie rannte die Treppe hinunter und stolperte fast dabei. Auf der Straße schnaufte sie erst einmal tief durch. Ihr Pulsschlag glich immer noch dem eines Eichhörnchens beim Anblick eines Fuchses, als eine der drei Damen vom Grill sagte: »Kommen S’ her!«
Misstrauisch ging Agathe zu der Würschtlbude.
»Den können S’ jetzt bestimmt brauchen«, sagte eine Frau und reichte ihr ein Glas Schnaps.
Ohne nachzudenken griff Agathe nach dem Stamperl und kippte den Williamsgeist in einem Zug hinunter. Tatsächlich breitete sich sofort so etwas wie Ruhe in ihr aus. »Danke«, raunte sie.
»Respekt«, erwiderte die Frau. »Da gehört schon etwas dazu, sich in Wirkendorf am Kirwamontag als Frau ins Wirtshaus zu trauen.«
»Ich wusste ja nicht, dass das verboten ist«, gab Agathe trotzig zurück.
»Ja mei«, erwiderte die Frau, »ihr in der Stadt wissts halt eben doch nicht alles.«
»Und du kommst nicht mal aus Regensburg, oder?«, wollte die zweite der drei Frauen wissen. »München?«
Agathe nickte.
»Aber auch nicht gebürtig?«
»Lübeck.«
»Marzipan …«
Die entstandene Pause nutzte Agathe. »Und wie geht das jetzt weiter? Die bleiben da in ihrem Saal sitzen und löten sich weg, bis der Arzt kommt, oder wie?«
»Jetzt geh erst mal auf die Seite. Kennst du das Lied, was sie gerade spielen?«
Agathe konzentrierte sich auf die immer noch deutlich zu hörende Blasmusik, zu der jetzt der Wirkendorfer Kirwamontagsmännerchor erklang: »… ooond erhalte dir die Farben deines Himmels, weiß und blaaaooo!«
»Ein Traditionslied?«, riet Agathe.
»Die Bayernhymne. Jetzt ist Mittag. Gleich kommen die runter. Da solltest du am besten nicht im Weg stehen.«
»Und was passiert dann?«
»Dann tanzen sie um den Baum und ziehen anschließend durch das Dorf.«
»Und dabei dürfen dann auch Frauen mitmachen?«
»Beim Tanz noch nicht, da verkleiden sich unsere Männer als Frauen. Aber es ist in Ordnung, zuzuschauen und später mitzugehen.«
Agathe dachte an das Gespräch mit ihrem Chef am Morgen zurück. Nichts los da oben … ja, genau! »Und wohin gehen die dann?«
»Erst rauf ins Schloss, um die alte Gräfin hochleben zu lassen, und anschließend zu den anderen Wirtshäusern im Dorf. Eins nach dem anderen klappern die dann ab.«
Von der Eingangstür drang bereits der dumpfe Klang von einer sich nähernden Elefantenhorde zu den Frauen, so laut war das Stampfen der vielen Männer auf den Holzstufen.
»Was wollen Sie eigentlich hier in Wirkendorf?«, fragte die jüngste der drei.
»Ich … suche einen Bekannten.«
»Soso«, brummte die Älteste. »Wen denn?«
»Den … kennen Sie bestimmt nicht«, wich Agathe aus.
»Na ja, wichtig ist, dass du ihn kennst. Wer da oben im Saal war, erkennt am Mittag im Normalfall noch nicht mal seinen Nachbarn.«
»Was ist das eigentlich für eine Feier? Das macht ihr doch nicht jeden Montag.«
Die drei Frauen sahen Agathe stumm an.
»Oder …?«
Die ersten Männer stoben auf die Straße. »Mach einmal gleich zehn Bratwurschtsemmeln!«, brüllte der Frontmann.
»Mir auch!«, rief ein weiterer.
»Mei, Herzerl«, seufzte die älteste, schob Agathe beiseite und ging an den Grill, »das ist halt die Wirkendorfer Kirwa!«
Damit war Agathe zwar genauso schlau wie vorher, aber auf ihrem Gebiet war sie Profi. Sie wusste: Wo gefeiert wurde, da waren auch Informationen.
Agathe wartete zunächst an der Würschtlbude, bis sich die Meute der angeheiterten Männer aus dem Saal auf die Straße ergoss. Darunter waren doch tatsächlich einige, die in zerlumpte alte Frauenkleider gehüllt waren. Diese wurden von ihren »Kirwaburschen« zum Tanzpodium unterhalb des Kirwabaumes geführt, und die Blaskapelle gab das dazu passende Standkonzert. Als sich unter die Männerherde immer mehr Frauen mischten, die zusahen, wie sich die Männer zum Affen machten, wagte sich auch Agathe näher. Schließlich setzte sich die gesamte Menschenmenge unter den zackigen Klängen der Wirkendorfer Kirwamusikanten in Bewegung, um durch das Dorf zu ziehen.
Als die Gruppe etwas später im Innenhof des Wirkendorfer Schlosses angekommen war, bildete sich um die Freitreppe, die in zwei Bögen links und rechts von dem etwa vier Meter hoch gelegenen Eingangsportal nach unten schwang, ein großer Halbkreis. Im Zentrum erspähte Agathe eine betagte Frau im Rollstuhl. Sie war tadellos in einen grünen Lodenjanker gekleidet, unter ihrem perfekt sitzenden Filzhut zeigten sich Spitzen ergrauten, aber gepflegten Haares.
»Unsere alte Frau Gräfin, sie soll leben!«, brüllte ein Mann, der vor der alten Dame stand. Er hob seinen überdimensionalen Bierkrug und animierte das Publikum, welches prompt in ein dreifaches »Hoooch!« ausbrach.
Das war also die »alte Gräfin«. Agathes Blick fiel auf einen Mann Mitte vierzig, der neben dem Rollstuhl stand. Nachdem der Schreier der Dame den Krug überreicht hatte, half dieser ihr, einen kleinen Schluck aus dem riesigen Gefäß zu nehmen. Vermutlich ihr Sohn oder sonst ein Verwandter. Als die Gräfin abgesetzt hatte, sagte sie mit leiser, aber sehr klarer und deshalb verständlicher Stimme: »Meine Herren, ich danke Ihnen für Ihre alljährliche Aufwartung. Sie werden verzeihen, wenn ich den Krug heute nicht ganz austrinke.«
Die Menge brach in schallendes Gelächter aus, denn Agathes Schätzungen nach musste der Krug mindestens drei Liter fassen.
»Auch den obligatorischen Tanz muss ich heute leider ablehnen.«
»Ach, kommen Sie, Frau Gräfin! Auf den hatte ich mich schon so gefreut«, spielte der Mann mit dem Krug den Beleidigten.
»Bei der Entscheidung habe ich ausschließlich an Ihre Gesundheit gedacht«, erwiderte die Dame. »Nach diesem wunderbaren Frühschoppen könnten Sie mit meinem Tempo vermutlich nicht mehr mithalten.«
Wieder lachten die Zuschauer, und in Agathe stieg unmittelbar Bewunderung für die alte Frau auf. Obwohl sie im Rollstuhl saß, strahlte sie eine fast greifbare Würde aus, und ihr feiner Humor verfehlte seine Wirkung nicht.
»Dann muss ich eben mit unseren ›Frauen‹ tanzen«, meinte der Mann. Er gab der Musik ein Zeichen, und die Kapelle hob zu einem schnellen Walzer an.
Agathe suchte nach dem Musiker, der ihr vorhin geholfen hatte, den Saal unbeschadet zu verlassen. Er war nirgendwo zu sehen, an seiner statt hielt ein anderer Mann das Tenorhorn mit dem Trichter nach unten fest. Sie suchte den Blickkontakt zu ihm und zeigte fragend auf das Instrument.
Mit seiner freien Hand gestikulierte der Mann, dass der Besitzer des Instrumentes wohl beim Verrichten seiner Notdurft war. Er wies auf eine gemauerte Ecke, die das Schlossgebäude vom hinteren Teil des Hofes trennte.
Unauffällig stahl sich Agathe von der Menschenmenge in Richtung des Gebäudevorsprungs davon und warf einen dezenten Blick dahinter. Dem Schloss war eine Landwirtschaft angegliedert. An dieser Stelle wurde wohl die Jauche zum Düngen angesetzt. Aus einem großen Tank, der abgesehen von den vielen braunen Dreckspritzern stumpf aluminiumfarben schimmerte, kroch ein beißender Gestank nach Exkrementen und verrottenden Abfällen. Der Tank war etwa anderthalb Meter über dem Erdboden angebracht, und aus seinem ovalen Spundloch war bereits eine große Lache übel riechender Flüssigkeit getropft.
Ihr Retter hatte sich hinter dem Tank positioniert und drehte sich nichts ahnend um. Gerhard Leitner stopfte sein Hemd in die Unterhose, der Latz seiner Lederhose war noch nicht wieder hochgeklappt.
»Den würde ich aber wieder zumachen, bevor Sie zu den anderen gehen«, riet Agathe.
Leitner erschrak, begann aber kurz darauf mit seinem Einknöpfungsversuch. »Sie haben großes Talent, dort zu erscheinen, wo Sie nichts zu suchen haben.«
Seine Stimme klang rau, was an den Festivitäten der letzten Tage liegen konnte, hatte aber einen sonoren Klang. Es war eine Stimme, die Agathe guttat. »Ich bin nicht aus der Gegend …«
»Ach was. Im Ernst?«
Agathe ging auf die Ironie nicht ein und fuhr fort: »… aber ich müsste mich dringend mit jemandem unterhalten, der sich hier auskennt.«
Leitner hatte seinen Aufzug wieder in Ordnung gebracht und schüttelte den Kopf. »Jetzt schon gleich überhaupt nicht, Madame. Jetzt geht’s erst richtig los. Ich muss wieder vor, ohne mich ist die Kapelle nur halb so gut.«
Schnellen Schrittes wollte er in Richtung Schlosshof gehen, doch einer seiner Lederhosenträger verfing sich am Verschlusshebel des Gülletanks und zog unglücklicherweise in die falsche Richtung. Mit einem lauten metallischen Klacken öffnete sich die Luke und ließ einem gigantischen Schwall seines Inhalts freien Lauf. Leitner wurde von der Wucht, mit der seine eigene Geschwindigkeit gestoppt wurde, zu Boden gerissen und fiel mitten in die große Lache Gülle, die sich fortwährend aus dem Tank ergoss.
Agathe kämpfte gegen die plötzliche Übelkeit, die in ihr hochstieg, während sie beobachtete, wie sich Leitner vergeblich auf dem Boden wälzte und sich somit nur noch mehr mit der Flüssigkeit besudelte. Als plötzlich aus der Luke auch noch mehrere Konservendosen ins Freie fielen, suchte sich Agathe einen Weg durch den Güllebach zu dem armen Tenorhornspieler.
»Wer von uns beiden steckt jetzt in der Scheiße, hm?«, konnte sie sich einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen. Sie wollte ihm gerade ihre Hand reichen, um ihn auf seine zwei Füße zu ziehen, da hörte sie aus dem Tank ein Scheppern und kurz darauf einen dumpfen Knall. Ein hühnereigroßer Ball fiel heraus, hüpfte klatschend durch den Dreck und kam vor Agathes Füßen zu liegen. Sie sah genauer hin, und ihr Herz blieb beinahe stehen. Denn der Ball, so dreckig er auch war, blickte zurück. Er sah beinahe aus wie ein Auge.
»Oh Gott …«, flüsterte Agathe und spürte, wie die Drüsen in ihrem Mund anfingen, Speichel zu produzieren. Sie drehte ihren Kopf zu der Luke, von wo aus ihr eine halb verweste menschliche Fratze mit ausgefransten Lippen entgegenlächelte. Eine der Augenhöhlen war leer.
Schnell ließ Agathe die Hand ihres ehemaligen Retters los. Sie brauchte ihre eigenen beiden, um sich den Bauch zu halten, während sie ihr Frühstück auf den Hof spie.
Kurze Zeit später trat im Wirkendorfer Schloss eine Dame um die fünfzig im dezent grauen Kostüm aus der Gesindeküche und schob einen messingfarbenen Servierwagen vor sich her. Im Großen Salon lenkte sie ihn zu einem der ausladenden grünen Polstersessel, auf welchem Agathe Viersen Platz genommen hatte. Die Dame schenkte aus der Silberkanne auf dem Wagen eine Tasse Tee ein und reichte sie ihr.
»So, schauen S’ her, den trinken S’ jetzt in Ruhe, und dann wird Ihnen gleich besser!«
»Danke, Friedel«, sagte die alte Gräfin, die neben Agathe im Rollstuhl saß. »Ihr Kräutertee wird der jungen Dame bestimmt guttun.«
Friedel nickte kurz und verzog sich wieder in die Küche.
»Friedel sammelt eigenhändig sämtliche Kräuter im Schlosspark. Sie kennt deren Wirkung wie keine Zweite und weiß, wie man sie für verschiedene Zwecke kombinieren muss.«
Agathe blickte zu der alten Frau und trank den ersten Schluck Tee. Eigentlich mochte sie keinen Tee und war eher der Kaffeetyp, aber der warme Kräutersud schien ihre Magenwände tatsächlich zu beruhigen. Sie nutzte den wohligen Schauer, der sie durchfuhr, um sich ein wenig zu sammeln und sich im Salon umzusehen.
An jeder Wand hingen teilweise mehrere riesige Gemälde, allesamt Porträts. Die Männer waren mit strengem Blick in Uniform abgebildet, die Frauen in feinsten Kleidern. Über die Jahre hinweg hatte die feuchte Luft im Schloss die Holzrahmen aufquellen lassen, sodass die Bilder sich von den Wänden wölbten. Unter ihnen standen prächtige Möbel – ein Sekretär, zwei Kommoden, zwei Beistelltischchen, allesamt aus edlem dunklen Holz gefertigt. Im Kamin an der gegenüberliegenden Wand loderte ein wärmendes Feuer.
Ein rhythmisches Knarzen wurde immer lauter, und ein Mann in Jeans und rotem Pullover kam festen Schrittes herein. Hauptkommissar Deckert blickte kurz auf den Schreibblock in seiner Hand und rief dann durch eine weitere offen stehende Tür: »Ertl, ist die Spurensicherung fertig?«
»Die Leiche ist auf dem Weg nach Erlangen«, antwortete ein Polizeibeamter in Uniform, »und mit dem Boden sind sie auch schon fertig. Bloß der Dreck muss später noch weggemacht werden.«
»Haben sie alles mitgenommen?«
»Ja.«
»Auch die Konservenbüchsen?«
»Die auch. Aber den Inhalt kennen wir noch nicht, also, ob’s Sauerkraut oder Ravioli oder sonst was ist. Etiketten waren entweder keine dran oder sind schon verfault.«
»Na, im Labor werden Sie dann hoffentlich mehr rausfinden.«
Ertl trat einen Schritt vor. »Das Zeug drinnen müsste man sogar noch essen können. So Büchsen halten ja ewig, selbst wenn die wochenlang in der Scheiße gelegen haben. Auf Kabel 1 habe ich mal gesehen, wie sie …«
Mit lautem Scheppern stellte Agathe ihre Tasse auf die Untertasse, und der Beamte unterbrach seine Schilderung.
»Danke, Ertl! Sie können dann verschwinden!«, herrschte Deckert seinen Mitarbeiter an. Es war nicht zu übersehen, dass die beiden Damen im Raum nicht besonders erfreut über dessen Erkenntnisse in puncto Haltbarkeit von Lebensmitteln waren. Er ging zu ihnen hinüber. »Ist Ihnen noch etwas eingefallen, was Sie bei Ihrer Aussage vorhin vielleicht vergessen haben, Frau Viersen?«
Agathe schüttelte langsam den Kopf.
»Nein. Es war alles so, wie ich Ihnen gesagt habe.«
»Tja«, brummte der Hauptkommissar und überflog seine Notizen, »das hilft uns natürlich nicht viel weiter. Aber Ihre Aussage und die vom Herrn Leitner sind deckungsgleich, von daher … müsste das eigentlich fürs Erste alles sein.«
»Wo ist er eigentlich … der Herr Leitner?«, fragte Agathe.
»Er wird gleich kommen.«
Agathe sah zu dem hochgewachsenen Mann, der in diesem Moment den Salon betrat.
»Ich habe nur ein paar Minuten nach passender Kleidung für den Unglücklichen suchen müssen. Ich bitte um Verzeihung. In der Hektik sind wir noch gar nicht vorgestellt worden. Gestatten, Sebastian Graf zu Söllwitz.«
»Mein Sohn«, ergänzte die Dame im Rollstuhl.
Agathe reichte dem schlanken eleganten Mann die Hand, auf die der Graf einen perfekt angedeuteten Handkuss hauchte.
»Der Gerhard ist noch in der Dusche«, sagte er. »Er muss gleich fertig sein.«
Auch Hauptkommissar Deckert wandte sich nun Graf Sebastian zu Söllwitz zu. »Wie lange besteht die Landwirtschaft neben Ihrem Schloss schon?«
»Du liebe Zeit!« Der Graf richtete die Augen zur Decke und grübelte. »Eigentlich so lange wie unser Herrensitz. Früher hat unser Anwesen hier ja wesentlich mehr Menschen beherbergt. Und jeder musste von etwas leben.«
»Dieses Silo … eigentlich sieht es mehr nach einem Brauereitank aus.«
»Das ist richtig. Wir haben den Tank damals aus unserer Brauerei ausgemustert. Die Kleinbauern hier in der Gegend waren dankbar für eine zentrale Stelle, an der sie ihre Jauche loswerden konnten, und der Tank schien uns für diesen Zweck noch geeignet.«
»Uns?«
»Nun, meinem Vater und mir. Es ist ja schon einige Zeit her, dass wir die Brauerei modernisiert haben.«
Agathe entging das ermahnende Räuspern der Gräfin nicht.
Der Kommissar machte sich Notizen. »Das heißt, jeder kann herfahren, um seinen Mist in das Silo zu werfen?«
»Korrekt. In den Tank haben wir an der Oberseite einen Deckel hineingeschnitten. Das ist seit dreißig Jahren eine praktikable Lösung, noch dazu, da die Viehwirtschaft bei uns in der Region immer mehr abnimmt.«
»Sie verstehen sicher, warum mich das so interessiert. Es kommt ja nicht jeden Tag vor, dass jemand eine Leiche in ein riesiges Güllefass wirft. Theoretisch hätte also jeder …« Deckert machte eine hilflose Geste.
»… jeder, der unser Schloss und unsere Anlage kennt, die Leiche dort entsorgen können«, beendete Graf Sebastian den Satz. »Also praktisch jeder Bewohner von Wirkendorf.«
»Ich sehe schon, wir kommen hier nicht weiter«, brummte Deckert. »Wenn Sie«, sein Blick fiel auf Agathe, »morgen Nachmittag vielleicht auf die Polizeiinspektion Schwandorf kommen könnten? Dann wissen wir hoffentlich schon mehr.«
»Selbstverständlich.«
»Und bringen Sie den Herrn Leitner mit. Wenn er bis dahin mit dem Duschen fertig ist.« Damit verließ Hauptkommissar Deckert den Großen Salon und wenige Minuten später Schloss Wirkendorf.
»Es ist immer eine sehr unerfreuliche Angelegenheit, die Behörden im Hause zu haben«, seufzte die Gräfin.
In diesem Satz lag so viel Tiefe, dass Agathe aus den Augenwinkeln die alte Dame neugierig betrachtete. Über ihrem dunklen Rock trug sie nun eine graue Bluse, darüber eine violette Weste, und um ihren Hals hing eine mächtige Perlenkette. Agathe hatte keinen Zweifel daran, dass es echte Perlen waren. Das graue Haar der Gräfin, das ebenfalls leicht violett schimmerte, war schwungvoll fixiert. Ein Hauch von Lavendelduft waberte in der Luft. Die Gräfin musste gut über achtzig sein. Alt genug also, dass sie die Zeiten noch miterlebt hatte, in welchen man Uniformträger und Behörden in Deutschland und Europa mit Todesangst fürchten musste. In diesem Zusammenhang kam Agathe das Wort »unerfreulich« schon fast sarkastisch vor.
»Bekommt Ihnen der Tee?«, erkundigte sich die Gräfin, für die zu der Sache mit der Polizei im Hause anscheinend alles Notwendige gesagt war.
»Es geht schon wieder. Wirklich. Es war nur, weil …«
»Ich kann Sie verstehen, junge Frau. Eigentlich machen Sie auf mich keinen schwachen Eindruck, aber es kam einfach zu plötzlich, zu unerwartet.«
»Ja.«
»Das ist doch der blanke Wahnsinn!«, ließ sich Graf Söllwitz vernehmen. »Wer macht denn so etwas? Einen Menschen in …«, mit Rücksicht auf seine Mutter wog er das nächste Wort trotz seiner Empörung sorgfältig ab, »Exkrementen zu versenken!«
In diesem Moment kam Gerhard Leitner zur hinteren Tür herein. »Erinnere mich bitte daran, dass ich bei euch nie wieder zum Bieseln gehe … oh!« Er verstummte, da er die alte Gräfin jetzt erst bemerkt hatte.
»Dafür gibt es in unserem Haus eigentlich auch Toiletten, Herr Leitner«, sagte diese. »Insgesamt sogar elf.«
»Passen dir meine Sachen?«, fragte Graf Söllwitz.
»Einigermaßen. Du bist halt doch einen Kopf größer als ich.« Leitner betrachtete die Absätze der ebenfalls geliehenen Schuhe, mit denen er bei jedem Schritt auf die zu langen Hosenbeine trat.
Agathe musste bei seinem Anblick in der zu großen Garderobe ein Lächeln unterdrücken. In den Lederhosen hatte Leitner phantastisch ausgesehen, aber die waren auch auf seine eins fünfundsiebzig ausgelegt gewesen.
»Ich bring dir die Sachen dann gereinigt wieder zurück, zu Hause ziehe ich mich eh gleich um. Alles, was recht ist, und an der Kirwa hab ich schon vieles erlebt, aber so ein Tag wie heute war noch nie dabei. Der ist echt konkurrenzlos.«
»Das kannst du laut sagen.«
»Möchte man wirklich nicht glauben, wo dieses Zeug überall reinfließt.« Leitner popelte mit einem kleinen Handtuch in seinem linken Ohr herum.
Agathe betrachtete ihn eingehend. In sein rundliches Gesicht war wieder eine gesunde Hautfarbe zurückgekehrt, die der Schock vorher vertrieben hatte. Auch seine braunen Augen strahlten wieder lebendig. Als er den Bart an seinem Kinn, welcher aussah, als hätte er ihn seit einer knappen Woche wachsen lassen, trocken rieb, erkannte Agathe durch das zu große Hemd des Grafen an seinem linken Oberarm die Ansätze von Tattoos. In seinem eigenen Outfit hatte Gerhard Leitner gut gebaut gewirkt; mit deutlicher Taille, kräftigen Armen und breiten Schultern, sein Kopf von schwarzbraunem schulterlangen Haar umspielte. Bei seinem Anblick in des Grafen Kleidern musste Agathe jedoch unweigerlich an Charlie Chaplin denken.
»Möchten Sie auf diesen Schreck ebenfalls eine Tasse Kräutertee, Herr Leitner?«
»Nein danke, Frau Gräfin. Das Einzige, was mir jetzt wirklich helfen könnte, wären ein paar Halbe Hopfentee.«
Nach einigen weiteren Minuten hatten sich Leitner und Agathe von der Adelsfamilie verabschiedet und standen nun im Schlosshof.
»Und wo müssen Sie heute noch hin?«, fragte der Musiker.
»Ich habe ein Zimmer im Dorfhotel gebucht. Wie heißt es doch gleich noch? Ach ja, ›Zum Schimmel‹.«
»Gut. Dann … ja, einen schönen Tag noch.«
Als er sich zum Gehen wandte, sagte Agathe: »Wir sollen morgen Nachmittag gemeinsam auf die Polizeiwache kommen. Anweisung vom Herrn Kommissar.«
Leitner gab eine Art Grunzen von sich, was wohl bedeuten sollte, dass er den Sachverhalt verstanden hatte, jedoch nicht übermäßig begeistert davon war. »Dann so gegen halb drei bei der Inspektion?«
»Gut, das passt.«
»Ich weiß wirklich nicht, was die noch von uns wollen. Sie haben Deckert doch auch schon erzählt, was passiert ist, oder?«
Agathe bejahte.
»Und ich auch. Aber vielleicht geschieht über Nacht ja ein Wunder, und sie können uns morgen schon sagen, wer dafür verantwortlich ist.«
Leitner wollte sich schon in Richtung Brauereiwirtschaft entfernen, als Agathe verschwörerisch sagte: »Vielleicht können sie uns auch etwas zunächst viel Wichtigeres sagen.«
Leitner verharrte in seiner verdrehten Position. »Und das wäre?«
»Wessen Leiche wir da heute Mittag aus ihrer schrecklichen Grabstätte befreit haben.«
Dienstag
»Wie Sie sehen, kann man den Leichnam nicht mit blankem Auge identifizieren«, sagte Hauptkommissar Deckert. »Dafür ist der Verwesungsprozess schon zu weit fortgeschritten.«
Agathe blätterte mit kühler Effizienz die grausigen DIN-A4-großen Fotos durch. Der Leichnam war aus allen möglichen Blickwinkeln abgelichtet worden. Die Gerichtsmediziner hatten offensichtlich versucht, den Toten so weit wie möglich zu reinigen, dennoch bestanden das Gesicht wie auch der übrige Körper nur noch aus zerfressenen Fleischfetzen.
»Wir haben nicht nur den Schädel, sondern auch den Rest vom Schützenfest in dem Tank gefunden, aber das hilft uns momentan auch nicht weiter. Kein besonders hübscher Kerl, was?«
Agathe hielt Leitner die Fotos hin.
»Geh, tun Sie das weg«, winkte er angewidert ab. »Mir hat’s gestern schon gereicht.«
Agathe warf die Bilder auf den Schreibtisch. »Und wer war er nun, unser Toter?«
Hauptkommissar Deckert griff nach einer Akte und klappte deren Deckel auf. »Männlich, um die vierzig, leicht adipös, hat wahrscheinlich seit mehreren Wochen im Gülletank gelegen. Die schwankenden Außentemperaturen der letzten Zeit machen eine genauere Bestimmung des Todeszeitpunkts unmöglich.«
»Und die Todesursache?«, wollte Agathe wissen.
Deckert kratzte sich etwas unsicher am Kinn. »Eigentlich sind Sie hier, um mir einige Fragen zu beantworten, nicht umgekehrt.«
Wie auf Kommando lehnten sich Agathe und Leitner zurück und musterten den Bürokratie gewohnten Kriminalbeamten mit durchdringenden Blicken.
»Aber wenn man bedenkt, dass Sie die Leiche gefunden haben …«, lenkte Deckert ein. »Also, als Todesursache kommen Ersticken, Ertrinken und Vergiftung in Frage. Am Schädel sind keinerlei Traumata nachweisbar. Vermutete Spuren eines Kanals im Brustbereich, möglicherweise hervorgerufen durch eine Schuss- oder Stichverletzung, jedoch nicht sehr tief, wenn man das überhaupt noch beurteilen kann. Die Bakterien haben einfach schon zu viel Zeit mit unserem Kameraden verbracht.«
»Das heißt also, wir wissen nicht, wer der Tote ist?«, meldete sich Leitner zu Wort.
»Leider nicht.«
»Was ist mit Gentests, mit DNA und so?«
Hauptkommissar Deckert lehnte sich in seinem Dienstsessel zurück. »Das funktioniert nur, wenn der Tote zu Lebzeiten schon mal erkennungsdienstlich behandelt oder seine DNA sonst irgendwie digital gespeichert wurde. Bei einer Operation beispielsweise.«
»Und die Zähne?«, brummte Leitner. »Das Gebiss kann man doch auch irgendwie –«
»Dafür gilt das Gleiche: Wenn seine Gebissdaten oder -aufnahmen irgendwo gespeichert sind, haben wir eine Chance auf Identifizierung. Bei den örtlichen Zahnärzten wurden schon entsprechende Hilfsanfragen gestellt. Aber wenn der Tote natürlich nicht aus Wirkendorf stammt oder jemand ist, der nie zum Zahnarzt gegangen ist, dann …« Deckert hob hilflos die Hände.
»Wenn der da schon seit Wochen in der Jauche gelegen hat, besteht wahrscheinlich auch keine Hoffnung auf Spuren auf dem Boden rund um das Silo, oder?«, mischte Agathe sich ein.
Verwundert horchte Leitner auf. Die Fremde hörte sich fast selbst schon an wie eine Polizistin.
»Leider ist das so. In den vergangenen Wochen – und wir reden hier durchaus von der Zeit bis zum Spätsommer – haben dort zig Auto-, Traktor- und Hängerreifen ihre Spuren hinterlassen und jeweils die vom Vorgänger platt gewalzt. Wir haben also leider nicht viel. Außer unserem E.T.« Deckert zeigte auf die Fotos.
»Und die Konservenbüchsen?«, fragte Agathe. »Was war in den Konservenbüchsen?«
»Das ist in der Tat merkwürdig«, raunte Deckert und suchte auf seinem Schreibtisch den entsprechenden Bericht hervor. »Insgesamt haben wir sechs Stück sichergestellt. Je zwei mit Sauerkraut und Heringen in Tomatencreme und je eine mit roten Kidneybohnen und Thunfisch in Olivenöl. Daraus macht man keinen leckeren Eintopf, nicht wahr?« Er sah auf und erkannte, dass sein Scherz weniger Vergnügen als vielmehr Abscheu in seinen beiden Zuhörern hervorgerufen hatte. Er räusperte sich dezent. »Aber gut, wir tun unser Möglichstes. Jetzt brauchen wir nur noch Ihre Personalien. Ihre, Frau Viersen, haben wir ja gestern schon notiert. Und bei Ihnen, Herr Leitner … Das Geburtsdatum haben wir bereits … 12. August 1980 … Geburtsort?«
»Weiden.«
Der Kommissar schrieb es nieder. »Und Beruf?«
»Selbstständig. Ich habe einen PA-Verleih.«
»PA?«
»Personal Announcement. Ich verleihe Lautsprecherboxen, Mischpulte, Mikrofone, Lichttraversen, Scheinwerfer und so Zeug. Für Konzerte.«
Deckert winkte ab. »Selbstständig. Gut. Von unserer Seite wäre es das dann erst mal. Ihre Kontaktdaten haben wir. Wenn sich noch etwas ergibt, werden wir uns bei Ihnen melden.«
»Den Satz habe ich schon zur Genüge gehört«, sagte Leitner zu Agathe, als sie vor der Polizeistation standen.
»Welchen Satz?«
»Na, dieses: ›Wenn sich was ergibt, melden wir uns bei Ihnen! Sie hören von uns!‹ Das kenne ich aus meinem Geschäft, wenn ich Angebote an Festivals und Organisatoren schicke.«
»Wie heißt denn Ihr Geschäft?«
»›Leit(ner)‹«, er malte Anführungszeichen beim letzten Wortteil in die Luft, »›and Sound‹.«
»Originell.« Agathe verlagerte ihr Gewicht auf das andere Bein. »Herr Leitner, ich will offen mit Ihnen sein. Ich habe der Polizei nicht die ganze Wahrheit gesagt.«
»Wobei?«
»Als mich der Kommissar gefragt hat, warum ich nach Wirkendorf gekommen bin, habe ich geantwortet, dass ich einmal bei der berühmten Kirwa dabei sein wollte.«
»Und das waren Sie doch auch. Wir können schließlich nichts dafür, dass der Kirwamontag so rasch ein Ende gefunden hat.«
»Das habe ich auch nicht gemeint …« Sie verstummte, weil sie sah, wie Leitners Miene gefror. Seine Augen schienen über ihre Schultern hinweg jemanden zu fixieren. Agathe drehte sich um und sah einen Mann Mitte fünfzig mit einem kleinen Kind an der Hand. Das Mädchen riss sich los und lief auf Leitner zu.
»Onkel Gerhard!«, rief sie und wäre auf dem letzten Meter fast gestolpert, hätte Leitner sie nicht aufgefangen.
»Wo kommst du denn her, meine Süße?«, rief er und wirbelte seine Nichte einmal um die eigene Achse, bevor sie sich mit Schwung wie ein kleiner Affe an seine Schultern klammerte.
»Wir waren spazieren«, erklang die nüchterne Stimme des Mannes.
»Servus, Vater.« Leitner nickte kühl in dessen Richtung.
»Guten Tag«, grüßte Agathe freundlich, während der Mann sie misstrauisch beäugte.
»Werner Leitner«, stellte er sich vor. »Gibt es schon irgendetwas Neues?« Er blickte in Richtung der Polizeistation.
»Leider nicht.« Agathe sah auf die Kleine und vermied das Wort Leiche. »Sie … wissen noch nicht, um wen es sich handelt.«
Werner Leitner brummte kurz als Antwort und wandte sich zu seinem Sohn um. »Die Kirwa war recht schön. Abgesehen von dem Fund.«
Leitner schien mit den Worten seines Vaters nicht gut umgehen zu können, bemerkte Agathe, und dabei hatte sie keine Ahnung, dass die Bewertung durch »recht schön« bei einem Oberpfälzer der Verleihung eines Oscars gleichkam.
Der Mann hob das Mädchen von Leitners Schultern und stellte es auf den Boden. »Ich war vorhin noch auf der Sparkasse. Das mit deinem Kredit müsste in Ordnung gehen.«
Leitner sah peinlich berührt zu Agathe. »Das ist lieb von dir.«
»Wenn du diese technische Ausrüstung unbedingt brauchst, muss ich halt als Bürge einspringen.«
»Das ist wirklich so. Ich habe schon den Auftrag für die Fat Burners, und für deren Auftritt müssen die Boxen schon über ein paar Watt mehr verfügen.«
»Für mich ist das sowieso keine Musik. Bei denen tät’s nicht schaden, wenn man die nicht so laut aufdreht.«
»Trotzdem danke, Vater.«
Werner Leitner zuckte theatralisch mit den Schultern. »Was bleibt mir denn anderes übrig? Einen gescheiten Beruf hast du ja nicht lernen wollen. Deshalb musst du jetzt halt auf den Bühnen herumtingeln.«
»Ich denke, dieses Thema haben wir bereits lang und breit besprochen.«
»Dein Leben hat mich zwei Herzinfarkte gekostet.«
Leitner atmete tief durch. »Dann reg dich bitte nicht auf, einen dritten können wir wirklich nicht gebrauchen.«
Der Senior hatte seinem Unmut über den Beruf seines Sohnes anscheinend ausreichend Raum verschafft. »Wie geht es heute bei dir weiter, Gerhard?«, fragte er wieder ruhiger.
»Ich muss ins Krankenhaus. Zum Roland.«
Werner Leitner richtete sich auf. »Aha.«
Agathe erschauerte bei der Kälte, die in den drei Buchstaben mitschwang. Als wäre plötzlich eine Mauer zwischen den beiden Männern errichtet worden, standen sie sich steif gegenüber.
»Na, dann gehen wir wieder heim zur Oma«, sagte der Ältere schließlich. »Die hat uns bestimmt schon was Feines zum Kaffee hergerichtet.«
»Au ja!«, ließ sich das Mädchen vernehmen, das dem Anschein nach die Backkünste seiner Oma sehr zu schätzen wusste, und machte sich mit seinem Opa auf den Weg.
Agathe sah den beiden nach und wandte sich dann wieder dem Musiker zu. »Herr Leitner?«
»Bitte?« Er kehrte aus seinen Gedanken zurück.
»Ich wollte vorhin sagen, dass ich hier bin, um etwas in Erfahrung zu bringen. Und dazu brauche ich die Hilfe von jemandem, der sich in Wirkendorf auskennt.«
»Aha«, brummte Leitner verständnislos und ohne Interesse.
Als er auch nach einigen langen Sekunden nichts weiter hatte verlauten lassen, ergriff Agathe die Initiative: »Ich würde mich gern etwas ausführlicher mit Ihnen unterhalten. Haben Sie heute Abend Zeit, mit mir zu essen?«
Leitner war auf diese Anfrage sichtlich unvorbereitet und wich instinktiv einen Schritt zurück. Er musterte Agathe von oben bis unten. Vor ihm stand eine junge Frau; er schätzte sie auf achtundzwanzig Jahre, der klaren, etwas breiten Aussprache nach aus Norddeutschland stammend. Sie hatte ein angenehmes ovales Gesicht mit prägnanten Wangenknochen. Ihr rotbraunes Haar war zu einem kurzen Pferdeschwanz gebunden. Als langjähriger Musiker erkannte er sofort, dass Agathe Viersens Proportionen stimmten, wobei die Brustpartie etwas voluminöser war als die Gesäßregion. Sie trug dunkelblaue unverwaschene Levis, eine seidene weiße Bluse und eine zu ihrer Haarfarbe passende Jacke aus Lammleder, wirkte elegant, aber nicht überkandidelt. Nein, was er sah, missfiel ihm durchaus nicht.
Dann aber stieß er ein leises Lachen aus und schüttelte den Kopf. »Seien Sie mir nicht bös, aber mir ist das völlig wurscht, was Sie in Erfahrung bringen müssen.«
Agathe gab ihrem Vorhaben eine zweite Chance. »Dann gehen Sie doch einfach so mit mir zum Essen. Ich kenne mich in der Gegend überhaupt noch nicht aus.«
»Es geht wirklich nicht. Ich habe heute Abend schon eine Verabredung. Oder ein Date, das Wort werden Sie aus der Großstadt besser verstehen.«
Agathe musste die Runde verloren geben, konnte sich aber nicht verkneifen zu fragen: »Sie gehen mit einer Frau aus?«
»Freilich.«
»Dann empfehle ich Ihnen dringend, sich vorher noch ein paar Stunden unter die Dusche zu stellen. Ich hätte es nicht gedacht, aber ihr Jungs hier stinkt tatsächlich alle nach Kuhstall.« Damit ließ Agathe Leitner stehen, stieg in ihren Wagen und fuhr davon.
»Was war das denn für eine?«, hörte Leitner eine Stimme hinter sich. Es war Dominik Kammerl, die erste Klarinette der Wirkendorfer Kirwamusik. »Hat fast so aufgebrezelt ausgeschaut wie eine Russin.«
»Eine Preißin. Das ist ja noch schlimmer.«
»Kommst nachher zur Probe?«
»Klar«, sagte Leitner. »Aber ich muss pünktlich weg, weil ich mit der Martina zum Essen verabredet bin.«
Ungläubig lächelnd wackelte Kammerl mit dem Kopf. »Du kannst es nicht lassen, oder? Interessiert sich nicht Graf Sebastian zurzeit so arg für die Martina? Und sie sich auch für ihn?«
Leitner sah ihn drohend an.
»Na ja, du musst es ja wissen, wie du deine Weiber handhabst. Warst du da gerade drin?« Kammerl deutete auf die Polizeiwache. Als Leitner bejahte, fragte er: »Hast du noch Zeit für einen Kaffee? Dann könntest du erzählen, was die dich gefragt haben.«
»Ich muss ins Krankenhaus.«
»Zum Roland?«
Leitner nickte.
»Wie geht’s ihm denn?«, fragte die Klarinette betroffen.
»Sie haben ihn gestern wieder operiert.«
Leitner betrat das St.-Barbara-Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Schwandorf und ging direkt am Empfang vorbei. Nach der Zimmernummer von Roland Schweller musste er nicht mehr fragen. In der letzten Woche war er fast jeden Tag hier gewesen. Dritter Stock, Innere. Haus B, Zimmer 314.
Von Bewegungsmeldern aktiviert, öffnete sich die gläserne Schwingtür, die zu den einzelnen Stationen führte. Sofort schlug Leitner eine Geruchsmischung aus sterilem Desinfektionsmittel, ungewaschenen Menschen und nicht verzehrten Streichwurstsemmeln entgegen. Seine Schuhe quietschten auf dem PVC-Boden, als er am Zimmer der Krankenschwestern vorbeiging, in dem zwei von ihnen Kaffee tranken. Beide grüßten Leitner freundlich, der wenige Sekunden später nach rechts abbog. Roland Schwellers Zimmer lag am Ende des Ganges.
Der Besuch seines Freundes Roland hatte heute keinen so heiteren Anlass wie die in den ganzen langen Jahren zuvor. Als Bub hatte Leitners Weg zur Schule immer an der Werkstatt von Roland Schweller vorbeigeführt, in deren Schaufenster Klarinetten, Saxofone, Trompeten und ein Waldhorn hingen. Roland Schweller, der Blasinstrumentenbauer, beobachtete den Knaben über mehrere Wochen hinweg und ging an einem Frühlingstag, als er sich wieder einmal die Nase am Schaufenster platt drückte, aus seinem Geschäft nach draußen, um mit ihm zu reden. Zuerst erschrak der kleine Gerhard gehörig, weil seine ganze Aufmerksamkeit den Instrumenten gegolten hatte. Den großen Mann mit den zurückgekämmten Haaren hatte er nicht bemerkt. Aber auf dessen Lippen in seinem vom Leben gezeichneten Gesicht lag ein freundliches Lächeln, als er ihn fragte: »Du wohnst wohl nicht weit weg, wenn du jeden Tag hier vorbeikommst?«
Gerhard schüttelte schüchtern den Kopf. »Da vorn gleich.«
»Du bist der kleine Leitner, gell?«
Noch immer etwas unsicher blickte Gerhard den Mann an, der bemerkte, dass der Junge ein wenig Angst vor ihm hatte. Also wandte er sich zum Schaufenster und fragte mit gütigem Blick, ob Gerhard denn auch ein Musikinstrument spiele.
»Trompete halt«, antwortete dieser mit großen Augen.
Roland Schweller nahm ihn mit in den Laden und drückte ihm eine Trompete in die Hand.
Zunächst wendete Gerhard das Instrument voller Respekt hin und her und war sich unsicher, ob er wirklich in das Mundstück hineinblasen sollte.
»Wenn du nicht magst, dann spiele halt ich ein bisschen.« Roland Schweller griff sich seine eigene Trompete und begann mit den ersten Takten von »An der schönen blauen Donau«.
Gerhard ließ sich vom Klang einfangen, setzte die Trompete, die Roland Schweller ihm gegeben hatte, an die Lippen und spielte fehlerfrei die zweite Stimme darüber. Er blies aus Leibeskräften, die beiden Musiker beflügelten sich gegenseitig, sodass es selten eine Darbietung der »Donau« gegeben hatte, die reiner, brillanter oder gefühlvoller gewesen wäre.
Als das Stück zu Ende war, sprach minutenlang keiner ein Wort. Beide hingen still den Klängen der Musik nach. Gerhard hatte das besser gefallen, als wenn er vom Vater alljährlich an Weihnachten gezwungen wurde, vor der versammelten Familie »Stille Nacht, heilige Nacht« zu spielen. Das war richtige Musik gewesen. Zum Abschied sagte Roland Schweller zum kleinen Gerhard noch, er könne ihn jederzeit besuchen kommen.
Von da an verging kein Tag, an dem der Knabe seinen Kopf nicht zur Werkstatttür hineinsteckte. Eines Tages überraschte Gerhard seinen neuen Freund bei einer Brotzeit. Natürlich hatte Roland Schweller mit dem Buben geteilt, und von diesem Tag an hielt der Instrumentenbauer jeden Mittag ein paar Kekse und ein Glas Milch für den Jungen bereit. Dass Gerhard kurz vor dem Essen zu Hause noch naschte, hätte seine Mutter wahrscheinlich nicht gern gesehen, doch an seinem Appetit änderte sich nichts. Die Kekse und die Milch waren sein Männergeheimnis, wenn auch nur ein kleines.
Im Laufe der Jahre hatte Leitner bei Schweller fast alle Arten von Blasinstrumenten ausprobieren dürfen. Aus dessen Geschäft stammten auch die Bücher über Tonerzeugung, Frequenzbereiche und Harmonielehre, die Leitner förmlich verschlang. Ihr Wissen hatte ihm zu seinem jetzigen Beruf verholfen. Mit Roland Schweller hatte er nie darüber geredet, aber insgeheim dachte er die ganze lange Zeit, wenn er auf den Instrumenten übte, an ihn. Sein Urteil war für Leitner maßgeblich gewesen.
»Wenn du zu rauchen aufhören würdest, hättest du ein viel größeres Volumen am Tenorhorn!«, hatte Roland Schweller einmal zu ihm gesagt, als Leitner mitten im Flegelalter war. Kurze Zeit später hatte er seine letzte, halb volle Schachtel Marlboros weggeworfen und sich seitdem nie wieder eine angesteckt. Roland Schweller selbst war jedoch nie von seinen zwei Schachteln Overstolz pro Tag losgekommen.
Leitner stand vor Zimmer 314 und klopfte kurz an die Tür. Keine Antwort. Er ging trotzdem hinein. In dem Doppelzimmer standen ein leeres Bett und ein zweites, in dem Roland Schweller lag.
Leitner durchfuhr ein Schauer bei seinem Anblick. Nicht so sehr wegen der vielen Plastikschläuche oder des piepsenden Kontrollgerätes, an das sein Freund angeschlossen war. Sondern wegen Roland Schweller selbst. Er war gut einen Meter siebzig groß, hatte für einen Neunundsechzigjährigen einen straffen Körper mit einem kleinen Bierbauch und noch volles weißes Haar, das er wie in den letzten dreißig Jahren stets zurückgekämmt trug. Die Lachfalten an seinen Augen strahlten Wärme aus – normalerweise.
Jetzt waren seine Haare fettig und zerzaust. Sein Bierbauch war weggeschmolzen, und seine Augen lagen tief in ihren dunklen Höhlen. Schweller wollte sich aufrichten, als er Leitner auf sich zukommen sah.
»Wart, Roland, da gibt’s doch einen Knopf.« Leitner wusste, wie viel Kraft Schweller das Aufrichten kostete. Er griff sich die Fernbedienung des Krankenbettes und ließ die Rückenlehne ein wenig hochfahren.
»So passt es schon«, sagte Schweller. Seine Stimme klang schwach.
»Was haben sie gestern mit dir angestellt?«, fragte Leitner besorgt.