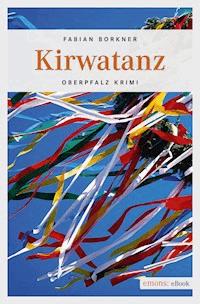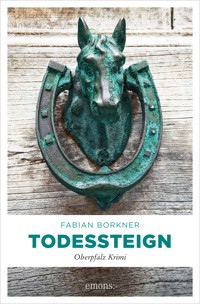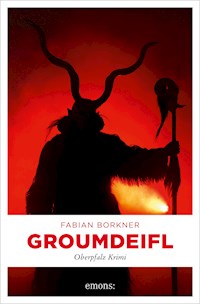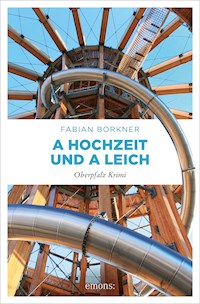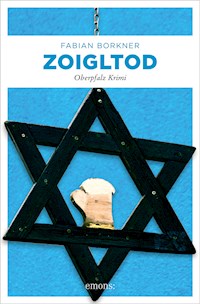
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Agathe Viersen und Gerhard Leitner
- Sprache: Deutsch
Brotzeit, Zunft und Zoigl: humorvoll, hintersinnig und mit viel Liebe zu Land und Leuten. In Windischeschenbach ereignet sich beim Besuch des bayerischen Finanzministers ein schrecklicher Vorfall: Während der Besichtigung eines Metallwerks kommt ein Mann ums Leben. Ein tragischer Unfall – oder Mord? Die Versicherungsdetektive Agathe Viersen und Gerhard Leitner gehen der Sache auf den Grund. Dabei tauchen sie ein in die urige Welt der nördlichen Oberpfalz und treffen auf familiäre Abgründe und knallharte Geschäftsinteressen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fabian Borkner kam in Rosenheim zur Welt und verbrachte seine Kindheit in München. Die erste Klasse besuchte er jedoch bereits in Schwarzenfeld in der Oberpfalz. 2014 erhielt der Unterhaltungskünstler und freie Redakteur den BLM-Hörfunkpreis für die beste Comedy und Unterhaltung.www.fabianborkner.de
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2022 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: istockphoto.com/3quarks
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Christiane Geldmacher, Textsyndikat Bremberg
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-898-6
Oberpfalz Krimi
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Verlagsagentur Lianne Kolf.
Dieser Roman ist meiner Mutter gewidmet, die meine Tätigkeiten an den vielen Bühnen, Kameras und Mikrofonen sowohl vor wie hinter den Kulissen stets unterstützend begleitet hat.
1
Die Werkshalle war sonst bei Weitem nicht so hell und sauber wie an diesem Tag. Man erkannte sogar die Grundfarbe des Hallenbodens, ein mattes Olivgrün. Üblicherweise lag darüber ein dunkler, schmieriger Schleier, der aus feinem Metallstaub, Maschinenöl und Sandpartikeln bestand und der von der Arbeit herrührte, die in der Werkshalle verrichtet wurde. Diesem Mittwoch aber waren zwei Tage vorangegangen, an welchen die Mitarbeiter des Betriebes eben nicht nur ihre Maschinen bedienten, sondern vor allem mit einer Tätigkeit beschäftigt waren: dem Putzen.
»Schauts sofort, dass ihr die Gitterboxen da drüben noch wegräumts!«, schrie ein hochgewachsener, gertenschlanker Mann in schwarzem Rollkragenpullover. »Und dann ziehts euch saubere Arbeitskleidung an. Nicht diese alten Fetzen da, verstanden?«
Die Belegschaft zeigte sich von Markus Pichlers Ansage unbeeindruckt, und die Männer warfen ihm abschätzige Blicke zu. Dann taten sie aber das, was Pichler ihnen aufgetragen hatte.
Ein Mitarbeiter murmelte zu einem anderen: »Jetzt drehen sie alle durch, und das bloß, weil der Minister vorbeischaut.«
»Mir können die alle gestohlen bleiben, ob Minister oder sonst irgend so ein Krawattenträger«, antwortete der andere.
Wieder erschallte Pichlers Stimme. »Herrschaftszeiten, wo ist der Franz? Wenn man ihn braucht, ist er nicht da!«
»Wart nur, bis er kommt, der Franz«, zischte der eine Mitarbeiter leise. »Dann brauchst du dich hier gar nicht mehr so aufzumandln. Täte sich der Pichler hier aufführen, nur weil der Meister ein paar Minuten zu spät kommt!«
»Du weißt es doch, Hans«, pflichtete der andere ihm leise bei. »Wenn man einen kleinen Scheißdreck groß macht, stinkt er umso mehr …«
Im Büro des Firmeninhabers überprüfte dieser gerade den Sitz seiner Frisur. Dies bereitete ihm jedoch zeit seines Lebens schon immer Sorgen, weil sich die sehr dünnen Haare eigentlich nur glatt seitwärts kämmen ließen. Sein Haar war schlicht nicht geeignet für schicke oder gar flippige Frisuren. So blieb es auch an diesem Mittwoch dabei, dass er sein mattblondes Haar mit einem Kamm zur Seite strich, was seinem Gesicht wie üblich eine ungewollte Breite verlieh. Er betrachtete sich im Spiegel und atmete tief durch.
»Bist du im Büro?«, hörte Axel Dirscherl die Stimme seiner Frau im Korridor vor seinem Arbeitszimmer. »Axel?«
»Ja, ich bin hier.«
Die Bürotür öffnete sich, und Simone Dirscherl trat herein. Sie stellte sich neben ihren Mann und sah ebenfalls in den Wandspiegel. »Deine Frisur passt schon. Schöner wirst du nicht mehr.«
Dirscherl betrachtete nun seinerseits seine Gattin und verzog die Lippen zu einem Schmollmund. »Meinst du wirklich, dass das ein passendes Outfit für heute ist?«
Simone Dirscherl hatte ihre Garderobe wie stets bewusst gewählt. »Auch wenn er Minister ist, wird er doch Augen im Kopf haben, oder?«
Axel Dirscherl ließ den Blick über die dunkelblonden langen Haare seiner Frau fallen. Sie hatte mit Haarwachs ein paar Strähnen eingezogen, sodass es einen kleinen Hauch von Ruch verströmte. Ihre schwarze Bluse saß stramm an ihrem Körper und ließ genügend Einblicke in das Dekolleté zu. Ihre knallrote Stoffweste stand in Kontrast zu dem tiefgrünen kurzen Rock, den sie über ihren Wildlederstiefeln mit den hohen Hacken trug.
»Ich meine, es ist ja nicht irgendein Grillfest, wo wir jetzt dann hingehen müssen.«
»Das weiß ich schon selber«, seufzte Simone.
Vor einigen Wochen war bekannt geworden, dass sich im Terminkalender des bayerischen Staatsministers der Finanzen und für Heimat ein freies Intervall von anderthalb Stunden finden ließ, in welchem er ohnehin Termine in seiner Heimat Oberpfalz wahrnahm. Axel Dirscherl, der als Inhaber eines Metallbau- und Gießereibetriebes freilich stets in regem Austausch mit den örtlichen Politikern und den Abgeordneten des Bayerischen Landtages und des Bundestages stand, hatte sich diese Chance nicht entgehen lassen. Über Magda Ebenhoch, die örtliche Stimmkreisabgeordnete, hatte er mit dem Büro des Ministers kommuniziert, und nun waren es nur noch wenige Minuten, bis der groß gewachsene Mann, der Herr über die Finanzen im Freistaat war, in Windischeschenbach eintreffen würde.
Simone war sich durchaus bewusst, dass für die Zukunft des Betriebes zurzeit wichtige Weichen gestellt wurden. Der Besuch eines Staatsministers war in diesem Zusammenhang nun wirklich alles andere als eine Lappalie. Jedoch ging Simone Dirscherl dergleichen Dinge immer mit einer gewissen Sorglosigkeit an, die ihr Gatte des Häufigeren schon in breitem Nordoberpfälzisch »Wurschtigkeit« genannt hatte. Sie stand nun mal auf der bodenständigen Seite des Lebens und schickte einen genervten Blick gen Himmel, als sie ihren Mann sagen hörte: »Solltest du nicht lieber was anderes anziehen? Ich meine, irgendwas Festliches oder so?«
Simone Dirscherl ließ sich halb hockend auf seinem Schreibtisch nieder. »Mein lieber Brummbär, so bin ich nun mal gestrickt. Für mich sind das hier festliche Anziehsachen. So fühle ich mich wohl, und ich müsste mich schon sehr irren, wenn mein Anblick dem Herrn Minister zuwider wäre.«
Axel Dirscherl nickte stumm ein paarmal, als ob er sich innerlich selbst einreden müsste, dass das Ensemble seiner Frau schon irgendwie in Ordnung ginge.
»Du machst dir zu viele Sorgen, wo du keine haben müsstest«, sagte Simone beruhigend, während sie ihr Gesäß von der Tischplatte hob und auf Dirscherl zuging. »Du hast doch gut gearbeitet in den letzten Monaten, oder? Gut und sehr hart. Frag deine Belegschaft.«
Dirscherl sah ihr kurz in die Augen und senkte seinen Blick. »Du hast mit der Magda einen superheißen Draht in den Landtag, oder?« Abermals nickte Dirscherl in Richtung Fußboden. Das Telefon im Büro klingelte zweimal. Dirscherls Kopf fuhr zu seinem Schreibtisch herum.
Simone aber beachtete das Telefonsignal nicht. Stattdessen legte sie die Finger an sein Kinn und hob seinen Kopf, sodass er ihr jetzt geradewegs in die Augen sah. »Und du weißt, dass du den großen Deal, den du geplant hast, auch schultern kannst!«
Dirscherl schwieg und atmete schwer. Das Klingeln verstummte.
»Ist das so, wie ich es sage?«, insistierte Simone.
Die Gesichtszüge ihres Mannes strafften sich und strahlten sofort Selbstsicherheit aus. »Ja, es ist so, wie du sagst.«
»Dann wird es auch klappen. Davon bin ich überzeugt«, flüsterte sie in sein Ohr.
Mit dem Rückhalt seiner Ehefrau im Gepäck presste Dirscherl die Lippen entschlossen aufeinander. Er wollte eben etwas sagen, als die Tür aufgerissen wurde.
Markus Pichler keuchte: »Das war die Referentin vom Minister! Die fahren gerade von der Autobahn runter, keine zehn Minuten mehr, dann sind sie da.«
»Gut, Markus«, sagte Axel Dirscherl. Als Pichler in der Tür stehen blieb, fragte der Chef: »Was ist denn noch?«
»Der Thiercke Franz ist immer noch nicht da.«
Instinktiv warf Dirscherl einen Blick auf die Wanduhr. Es war kurz vor zehn. Er runzelte die Stirn. Es sah Thiercke überhaupt nicht ähnlich, nicht überpünktlich vor Ort zu sein, noch dazu, wenn so ein außergewöhnliches Ereignis anberaumt war. »Gibt’s doch nicht, Kruzifix!«, fluchte Dirscherl kaum hörbar. Lauter fügte er hinzu: »Das ist jetzt wurscht. Ihr habt ja so weit alles vorbereitet, oder?«
»Ja, freilich«, sagte Pichler pikiert.
»Gut, dann geht es jetzt, wie es geht. Komm«, sagte er zu Simone. »Wir gehen mit dem Markus gleich runter.« Mit einem letzten Strich durch seine dünnen Haare folgte Dirscherl seinem Mitarbeiter und seiner Frau auf die Gittertreppe, die das erhöht untergebrachte Chefbüro mit der Werkshalle verband. Als sie unten angelangt waren, sagte Dirscherl in professionellem Geschäftston: »Habt ihr die Türen vom Strahlhaus auch gereinigt?«
»Sicher«, hechelte Pichler, der seit den frühen Morgenstunden offensichtlich nur im leichten Laufschritt auf dem Werksgelände unterwegs gewesen war.
Simone Dirscherl brachte die verschiedenen Stoffschichten in Ordnung, die ihre Brüste hielten, und fragte beiläufig: »Was wollt ihr denn am Strahlhaus? Da ist doch momentan gar kein Werksstück drin, oder?«
»Doch«, entgegnete Pichler. »Haben wir uns extra aufgespart. War eine gute Idee, Chef. Das ist bestimmt ein Hingucker.«
Die rund fünfzig Meter lange Halle hindurch lief das Trio eilenden Schrittes zum geöffneten Tor an der Stirnseite. Unterwegs ermahnte Pichler alle Mitarbeiter, die noch an ihren Stationen sauber machten oder sonst noch herumstanden und abwarteten, ihnen zu folgen und sich in einem ordentlichen Halbkreis am Hallentor aufzustellen. Mit militärischer Effizienz checkte Axel Dirscherl jeden einzelnen seiner Untergebenen und bemängelte wie ein Kompaniechef halb geschlossene Reißverschlüsse und nicht zugeknöpfte Taschen. »Der Thiercke Franz?«, sagte er knapp zu Pichler.
»Immer noch nicht da«, hob dieser entschuldigend die Hände.
»Gut, dann macht’s auch nichts. Dann ist er wahrscheinlich schon beim Dobmeier drüben.« Weiter suchte Dirscherls Blick gleich einem Adler die Szene ab, die sich dem Staatsminister in wenigen Minuten bieten würde. Er suchte seine Frau und fand sie in der Nähe des Strahlhauses. »Simone, komm halt du auch bitte her!«, sagte er mit mühsamer Beherrschung. »Ich hätte gerne, dass wir uns als Inhaberpaar hier in die Mitte stellen. Zwischen die anderen.«
Just als Simone ihrem Mann folgte, drang das Geräusch von mehreren schweren Automotoren zum Werksgelände herüber. Alle Augen blickten zur Einfahrt. Von dort kamen in unangemessen hoher Geschwindigkeit zwei Streifenwagen der Polizei herangeprescht und blieben V-förmig vor dem Halleneingang stehen. Je zwei Beamte stiegen aus den Wagen. Einer der Uniformierten sagte etwas in sein Handfunkgerät. Es dauerte nur zehn Sekunden, bis ein schwarzer Audi A8 mit Münchener Kennzeichen schwungvoll auf das Firmengelände einbog und in einiger Entfernung zum Hallentor stehen blieb. Ein dunkelgrauer 7er BMW folgte unmittelbar dahinter und belegte den Platz neben dem Audi.
Gespannt blickten alle aus der Halle auf das Freigelände. Dort entstieg dem Fond des Audi ein knapp zwei Meter großer Mann in weißem Hemd. Von Weitem sahen die Männer von »Dirscherl Metallbau und Gießerei« einen dunklen Haarkranz, der den ansonsten kahlen Hinterkopf rahmte, der in der kräftigen Frühjahrssonne hell zu ihnen herüberschien. Der Fahrer des Audi entstieg ebenfalls dem Fahrzeug und öffnete behände den Kofferraum, welchem er ein modernes schwarzes Trachtensakko entnahm. Er half seinem Boss hinein, und nachdem dieser die Knöpfe des Jankers geschlossen hatte, drehte er sich zum BMW. Hier stieg eine Frau Ende vierzig vom Fahrersitz aus und trat eilig zum Minister hinüber.
»Das waren jetzt keine fünf Minuten seit dem Anruf. Die müssen von der A 93 weg ganz schön gerast sein«, flüsterte Pichler seinem Chef zu. Der aber tat diesen Einwurf mit verärgerter Geste ab und trat seinen Besuchern entgegen. Zwei schwarz gekleidete junge Männer checkten mit raschen Blicken die Sicherheitslage ab und postierten sich links und rechts des Halleneingangs. Einer davon sprach mit seinem Handgelenk, wo offenbar das Mikrofon seines Funkgeräts angebracht war. Dann nickte er dem anderen zu und schließlich auch seinem Chef. Mit großen Schritten ging der Finanzminister in die Halle und nickte und lächelte in alle Richtungen. Vom Fernsehteam des örtlichen Senders OTV hielt die Moderatorin dem Kameramann den Rücken frei, als dieser mit dem Auge am Okular im Rückwärtsgang einen Halbkreis um den Ehrengast zog. Axel Dirscherl streckte die Hand aus und sagte laut: »Herr Staatsminister, es ist mir eine Ehre, Sie heute hier in unserem Betrieb begrüßen zu dürfen!«
»Ja«, entgegnete der große Mann und fuhr in kernigem Oberpfälzisch fort: »Da sieht man schon, dass sich bei euch was rührt! Das taugt mir!«
Ein voluminöser Mann hob seine Spiegelreflexkamera auf Augenhöhe und begann, den Ehrengast für seine Zeitung zu fotografieren. Die Frau aus dem BMW gab peinlich genau acht, dass sie zwar deutlich auf den Bildern sichtbar war, jedoch stets einen Schritt hinter dem im Rang über ihr stehenden Mann. Axel Dirscherl folgte den Anweisungen der Kameraleute und postierte sich zwischen der Landtagsabgeordneten und dem Finanzminister. Als die Bilder geschossen waren, wollte der Minister sich ein wenig in der Halle umsehen. Der Fotograf aber bat alle drei, noch in der Formation stehen zu bleiben.
»Brauchen Sie noch weitere Fotos?«, fragte der Minister erstaunt.
Dirscherl zischte: »Was brauchst denn noch, Karl?«
Der Angesprochene verstaute den Fotoapparat in seiner Umhängetasche und kramte in seiner Weste nach einem Smartphone. »Ich muss auch ein Video machen, für Dingsda … Wie heißt es gleich? Da im Internet?«
»Sie meinen Instagram«, half der Staatsminister dem Journalisten.
»Ja, das sollen wir jetzt alles alleine machen. Foto, Video … weil sie keine Leute mehr haben.«
»Dann mach das schnell, wir wollen weitergehen, Karl!«, herrschte Dirscherl ihn an.
Nachdem auch diese mediale Aufgabe erledigt war, führte Dirscherl den Minister und die Entourage ins Halleninnere. In verständlichen Worten erklärte Dirscherl verschiedene Arbeitsstationen und die Schritte, die dort für das jeweilige Metall- oder Gussprodukt erfolgten. Der Minister nickte häufig, obgleich er die wesentlichen Daten der Firma Dirscherl von seinem Büro natürlich schon lange vor dem Besuch erhalten hatte. Er wurde Zeuge, wie eine weiß glühende zähe Flüssigkeit von tausendfünfhundert Grad Temperatur in Gussformen floss und dabei funkensprühend alles verbrannte, was an restlichem Staub oder sonstigen Partikeln auf den Formen geblieben war. Interessiert betrachteten die Politiker die großen mit Sand gefüllten Kisten, in welche die heißen Gussstücke zum Abkühlen gelegt wurden. Die Metallarbeiter gaben bereitwillig Auskunft über ihre Arbeit. Nach einer knappen halben Stunde hatte die Gruppe ihre Runde in der Halle beendet und stand nun wieder unweit des Tores, durch welches die Politiker hereingekommen waren. Rechts neben dem Tor blieb Axel Dirscherl mit seinen Gästen schließlich vor einer großen weißen Wand stehen. Sie bildete mit dem Winkel der Hallenecke und einer weiteren Wand eine Art Häuschen innerhalb der Halle. Außen an der Wand war ein großer Türgriff sichtbar. Außerdem gab es zwei Bullaugen, durch die man in das Häuschen hineinblicken konnte.
Dirscherl platzierte sich neben eines der kleinen Fenster. »Dies hier ist unser Strahlhaus, Herr Staatsminister. Sie haben gerade vorhin gesehen, dass wir sehr große Gussteile für den Eisenbahn- und Schiffsbau herstellen.«
»Das sind schon riesige Trümmer, das war sehr beeindruckend«, sagte der Minister in salbungsvollem Ton.
»Und wissen Sie, was dies hier ist?« Damit reichte Dirscherl ihm ein etwa handygroßes Gussabfallteil. »Tasten Sie doch bitte mal mit dem Finger über die Oberfläche.«
Der Minister kam der Bitte nach. »Oha, ganz schön scharf!«, entfuhr es ihm, als er über die spitzen Zacken des Metalls fuhr.
Dirscherl erläuterte: »Sehen Sie, wenn die Gussformen aufeinandergepresst werden, dann quillt immer etwas von dem heißen Stahl an den Seiten heraus.«
»Wie der Kuchenteig, wenn man ein Osterlamm backt«, warf Magda Ebenhoch ein, und die Belegschaft schmunzelte pflichtbewusst über den Vergleich der Landtagsabgeordneten.
Dann übernahm wieder Dirscherl. »Diese Gussgrate müssen natürlich entfernt werden, damit die fertigen Werksteile reibungslos und präzise zueinanderpassen und verbaut werden können. Und genau das passiert hier drinnen.«
Damit deutete Dirscherl dem Minister an, durch das andere kleine Fenster in das Innere des Strahlhauses zu blicken. »Können Sie sich vorstellen, was das dort ist?«
Der Minister schirmte mit den Händen das Umgebungslicht ab, während er versuchte, das gusseiserne Ungetüm im Strahlhaus zu identifizieren. »Das schaut mir irgendwie nach einem großen Motorblock aus«, riet er schließlich.
»Da hat der Herr Staatsminister voll ins Schwarze getroffen. Dieser Block ist für ein großes Transportschiff gegossen worden, welches bald vom Stapel laufen wird. Und zwar in China.«
»Da liefern Sie bis nach China?«, spielte der Minister den Ungläubigen, obwohl er aus dem Dossier über Dirscherl natürlich wusste, dass es sich bei der Firma aus Windischeschenbach um einen Global Player handelte.
»Wenn so ein Motorblock ein Containerschiff antreiben soll, das zweihundertvierzigtausend Tonnen Tragfähigkeit hat, dann muss trotz der Größe präzise gearbeitet werden. Damit nun eben diese Grate verschwinden, wandern unsere Werksstücke in das Strahlhaus. Dort beschleunigen wir Hunderttausende von winzig kleinen Stahlkügelchen auf Überschallgeschwindigkeit und schießen sie auf das Werksteil.«
»So wie bei einem Sandstrahler, nur größer«, meldete sich Frau Ebenhoch wieder zu Wort.
Diesmal fiel das höfliche Schmunzeln spärlich aus.
»Dann darf ich zum großen Moment bitten«, sagte Dirscherl rasch.
Der Minister und die Stimmkreisabgeordnete traten an die beiden Bullaugen. Dirscherl deutete einem Mitarbeiter an, die Maschinerie in Gang zu setzen. Jener betätigte einige Knöpfe auf einer Schaltfläche neben dem Strahlhaus, und wenige Sekunden danach ertönte das Dröhnen der Windturbinen, die die kleinen Stahlkügelchen beschleunigten. Es folgte ein ohrenbetäubendes Prasseln, als die Kugeln kreuz und quer durch den abgeschotteten Raum schossen. Dirscherl sah stolz zu, wie die Politiker den Vorgang aufmerksam verfolgten. Der Minister drehte sich zu Dirscherl und sagte etwas zu ihm. Der Lärm aber war zu groß.
Dirscherl ging näher zum Minister, und dieser rief nun mit lauter Stimme: »Und was ist da so rot?«
Dirscherl blickte den Finanzminister verständnislos an.
»Was ist das Rote da drin im Strahlhaus?«, rief der andere erneut.
Dirscherl blickte durch die Scheibe, und tatsächlich leuchtete ein kräftiges Rot hindurch. Er sah zu Magda Ebenhoch. Sie stand wie verwurzelt und ohne jede Regung an dem Bullauge. Ihr Gesicht war käseweiß.
»Herr Dirscherl, ich glaube, da ist irgendwas nicht ganz …«, stammelte sie.
Der Firmeninhaber eilte zu Ebenhochs Fenster. Daran klebte im Inneren ein Schnitzel. Es sah aus, als hätte man es gerade frisch aus der Oberschale geschnitten. Der Fetzen Fleisch löste sich langsam und rutschte, einen blutigen Streifen hinterlassend, von der Scheibe zu Boden.
»Gehört das so?«, rief der Finanzminister und sah sich verstört nach seinen Security-Mitarbeitern um.
Diese erkannten, dass etwas Außergewöhnliches passiert sein musste, denn sie sprachen hektisch in ihre Mikros am Handgelenk. Einer lief in die Halle, der andere eilte zu den bereitstehenden Polizisten.
»Machts sofort aus!«, schrie nun Dirscherl in schrillem Ton. Das Dröhnen verstummte. Das Prasseln ebenso.
Der Leibwächter zog den Minister und auch die Landtagsabgeordnete zur Seite, als Axel Dirscherl die Tür zum Strahlhaus öffnete. Er wünschte sich, dass die vielen Medienvertreter wie zu so vielen anderen Termineinladungen heute nicht gekommen wären. So aber erhielten die Objektive sowohl des TV-Teams als auch der örtlichen Zeitung und deren Instagram-Accounts unverbauten Blick auf den riesigen Motorblock und die Innenwände des Strahlhauses, die allesamt rot gesprenkelt waren. Lediglich das Violett, das Dunkelbraun und das Grau der verschiedenen menschlichen Organe, die die Kugeln zerfetzt hatten, und einige weiße Splitter, die zuvor noch ein intaktes Knochengerüst dargestellt haben mussten, lenkten von der dunkelroten Soße ab, die sich auf den Boden zu den Abflussgittern ergoss.
2
In dem weißen Ford Transit startete Gerhard Leitner zum fünften Mal an diesem Vormittag den Motor, nur um wieder lediglich ein paar Meter weiterzukommen. »Mein lieber Freund, da haben wir uns wirklich einen saublöden Tag ausgesucht«, stieß er genervt aus.
Auf dem Beifahrersitz packte Agathe Viersen soeben ihre zweite Leberkässemmel aus und biss mit großem Appetit hinein. »Ach komm«, tat sie Leitners Beschwerde ab. »Es sind doch nur noch zwei Autos vor uns.«
Leitner brummte. Er war tatsächlich froh, dass die Mitarbeiter des Recyclinghofes in Dachelhofen nur noch zwei Fuhren abfertigen mussten, bevor er zusammen mit seiner Kollegin den Inhalt des Transportbusses in die entsprechenden Container werfen konnte. Missmutig blickte Leitner nach hinten in den Laderaum. »Ich hoffe, die nehmen das Zeug an. Nicht dass wir es hinterher wieder mit nach Hause nehmen müssen.«
»Dafür hätten wir eh keinen Platz mehr«, schmatzte Agathe vergnügt. Leitner schnaubte verächtlich. Es war eine große Schinderei gewesen, den alten Schrank aus Agathes Schlafzimmer den Korridor ihrer Wohnung in Schwandorf hindurch die Treppen hinunterzubugsieren. Und wie es häufig der Fall war, kam man vom Hundertsten ins Tausendste, und so hatte Agathe ihrem Mitbewohner befohlen, auch das alte Schuhkästchen, den Küchentisch und die zwei Kommoden aus dem Wohnzimmer zu entsorgen. Das alles musste natürlich in dem Transporter verstaut werden, wobei Leitner froh gewesen war, dass es sich nicht um neue Möbel handelte. So war es nicht schlimm, wenn beim Verladen irgendwelche Kratzer in die Holzflächen gerieten.
Wieder fuhr ein Auto mit Anhänger vom Hof, und Leitner und Agathe schlossen auf. Durch das heruntergekurbelte Fenster konnten sie eine laute, in breitem Berliner Dialekt tönende Stimme hören.
»Das Zeug nehm ich nicht. Tapete und Schutt, det jeht nich.«
Leitner sah, wie der Leiter des Recyclinghofes sich eine Zigarette ansteckte und dann zu einem etwas unbeholfen wirkenden Mann im Blaumann sagte: »Det müssen Sie trennen, so leid’s mir tut.« Während der Angesprochene sich widerwillig daranmachte, aus dem Schutt, den er auf seinem Anhänger geladen hatte, die papiernen Tapetenfetzen herauszuklauben, hatte die Szene auch Agathes Aufmerksamkeit erregt.
»Das ist aber ein forscher Typ«, meinte sie und verfolgte gespannt die nächste Szene.
Der Berliner hatte einen anderen Mann aufs Korn genommen, der eben alte Zaunlatten in den Holzcontainer werfen wollte. »Det is Außenholz! Kein Innenholz! Hier nur Innenholz!«
Der andere wollte etwas erwidern, aber der Berliner war in Fahrt. »Bauste den Zaun ab und stellste ihn in die Garage, denn isses Innenholz, wa? Und wenn du dir ’ne Schraube durchs Knie machst und ein Klavier draufstellst, denn weißte, wie schwer Musik is, hm?«
Agathe kicherte, und Leitner meinte: »Wir haben gottlob wirklich nur Sperrmüll. Ich glaube, das dürfte er uns durchgehen lassen.«
»Denke ich auch«, meinte Agathe und nahm einen weiteren Bissen von ihrer Leberkässemmel. Leitner betrachtete seine Kollegin amüsiert. Vor wenigen Jahren hatte sie noch gar keinen Leberkäse gekannt. Agathe Viersen, die gebürtig aus Lübeck stammte, war vor einigen Jahren von ihrer Versicherungsgesellschaft in die Oberpfalz geschickt worden, um dort das Verschwinden einer teuren Maschine aufzuklären. Als Versicherungsdetektivin sollte sie herausfinden, ob ihre Gesellschaft für den Schaden aufzukommen hatte. Dabei lernte sie den damaligen Musikanten Gerhard Leitner kennen, und als beide durch Zufall bei der Wirkendorfer Kirwa auf eine stark verweste Leiche in einem Gülletank stießen, fanden sie sich unfreiwillig als Ermittlungsteam in einem Mordfall wieder. Der erfolgreichen Aufklärung verdankte Gerhard Leitner ein Angebot, ebenfalls für die Versicherung zu arbeiten, und so waren er und Agathe Viersen seit fünf Jahren ein Detektivduo, das für die Jacortia-Versicherungsgesellschaft alle zu klärenden Fälle in der Oberpfalz bearbeitete. Aus Kostengründen nahmen sie sich eine gemeinsame Wohnung in Schwandorf, denn dort wohnte man einigermaßen zentral und konnte rasch jeden Einsatzort in der Oberpfalz erreichen.
»Oh, klasse!«, mampfte Agathe vor sich hin, als sie sich das letzte Stück der Semmel einverleibte. Es gehörte zu ihren Lieblingssnacks: zwei Semmeln mit grobem, warmem Leberkäse und dazu eine ordentliche Portion Händlmaier Hausmachersenf.
Leitner dachte an all die schmackhaften, deftigen Speisen, die Agathe seit ihrer Zeit in der Oberpfalz kennen und schätzen gelernt hatte. Er hätte das anfangs zwar nicht für möglich gehalten, aber das Nordlicht hatte sich stehenden Fußes in Schlachtschüsseln, Schopperler, Leberkäs und Weißwürscht verliebt. Trotzdem hielt Agathe ihre Figur, welche angenehme Proportionen aufwies. In Leitners Augen waren alle Rundungen da, wo sie sein sollten, und auch so ausgeprägt, wie sie sein sollten – mit leichtem Überhang in der Brustpartie. Leitner selbst langte bei gutem Essen und geistigen Getränken selbst gerne zu, was als ehemaliger Musikant und Leiter einer Blaskapelle auch nicht weiter verwunderlich war. Wenngleich sich bei ihm als Enddreißiger natürlich nun mancher Schweinebraten deutlicher bemerkbar machte, als es Anfang zwanzig der Fall gewesen war, so war Leitner mit seinen schulterlangen schwarzen Haaren dennoch eine stattliche Erscheinung.
Nun winkte der Berliner den Ford Transit heran. »Wat habt ihr denn im Gepäck?«, fragte er knapp.
»Nur alte Möbel, nix Besonderes«, sagte Leitner und stieg aus.
Als der die Hecktüren geöffnet hatte, maß der Leiter des Recyclinghofes kurz den Inhalt auf der Ladefläche ab.
»Det wirfste alles hier rin!«, sagte er in militärischem Befehlston.
Agathe kletterte in den Transporter, Leitner postierte sich davor. Sie schob mit einigen Mühen die schwere Wohnzimmerkommode ins Freie, wo Leitner sie keuchend in Empfang nahm. Just als Agathe sich an dem Möbel vorbeizwängte und aus dem Ford kletterte, um das andere Ende der Kommode zu ergreifen, klingelte ihr Telefon. Sie griff in die Tasche und sah auf das Display.
»Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder?«, rief Leitner verärgert, als er immer noch das eine Ende der Kommode auf seinen Oberschenkel gestützt festhielt, während das andere auf der Kante der Ladefläche ruhte.
»Nein, das ist nicht der Ernst. Das ist unsere Chefin«, sagte Agathe schnippisch und drückte auf den grünen Hörer ihres Smartphones. »Hallo, Frau Wendell? Hier Agathe Viersen …«
»Diese dusselige Kuh schafft es doch immer wieder!«, fluchte Leitner. Jetzt waren er und Agathe sich mit ihrer Chefin Chris Wendell schon von Haus aus nicht wohlgesinnt, da musste sie nun auch noch anrufen, während er hier dieses schwere Teil tragen musste!
Der Berliner kam zu ihm und sagte: »Wat is denn det nu? Ruft se schon um Hilfe?«
»Das ist unsere Chefin, da muss sie leider rangehen«, nahm Leitner seine Kollegin in Schutz.
Zu seiner Überraschung sagte der Recyclinghofchef: »Denn helf ick dir rasch. Det wär ja sowieso nischt jeworden, so ’ne hübsche junge Dame det schwere Zeug hier schleppen lassen!«
Der geübte Berliner wusste, wo man anzupacken hatte, und hob das auf der Laderampe stehende Ende mühelos an. Zusammen mit Leitner wuchtete er das Teil zu dem Container und kippte es in die Höhe, damit das Möbelstück über die Kante geriet. Dabei öffnete sich eine Schublade, die Leitner fast die Nase einschlug. Der Schub war nicht leer wie alle anderen in der Kommode. Eine Vielzahl von Briefen fing an, um Leitners Gesicht zu flattern, und plötzlich hörte er direkt vor seinem Gesicht ein unangenehmes Klirren. Gleich darauf spürte er eine kalte Flüssigkeit sein Gesicht hinablaufen. Er bekam etwas davon in den Mund und spuckte angewidert aus. Es schmeckte chemisch.
»Na, nu komm! Rin mit det Ding!«, orderte der Recyclinghofchef.
Leitner gab seinem Ende der Kommode einen kräftigen Ruck, dann fiel sie krachend in den Metallcontainer.
Der Berliner sah Leitner an. »Na, jetz siehste aus wie Hannibal Lecter nach seiner letzten Mahlzeit mit Leber und Favabohnen!«
Leitner musste abermals ausspucken, um den widerwärtigen, fremden Geschmack aus seinem Mund zu entfernen.
»Und die Scherben und deine Korrespondenz, die entsorgste aber noch, nich wahr, Hannibal?«
Damit ließ der Berliner Leitner stehen, und der konnte jetzt erst an sich hinabsehen. Sein grauer alter Pullover, den er für derlei Arbeiten anzog, und auch seine ausgebleichte Arbeitsjeans waren voller rotbrauner Farbe. Er wischte sich über die Lippen und sah zu seinem Erschrecken, dass auch sein Handrücken im Nu in dunklem Rotbraun glitzerte. Hannibal Lecter nach der Mahlzeit … »Komiker!«, entfuhr es Leitner leise, der nicht wollte, dass der Mann, der ihm geholfen hatte, sich nun beleidigt fühlen würde. Er betrachtete die am Boden liegenden Papiere, über die sich ebenfalls das braune Zeug ergoss. Glasscherben lagen dazwischen verteilt, und drei Splitter waren durch ein aufgeklebtes Etikett miteinander verbunden. Es war Tinte gewesen. Braune Tinte für einen Füllfederhalter. Zorn stieg in Leitner hoch, und er drehte sich langsam zu Agathe, die ihr Telefonat beendet hatte.
Sie hielt inne, als sie Leitner erblickte. Ihre Lippen blieben geschlossen, aber Leitner konnte deutlich hören, wie sich Luft durch Agathes Nasenlöcher presste. Ihr Körper erbebte vor unterdrücktem Lachen, und Leitner musste an sich halten, um ihr nicht auf der Stelle wie einem unartigen Kind den Hintern zu versohlen.
Agathe rang um Fassung, als sie schließlich mit mühsam beherrschter Stimme sagte: »Was … wie siehst du denn aus?« Wieder drang ein Glucksen aus ihrer Kehle.
Leitner erwiderte nichts. Stumm ging er, gleich einem Westernhelden, der auf der leer gefegten Hauptstraße zum finalen Revolverduell antrat, auf Agathe zu.
Sie sah die Wut in seinen Augen und konnte dennoch nicht ernst bleiben. »Das … das passt doch ganz gut zu … ich meine, dein grauer Pulli und das Kastanienbraun …«
Der Westernheld schritt weiter.
Agathe hob die Hände. »Hey, komm! Es waren doch alte Anziehsachen …«
Nur noch wenige Meter, dann würde der Westernheld ziehen und schießen.
Doch in diesem Augenblick kam der Berliner des Weges. »Wat war denn det eigentlich? Tinte? Vons Fräulein hier?«
»Ja, ich habe leider vergessen, meinen Schub auszuräumen. Das sind meine Briefe, ich räume sie sofort weg.«
Dann wandte sich der Berliner zu Leitner und sagte: »Na, an deinem Gesicht kannste mal sehen, wat die junge Dame für ’ne jepflegte Handschrift hat! So, und nu macht euch mal vom Acker. Da kommen schon die Nächsten.«
Leitner blieb nichts weiter übrig, als zusammen mit Agathe schnellstmöglich den Papierwust aufzuheben und den Platz auf dem Recyclinghof wieder freizugeben. Es war Agathe, die den Ford steuerte. Leitner hatte sich von Agathe Feuchtigkeitstücher geben lassen und bemühte sich mit mäßigem Erfolg, die Tinte aus seinem Gesicht zu wischen. Nach einer Weile sagte er, den Blick auf den heruntergeklappten Beifahrerspiegel an der Sonnenblende gerichtet: »Ich habe extra noch gesagt, räum dein Glump aus der Kommode raus. Ich habe meine Sachen alle schon gestern rausgetan.«
»Und ich habe es eben erst heute früh erledigt.«
»Ja, das sehe ich«, gab Leitner murrend zurück. »Hast du noch so ein Feuchttuch?«
»In meiner Tasche. Du kannst die ganze Packung haben.«
»Die werde ich auch brauchen!«
Leitner rieb und scheuerte weiter, bis das letzte Tuch aufgebraucht war. Dann blickte er durchs Seitenfenster. Er sah, dass Agathe den Transporter bei Schwandorf-Klardorf auf die Autobahn in Richtung Regensburg lenkte, und sagte: »He, du bist verkehrt gefahren. Der Dominik wohnt doch in der anderen Richtung. Nach Norden. Außerdem, warum nimmst du überhaupt die Autobahn?«
Agathe ließ den Diesel im dritten Gang beschleunigen, dann schaltete sie in den vierten. »Wir sind schon richtig, fürchte ich.«
»Einen Schmarrn sind wir. Wir müssen dem Dominik seinen Laster wieder zurückbringen. Der braucht ihn jetzt. Hat er mir extra gesagt.«
»Das ändert nichts, wir müssen nach Regensburg.«
Jetzt erst besann sich Leitner des Telefonats, das Agathe vorhin geführt hatte. Er ordnete einige Sekunden lang seine Gedanken, und dann trat ein Schreckensbild vor sein geistiges Auge. »Halt! Stopp! Du willst jetzt nicht wirklich mit mir zur Jacortia fahren?«
Agathe schloss den Überholvorgang eines Lkw ab und zog zurück auf die rechte Fahrspur. Sie antwortete nicht.
»Du willst doch nicht ernsthaft, dass ich mich jetzt, angeschmiert wie ein Indianerhäuptling, da vor unseren Sonnenschein von Chefin setze, oder?«
Agathes Schweigen sagte ihm, nein, es brüllte förmlich, dass genau dies ihre Absicht war.
Leitner sank in seinem Sitz zusammen. »Um Gottes willen, tu mir das nicht an. Nicht vor dieser Schreckschraube.«
»Es geht leider nicht anders, Gerhard. Die Ansage von der Wendell vorhin am Handy hat mich selber so geföhnt, dass es mir fast durchs Telefon meine Haare weggeblasen hätte.«
Leitner blieb der Mund offen. Er fühlte, dass er die Situation nicht zu seinen Gunsten würde drehen können. »Aber was um alles in der Welt kann denn so wichtig sein, dass wir nicht einmal duschen dürfen und die Autos tauschen?«
»Es geht um einen Todesfall in einer Gießerei in Windischeschenbach, die bei uns versichert ist.«
Leitner hob verächtlich die Schultern. »Ja mei, Todesfall … wenn da einer tot ist, dann läuft er doch nicht weg, oder?«
»Das nicht. Aber es hieß, da hängt irgendein Minister mit drin. Ich habe es auch nicht genau verstanden, aber auf jeden Fall eilt’s.«
Leitner schmollte. Agathe betrachtete ihn aus den Augenwinkeln und meinte schließlich verschmitzt: »Es hat doch auch was Gutes, dass du heute so … so außergewöhnlich aussiehst.«
»Und was wäre das?«
»Na, bei deinem Anblick, glaube ich, vergisst die Wendell wohl ihr übliches schnippisches Gehabe.«
»Warum?«
»Weil sie sich wahrscheinlich davor schon totgelacht hat …«
In Regensburg nahm Agathe die Ausfahrt West und fuhr zum Bürogebäude der Jacortia. Als sie und Leitner das Gebäude betraten, nahm der Mann an der Rezeption einen Telefonhörer in die Hand und sagte: »Das Facility Management, bitte.« Sie kamen gerade an seinen Tisch, als sie den Mitarbeiter ins Telefon sagen hörten: »Was heißt, Sie haben keine Maler bestellt? Gerade sind sie mit ihrem weißen Firmenwagen vorgefahren. Die Maler stehen doch hier, vor mir!«
Leitner war überhaupt nicht zu Scherzen aufgelegt und sagte: »Lassen Sie den Krampf und melden Sie uns lieber im Vorzimmer von der Frau Wendell an.«
Der Mitarbeiter ließ den Telefonhörer kurz sinken und stammelte dann hinein: »Herr Weniger? Hat sich erledigt.« Er legte auf: »Herr Leitner, ich habe Sie jetzt nicht gleich erkannt, das tut mir leid. Aber in diesem … Outfit …«
Agathe wollte sich bei ihrer Chefin über einen Todesfall informieren und nicht ihrem Kollegen dabei zusehen, wie dieser einen weiteren verursachen würde. Deshalb sprang sie ein: »Ja, sein Outfit ist heute etwas seltsam, denn der Pulli passt ihm eigentlich gar nicht mehr. Und jetzt: Vorzimmer Wendell. Pronto!«
Nachdem der verdutzte Rezeptionist den Besuch der beiden Detektive telefonisch angekündigt hatte, fuhren Agathe und Leitner im Aufzug nach oben, passierten die ungläubigen Blicke der Chefsekretärin und nahmen schließlich gegenüber von Chris Wendell Platz. Diese betrachtete Leitners farbenfrohen Anblick, und auch Agathes Arbeitsoutfit beäugte sie mit offenkundigem Missfallen.
»Sagen Sie mir bitte eines …« begann die Wendell zögerlich. »Will ich wissen, warum Sie in diesem Aufzug hier bei mir erscheinen?«
»Nein!«, entfuhr es Leitner abrupt. »Das wollen Sie nicht wissen.«
»Wir haben unsere Wohnung ausgeräumt, und Sie haben am Telefon ja gesagt, dass wir unverzüglich hierherkommen sollen, nicht wahr?«
Die Chefin musste sich zwingen, ihren Blick vom tintenverschmierten Leitner zu lösen. Dann sagte sie in kühlem Geschäftston: »Stimmt. Nun gut. Frau Viersen, Herr Leitner, wir haben es diesmal mit einem sehr speziellen Fall zu tun. Es betrifft einen Metallbaubetrieb in Windischeschenbach, der bei uns versichert ist. Axel Dirscherl heißt der Inhaber.«
Agathe beugte sich zu ihrem Kollegen. »Windisch… wie bitte?«, flüsterte sie.
»Windischeschenbach. Das liegt nördlich, hinter Weiden.«
»Bitte verschieben Sie Ihre Geografiestunde auf später. Jetzt geht es ums Geschäft.«
Agathe lehnte sich angespannt im Stuhl zurück und biss sich auf die Lippe. Das sollte ihr helfen, die Abneigung gegen ihre Chefin im Zaum zu halten.
Chris Wendell fuhr fort: »Bei Axel Dirscherl herrschte heute Hochbetrieb, weil er den bayerischen Finanzminister zu Besuch hatte. Fragen Sie mich nicht nach den technischen Einzelheiten, aber irgendwie ist dort ein Unfall passiert, bei dem ein Mensch in so einer Strahlkammer bis ins Kleinste zerfetzt worden ist.«
»Ist er tot?«, fragte Leitner unbedarft.
»Es ist wohl kaum wahrscheinlich, dass er am Leben ist, wenn seine Lunge an der Decke klebt und seine Gedärme auf dem Fußboden liegen!«, blaffte die Wendell zurück. »Wir müssen also schnellstmöglich herausfinden, was dort passiert ist.«
»Sie meinen, wir sollen herausfinden, unter welchen Umständen dieser jetzt Verstorbene in diese Strahlkammer gelangt ist?«, fragte Agathe.
»Sie haben es erfasst. Ein Todesfall ist für eine Versicherungsgesellschaft wie die unsere immer eine besondere Belastung. Es kommen jetzt die Ansprüche der Hinterbliebenen auf den Tisch, die Ausfallkosten für den Betrieb, Kosten für Rechtsanwälte und Gutachter und dergleichen. Deswegen wäre es gut, wenn man dem Betrieb Fahrlässigkeit oder sonstige Versäumnisse in puncto Sicherheitspflicht nachweisen könnte.«
»Weil die Jacortia dann nicht bezahlen müsste«, murmelte Leitner.
»Goldrichtig. Ich beauftrage Sie hiermit, die Umstände dieses zugegebenermaßen äußerst ekelhaften Todesfalls zu klären und mir unverzüglich Bericht zu erstatten, sobald Sie erste Erkenntnisse haben.«
Ohne dass weitere Worte gewechselt wurden, wussten die beiden Detektive, dass die Besprechung vorüber war. Sie warfen sich einen vielsagenden Blick zu und erhoben sich aus den Stühlen.
Als Agathe die Tür öffnete, sagte Chris Wendell: »Ach, übrigens, Herr Leitner?«
»Was gibt es noch?«
»Ich gehe zwar davon aus, dass der Finanzminister schon wieder auf dem Weg nach München in sein Ministerium ist. Aber trotzdem empfehle ich Ihnen dringend eine Dusche, bevor Sie Ihre Ermittlungen starten.«
Agathe musste ein Kichern unterdrücken.
Leitner antwortete: »Ich weiß, ich weiß. Ich werde mir die Flecken aus dem Gesicht wegmachen.«
»Die Flecken sind nur ein Teil des Problems. Werden Sie bitte auch den Gestank Ihrer … Arbeitskleidung wieder los, bevor Sie zu unserer Mandantschaft gehen.«
3
Auf der Fahrt zurück nach Schwandorf ließen die Versicherungsdetektive ihre Gedanken eine Zeit lang ohne Worte kreisen.
Auf Höhe Teublitz sagte Leitner schließlich: »Das wird haarig. Wir können ja schlecht dahinmarschieren und sagen: ›He, war der Typ da einfach dämlich, oder habt ihr den absichtlich vor dem Minister zerfetzt?‹ Das kommt wahrscheinlich nicht so gut.«
»Nein, mit Sicherheit nicht. Ich denke auch schon nach, wie wir das am besten anstellen. Ich denke, wir müssen es von zwei Seiten her versuchen.«
»Was meinst du damit genau?«
Agathe zog sich den streng sitzenden Anschnallgurt etwas von der Brust, was aber nur kurzfristig Lockerung versprach. »Es wäre ideal, wenn ich den offiziellen Teil übernehme. Ich meine damit, dass ich als Vertreterin der Versicherung in Erscheinung trete und so alles Dienstliche abarbeiten kann.«
»Klingt vernünftig. Und ich?«
»Ich weiß nicht, wie wir das bewerkstelligen könnten, aber du müsstest irgendwie von innen heraus ermitteln. Sozusagen nah an den Menschen und an der Familie. Dann hätten wir zwei Seiten der Medaille und könnten uns ein stimmiges Gesamtbild machen.«
Leitner dachte kurz nach, dann sagte er: »Von innen heraus … da fällt mir eigentlich nur eine Möglichkeit ein. Ja, aber so könnte es gehen!«
Leitner führte seinen Gedanken nicht weiter aus. Stattdessen fuhr Agathe zum Hof von Dominik Kammerl. Sie übergaben Leitners ehemaligem Musikkollegen wieder seinen Transporter und stiegen um auf den weißen BMW X5, den sie dort geparkt hatten. Als sie wenig später zu Hause in ihrer gemeinsamen Wohnung in der Klosterstraße in Schwandorf angekommen waren, marschierte Leitner schnurstracks in die Dusche und reinigte sein Gesicht mit allen ihm zur Verfügung stehenden Shampoos, Duschgels und Rasierwassern, sodass die braune Tinte tatsächlich weitgehend verschwunden war. Er hatte nur ein Badetuch um die Hüften gebunden, als er zu Agathe in die Küche ging. Sie betrachtete seinen wohlgeformten Körper mit den Tribaltattoos, die sich von der Schulter bis zu seinen Hüften hinabzogen, mit großem Gefallen. Sie und Leitner hatten eine nicht eindeutig beschreibbare Beziehung zueinander. Es war in der Vergangenheit schon öfter dazu gekommen, dass sie zusammen der Versuchung nachgaben und sich gefühlvolle Nächte in einem Bett bereiteten. Allerdings wäre keiner von beiden am nächsten Tag auf die Idee gekommen, den anderen als festen Lebenspartner zu bezeichnen. Dafür vergnügten sich sowohl Agathe als auch Leitner zu gerne mit den sich im Leben ergebenden anderen Möglichkeiten. Dennoch hegten beide eine definitive Zuneigung füreinander, und es waren Momente wie dieser, in denen Leitner eben nur spärlich bekleidet vor ihr stand und sich mit einem kleinen Handtuch das nasse, schwarze, schulterlange Haar trocknete und Agathe sich zwingen musste, ihre Gedanken von seinem Körper loszureißen und an die Arbeit zu denken.
»Sieht ja schon wieder prächtig aus, kaum noch was zu erkennen«, meinte sie aufmunternd.
»Frage nicht, ich hätte mir beinah die Haut weggeschrubbt, so fest saß das Zeug.«
»Ist eben gute Tinte, dokumentenecht«, lächelte Agathe, um gute Stimmung bemüht. »Was hattest du denn vorhin gemeint? Hast du eine Idee, wie wir dich in den Betrieb bringen können?«
»Allerdings. Ich rufe den Jürgen Wullinger an.«
»Und wer soll das sein?«
»Das ist ein Bekannter von mir, der in Fronberg draußen das Eisenwerk leitet. Diese Betriebe kennen sich alle untereinander, darum werde ich ihn bitten, dass er mich an die Firma Dirscherl in Windischeschenbach vermittelt.«
»Wie, einfach so?«, fragte Agathe skeptisch.
»Ich denke, dass die auch immer wieder billige Hilfsarbeiter brauchen können. Der Wullinger soll dem Dirscherl erklären, dass ich ein Bekannter bin, der wieder in die Oberpfalz zurückkehrt, nachdem seine Pläne in der Großstadt nicht aufgegangen sind. Meinetwegen soll er sagen, ich würde finanziell ziemlich am Abgrund stehen und wäre dankbar für jeden Ferienjob, der sich mir bietet. Das kann der bestimmt deichseln.«
Agathes Skepsis schwand, als sie sich den Vorschlag ausmalte. »Das hätte was für sich …«, murmelte sie schließlich und fuhr dann fort: »Dann wärst du tief im Herzen der ganzen Chose. Und du kämst sehr schnell in Kontakt mit allen Mitarbeitern, weil die dich ja erst anlernen müssen.«
»So sehe ich das auch«, stimmte Leitner zu und griff nach seinem Smartphone. Jürgen Wullinger hörte sich Leitners Geschichte an und versprach, sich mit Axel Dirscherl in Verbindung zu setzen.
Nach Leitners Telefonat sagte Agathe: »Bis du Antwort von dem Eisenwerksmenschen erhältst, fahre ich da schon mal rauf und stelle die ersten Fragen.«
So machte sich Agathe auf den Weg und fuhr von der Klosterstraße zur Naabuferstraße und bog dort rechts ab in Richtung der A 93.
Nach einer knappen Stunde Fahrt in Richtung Norden vorbei an Schwarzenfeld, Nabburg, Wernberg-Köblitz und Weiden hatte Agathe die Ausfahrt Windischeschenbach erreicht. Ohne es zu wissen, nahm sie denselben Weg wie einige Stunden zuvor der Staatsminister. Auf dem Gästebereich des Parkplatzes stellte sie ihren BMW X5 ab und betrachtete einige Minuten lang das riesige Hallengebäude von außen. Immense stählerne Bauteile warteten an den Außenwänden auf den Abtransport. Sie schürzte angesichts ihres wuchtigen Volumens respektvoll die Lippen. Das Firmenschild über dem Haupteingang rechts hatte ein modernes, klar gezeichnetes Logo. Nirgends auf dem Parkplatz oder auf den Außenflächen wuchs Unkraut zwischen den Pflastersteinen hervor. Kein Löwenzahn oder ähnliches Grün am Zaun, das sich auf so vielen Fabrikhöfen fand.