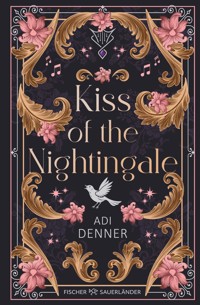
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Atemberaubendes Romantasy-Debüt ab 14 zur Zeit der Belle Époque – mit einer prickelnden Dreiecks-Liebesgeschichte in der glanzvoll verruchten Opernwelt Cleodora ist ein Niemand. Nach dem Tod ihres Vaters kann sie sich und ihre sterbenskranke Schwester kaum über Wasser halten. Sie wohnt in der glanzvollen Stadt Lutèce, doch deren Welt der magischen Talente ist für Cleo unerreichbar. Als sie von der berüchtigten Madame Dahlia beim Diebstahl erwischt wird, nimmt ihr Leben eine unglaubliche Wendung: Dahlia macht sie mithilfe eines Gesangstalents über Nacht zur gefeierten Sängerin an der Oper. Sie erlebt Galas und opulente Bälle. Je länger Cleo im Rampenlicht steht, desto weniger kann sie sich Dahlia entziehen. Sie soll für sie das Talent des verflucht gutaussehenden Vicomte Lenoir stehlen. Ein Talent, für das er nicht viel übrig zu haben scheint – jedoch umso mehr für Cleo ... Romantasy at its best: opulent, düster und verflucht sexy - Love Triangle Story für alle ab 14 Jahren, die Stephanie Garber und Adalyn Grace lieben! Mit besonders schöner Ausstattung in der ersten Auflage, ein echtes Romantasy-Schmuckstück, modern und frisch erzählt von einem neuen YA-Talent: Debütautorin Adi Denner ist selbst Opersängerin und zeigt uns eindrucksvoll, dass dass jede Form von Kunst in Wahrheit Magie ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 656
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Adi Denner
Kiss of the Nightingale
Über dieses Buch
Atemberaubendes Romantasy-Debüt ab 14 zur Zeit der Belle Époque – mit einer prickelnden Dreiecks-Liebesgeschichte in der glanzvoll verruchten Opernwelt
Cleodora ist ein Niemand. Nach dem Tod ihres Vaters kann sie sich und ihre sterbenskranke Schwester kaum über Wasser halten. Sie wohnt in der glanzvollen Stadt Lutèce, doch deren Welt der magischen Talente ist für Cleo unerreichbar. Als sie von der berüchtigten Madame Dahlia beim Diebstahl erwischt wird, nimmt ihr Leben eine unglaubliche Wendung: Dahlia macht sie mithilfe eines Gesangstalents über Nacht zur gefeierten Sängerin an der Oper. Sie erlebt Galas und opulente Bälle. Je länger Cleo im Rampenlicht steht, desto weniger kann sie sich Dahlias Machenschaften entziehen. Sie soll für sie das Talent des verflucht gutaussehenden Vicomte Lenoir stehlen. Ein Talent, für das er nicht viel übrig zu haben scheint – jedoch umso mehr für Cleo ...
Romantasy at its best: opulent, düster und verfluchtsexy - Love Triangle Story für alle ab 14 Jahren, die Stephanie Garber und Adalyn Grace lieben!
Mit besonders schöner Ausstattung in der ersten Auflage, ein echtes Romantasy-Schmuckstück, modern und frisch erzählt von einem neuen YA-Talent: Debütautorin Adi Denner ist selbst Opersängerin und zeigt uns eindrucksvoll, dass dass jede Form von Kunst in Wahrheit Magie ist.
Weitere Informationen finden Sie unter www.fischer-sauerlaender.de
Biografie
Adi Denner entdeckte bereits als Teenager ihre Leidenschaft für die Malerei, Bildhauerei und die Darstellende Kunst. Heute ist sie eine etablierte Opernsängerin, die sich auf moderne Stücke spezialisiert hat. Außerdem lebt sie ihre Kreativität als Schriftstellerin aus. In ihren Werken verbindet Adi am liebsten all ihre Passionen miteinander und ist fest davon überzeugt, dass Kunst eine Art von Magie ist.
Inhalt
[Widmung]
Kapitel 1 Gestutzte Flügel
Kapitel 2 Meine kleine Nachtigall
Kapitel 3 Goldener Käfig
Kapitel 4 Mondscheinserenade
Kapitel 5 Das Haus Garnier
Kapitel 6 Sing, Vögelchen, sing
Kapitel 7 Ein nächtlicher Spaziergang
Kapitel 8 Rampenlicht
Kapitel 9 Champagner und Biskuits
Kapitel 10 Schlagzeilen
Kapitel 11 Bilderwelten
Kapitel 12 Eine Seite voll Gekritzel
Kapitel 13 Scheuende Pferde
Kapitel 14 Vögel im Garten
Kapitel 15 Candle-Light-Dinner
Kapitel 16 Taktgefühl
Kapitel 17 Die fröhlichen Weiber
Kapitel 18 Die hübscheste Blume
Kapitel 19 Mondscheinbaden
Kapitel 20 Gesträubte Federn
Kapitel 21 Singvogel oder Krähe?
Kapitel 22 Auf der Schattenseite
Kapitel 23 Kleider machen Leute
Kapitel 24 Verborgene Gesichter
Kapitel 25 Her damit!
Kapitel 26 Hinter der Maske
Kapitel 27 Zerrissen
Kapitel 28 Cleodora Finley
Kapitel 29 Eine Blume in voller Blüte
Kapitel 30 Ein letztes Lied
Kapitel 31 Wenn die Glocke läutet
Kapitel 32 Entscheidungen
Kapitel 33 Auf breiten Schwingen
Danksagung
Für alle, die den Mut zum Singen brauchen.
Kapitel 1Gestutzte Flügel
Vaters Ring steckt kahl an meinem Finger – entkernt, ausgehöhlt. Wenn ich ihn ansehe, funkelt kein Edelstein darin, keine Magie singt in meinem Blut. Er ist so leer wie unsere Kasse mit den zwei Silberfrancs und zehn Bronzepièces – gerade genug, um meine Schwester und mich zwei Wochen durchzubringen. Unsere Schneiderei hat eindeutig schon bessere Zeiten gesehen.
Ich lehne am hölzernen Tresen, die Hände vor dem Gesicht. Ich habe schon vor Langem gelernt, dass die Tür anzustarren auch keine Kundschaft herbeizaubert.
Ein durchdringendes Husten aus dem Hinterzimmer schnürt mir die Kehle zu.
»Es geht mir gut!«, ruft Anaella mit rauer Stimme.
Das ist das zwölfte Mal, dass meine kleine Schwester in den letzten fünf Minuten gehustet hat.
Ich laufe zum Waschbecken und nehme ein gesprungenes Glas vom Regal. Das Wasser aus dem Hahn ist trüb, beinahe grau, aber es ist das Einzige, was ich habe, um ihre Kehle vor dem Austrocknen zu bewahren.
»Wieso um alles in der Welt bist du nicht im Bett?«, platzt es aus mir heraus, als ich das Hinterzimmer betrete und meine Schwester am Schreibtisch vorfinde.
»Ich hab doch gesagt, es geht mir gut, Cleo.« Sie verdreht genervt die Augen, bevor sie von einem neuerlichen Hustenanfall durchgeschüttelt wird.
Ich drücke ihr das Glas in die Hand. »Nein, tut es nicht. Du sollst dich eigentlich ausruhen.«
Anaella nimmt einen zögerlichen Schluck von dem bitteren Wasser und verzieht das Gesicht. »Ich hatte die Idee für einen neuen Entwurf. Guck mal.« Sie deutet auf den Schreibtisch, der mit einer Vielzahl winziger Zeichnungen auf hauchdünnem Papier übersät ist.
Ich greife nach der, die mir am nächsten ist, und fahre mit den Fingern über die zarten Pinselstriche, die aus Wasserfarbe ein federleichtes Chiffonballkleid entstehen lassen. Der Stoff ist so gefältelt, dass der ausladende rosafarbene Rock wie ein blühender Garten aussieht, der über und über mit samtenen Blütenblättern bedeckt ist. Sie reichen bis zu dem engen schulterfreien Korsett hinauf, das mit goldenen, wie Tautropfen im Morgenlicht schimmernden Glasperlen bestickt ist. Es ist all das, was Anaella und ich in unseren verblichenen Baumwollkleidern niemals sein können, denn etwas derart Luxuriöses und Elegantes kann sich nur eine Dame der feinen Gesellschaft leisten.
Der Rand der Zeichnung zerknittert zwischen meinen Fingern. Meine Schwester hat offensichtlich wieder in Vaters Buch geschmökert – so einen Kreativitätsschub hat sie immer, wenn sie die Entwürfe und Notizen unserer verstorbenen Eltern sieht. Mein Verdacht bestätigt sich, als ich den alten Ledereinband entdecke, der zwischen den verstreuten Zeichnungen hervorlugt. Der Anblick versetzt mir einen Stich ins Herz.
»Stell es dir in Elfenbeintönen vor«, erklärt Anaella. »Ich wollte es cremeweiß mit goldenen Akzenten, aber … mir ist die Farbe ausgegangen.«
»Es ist wunderschön«, versichere ich und schlucke mühsam den Kloß in meinem Hals runter.
»Ich dachte … wenn wir es schaffen, das zu nähen, und es ins Schaufenster stellen, könnten wir …« Der Rest ihrer Worte geht in rasselndem Husten unter, der auch das letzte bisschen Farbe aus ihren eingefallenen Wangen weichen lässt. Ein weiterer Schluck Wasser verschafft ihr etwas Linderung. »Dann könnten wir mehr Kundschaft anlocken.«
Wenn Vater hier wäre, würde er ihr wahrscheinlich sofort recht geben. Doch ohne ihn ist unsere Boutique nur noch ein Schatten ihrer selbst. Alles, was von ihrem früheren Glanz übrig ist, sind Stapel wertloser Stoffreste, die langsam Staub ansetzen.
»Diese Art von Material ist nicht billig, Ann … ganz zu schweigen von den Perlen. Außerdem bin ich nicht geschickt genug, um etwas derart Kompliziertes zu nähen.«
Sie lässt den Kopf hängen. »Cleo, mag sein, dass du Papas Talent nicht geerbt hast, aber du bist definitiv gut genug.«
Nun bin ich es, die den Blick senkt. Unwillkürlich landet er wieder auf dem Ring an meinem Finger, einem schlichten, schmucklosen Goldreif mit einer Lücke dort, wo ein Edelstein hätte sitzen sollen. Diese Lücke ist es, die mir die Kehle zuschnürt. Eine Erinnerung an das Versprechen, das unser Vater gebrochen hat, als er so plötzlich gestorben ist und sein Talent, die über fünf Generationen verfeinerte Kunstfertigkeit eines Schneiders, mit ins Grab genommen hat. Meine Schwester trägt genau den gleichen Ring am Finger, aber an ihrem prangt ein glänzender Opal.
Sie bemerkt meinen Blick und bedeckt ihren Ring mit der anderen Hand. Diese kleine Geste entlarvt ihre Worte als Lüge. Anaella hat mein Schicksal nie verstanden. Wie auch? Unsere Mutter hat ihr gestalterisches Talent vor ihrem Tod an sie weitergegeben. Meine Schwester musste nie erfahren, wie sich diese Leere anfühlt, die ständig in einem klafft, wenn man keins hat.
»Als reine Änderungsschneiderei können wir uns nicht über Wasser halten. Wenn wir den Laden weiterführen wollen, brauchen wir neue Kleider!«, drängt Anaella.
Ihre Augen sind so voller Entschlossenheit und Hoffnung, dass ich es nicht übers Herz bringe, ihr zu sagen, dass unsere Kasse leer ist und ich auch keinen Schmuck von Mutter mehr habe, den ich verkaufen könnte. »Vielleicht können wir gegen Ende des Monats die nötigen Materialien kaufen«, lüge ich.
Sie stößt sich vom Schreibtisch ab und streckt eine zarte Hand aus, doch bevor sie einen Schritt machen kann, geben ihre Beine unter ihr nach.
»Ann!« Ich fange sie auf, bevor sie zu Boden geht.
Ich brauche all meine Kraft, um sie durch den winzigen Raum zu dem Bett in der Ecke zu schleppen. Als unsere Eltern noch am Leben waren, hat uns das Stockwerk über dem Laden gehört, doch nun ist dieses stickige Hinterzimmer mit den zwei Betten und dem Schreibtisch alles an Zuhause, was Anaella und ich noch haben.
Sie stöhnt, als ich ihr ein zusätzliches Kissen unter den Kopf schiebe. Das sanfte Rosa ihrer Wangen ist einem kränklichen Gelb gewichen. Ihr einstmals fließendes Haar ist trocken und brüchig und das Funkeln in ihren runden braunen Augen so gut wie erloschen. Anaella und ich sehen einander zum Verwechseln ähnlich, aber ich fand schon immer, dass sie die Schönere von uns beiden war. Wenn sie mit ihrer wilden, ungezähmten Energie einen Raum betrat, war es, als hätte sie darin ein Feuer entfacht, dessen stiebende Funken alle in der Umgebung magisch anzogen. Sie so schwach und kraftlos zu sehen, bricht mir das Herz.
»Du solltest im Bett bleiben«, murmle ich.
»Ich möchte aber helfen«, entgegnet Anaella, bevor sie von einem weiteren Hustenanfall erfasst wird. Sie presst ihr Taschentuch vor den Mund. Als sie es wegzieht, sprenkeln Blutströpfchen ihr Kinn und den alten Stofffetzen. »Tut mir leid …«
»Du musst dich nicht entschuldigen.« Meine Lippen beben, als ich ihr das Gesicht abwische. »Ruh dich einfach ein bisschen aus. Über die Kleider reden wir, wenn du dich wieder besser fühlst.«
Sie nickt und schließt die Augen, während ich die Decke um sie herum feststecke und ihr die Haare aus dem Gesicht streiche. Ihre Stirn glüht.
Ich setze mich neben ihr auf den Boden und lehne den Kopf gegen die Wand. Sie braucht einen Arzt. Einen guten. Einen, den ich mir nicht leisten kann. Wie zum Hohn fällt mein Blick durch die offene Tür auf unsere Kasse, und es scheint fast, als würde sie die Leere in mir drin nachahmen.
Bald darauf werden Anaellas Atemzüge tiefer, und der Schlaf lindert vorübergehend ihre Schmerzen. Es gibt nichts, was ich nicht tun würde, um sie wieder gesund zu machen. Nichts, was ich nicht dafür geben würde. Mit einem leisen Ächzen rapple ich mich auf, schleiche aus dem Zimmer und hänge das »Geschlossen«-Schild an die Tür. Sämtliche Träume von zahlender Kundschaft sind längst ausgeträumt. Ich drehe mich noch einmal um und höre Anaella im Schlaf herzzerreißend husten, dann trete ich auf die trostlose Straße hinaus.
Der Himmel ist tiefblau mit Wattewölkchen, die über den fernen Horizont schweben. Doch hier unten in der schmalen Gasse ist die Luft stickig, und in den Mauern hängt der Gestank des Verfalls. Als ich ein Kind war, herrschte hier das blühende Leben. An der Hand meines Vaters schlenderte ich durch das Labyrinth der Sträßchen und Gassen und lauschte den zahllosen Geschichten, die in den alten Mauern von Lutèce steckten: von Liebe, Eifersucht und der Tapferkeit all jener, die bleibende Spuren in dieser Welt hinterlassen haben. Aber nach seinem Tod kam keine Kundschaft mehr. Wenig später schlossen die kleineren Geschäfte oder zogen weg und überließen die leer stehenden Gebäude sich selbst. Nein. Vater hat keine bleibenden Spuren in der Welt hinterlassen. Sein Vermächtnis besteht aus einem verblassten Schild über einer kaputten Tür und einem Ring mit einer klaffenden Lücke darin – einem nutzlosen Stück Metall, das mir auch nicht hilft, Essen auf den Tisch zu stellen.
Oder … vielleicht doch.
Ich bleibe wie angewurzelt stehen und streiche mit dem Daumen über den schmalen Goldreif. Im nächsten Moment stoße ich mich von dem Kopfsteinpflaster unter meinen Füßen ab und biege in eine andere Gasse, die zur großen Prachtstraße führt.
Hier glitzern die Schaufenster im Sonnenlicht, das sich in den makellosen Scheiben spiegelt – in Verheißung der von talentierter Hand erschaffenen Waren, die dahinter warten. Kundinnen und Kunden eilen dazwischen umher wie ein emsiger Bienenschwarm und bestäuben die Kassen mit den Pollen aus ihren tiefen, bis zum Rand gefüllten Geldbörsen. Solch blitzender und blinkender Luxus überall, und doch ist er bloß ein verlockender Vorgeschmack auf die Reichtümer, die sich in den abgeschotteten Domizilen der höheren Gesellschaft auf der anderen Seite des Flusses verbergen. Denn natürlich würden diese Leute sich niemals dort niederlassen, wo das Volk der Händler und Gewerbetreibenden wohnt.
Links von mir sitzen vornehme Damen mit ausladenden Hüten an Tischen, die mit blütenweißen Tischtüchern bedeckt sind, nippen an ihrem duftenden Kaffee und beißen schwatzend in zuckrige Gebäckstücke, bei deren Anblick sich mein leerer Magen schmerzhaft zusammenkrampft. Zu meiner Rechten hilft ein feiner Herr seiner lachenden Tochter in eine Kutsche und drückt ihr ein nagelneues Paar zartrosafarbener Ballettschuhe in die Hand. Doch vor mir, im Dunklen, klafft unheilvoll die Tür zum Pfandleihhaus auf.
Ich hole tief Luft und drehe den Ring an meinem Finger. Es bringt nichts, das Unvermeidliche noch länger hinauszuzögern.
Als ich über die Schwelle trete, schlägt mir der vertraute muffige Geruch des Pfandleihhauses entgegen. Mittlerweile kenne ich den vollgestopften Laden nur allzu gut. Wie so viele, die ihr Talent durch ein grausames Schicksal verloren haben oder denen damals, als die Minen noch vor Magie knisterten, keins zuteilgeworden ist, habe ich recht schnell gelernt, dass harte Arbeit allein nicht ausreicht, um in einer Welt, die von vererbten Gaben bestimmt wird, zu überleben. Nach Vaters Tod ist der Großteil unseres Familienbesitzes in diesen verstaubten Regalen gelandet.
»Kann ich Ihnen helfen, Mademoiselle …? Ach, du bist das schon wieder. Was kann ich heute für dich tun?« Der Pfandleiher rückt mit einem Finger die Brille auf seiner gebrochenen Nase zurecht, ohne sich die Mühe zu machen, hinter dem Tresen hervorzukommen.
Ich straffe die Schultern und gehe auf den alten Mann zu. »Ich möchte meinen Ring verkaufen.«
Der winzige Topaz an seinem Augenbrauenpiercing zuckt, als er eine Lupe aus der Tasche zieht. »Ehering? Familienerbstück?«
»Nein, aber er ist aus reinem Gold.«
Er nickt und öffnet die schwielige Hand.
Für einen kurzen Augenblick schließt sich meine Hand zur Faust. Mein Ring fühlt sich auf einmal viel schwerer an. In ihm stecken so viele unbezahlbare Erinnerungen und Versprechen, die durch kein Geld der Welt zurückgekauft werden können. Bin ich wirklich bereit, mich davon zu trennen?
»Was ist jetzt?« Der Händler mustert mich ungeduldig.
Anaellas eingefallene Wangen erscheinen vor meinem inneren Auge. Bereit oder nicht … ich kann sie nicht hängen lassen. Bevor ich es mir anders überlegen kann, nehme ich den Ring ab.
Ich beiße mir auf die Unterlippe, während der Händler den Ring unter die Lupe nimmt und auf eine Bronzewaage legt.
»Ich kann dir einen Silberfranc dafür geben«, sagt er auffallend schnell, sogar für jemanden mit seinem Analysetalent.
»Was? Das ist echtes Gold!«
Er legt den Ring auf den Tresen. »Wo ist der Stein? Niemand will einen unvollständigen Ring.«
Ich beiße die Zähne zusammen. Das soll der Wert von Vaters Vermächtnis sein, von all seinen Erinnerungen? Unmöglich.
»Da muss ein Fehler vorliegen«, nuschle ich. »Wiegen Sie ihn noch einmal. Vielleicht können Sie ihn einschmelzen. Oder …«
»Aus reiner Großzügigkeit biete ich dir einen Silberfranc und eine Bronzepièce. Höher kann ich nicht gehen.«
Ich schnappe mir den Ring vom Tresen. »Vergessen Sie’s.«
»Ein besseres Angebot wirst du nicht kriegen!«, ruft er mir nach, doch ich stürme bereits zur Tür hinaus.
Das Blut rauscht in meinen Ohren, und mein Atem geht schnell und stoßweise. Ich schließe die Augen und versuche, die Außenwelt auszublenden. Das war meine letzte Hoffnung, das Einzige, was ich noch hergeben kann, aber es ist nicht genug. Vater hat mich mit leeren Händen zurückgelassen. Der Ring ist nicht mehr als ein Kinkerlitzchen von sentimentalem Wert, ein Stück Metall, an dem ein Haufen Erinnerungen und gebrochene Versprechen hängen. Das Gelächter um mich herum ist zu laut, die Menschenmenge zu dicht, die Sonne zu hell. Ich dränge mich zwischen den Flanierenden, Kutschen und Pferden hindurch, ohne anzuhalten und Atem zu holen oder mich bei der Dame zu entschuldigen, die ich beinahe umrenne. Ich brauche frische Luft, ich muss raus aus diesem erdrückenden Gewimmel.
Ich werde erst wieder langsamer, als ich die Brücke erreiche, die über den breiten Fluss zur anderen Seite der Stadt führt – der besseren Seite der Stadt. Die Strömung peitscht unerbittlich gegen die gemauerten Pfeiler, als wolle sie die robusten Eindringlinge fortspülen. So, wie sie meinen Vater vor Monaten fortgespült hat.
An jenem Tag hat der Fluss uns viel mehr als nur Vaters Leben genommen.
Ich vertreibe die morbiden Gedanken aus meinem Kopf. Grüne Spitzdächer ragen am Horizont empor. Zarte graue Rauchschwaden steigen aus runden Schornsteinen und verfliegen am klaren Himmel. Mit einem Mal bin ich wieder ein kleines Mädchen, das ein Paket mit einem Kleid aus viellagiger blauer Seide in den Armen hält. Meine Wangen sind vor Aufregung gerötet, als Vater und ich den tosenden Fluss überqueren.
»Denk daran, mon cœur, das ist nur der erste von vielen solcher Ausflüge«, erklärte mein Vater. Seine Augen glitzerten vor Stolz. »Diese Robe wird die berühmte Sopranistin Mirella beim Maskenball tragen. In ein paar Jahren wirst du diejenige sein, die ihre Kleider näht.«
Es war das erste Mal, dass Vater mich zu einem Termin bei einer Kundin mitgenommen hatte, als Belohnung dafür, dass ich es geschafft hatte, ganz allein ein Korsett zu nähen. Ich blinzle das Echo seiner warmen Stimme aus meinen Gedanken. Ohne es zu merken, haben mich meine Füße ans andere Ufer getragen, getrieben von der Sehnsucht danach, mich in den alten Erinnerungen zu verlieren und mein aufgewühltes Inneres für eine Weile zu betäuben.
Auf dieser Seite der Stadt dominieren Marmor und Gold die Fassaden. Blühende Bäume zieren die Häuserfronten und tauchen die breite Avenue in gesprenkelte Schatten. Es gibt sogar einen Kanal, auf dem Schwäne gemächlich und voller Anmut entlanggleiten. Bei so viel Schönheit regt sich ein dumpfer Schmerz in meiner Brust; dieser Welt werde ich niemals angehören.
Ein Stück entfernt steht ein Mann in einem eleganten schwarzen Anzug und sieht auf seine Taschenuhr. »Mon amour, wir kommen zu spät«, ruft er einer Dame zu, die am Rand des Kanals steht und den Schwänen Brotstücke zuwirft. Selbst aus der Entfernung kann ich den goldenen Glanz der Brotkruste erkennen. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen, als in mir die Erinnerung an Honigglasur hochsteigt.
»Einen Moment noch, mein Schatz. Die Aufführung beginnt erst bei Sonnenuntergang.« Die Frau streicht sich eine perfekte blonde Locke aus dem Gesicht, und der durchscheinende Stoff ihrer Fledermausärmel flattert im sanften Wind.
»Es ist die letzte Aufführung der Saison«, beharrt der Mann. »Ich wäre gern schon frühzeitig dort, um uns unsere Plätze zu sichern. Du weißt, es wird voll.«
Die Dame lacht und wirft das restliche Brot ins Wasser. Bestürzt sehe ich zu, wie es untergeht und mein Herz mit ihm, während die Vögel es von allen Seiten zerpflücken. Von diesem Laib hätten meine Schwester und ich eine Woche lang leben können.
»Es ist dieselbe Loge, die wir schon die ganze Saison lang hatten. Da passiert schon nichts, ganz sicher«, erwidert die Dame, geht aber trotzdem zu ihm.
Ich sollte umkehren, heimgehen und nach Anaella sehen, aber ich kann nicht anders, als ihnen zu folgen. Vielleicht liegt es an der Anmut, mit der die Dame sich bewegt, oder an der Bewunderung, mit der ihr Mann sie anschaut. Irgendwie erinnern mich die beiden an meine Eltern. Es ist, als würde ich durch einen Spiegel in eine Welt blicken, die ich schon vergessen hatte. Vor meinem inneren Auge sehe ich Mutter in einem rosafarbenen Abendkleid. Sie hat sich bei Vater untergehakt, der sie in die Oper ausführt. Mutter hat Musik geliebt – eine Leidenschaft, die sie mit meinem Vater teilte. Für einen kurzen Moment versetze ich mich an ihre Seite. Ich stelle mir vor, wie sie sich vor Beginn des Stücks ein Glas Champagner gönnen und wie sie von ihren samtenen Sitzen zusehen, als sich der Vorhang zur Bühne hebt.
Aber das hier sind nicht meine Eltern. Und ich werde nie wieder ihre Liebe spüren oder diesen Luxus erleben.
Ich folge dem Paar, das sich flüsternd unterhält, die Avenue entlang bis zum Opernplatz. Vor den Bogentoren mit ihren imposanten geflügelten Pferden und Marmorengeln bleibe ich stehen. In der Mitte des Platzes plätschert ein Springbrunnen, dessen Becken mit einem Relief aus steinernen Rosen verziert ist. Das Wasser glitzert im Licht der tief stehenden Sonne. Doch die Schönheit des Opernplatzes verblasst im Vergleich zu dem architektonischen Wunder, das ihn regelrecht überragt: die Oper von Lutèce. Säulen stützen die goldenen Bögen an der Fassade und rahmen die hohen Buntglasfenster ein. Jeder Winkel, jede Nische ist bis zur Perfektion ausgearbeitet, als hätte jemand ein Schloss aus einem Märchenbuch herbeigezaubert.
Die Menschen hier sind alle festlich gekleidet: mit zarter Spitze verbrämte Ausschnitte und edle Samtkragen, fließende Roben mit Schleppen aus Chiffon, Seidenanzüge und funkelnde Juwelen. So viele Juwelen. Diamantgeschmeide, blitzende Saphirringe, prächtige Perlenohrringe und edelsteinbesetzte Krönchen, die in allen Formen und Farben erstrahlen.
Die kostbaren Steine üben eine hypnotische Wirkung auf mich aus. Was ich alles kaufen könnte, wenn ich nur einen einzigen davon hätte.
Ich frage mich, welche dieser lebhaft glitzernden Edelsteine Magie in sich bergen. Als meine Schwester und ich klein waren, haben wir daraus oft ein Ratespiel gemacht. Ein Rosenquarz für eine Ballerina, ein Aquamarin für einen Lehrer, oder so ähnlich. Zweifelsohne muss es sich bei den Talenten, die in dieser Menge vertreten sind, um die hochwertigsten in ganz Lutèce handeln. Hier geht es nicht bloß um Handwerkskunst, sondern um Fähigkeiten, die von der Oberschicht bereits gehegt und gepflegt wurden, als Händler und Gewerbetreibende nicht mal im Traum daran gedacht hätten, jemals einen magischen Stein in den Händen zu halten.
Ich trete unbehaglich von einem Bein aufs andere und schrumpfe immer mehr unter den kritischen Blicken zusammen, die an meinem verblichenen braunen Baumwollkleid mit dem ausgefransten Saum hängen bleiben. Die Scham darüber hinterlässt einen bitteren Geschmack in meinem Mund, als ich mich von der versammelten Menge vor dem Eingang zum Opernhaus abwende. Ich habe das Paar längst zwischen all den anderen Menschen aus den Augen verloren. Was würde ich nicht dafür gegeben, zu ihnen zu gehören: respektiert, willkommen geheißen, ja, vielleicht sogar bewundert zu werden. Ohne Talent wird mir all das für immer verwehrt bleiben.
In meinem Rücken geht die Sonne unter und verleiht den weißen Straßen einen orangefarbenen Glanz, während ich den Opernplatz hinter mir lasse und mich auf den Rückweg in die Stadt mache. Hier, auf dieser Seite des Flusses, stehen die Häuser viel weiter auseinander, umringt von weitläufigen Gärten. Ich folge der Reihe halbrunder Balkone, bis mein Blick auf eine Kutsche ein paar Häuser weiter fällt. Der Kutscher steht auf dem Gehsteig und hält die Zügel zweier weißer Pferde.
»Wo steckt dieser Butler nur, wenn man ihn braucht?«, ertönt eine laute Stimme aus dem prachtvollen Stadthaus links von uns. Eine alte Dame kämpft mit der schweren Eingangstür. »Lass die verdammten Gäule los und halte mir die Tür auf, du Narr.«
Der junge Kutscher macht eine überstürzte Bewegung, wodurch die Pferde scheuen und sich mit der unbändigen Kraft der wilden Tiere, die immer noch unter ihrem gezähmten Äußeren stecken, aufbäumen. Die Kutsche schießt vorwärts, und der junge Mann, der noch versucht, die Zügel wieder unter Kontrolle zu bringen, stolpert und fällt hin. Mit einem Schmerzensschrei stürzt er auf den Gehsteig und hält sich den Ellbogen.
»Du tollpatschiger Nichtsnutz!«, schimpft die alte Dame. »Wenn ich deinetwegen die Aufführung verpasse, ziehe ich das von deinem Lohn ab.«
Ich laufe zu ihm und bücke mich, um seine Verletzung zu untersuchen. »Tut es sehr weh?«
Er schüttelt den Kopf, ergreift meine Hand und lässt sich von mir aufhelfen, bevor er sich beeilt, die Pferde zu beruhigen.
»Verzeihung, Madame. Das war mein Fehler«, murmelt er.
»Ich helfe Ihnen mit der Tür, Madame«, biete ich an, woraufhin mir der Kutscher einen dankbaren Blick zuwirft.
Die Frau mustert mich von Kopf bis Fuß, als ich durch das Tor im Zaun trete und auf das Haus zugehe. Ihr entgeht keine lose Haarsträhne, kein Fleck auf meinem Kleid. Sie rümpft missbilligend die Nase, die an einen Vogelschnabel erinnert, nickt jedoch, und so steige ich die vier Stufen vor dem Eingang hinauf. Ihre kerzengerade Haltung und die exquisite Qualität ihrer silbernen Robe verraten mir, dass sie es gewohnt ist, immer und von allen respektvoll behandelt und bedient zu werden. Ich bezweifle, dass sie in ihrem gesamten Leben jemals eine Tür selbst aufmachen oder sich auch nur eigenhändig die Haare kämmen musste.
»Wenigstens wiegen deine Manieren dein armseliges Erscheinungsbild einigermaßen auf«, sagt sie, als ich eine höfliche Verneigung andeute und die Tür festhalte, damit sie standesgemäß zur Kutsche schreiten kann.
»Hier.« Sie fischt eine Bronzemünze aus ihrer winzigen Handtasche und lässt sie mir in die Hand fallen. »Nun aber schnell!«, blafft sie den Kutscher an, der herbeistürzt, um ihr den Kutschenschlag zu öffnen. »Lass die Tür einfach zufallen, Mädchen, sie verriegelt sich von selbst.«
»Jawohl, Madame«, antworte ich und lasse die schwere Tür los, halte jedoch schnell den Fuß dazwischen, als die alte Dame nicht hinsieht.
Kurz darauf traben die Pferde davon und verschwinden um die nächste Straßenecke. Ich stehe da wie festgefroren, während sich in meinem Körper ein seltsames Kribbeln ausbreitet. Die Straße ist menschenleer, das einzige Geräusch ist das Zwitschern der Vögel, die sich für die Nacht in den Bäumen niederlassen. Was mache ich hier eigentlich? Die Tür drückt schmerzhaft gegen meinen Fuß, aber ich zögere noch. In diesem Haus warten Reichtümer, die selbst meine kühnsten Vorstellungen übertreffen. Ein einzelner Teelöffel dürfte mehr wert sein, als wir mit unserem Laden im ganzen letzten Monat eingenommen haben. Davon könnte ich problemlos den besten Arzt der Stadt bezahlen. Und wenn man so viel besitzt, fällt es doch bestimmt nicht auf, wenn etwas fehlt, oder?
Mit zitternder Hand öffne ich die Tür und schlüpfe ins Haus. Beim Anblick der Eingangshalle breche ich in nervöses Gelächter aus. Über mir hängt ein gewaltiger Kronleuchter, der aussieht, als hätte jemand eine Handvoll Sterne genommen und sie zu einem komplexen Gebilde zusammengefügt. Tropfen aus gelbem Licht sprenkeln die mit rotem Teppich verkleidete Prachttreppe.
Mein Puls rast, als ich die Stufen hinaufschleiche. Das Metall des Treppengeländers fühlt sich kalt an. Ich klammere mich daran fest wie an einer Rettungsleine, bis meine Knöchel weiß hervortreten. Doch so groß meine Angst auch ist, den Reichtum hier drin kann man gar nicht übersehen. Er spricht aus der hohen, aufwendig bemalten Decke, die in der Mitte zu einer Kuppel zusammenläuft, und aus den zahllosen goldgerahmten Porträts an den Wänden. Sogar die Luft duftet opulent, nach einer Mischung aus Vanille und Rosenblüten.
Aber ich habe keine Zeit, rumzustehen und zu gaffen. In einem Anwesen wie diesem gibt es immer Bedienstete, und wenn ich erwischt werde, war es das für mich. Ich eile die Treppe hinauf in den ersten Stock und betrete den Flur. Aus dem Augenwinkel nehme ich einen perfekt getrimmten Garten draußen vor den Fenstern wahr. Mein Mund ist wie ausgetrocknet, als ich zur erstbesten Tür husche und mein Ohr dagegendrücke. Dahinter ist alles still. Schnell blicke ich mich nach links und rechts um, dann drehe ich den Türknauf.
Der Raum ist so groß, wie ich erwartet hatte. Ein riesiges Schlafzimmer mit mahagonivertäfelten Wänden, schweren roten Vorhängen und einem Himmelbett. An der Rückwand steht ein enormer Schminktisch, in dessen blinkendem Spiegel die Auswahl aus bunten Parfümflakons und Tiegeln mit teuren Tinkturen gleich noch mal so umfangreich erscheint. Die kräftigen Aromen ziehen mich geradezu magisch an. Als ich eintrete, versinken meine Füße regelrecht in dem dicken, weichen Teppich.
Mit zitternden Händen greife ich nach einem herzförmigen Flakon und schnuppere daran. Er riecht nach Orangenblüten. Nach einem schnellen Blick über meine Schulter drücke ich auf den runden Pumpzerstäuber, und etwas von der Flüssigkeit sprüht auf mein Handgelenk. Das Gefühl hat etwas Berauschendes: das kühle Öl auf meiner Haut, der erfrischende Blumenduft. Mir entfährt ein leiser Seufzer, und ich strecke die Hand nach einem weiteren Flakon aus – gerade als auf der anderen Seite der Tür Schritte erklingen.
Mir gefriert das Blut in den Adern, und ich erstarre. Die Schritte entfernen sich, doch das panische Gefühl bleibt. Für solche Spielereien habe ich keine Zeit. Ich atme tief durch, dann fange ich an, die Schubladen aufzuziehen. Ich muss irgendetwas finden, das die alte Dame nicht vermissen wird. Etwas Kleines, Unbedeutendes, das trotzdem teuer genug ist, um die Kosten für Anaellas Versorgung zu decken.
Bei der dritten Schublade halte ich inne, meine Hand schwebt unschlüssig über einer goldenen Schatulle. Sie ist rund und schwer, und in den Deckel ist ein Singvogel eingraviert, ein Rotkehlchen oder eine Nachtigall vielleicht. Ich bin wie verzaubert, der Vogel sieht so lebendig aus, als könnte er jeden Moment loszwitschern. Die Schatulle auch nur zu berühren, fühlt sich schon wie ein Verbrechen an. Mit bebenden Fingern hebe ich den Deckel, und mir verschlägt es den Atem. Ich habe ja mit Reichtum gerechnet, aber das übertrifft all meine Vorstellungen. Die Schmuckstücke sind so zahlreich wie Regentropfen auf einer Sommerwiese, sie stürzen über- und untereinander her, als würden sie alle um einen Platz ganz oben kämpfen: Edelsteine und Diamanten, die in einem schier endlosen Meer aus Gold um die Wette funkeln.
Ich schließe die Augen und drehe den Ring an meinem Finger. Den Ring, der mir einst eine blühende Zukunft verheißen hat und der nun nicht mehr als einen Silberfranc wert ist. Damit locke ich nicht einmal den billigsten Arzt hinter dem Ofen hervor. Ich brauche Geld, und das hier ist der einzige Weg, an welches zu kommen. Ich schüttle den Kopf und greife in die Schatulle, wobei ich versuche, eines der Schmuckstücke von ganz unten zu erwischen, denn ich gehe davon aus, dass deren Verlust am wenigsten ins Gewicht fällt. Wahrscheinlich sind sie eh längst vergessen.
Meine Finger schließen sich um etwas, das sich wie eine edelsteinbesetzte Halskette anfühlt.
»Komm schon …«, murmle ich, während ich mich abmühe, sie unter all dem anderen Schmuck hervorzukramen, in dem sie sich immer wieder verfängt. Schließlich gelingt es mir, sie zu befreien, und ich stoße ein kurzes, stummes Triumphgeheul aus. Die Kette besteht aus purem Gold und ist am unteren Ende mit silbernen Blättern verziert. Schlicht, aber elegant. Doch was mir daran besonders auffällt, ist der Stein – ein tränenförmiger Rubin, eingefasst in silberne Blütenblätter. Er fühlt sich warm an und funkelt so stark, dass er förmlich von innen heraus zu leuchten scheint.
»Das gehört dir nicht«, sagt eine tiefe Stimme hinter mir.
Ich wirble erschrocken herum, doch im selben Moment wird alles um mich herum dunkel. Jemand hat mir einen Sack über den Kopf gestülpt, dessen grober Stoff meinen Aufschrei verschluckt.
Kapitel 2Meine kleine Nachtigall
Die linke Seite meines Kopfes pocht schmerzhaft. Langsam öffne ich die Augen und blinzle, bis sich mein verschwommenes Blickfeld klärt. Der Raum um mich herum ist düster und stickig, in der Luft hängt ein unverkennbarer Schimmelgeruch.
Ich versuche, meinen Arm zu heben, kann ihn jedoch nicht bewegen. Er fühlt sich unangenehm steif an. Angestrengt kneife ich die Augen zusammen, um in der Dunkelheit etwas zu erkennen. Ich bin an einen Stuhl gefesselt, die Hände auf dem Rücken, die Füße mit einem Strick an die Stuhlbeine gebunden. Panisch zerre ich an meinen Fesseln, bewirke damit aber nur, dass sie mir tiefer in die Handgelenke schneiden.
Ist mein Angreifer hier? Ich drehe den Kopf hin und her. Soweit ich das feststellen kann, bin ich alleine. Das Letzte, woran ich mich erinnere, sind grobe Hände, die mich gepackt und über breite Schultern geworfen haben, gefolgt von einem dumpfen Schlag auf den Kopf. Die Polizei kann ich also ausschließen; dazu passt die Vorgehensweise nicht. Ein hauseigener Wachmann vielleicht?
Sollte ich schreien? Um Hilfe rufen? Um mich herum gibt es nichts als graue Wände. Keine Fenster. Keine Möbel. Nur eine kurze Treppe, die zu einer Betonplattform mit einer verriegelten Eisentür hinaufführt. Es scheint sich um eine Art Keller zu handeln – da kann ich schreien, wie ich will, niemand wird mich hören. Niemand außer denjenigen, die mich hier eingesperrt haben. Mein Herz beginnt zu rasen, und mein Atem geht kurz und stoßweise.
Was haben sie mit mir vor? Mich foltern? Mich an die Polizei ausliefern und ins Gefängnis werfen? Mich töten? Was wird aus Anaella, wenn ich einfach nicht mehr nach Hause komme? Wird sie glauben, ich hätte sie im Stich gelassen? Sie wird an gebrochenem Herzen sterben, bevor ihre Krankheit sie töten kann.
Ich zucke zusammen, als ich von draußen schwere Stiefeltritte höre, und zerre erneut an meinen Fesseln. Vergeblich. Das Klirren von Schlüsseln lässt mir das Blut in den Adern gefrieren, dann geht die Metalltür mit einem rostigen Kreischen auf.
Zwei riesige Männer stehen davor, ihre Köpfe streifen nur um eine Handbreit nicht die Decke. Sie treten ein und bauen sich wie eine schützende Mauer vor einer weiteren Person auf, deren Umrisse sich im Dunklen hinter ihnen auf der Treppe abzeichnen.
»Jungs«, sagt eine junge Frauenstimme, »seid so gut und bindet meinen Gast los, ja?«
Einer der Männer stapft auf mich zu. In seiner Hand blitzt ein Messer auf.
»Bitte tut mir nichts!«
»Keine Angst, meine Liebe«, beschwichtigt mich die Frau, während der Mann geschickt die Stricke um meine Handgelenke und Knöchel durchtrennt.
Ihr Tonfall klingt aufrichtig, aber ihre riesenhaften Handlanger sind mir nicht geheuer. Ich kauere mich auf dem Stuhl zusammen und massiere mir die Handgelenke. Während das Blut langsam und mit einem unangenehmen Kribbeln wieder in meine tauben Finger strömt, kehrt der Mann auf seinen Posten zurück. »Wer … wer sind Sie? Was wollen Sie von mir?«
Die Frau schwebt die Treppe hinab. Sie hält einen mehrarmigen Kerzenleuchter in den langen, zarten Fingern. Der Lichtschein fällt direkt auf ihr Gesicht, und die flackernden Schatten betonen ihre hohen Wangenknochen. Ihr glattes schwarzes Haar ist zu einem strengen Dutt zurückgebunden, und ihre dunklen Augen sind scharf und bohrend wie zwei Dolche. Als sie das Ende der Treppe erreicht, verziehen sich ihre Lippen zu einem wissenden Lächeln. Es liegt jedoch nichts Freundliches darin, sondern vielmehr ein Ausdruck von Überlegenheit, so als würde sie dahinter zahllose Geheimnisse verbergen, die sie jederzeit gegen mich verwenden kann.
Ihr gegenüber fühle ich mich auf einmal ganz klein, schwach, verängstigt. Ich fröstele. Irgendetwas an ihr fesselt mich fester an den Stuhl als noch die Stricke.
»Ich bin Madame Sibille, aber wenn unser Gespräch so verläuft, wie ich erwarte, kannst du mich Dahlia nennen.« Beinahe verspielt legt sie den Kopf schief, während sie den Kerzenleuchter an einen der Männer weiterreicht. Die Geste wirkt so selbstbewusst, so selbstverständlich, als wäre sie eine mächtige Herzogin, nur dass sie kein Heer ergebener Untertanen befehligt, sondern riesenhafte Ganoven mit Messern. »Und ich glaube, die eigentliche Frage lautet: Was willst du von mir?«
»Ich will gar nichts von Ihnen«, beteuere ich. »Ich möchte einfach nur nach Hause zu meiner Schwester.«
»Siehst du, und das ist gelogen. Wenn ich mich nicht irre, hast du dich ganz besonders hierfür interessiert.« Sie zieht die Kette, die ich zu stehlen versucht habe, hervor. Das Schmuckstück hängt einen Moment zwischen uns in der Luft und funkelt im schwachen Kerzenlicht, bevor sie es sich umlegt. Der Rubin schmiegt sich nahtlos in den Ausschnitt ihres eng anliegenden Kleides. Die meisten Damen der höheren Gesellschaft würden ihre Aufmachung als unanständig missbilligen: Die blutrote Seide umschmeichelt ihre Kurven wie eine zweite Haut und bringt ihre Figur perfekt zur Geltung.
Ich frage mich, wie es sich wohl anfühlt, solch ein Kleid zu tragen, sich derart sinnlich und verwegen zu zeigen. Fast bewundere ich sie dafür. Eine ungekannte Wärme steigt mir in die Wangen, als ich sie so unverhohlen anstarre. Das Gefühl ist beunruhigend … gefährlich. Furcht ergreift mich mit scharfen Klauen, und ich drehe schaudernd den Kopf weg.
»Es tut mir leid«, bringe ich so mühsam hervor, als wäre mein Mund voller Sand.
Diebe, Ganoven, Banditen. Sie alle lauern schon immer im zwielichtigen Untergrund der Stadt. Diese Frau, so elegant sie auch erscheinen mag, gehört eindeutig dazu. Menschen wie sie gewinnt man durch Macht, Bestechung oder Tauschhandel, doch ich habe ihr nichts zu bieten. Mir bleibt nichts anderes übrig als zu betteln.
»Ich bin keine Diebin«, erkläre ich. »Das schwöre ich Ihnen. Ich wollte nur etwas, womit ich einen Arzt für meine Schwester bezahlen kann. Sie ist krank, wissen Sie, und …«
Dahlia hebt die Hand, und meine Stimme erstirbt. Mein ganzer Mut ist mit einem Schlag verflogen.
»Ja, Anaella ist furchtbar krank, nicht wahr?« Ihr Tonfall ist so sanft wie das Schnurren einer Katze.
Entsetzen flutet jede Ader meines Körpers. »Woher … woher kennen Sie ihren Namen?«
Wieder ist da dieses berechnende Lächeln. Ich bekomme eine Gänsehaut. Was weiß sie sonst noch alles? Würde sie Anaella etwas antun, um mich für meinen Fehltritt zu bestrafen? Wie konnte ich nur so unvorsichtig sein? Ich verdiene, was auch immer mich erwartet. Wenn ich doch nur meine Schwester davor bewahren könnte …
»Ich weiß alles über dich, Cleodora«, erwidert Dahlia. »Ich lasse mich auf kein Geschäft ein, das ich nicht vorher sorgfältig geprüft habe.«
Ihre Worte dringen durch das Dröhnen in meinem Kopf und lassen mich stutzen. »Geschäft?«
»Ganz recht.«
Das muss eine Falle sein. Dieser Frau ist nicht zu trauen. Aber was habe ich für eine Wahl? Die riesenhaften Ganoven wirken nun, da sie abwartend im Schatten stehen, sogar noch größer.
»Du kannst auch ablehnen«, fährt sie fort, als hätte sie meine Gedanken gelesen, während sie langsam um mich herumgeht. »Allerdings bezweifle ich, dass du das willst, sobald du mein Angebot gehört hast.«
»Ich … ich kann Ihnen nichts dafür geben. Wenn Sie wirklich alles über mich wissen, muss Ihnen doch auch bekannt sein, dass ich kein Talent habe.«
»Und genau deshalb bist du perfekt.« Dahlia bleibt dicht vor mir stehen, zu dicht für meinen Geschmack. »Dein Vater hat dir einen Laden hinterlassen, den du ohne sein Talent nicht betreiben kannst. Deine Mutter hat ihr Talent an deine kranke Schwester übergeben, die damit nichts anfangen kann. Andere Freunde oder Familienmitglieder gibt es nicht – du bist praktisch unsichtbar. Doch statt dir Sorgen zu machen, wie du Essen auf den Tisch stellen kannst, versuchst du alles, um an Medizin zu kommen. Das ist eine schwere Last für so ein junges Mädchen. Gerade mal neunzehn.« Jasminduft hüllt mich ein, als sie sich vorbeugt, bis ihre Lippen beinahe mein Ohr berühren. »Ich weiß, wie du dich fühlst«, flüstert sie, ihr Atem warm auf meiner Haut. »Hilflos. Wertlos. Ich kann dir helfen, wenn du im Gegenzug mir hilfst.«
Ich soll ihr helfen? Es gibt nichts, was ich einer Frau wie ihr bieten kann, jedenfalls nichts, wofür ich nicht in eine Schattenwelt eintauchen müsste, mit der ich nichts zu tun haben will. Ich sollte Nein sagen, sie um Gnade bitten und für das Wohlergehen meiner Schwester beten. Doch irgendwo tief in mir regt sich etwas, das die Worte ersterben lässt, bevor sie meine Lippen erreichen. Woher hat sie bloß all die Informationen?
Ich fühle mich nackt, bloßgestellt. Sie hat treffsicher die Dinge ans Licht gezerrt, die ich am tiefsten bereue, für die ich mich am meisten schäme. Der Drang, schützend meine Arme um mich zu legen, ist geradezu überwältigend, aber ich zwinge mich stillzuhalten. Wenn sie wahrhaftig so viel über mich weiß, stimmt dann vielleicht auch der Rest von dem, was sie sagt? Kann sie mir tatsächlich helfen?
»Was muss ich dafür tun?«, frage ich mit zitternder Stimme.
Sie lehnt sich lächelnd zurück. Ich fühle mich wie benebelt, aber ich weiß nicht, ob das an ihrem Jasminparfüm liegt oder an ihrer berauschenden Ausstrahlung. »Weißt du, der Stein, den du Madame Adley stehlen wolltest, gehört ihr eigentlich gar nicht.«
»Madame Adley? Die berühmte Sopranistin?«
»Unausstehliche Person, wenn du mich fragst. Findest du nicht auch, Henry?« Dahlia dreht sich zu einem der Wachmänner um, der wie auf Kommando nickt. Es hat etwas Marionettenhaftes. »Wie dem auch sei«, seufzt Dahlia. »Dieser wunderschöne Edelstein war ein Geschenk meiner Familie, das ich schon seit Langem zurückzuholen gedenke.«
Ich runzle verwirrt die Stirn, als sie die Kette abnimmt und mit den Fingern den Rubin umkreist. »Was hat das mit mir zu tun?«
»Kannst du dir das denn nicht denken?« Dahlia lacht perlend, ein Geräusch, das so gar nicht zu ihr passt. »Das hier ist Madame Adleys Gesangstalent.«
»Was?« Ich suche in ihrem Gesicht nach der Lüge, nach irgendeinem Hinweis darauf, dass sie bloß mit mir spielt, doch ich finde nichts. »Das kann nicht sein. Die Kette lag ganz unten in ihrer Schmuckschatulle.« Ungläubig starre ich den funkelnden Rubin an. »Niemand würde ein Talent so …«
»Achtlos behandeln?«, vollendet Dahlia. »Du wärst überrascht, wie undankbar manche Menschen sind. Und genau das ist der Grund, weshalb ich auf der Suche nach jemandem bin, der dieses vernachlässigte Talent übernimmt. Jemandem wie dir.«
»Mir?« Obwohl die Angst immer noch in meinem Nacken kribbelt, muss ich beinahe lachen. Das kann doch nicht ihr Ernst sein. Ich bin ein Niemand. Ich habe kein Talent und auch sonst nichts vorzuweisen. Ich kann keine Opernsängerin werden. Keine Dame der höheren Gesellschaft. Wieso sollte sie das überhaupt wollen?
»Madame Adley hat vor, sich zur Ruhe zu setzen«, erklärt Dahlia. »Für eine Primadonna ist sie inzwischen zu alt. Sie hat keine Kinder und auch sonst keine Erben. Ich beobachte sie schon eine Weile und bin zu dem Schluss gekommen, dass es Zeit für sie wird abzutreten. Die heutige Aufführung ist Madame Adleys letzter großer Auftritt, danach wird sie Lutèce verlassen und sich in ihre Sommerresidenz an der Riviera zurückziehen.« Dahlia schnippt mit den Fingern, und einer der Wachmänner reicht ihr eine kleine Phiole, die mit einer dicken roten Flüssigkeit gefüllt ist.
Mein Mund wird ganz trocken, und mein Magen krampft sich schmerzhaft zusammen. »Ist das …?«
»Madame Adleys Blut.« Dahlia dreht die Phiole um und sieht zu, wie die rote Flüssigkeit am Glas hinabläuft. »Der gute Darrin hier hat es geholt, nachdem er dich hergebracht hat. Ich habe alles, was ich für eine Übergabezeremonie benötige. Nun musst du dich nur noch bereit erklären, ihren Platz einzunehmen.«
Mein Blick huscht zwischen dem Rubin und der Phiole hin und her. Das ist kein Trick. Keine Lüge. Sie will mir wirklich ein Talent geben – die eine Sache, von der ich dachte, dass ich sie niemals erlangen würde. Das Einzige, was imstande ist, den Scherbenhaufen zu kitten, zu dem mein Leben nach Vaters Tod zerfallen ist. Heißes Verlangen und eiskalte Furcht schwappen in Wellen durch meinen Körper, stürzen in- und übereinander, während ich gegen den Impuls ankämpfe, mir den Rubin zu schnappen und ihn nie wieder loszulassen.
»Du wirst der Welt als Madame Adleys entfernte Cousine präsentiert, die von ihr zur Erbin auserkoren wurde«, fährt Dahlia fort. »Du wirst zum Opernstar und bekommst ihren gesamten Besitz. Von dem Geld kannst du deiner Schwester die bestmögliche Versorgung finanzieren und ihr sogar ein eigenes Haus kaufen.«
Ich schüttle den Kopf. Ich komme einfach nicht hinterher. »Aber … ich habe keine Ahnung vom Singen.«
»Ich verschwende meine Zeit nicht mit ungeschulten Talenten.« Dahlias Augen blitzen erbost auf, doch sie blinzelt ihren Zorn gleich wieder weg. »Du wirst alle nötigen Fähigkeiten besitzen, sobald wir es auf dein Blut übertragen.«
Mein Blut … verknüpft mit einem Talent. Ich werde nicht länger ausgestoßen sein. Nicht länger am Rande der Gesellschaft vegetieren. Es klingt zu schön, um wahr zu sein. »Aber warum …?«
Dahlia schneidet mir das Wort ab. »Oh, ich kann es schon sehen.« Sie tritt hinter mich und streicht mir mit ihren zarten Fingern durchs Haar. Ich erschaudere, als sie mir die Rubinhalskette umlegt. »Unter all dem Schmutz bist du wunderschön. Wie gemacht für die Bühne.«
Ich weiß, ich sollte ablehnen. Ich sollte nicht mal mit dem Gedanken spielen. Es kann nichts Gutes daraus entstehen, nicht, wenn ich die Schattenseiten bereits erahnen kann. Aber ihre Worte haben tief in mir drin einen Funken entzündet, ein Verlangen, das ich nur allzu gut kenne. Es ist dasselbe Gefühl, das ich hatte, als ich die Angehörigen der Elite vor dem Opernhaus beobachtet habe: der Wunsch, dazuzugehören, respektiert und verehrt zu werden.
Zugegeben, es ist nicht das Talent, von dem ich immer geträumt habe, aber irgendwie macht es das noch aufregender. Es ist ein Neuanfang, ein Weg, meine Schwester und mich zu retten, die Tür zu einem Luxusleben, das ich mir nie auch nur vorzustellen gewagt habe. Das Gewicht des Steins drückt auf meine Brust – er ist so nah. In mir brennt eine Begierde, die ich mir in dieser Stärke nie zuvor zugestanden habe.
Ich muss ihn haben.
»Das Ganze hat natürlich seinen Preis«, ergänzt Dahlia.
»Alles, was Sie wollen!«, versichere ich, ohne nachzudenken. Das Echo meiner Stimme hallt durch den Keller.
Das Lächeln, das sich auf ihren Lippen ausbreitet, ist so atemberaubend schön, dass es fast schon unheimlich ist. »Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Weißt du, Cleo, in meiner Branche sind gute Verbindungen das A und O. Ich brauche Leute, denen ich vertrauen kann. Kann ich dir vertrauen?«
Ich nicke augenblicklich, obwohl irgendwo in meinem Hinterkopf die Alarmglocken schrillen. Wer ist Dahlia? Ich bin dem Namen Sibille noch nie begegnet, nicht mal, als Vater noch die Kleider für den Großteil der feinen Gesellschaft geschneidert hat. Mich mit ihr zu verbünden, wäre garantiert ein Fehler. Aber die Energie, die die Kette auf meiner Haut ausstrahlt, ist zu stark, und tief in meinem Inneren weiß ich, dass ich alles dafür tun würde, um sie zu besitzen. Um meine Schwester zu retten. Um mein Schicksal zu ändern.
»Als mein Vater Madame Adley das Talent an deinem Hals gegeben hat, war sie bloß ein Straßenköter«, sagt Dahlia. »Zum Ausgleich für ihre Dienste hat er ihr ein echtes Leben geschenkt. Nun, da sie sich zur Ruhe setzt, gehen ihre Pflichten auf dich über.«
»Was muss ich tun?«
»Ich möchte, dass du mir hilfst, meinen Kunden zu beschaffen, was immer sie wünschen. Ich kann mit Stolz behaupten, dass ich nie einen Auftrag ablehne. Sofern der Preis stimmt, versteht sich.« Sie lacht lang und gackernd.
Mein Blick huscht zu ihren beiden Handlangern, die so reglos wie Statuen dastehen. »Sie meinen … auf illegalem Weg?« Ich kann das Zögern in meinem Tonfall nicht verbergen.
Ihre Mundwinkel kräuseln sich. »Du wirst eine meiner Angestellten. Du mischst dich unter die Elite, lebst ihr Leben und gewinnst ihr Vertrauen, sodass ich deine Verbindungen nutzen kann, wofür auch immer ich sie brauche.«
»Ich weiß nicht, ob ich Ihnen folgen kann.« Ich senke den Blick. Auf dem Betonboden schimmern rund um meine Füße dunkelrote Flecken im flackernden Kerzenlicht. Mir wird flau im Magen. Was mache ich hier?
»Dieser Tage sind Talente mein lukrativstes Geschäftsmodell. Sie sind ein rares Gut, seit es keine neuen Steine mehr gibt.«
Rar ist untertrieben. Der Nachschub aus den Minen ist kurz vor meiner Geburt versiegt, was heftige Straßenunruhen zur Folge hatte. Doch selbst diese Aufstände konnten nichts an der Realität ändern: Neue Talente zu schürfen, ist ein Ding der Unmöglichkeit, wodurch die vorhandenen Steine nur noch wertvoller geworden sind. Aber wenn alle Talente in fester Hand sind, wie können sie dann als Geschäftsmodell dienen?
»Bedauerlicherweise«, fährt Dahlia mit sanfter Stimme fort, »führen Verhandlungen nicht immer zum gewünschten Ergebnis.« Ihre langen Finger umfassen mein Kinn und heben es an, sodass ich gezwungen bin, in die Tiefen ihrer schwarzen Augen einzutauchen.
Ihr Blick hält mich gefangen und raubt mir den Atem. Es liegt etwas Intimes in dieser Verbindung, ein Anflug von Verletzlichkeit, der mir Angst macht. Nur fühle ich mich dadurch keineswegs geschwächt. Ich mustere ihr makelloses Gesicht, so wie sie meins, und für diesen kurzen Moment komme ich mir beinahe ebenbürtig vor.
Dahlia verzieht keine Miene, und doch spüre ich, wie in ihrem Gesicht eine Veränderung vorgeht. Plötzlich ist da eine … nein, Unsicherheit ist es nicht. Neugier vielleicht? Sie verengt die Augen, bevor sie weiterspricht. »Ich möchte, dass du meine Diebin wirst.«
Schlagartig reißt die Verbindung zwischen uns. Vergebens suche ich nach einer passenden Erwiderung, öffne den Mund zum Protest, bringe aber keinen Ton heraus. Ich hätte wissen müssen, dass das kommt. Ich wusste es auch. Aber statt dem Ganzen sofort einen Riegel vorzuschieben, habe ich mir erlaubt, mich für einen Moment diesem gefährlichen Traum hinzugeben. Doch was sie von mir verlangt, ist der reinste Albtraum.
Ich bin keine Kriminelle.
Ja, ich habe versucht, die Kette zu stehlen, aber das sollte eine einmalige Sache sein. Eine Möglichkeit, meiner Schwester zu helfen, nicht mehr. Ich wollte lediglich ein einzelnes Schmuckstück nehmen, irgendetwas Unbedeutendes, längst Vergessenes, das niemandem fehlen würde. Kein Talent. Jemandem seine Gabe zu stehlen, ist das abscheulichste Verbrechen, das es gibt. Ich weiß nur zu gut, wie es sich anfühlt, seines Schicksals, seiner Zukunft beraubt zu werden.
Nachdem Vater sein Talent mit in den Tod genommen hatte, dauerte es nicht lange, bis die Welt sich Anaella und mir von ihrer grausamen Seite zeigte. Die Kunden waren die Ersten, die verschwanden, und mit ihnen mein Traum, Schneiderin zu werden und die lange Familientradition fortzuführen. Unsere Freunde blieben auch nicht viel länger, und bald darauf ging es mit der Gesundheit meiner Schwester bergab. Es war, als wären wir verflucht, zu einem Schattendasein verdammt, in dem wir Tag für Tag ums bloße Überleben ringen mussten.
Wenn ich mich auf dieses Angebot einlasse, haben all diese Mühen ein Ende. Ich muss mir nie wieder den Kopf darüber zerbrechen, wie ich genügend Essen beschaffen kann. Ich muss nie wieder weinend im Bett liegen, weil ich nicht anständig für meine Schwester sorgen kann und weil ich als Oberhaupt der Familie versage. Ich könnte endlich ein vernünftiges Leben für uns aufbauen.
Aber um welchen Preis? Ich würde meine Integrität verkaufen, alles woran ich glaube. Ich würde mir meine Träume verwirklichen, indem ich sie jemand anderem stehle. Indem ich mein Leid auf andere Menschen übertrage.
»Du bist besorgt«, flüstert Dahlia. »Du fürchtest, jemandem das Leben zu ruinieren. Aber wenn du mein Angebot akzeptierst, verspreche ich dir, dass du nur denjenigen etwas wegnehmen wirst, die es sich leisten können.«
Sie ist mir jetzt ganz nah, ihr Atem streicht warm über meine Haut. Alles an ihr wirkt sanft und weich – ihr ebenmäßiges Gesicht, ihre perfekten rosigen Wangen. Der Kontrast zu der Dunkelheit um uns herum könnte nicht größer sein.
Sie ist wie ein Engel oder eine gute Fee, gekommen, um mir einen Ausweg zu bieten. Oder ist sie nicht eher der Teufel, an den ich dafür meine Seele verkaufen muss?
Habe ich das Zeug, das zu werden, was sie von mir verlangt? Eine Diebin? Jemand, der lügt und betrügt, trickst und … stiehlt.
Ihre vollen Lippen öffnen sich einen Spaltbreit, und zu meiner Verblüffung verspüre ich urplötzlich den überwältigenden Drang, mich vorzubeugen und zu prüfen, ob sie so weich sind, wie sie erscheinen. Sie ist eine Verführerin, eine Wölfin im Schafspelz, die es versteht, ihren Opfern den Kopf zu verdrehen, indem sie ihnen die Erfüllung ihrer sehnlichsten Wünsche in Aussicht stellt.
»Ach, Cleo, du enttäuschst mich.« Sie seufzt, als ich noch immer nichts erwidere.
Mit einem Mal verspüre ich ein dumpfes Ziehen in der Brust. Ich bin mir nach wie vor nicht sicher, dass ich ihr wirklich absagen kann, wenn mir mein Leben lieb ist. Aber selbst wenn dem so wäre, weiß ich nicht, ob ich dazu imstande bin. Noch so eine Chance bekomme ich nicht. Wenn ich ein eigenes Talent haben möchte, wenn ich sicherstellen will, dass meine Schwester eine ordentliche Versorgung erhält, dann habe ich keine andere Wahl. Wölfin hin oder her, wie könnte ich jemals damit leben, dass ich mir das habe entgehen lassen?
»Ich habe ehrlich auf eine Zusammenarbeit mit dir gehofft.« Dahlia wendet sich zum Gehen und bedeutet ihren Männern, die Stricke aufzusammeln.
»Ich mach’s.« Die Worte kommen aus meinem Mund, ohne dass ich Kontrolle darüber habe.
»Oh!« Sie schlägt die Hände zusammen. »Habt ihr das gehört, Jungs? Was für eine Freude!«
Mein Herz hämmert so wild, dass ich fürchte, es könnte mir jeden Moment aus der Brust springen. Was habe ich getan?
Doch Dahlia wird sofort aktiv. Keine Zeit für Reue. Einer ihrer Männer nimmt mir die Kette mit seinen rauen Händen ab, und ich sehe bestürzt zu, wie er sie in seiner Faust zermalmt. Der Rubin löst sich aus der Fassung, und die silbernen Blätter rieseln zerbrochen zu Boden.
»Ausgezeichnet, Darrin.« Dahlia schenkt ihm ein perfektes Lächeln. »Henry, Schatz, das Blut.« Sie gibt ihm einen Wink, ohne mich aus den Augen zu lassen.
Ihr zweiter Begleiter tritt mit einem Messer in der Hand auf mich zu. Er greift nach meinem Arm, und obwohl ich weiß, dass es sich um einen entscheidenden Teil der Zeremonie handelt, verkrampfe ich beim Anblick der aufblitzenden Klinge und versuche instinktiv, mich loszureißen. Doch sein Griff ist hart wie Stahl. Im nächsten Moment schneidet die Klinge tief in meine Handfläche, sehr viel tiefer, als ich erwartet hätte. Mir entfährt ein leises Wimmern, und mein Atem geht schneller. Mein Brustkorb hebt und senkt sich, während Blut auf mein Kleid tropft.
»Je glänzender der Stein, desto blutiger das Talent.« Dahlias Stimme ist sanft wie ein Wiegenlied. Ich bekomme eine Gänsehaut, als sie die Hand ausstreckt und mir eine Locke aus der Stirn streicht. Mit geübtem Griff nimmt sie den Rubin und leert die Phiole mit Madame Adleys Blut darüber aus. »Vertrau mir«, sagt sie, bevor sie den Stein in meine verletzte Handfläche drückt.
Ich zucke zusammen, als ein brennender Schmerz durch die frische Schnittwunde schießt, schaffe es aber, meine Hand ruhig zu halten. Mit geschlossenen Augen atme ich tief durch, während sich mein Blut mit dem auf dem Stein vermischt. So wird die Magie von Madame Adley auf mich übertragen, die alte Verbindung ausgelöscht und durch eine neue ersetzt.
Ich habe mir so oft ausgemalt, wie es sich anfühlen würde, mit einem Talent zu verschmelzen. Vater sagte immer, es lasse sich am ehesten als überwältigende Ekstase beschreiben, so als würde man auf einer Wolke dahinschweben. Doch die Wärme, die sich in mir ausbreitet, ist weder weich noch luftig. Elektrische Ströme fließen von meinem Scheitel bis in meine Fingerspitzen, als wäre meine Wolke bis zum Bersten mit Blitzen gefüllt. Als sie schließlich nachlassen, bin ich völlig außer Atem. Gleichzeitig ist die Leere, die ich mein Leben lang in mir herumgetragen habe, verschwunden. Der Rubin pulsiert in meiner Hand, und mein Herz pulsiert im Gleichtakt. Und mit einem Mal fühle ich mich vollständig.
Dahlia küsst mich auf den Kopf, die Berührung ihrer Lippen so zart wie das Flattern von Schmetterlingsflügeln. »Du wirst eine fantastische Diva abgeben, meine kleine Nachtigall.«
Kapitel 3Goldener Käfig
Die ersten Strahlen der Morgensonne überziehen den Horizont mit Pinselstrichen in Scharlachrot und knalligem Orange, die sich leuchtend vom tiefblauen Nachthimmel abheben. Ich eile durch die stille Gasse. Mein Herz schlägt so laut, dass ich darüber kaum das Zwitschern der erwachenden Vögel höre.
»Such nicht nach mir. Meine Männer werden dich schon bald mit Anweisungen versorgen«, hat Dahlia mir mit auf den Weg gegeben, bevor ihr Handlanger mir wieder den Sack über den Kopf stülpte, damit ich nicht sehen konnte, wo ich mich befand. Ich habe den Verdacht, dass er mit der Kutsche noch ein paar Extrarunden gefahren ist, um ganz sicherzugehen. Zu guter Letzt hat er mich nur ein paar Blocks von zu Hause entfernt abgesetzt.
Was soll ich Anaella erzählen? Die Wahrheit kann ich ihr nicht sagen … sie würde sie niemals verstehen. Ich bin ja nicht mal sicher, ob ich das alles verstehe. Wie soll ich ihr erklären, wo ich war? Hat sie sehr gelitten, während ich die ganze Nacht weg war?
Ich wölbe die Finger über meine bandagierte Handfläche. Die Wunde ist immer noch frisch und schmerzt, aber zumindest sickert kein Blut durch den weißen Stoff. Ich hätte nie erwartet, dass so viel Blut erforderlich ist, um mit einem Talent zu verschmelzen. Aber gut, es war auch nie vorgesehen, dass ich ein derart mächtiges Talent erhalte – ein Elitetalent. Dieser Stein ist einer echten Dame vorbehalten, dem Adel von Lutèce, der die ältesten, machtvollsten Talente besitzt.
»Was für ein Schmuckstück hättest du gern? Eine Kette? Ohrringe?« Dahlias Stimme hallt noch in meinen Ohren wider.
»Können Sie ihn an meinem Ring befestigen?«
Ich schließe die Augen und sehe, wie sich Dahlias volle Lippen zu einem Lächeln verziehen. »So sentimental.«
Mit einem Schaudern verdränge ich das Bild aus meinen Gedanken und sehe den Rubin an meinem Finger an – den Preis für meine Seele. Die Energie, die von dem Stein ausgeht, jagt mir eine Gänsehaut über den Körper. Es ist ein ungewohntes, ein berauschendes Gefühl.
Morgentau glitzert auf dem Unkraut, das in den Ritzen des Kopfsteinpflasters wächst. Selbst die grauen Mauern wirken aufgefrischt, das goldene Licht übertüncht ihren Verfall. Für einen Moment bin ich wieder ein Kind, das die erwachende Welt mit hoffnungsvollem Blick bestaunt. Doch die Leichtigkeit schwindet, als ich die hölzerne Tür zu unserem Laden erreiche.
Der Rubin an meiner Hand funkelt hell, als ich nach dem Türknauf greife. Er erscheint viel zu groß für meine schlanken Finger. Schnell nehme ich den Ring ab und stecke ihn in meine Tasche. Die Tür knarrt, als ich eintrete.
»Cleo?«, ruft meine Schwester.
Schuldgefühle brechen über mich herein, als ich ihre schwache Stimme höre. Ich laufe ins Hinterzimmer, um mich zu entschuldigen, dass ich sie über Nacht sich selbst überlassen habe, aber sie ist nicht allein.
Beim Anblick des Mannes, der neben ihr sitzt, bleibe ich wie angewurzelt stehen. Hinter ihm steht eine Frau in einem weißen Kittel mit einem Stethoskop in der Hand. Ein Arzt? Verwirrt runzle ich die Stirn. War Anaellas Husten letzte Nacht so schlimm, dass jemand von den Nachbarn einen Arzt gerufen hat?
»Ich dachte schon, du hättest mich verlassen«, meint Anaella. Ein Scherz, das sehe ich ihr an. Ihre Augen sind halb geschlossen, ihre Haut stark gerötet und von kaltem Schweiß überzogen, aber trotzdem lächelt sie mich an.
»Mademoiselle Finley?«, fragt der Mann, der mir durch seine dicken Brillengläser entgegenblinzelt.
»Ja, und Sie sind …?«
»Ich bin Dr. Banks, und das ist Schwester Dupont. Wir haben bereits auf Sie gewartet.«
Mir bleibt der Mund offen stehen. Ich habe schon von Dr. Banks gehört. Er ist ein wahrer Wunderdoktor. Sein Talent verleiht ihm die Gabe, Krankheiten auf den ersten Blick richtig zu diagnostizieren und selbst die scheinbar aussichtslosesten Fälle zu kurieren. Seine Patienten sind entweder stinkreich oder so verzweifelt, dass sie bereit sind, ihr Erbe, ihre Familie und sogar ihre Seele für seine Dienste zu verkaufen. Aber ich habe meine Seele bereits verkauft. Ich habe nichts mehr, was ich hergeben könnte, um ihn zu bezahlen.
»Ihre Schwester muss rund um die Uhr versorgt werden«, erklärt Dr. Banks. »Ich habe ihr eine Kräutermixtur verschrieben, und Schwester Dupont wird eine wöchentliche Schröpfkur anwenden. Zudem benötigt die junge Dame viel Flüssigkeit, frisches Essen und ausreichend Sonnenlicht.«
Ich würde ihn gern fragen, was sie hat, aber die Angst schnürt mir die Kehle zu. Das Blut, das Anaella hustet, lässt mich ohnehin das Schlimmste fürchten. Wenn ich damit richtigliege, will ich nicht, dass sie seine Antwort hören muss.
Er holt eine Flasche aus seiner Ledertasche und drückt sie mir in die Hand. »Ich komme in ein paar Tagen wieder, um nach ihr zu sehen. Sollte sich in der Zwischenzeit etwas ändern, weiß Schwester Dupont, wie sie mich erreichen kann.«
»Vielen Dank«, platze ich heraus, und er nickt mir kaum merklich zu. Dadurch blitzt der funkelnde Saphir an seinem Ohrläppchen auf, der sonst hinter seinen schwarzen Locken verborgen ist. Gleich darauf eilt er zur Tür hinaus.
»Ich gehe Wasser heiß machen«, verkündet die Krankenschwester und wendet sich der kleinen Kochecke zu.
Anaella zieht die Augenbrauen hoch. »Wie hast du das nur hingekriegt? Ich habe mir schon Sorgen gemacht, als du gestern Abend nicht nach Hause gekommen bist.«
»Tut mir wirklich leid, dass ich so lange weg war.« Ich sinke neben ihr auf die Knie. »Ich …«
»Ein geheimer Liebhaber?« Anaella lacht leise, was jedoch nur den nächsten Hustenanfall auslöst. Ich halte ihre Hand, bis sie sich beruhigt, und achte dabei sorgfältig darauf, meine verletzte Hand vor ihr zu verbergen.
»Wo ist dein Ring?«, fragt meine Schwester.
»Mein Ring?«
Sie runzelt besorgt die Stirn, und mein Magen krampft sich schmerzhaft zusammen. Meine Schwester mit ihren dunklen Locken und den hoffnungsvollen Augen ist wunderschön, daran kann selbst ihre Krankheit nichts ändern. Ich hasse es, Geheimnisse vor ihr zu haben. Aber sosehr ich die Last, die auf mir liegt, auch mit ihr teilen möchte, ich kann es einfach nicht. Ich kann ihr nicht von dem Geschäft erzählen, auf das ich mich eingelassen habe, von dem Preis, den ich bereit war zu zahlen: zu lügen, zu betrügen, zu stehlen. Nein, ich werde sie nicht der dunklen Schattenseite von Lutèce aussetzen. Nicht in diesem Zustand.
»Ich habe ihn verkauft.« Die Lüge kommt mir viel zu leicht über die Lippen.
Sie stützt sich auf die Ellbogen, was sie so viel Kraft kostet, dass sie vor Anstrengung zittert. »Cleo, das war …«
»Eines der wenigen Dinge, die noch von Vater übrig waren. Ich weiß … Aber du bist wichtiger, Ann.«
»Warum hörst du einfach nicht auf mich? Wir könnten meine Entwürfe verkaufen oder …«
»Ich habe einen Job.«





























