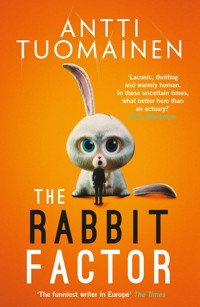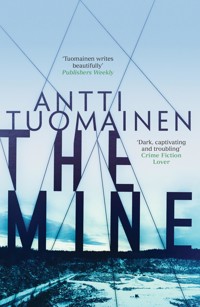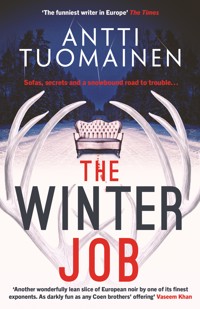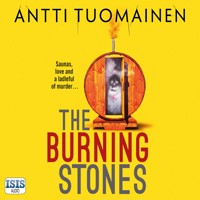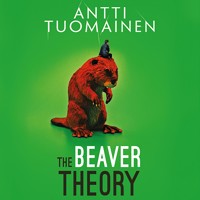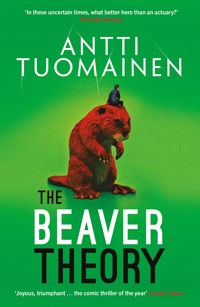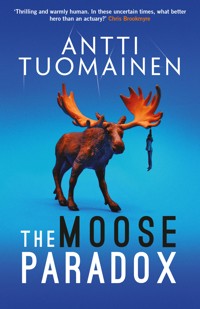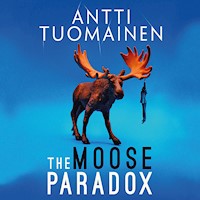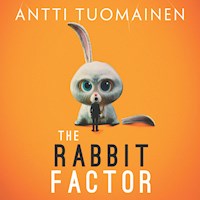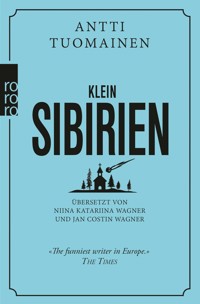
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Nr. 1 aus Finnland: Von The Times ausgezeichnet als eines der besten Bücher der letzten fünf Jahre, prämiert mit dem Petrona Award als bester skandinavischer Kriminalroman 2020. Rallyefahrer Tarvainen rast mit zu viel Promille und Selbstmordgedanken durch die schneebedeckten finnischen Wälder, als es am Himmel aufblitzt und etwas in sein Auto kracht. Das Etwas entpuppt sich als äußerst wertvoller Meteorit, so viel ist schnell allen Bewohnern des Örtchens Hurmevaara klar. Der Schatz wird vorübergehend in die Obhut von Pfarrer Joel gegeben, der als ehemaliger Militär kampferfahren ist. Was sich auszahlt, denn von dem Meteoriten hat auch das organisierte Verbrechen Wind bekommen. Dabei hat Joel ganz andere Sorgen. Seine Frau ist schwanger, aber nicht von ihm. Und so kämpft er gegen Berufskriminelle und andere Schatzsucher und fragt sich derweil, was für ihn in den Sternen steht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Antti Tuomainen
Klein-Sibirien
Roman
Über dieses Buch
Alles Gute kommt von oben.
Rallye-Fahrer Tarvainen rast mit zu viel Promille und Selbstmordgedanken durch die schneebedeckte Einöde Nordfinnlands, als es am Himmel aufblitzt und kurz darauf etwas in sein Auto kracht. Das Etwas entpuppt sich als äußerst wertvoller Meteorit, so viel ist schnell allen Bewohnern des Örtchens Hurmevaara klar. Der Schatz wird vorübergehend in die Obhut von Pfarrer Joel gegeben, der als ehemaliger Militär nicht ganz kampfunerfahren ist. Was sich auszahlt, denn von dem Meteoriten hat auch das organisierte Verbrechen schon Wind bekommen.
Dabei hat Joel ganz andere Probleme. Seine Frau ist schwanger, nur wohl leider nicht von ihm. Und so kämpft er gegen Berufskriminelle und andere Schatzsucher und fragt sich derweil, was für ihn in den Sternen steht.
«Eine Achterbahnfahrt und außerordentlich ergreifend.» Guardian
Von der Times ausgezeichnet als eines der besten Bücher 2019.
Vita
Antti Tuomainen, Jahrgang 1971, ist freier Journalist und einer der angesehensten finnischen Schriftsteller. Er wurde u.a. mit dem Clue Award, dem Finnischen Krimipreis, ausgezeichnet. Der Autor lebt mit seiner Frau in Helsinki.
Niina Katariina Wagner wurde 1975 in einer kleinen Küstenstadt im Südwesten Finnlands geboren. Sie studierte Soziologie, Psychologie und Kulturgeschichte in Turku und ist seit 2000 als freie Künstlerin in der Nähe von Frankfurt am Main tätig.
Jan Costin Wagner, 1972 geboren, lebt als freier Schriftsteller und Musiker in der Nähe von Frankfurt am Main. Seine Romane wurden in 14 Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet. Finnland, der Schauplatz der Romane um den jungen Ermittler Kimmo Joentaa, ist seine zweite Heimat.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel «Pikku Siperia» bei Like, Helsinki.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Februar 2020
Copyright © 2020 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«Pikku Siperia» Copyright © 2018 by Antti Tuomainen
Covergestaltung bürosüd, München
ISBN 978-3-644-00409-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Warmherzig und in Dankbarkeit Aino Järvinen, meiner Finnisch-Lehrerin, gewidmet.
Danke für die Improbatur und die Laudatur;
vor allem dafür, dass Du mir vor dreißig Jahren gesagt hast, dass das Schreiben etwas für mich sein könnte.
Ich verspreche, mein Bestes zu geben.
«Als ich auf halbem Weg stand unsers Lebens,
fand ich mich einst in einem dunklen Walde,
weil ich vom rechten Weg verirrt mich hatte.»
DANTE, Die Göttliche Komödie
Prolog
Der warme Schnaps zieht und zerrt von innen an seinem Mund, entzündet ein Feuerchen im Rachen. Er hat es unter Kontrolle. Der Wagen gleitet durch die Kurve, bei gleichbleibend hoher Geschwindigkeit.
Der Mann löst jetzt auch die rechte Hand vom Lenkrad, schaltet, wirft einen Blick auf den Tacho. Ein wenig schneller als 130. Eine wunderbare Geschwindigkeit an bitterkalten Wintertagen wie diesem, bestens geeignet auch für eine kurvige Straße wie diese hier, tief im finnischen Osten, in Hurmevaara.
Nicht zu vergessen, dass die Sicht bei Nacht schlecht ist. Auch wenn die Sterne hell leuchten.
Mit dem linken Fuß betätigt er ruckartig die Kupplung, mit dem rechten drückt er das Gaspedal durch. Er hebt wieder die Flasche an den Mund, nimmt einen Schluck, dieses Mal einen kleineren.
Ja. So trinkt man diesen Schnaps. Koskenkorva.
Zuerst ein großer Schluck, der die Zähne vom Kiefer abzulösen scheint und wie ein Feuerball brennt. Dann ein kleinerer als Nachschlag, der den Rachen benetzt, das Feuer löscht und vonnöten ist, um den ersten Schluck in die Körpermitte zu befördern.
Ja. Und so fährt man Auto.
Er erreicht den höchsten Punkt der Strecke, vor ihm liegt der sanft kippende Abhang, der den trügerischen Eindruck vermittelt, er sei leicht zu befahren. Auf den ersten Blick scheint es auszureichen, das Lenkrad gerade zu halten und Gas zu geben. Aber nein. Die Straße hat nämlich eine kaum merkliche Neigung zur linken Seite, und je schneller man fährt, desto größer ist die Gefahr, von diesem unscheinbaren Weg mitsamt seinem Wagen abgeworfen zu werden.
Der Mann hält das Lenkrad fest umschlossen. Seine Geschwindigkeit beträgt inzwischen 165 Stundenkilometer. Damit wäre er auf einer Etappe während der Weltmeisterschaft keineswegs chancenlos. Er weiß das. Es ist eine schmerzhafte Erkenntnis.
Rechts von ihm öffnet sich malerisch der Blick auf den vereisten Hurme-See. Fischer haben Flaggen ins Eis gerammt, um Eislöcher und die Netze für die Muränen kenntlich zu machen. Manchmal, wenn er hier vorbeifährt, hält er Ausschau nach den Flaggen, denn sie erinnern ihn an die Fahnen, die einst die jubelnden Zuschauer geschwenkt haben. Heute, in dieser Nacht, muss er das nicht sehen.
Er richtet das Lenkrad minimal nach rechts aus, um die Neigung der Straße auszugleichen. Als sich eine weitere Kurve in sein Sichtfeld hineinschlängelt, nimmt er den Fuß vom Gas. Füße und Hände arbeiten perfekt im Einklang. Er tritt die Kupplung, schaltet, die Bewegungen fließen in explosiver Abfolge ineinander. Er rammt sich die Flasche zwischen die Oberschenkel, packt mit der Linken das Lenkrad, mit der Rechten den Schaltknüppel, dann hebt er den Wagen in die Schwebe, beschleunigt. Er lässt zu, dass sich der Wagen an seiner eigenen Wucht ergötzt. Bremsen sind etwas für Amateure. Amateure wie den, von dem er sich den Wagen geliehen hat.
Schließlich erreicht er, nach einer kurzen ebenen Strecke, einen Hügel. Er spürt ein Brennen im Magen.
Das ist nicht der Schnaps, das ist das Schicksal.
Er beschleunigt weiter, ringt dem Fahrzeug die maximale Leistung ab. Das erfordert Perfektion. Er muss den Audi beherrschen, beherrscht er ihn, beherrscht er die Situation.
Man kann nicht einfach so Vollgas geben. Wer das tut, verliert die Kontrolle.
In diesem Moment würde das konkret bedeuten, dass er entweder in die rechte oder die linke Schneebank schleudern würde, mit mehrfachen Überschlägen. Am Ende würde das Auto auf dem Dach liegen.
Wenn er Glück hätte. Falls nicht, falls der Fahrer einen Moment zu lange zögert, würde der Wagen direkt im dichten Tannenwald zerschellen. Er würde sich um einen vereisten, meterdicken Baumstamm herumwickeln, wie Geschenkpapier.
Der Mann glaubt nicht an Glück. Er glaubt nur an die richtige Geschwindigkeit, im richtigen Moment.
Insbesondere jetzt, in diesem Moment, in dem alles ein Ende findet. Ein Ende, das ihm gefällt. Weil es passt.
Er fährt knapp 200, als er den höchsten Punkt der Anhöhe erreicht. Dann beginnt er zu fliegen. Hebt die Flasche an die Lippen. Das erfordert ebenso Genauigkeit wie das Steuern des Wagens. Seine linke Hand führt die Flasche routiniert und entspannt. Der Schnaps fließt in seinen Mund, an seinen Lippen entlang, während der Audi der frostigen Nacht entgegenschwebt. Sein Rachen brennt, er denkt an süße Flammen, eineinhalb Tonnen Stahl, Aluminium, ein heulender Motor, nagelneue Spike-Reifen stehen unter seinem Kommando.
Der Wagen fliegt, lange und weit. Er landet, als auch die Flasche wieder ihren Platz findet, zwischen seinen Oberschenkeln.
Er legt einen kleineren Gang ein, beschleunigt, schaltet wieder hoch. Es geht steil bergab, dann für Sekunden ebenerdig, dann schnellt der Wagen wieder eine Anhöhe hinauf. Dann wieder freier Fall. Es gelingt ihm, seinen Blick zugleich auf die rot leuchtenden Ziffern des Tachometers und die Flasche zwischen seinen Beinen zu heften. Der Tacho zeigt 200 an. Die Flasche etwas weniger als einen Deziliter. Dann prasseln die Spikes der Reifen wieder gegen die Straße, wie Maschinengewehrfeuer. Er lächelt, so gut es eben geht, mit vom Schnaps brennenden Lippen.
Er ist voll in Fahrt. Die, die ihn vertrieben haben, werden es bitter bereuen. Man hat ihn verleumdet, man hat ihn ausgegrenzt. Mag sein, dass er stirbt, aber weil das seine eigene Wahl ist, wird er sich über alles und jeden erheben. Er holt sie ein, überholt sie, winkt den Schleichern zu, während er sie links liegenlässt.
Der Gedanke ist wuchtig und warm. Er brennt in seinem Hirn, wie der Schnaps in seinem Rachen. Er trinkt gierig. Ein letztes Mal geradeaus. Der Audi scheint spitze Schreie auszustoßen.
Er öffnet das Fenster auf der Fahrerseite. Sein Gesicht ist vor Kälte starr, seine Augen tränen. Er wirft die leere Flasche durchs Fenster, in den Schnee.
Geradeaus. Bald kommt die T-Kreuzung. Er hat nicht die Absicht abzubiegen. Er denkt an den breiten Felsen, direkt hinter der Kreuzung.
Der Fahrer bestimmt die Höchstgeschwindigkeit. Das ist nicht diskutierbar, nichts, worüber man lange palavert. Es heißt immer, dass diese oder jene Höchstgeschwindigkeit zu diesem oder jenem Wagen gehöre, aber das ist Unsinn.
Er betrachtet den Tacho, der 240 Stundenkilometer anzeigt. In einem Auto, das angeblich bei 225 schlappmacht.
Er fokussiert die Straße, konzentriert sich darauf. Die letzten Kilometer. Dann aus. Aus und vorbei.
So ist das also, das ist das Ende, denkt er, in dem Moment, in dem er die Detonation hört. Er spürt sie auch. Sie wühlt sich durch seinen Körper, rüttelt ihn durch. Bruchteile von Sekunden laufen vor seinen Augen ab wie ein Film. Ein Lichtblitz. Dann ein Schatten. Senkrecht stehen sie im Raum, und sein Herz setzt aus. Dann beginnt es wieder zu pochen, laut und dumpf. Als würde jemand in unmittelbarer Nähe Metall schmieden.
Seine Sinne, alle fünf, sind geschärft, unmittelbar, so intensiv wie nie zuvor in seinem Leben. Er riecht das zerborstene Wagendach, er schmeckt den Kunststoff des aufgeplatzten Innenraums, er fühlt die Druckwelle, die über seine Hände streicht, er hört, obwohl möglicherweise sein Trommelfell geplatzt ist, die Explosion. Er hört sie weiter und weiter, in der Stille, in seinem Kopf.
Er handelt intuitiv. Schaltet in einen kleinen Gang, tritt die Kupplung durch, dann das Gas, die Bremse, dann Fuß vom Gas, Handbremse anziehen und gleiten. Treiben lassen. Das Auto rutscht auf die Kreuzung zu, dann steht es still.
Er weiß nicht, wie lange er so dasitzt, in der Stille. Nichts bewegt sich. Vielleicht eine Minute, vielleicht zwei Minuten. Er kann sich nicht bewegen. Sobald er dazu wieder in der Lage ist, sobald er seinen Griff vom Lenkrad lösen kann, wird er sich die Sache aus der Nähe ansehen.
Ihm ist durchaus klar, dass im Wagendach ein riesiges Loch klafft. Auch der Beifahrersitz ist durchlöchert. Der Durchmesser beider Löcher beträgt etwa vierzig Zentimeter. Wie gut, dass er eine Flasche Schnaps genossen hat. Hätte er das nicht getan, würde ihn der Anblick vermutlich verstören.
Er löst den Gurt, hält inne. Ganz ruhig, denkt er. Alles noch mal in Ruhe sortieren. Ein Loch im Dach. Ein Loch im Beifahrersitz. Er selbst sitzt wohlbehalten auf dem Fahrersitz. Das Loch ist neben ihm.
Er steigt aus. Dreht sich einige Male langsam um die eigene Achse. Endloser Schnee, helle, frostige Nacht. Mondschein, Sternenlicht. Der Schnee knirscht unter seinen Schuhen, während er um den Wagen herumläuft. Das Loch im Dach sieht aus wie ein verdrehter Kussmund, der sich tief hineingebohrt hat ins Metall. Er öffnet die Beifahrertür. Ja, tatsächlich, zerfetzte Lippen, ein Kuss, der ins Leere zielt, ins ausgehöhlte Innere des Wagens. Das Loch im Sitz sieht irgendwie obszön aus. Er lugt hinein ins Schwarze. Klar ist Folgendes: Was auch immer dieses Loch im Sitz verursacht hat, es ist da unten, denn er kann keinen Schnee sehen. Es ist durchs Dach eingetreten, hat sich durch den Sitz gebohrt und ist dann … stecken geblieben.
Er tritt einige Schritte zurück. Der Schnee knirscht. Sein Herz pocht.
Er hat sich darauf vorbereitet zu sterben. Dann ist etwas passiert. Und er lebt.
Gerade jetzt findet die Rallye Monte Carlo statt. Da sind jede Menge Leute. Schnaps aus den Alpen. Keine Löcher in den Autos. Nichts dergleichen. Nichts fällt …
… vom Himmel.
Er sieht nach oben. Da ist nichts. Da gibt es ohnehin eher selten irgendetwas zu sehen. Abgesehen von den Sternen, vom Mond und von der Sonne, wenn der Winter vorbei ist. Wolken. Flugzeuge. Aber doch nicht …
Er ist ein vernünftiger Mensch. Es gibt keine Außerirdischen, keine UFOs.
Eine Erinnerung zuckt auf. Da lief was im Fernsehen kürzlich. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis ein Komet mal die Erde trifft. Das behauptete dieser Typ in der Sendung. Der Aufprall werde eine neue Eiszeit auslösen, der Staub, der aufwirbeln werde, könne die Sonne verdunkeln. Alle würden sterben.
Alle, außer ihm, ganz offensichtlich.
Wobei … ist es nicht unlogisch zu glauben, dass ausgerechnet derjenige überlebt, der beim Einschlag des Kometen einen halben Meter entfernt sitzt? Warum sollen alle anderen sterben? Nein, auch wenn er hier, in der Ödnis, keine Lebenszeichen wahrnehmen kann, geht er davon aus, dass auch in diesem Moment im Dörfchen Hurmevaara jemand an seinem Wurstbrot knabbert.
Das bedeutet, dass es sich keineswegs um einen Kometen handelt.
Aber irgendwas in der Art muss es sein. Er weiß es nicht. Es ist kalt. Weder der Schnaps noch der Gedanke an den Tod können ihn jetzt noch erwärmen.
Wo ist sein Handy? Es müsste in der Brusttasche seines Overalls sein, hinter dem Reißverschluss, aber da ist es nicht. Er ist losgefahren, um zu sterben, nicht um zu telefonieren. Plötzlich spürt er, dass er stockbesoffen ist.
Wo ist das nächstgelegene Haus?
Ja, daran erinnert er sich.
Etwa drei Kilometer von hier. Aber dahin wird er nicht zurückkehren. Das übernächste Haus ist noch etwa einen Kilometer weiter entfernt.
Er läuft. Nach einigen hundert Metern bleibt er stehen. Er füllt seine Hände mit Schnee, wäscht sich das Gesicht. Das fühlt sich gut und richtig an. Es schmerzt, betäubt die Finger, die Wangen, das Gesicht. Aber es ist gut, sauber zu sein. Rein. Es ist wichtig. Er läuft weiter. Hält erneut inne.
Er wendet sich um, sieht das Auto in der Ferne. Dann betrachtet er den Himmel.
Was zum Teufel … ist da oben?
IDer Himmel stürzt ein
1
«Weißt du, was dann als Nächstes passiert?»
Seitdem ich Pfarrer der kleinen Gemeinde von Hurmevaara bin, seit genau einem Jahr und sieben Monaten, kommt der Mann, der diese Frage stellt, bei jeder Gelegenheit in meine Sprechstunde. Er notiert auf seinen förmlichen Terminreservierungen immer, dass er ausschließlich mit mir sprechen möchte. Mit Pfarrer Joel Huhta. Warum habe ich bis heute nicht begriffen.
Der Hintergrund ist immer der gleiche. Seelsorge. Aber der Blickwinkel, aus denen der Mann seine Themen betrachtet, ist immer ein wenig verändert.
Der Mann kratzt sich an der Wange, die übersät ist von kreuz und quer wachsenden Bartstoppeln, teilweise sind sie so dick und dunkel, dass seine Finger sie nicht durchdringen können. Er hat blaue Augen, in denen ich keine Freude finde. Das ist allerdings auch nicht verwunderlich, in Anbetracht der Prognosen, die er allwöchentlich stellt.
«Ich kann leider nicht hellsehen», sage ich.
Der Mann nickt.
«Die Vereinten Nationen können es», sagt er. «Ich habe mir die aktuelle Vorhersage zur Entwicklung der Weltbevölkerung angesehen. Momentan sind es 7,6 Milliarden Menschen. Im Jahr 2030, also in nicht allzu ferner Zukunft, werden es 8,5 Milliarden sein. Um 2050 herum werden es 9,7 Milliarden sein. Und am Ende des Jahrhunderts stehen wir dann, Abrakadabra, bei 11,2 Milliarden. Das ist eine vorsichtige Schätzung. Was sagst du dazu? Was nun?»
Ich sage gar nichts. Im Gemeinderaum herrscht Stille. Wir sind im nordöstlichen Flügel des Hauses, im Zimmer sind an beiden Fenstern die Jalousien heruntergelassen. Hinter den Jalousien verbirgt sich ein dunkler, verschneiter Nachmittag. Der Winter hat mit einiger Verzögerung nun doch begonnen. Wenn ich in den vergangenen Wochen meinen Blick über den Hurmesee habe gleiten lassen, habe ich zuletzt noch mehr als sonst daran gezweifelt, dass ich den Jahreszeitenkalender zu interpretieren verstehe.
Mein Zimmer ist sparsam eingerichtet. Annähernd japanisch. Niedrige Tische und dicke Teppiche. Wir sitzen auf den beiden Stühlen, die in diesem knapp 20 Quadratmeter großen Raum verfügbar sind.
«Und was sagen wir denn dann, wenn es von uns Finnen immer noch diese läppischen 5 Millionen gibt?» Er spricht mit fester Stimme, aber freudlos, trübe ist sein Blick. «Aber vielleicht wird es nicht mal die noch geben. In Afrika leben zurzeit etwa eine Milliarde Menschen, Ende des Jahrhunderts werden es viermal so viele sein. Also etwa 4,5 Milliarden. Es wird aber weniger Ressourcen geben, weniger Nahrung. Glaubst du, dass die Leute alle dableiben und darauf warten, dass Hunger und Durst ins Unermessliche steigen? In Afrika gebären Frauen durchschnittlich etwa fünf Kinder. Mal angenommen, dass eines von fünf die Entscheidung trifft, etwas zu ändern. Eines von fünf hat genug von Hunger, Armut, Krieg und Trockenheit. Eines von fünf Kindern entscheidet sich zu gehen. Oder es wird losgeschickt, um seinen Lebensunterhalt in besseren Gegenden zu verdienen.
Nehmen wir weiter an, dass es eine Art natürlicher Auslese gibt und dass dementsprechend nur jeder Zehnte diesen Weg gehen wird. Und dann nehmen wir an, dass jeder Zwanzigste auch tatsächlich ankommt. Na ja, das ist vielleicht zu tiefgestapelt. Egal. Lass uns den Blick erweitern, sagen wir, bis Ende des Jahrhunderts. Also, wir nehmen mehrere Generationen in den Blick. Wir nehmen von mir aus an, dass es noch weniger Menschen bis nach Europa schaffen. Von mir aus nur 2,5 Prozent von 4,5 Milliarden. Was würdest du schätzen, wie viele Menschen das sein werden? 112,5 Millionen. Wohin mit denen? Wo finden die Raum? Und unter welchen Umständen? Wer willigt ein, diese Menschen aufzunehmen? Das ist 112-mal die Flüchtlingskrise von 2015. Und die Zahl beruht auf einer defensiven Schätzung. Weil gar nicht berücksichtigt ist, dass Menschen geboren werden und sterben, millionenfach, in diesem Zeitraum. Diese 4,5 Milliarden entspringen einer vorsichtigen Prognose. Die eigentliche Geschichte, die Zukunft mit ihren Unwägbarkeiten, liegt noch vor uns. Schon immer kamen Menschen zur Welt, gingen ihren Weg, starben. Kinder wurden gezeugt. Geschenke Gottes.»
Der Mann sucht meine Augen. Ich vermute, dass er nichts wissen kann. Natürlich nicht. Ich habe niemandem davon erzählt. Niemandem.
«Der Herr weiß, dass ich meinen Teil getan habe», sagt der Mann. «Ich habe meinen Part geleistet, vor meiner Scheidung. Aber das hat damit nichts zu tun. Ich bin Ingenieur, und die Mathematik ist mein Hobby. Mein Steckenpferd. Ich träume nicht herum, ich phantasiere nicht. Das liegt mir nicht. Ich stelle Berechnungen an. Jede dieser Berechnungen belegt Folgendes: Die Welt geht unter.»
Ja. Fast täglich, um diese Zeit.
«Und da wir nun in dieser Welt leben», sagt der Mann, «in einer Welt, die nachweislich enden wird, und zwar sogar ziemlich bald, dann … ja, dann gibt es keine Hoffnung.»
Ich begreife nicht, warum dieser Mann immer wieder zu mir kommt. Vielleicht will er einfach, dass ich ihm irgendwann zustimme. Das wäre menschlich, verständlich. Es wäre angenehmer für ihn, Mitwissende zu haben, gemeinsam auf den Untergang zuzusteuern. Allein ist dieser Weltuntergang ein schwieriges, trübes, graues Unterfangen. Und weil ihm sonst niemand zuhören möchte, kommt er eben zum Gemeindepfarrer.
«Man kann immer Hoffnung schöpfen», sage ich.
«Warum?»
«Eine Antwort auf diese Frage wäre, dass Hoffnung uns in die Lage versetzt, für uns und andere das Beste zu wollen und zu geben.»
«Das soll eine Antwort sein?»
«Das ist die Antwort, die ich habe.»
«Bald wirst du hinzufügen, dass nur Gott alle Antworten kennt.»
«Die Sache ist die, unsere Zeit läuft langsam ab …»
«Darauf wollte ich hinaus», sagt der Mann.
«Nein, Entschuldigung, ich meinte, dass die Sprechstunde sich dem Ende zuneigt. Also, ich habe einen weiteren Termin. Wir haben bald vier Uhr.»
«Ich habe mich aber gerade erst warmgeredet.»
«Es ist mir wichtig, jedem dieselbe Zeit einzuräumen», sage ich und füge sicherheitshalber hinzu: «Also, hier, während der Sprechstunde.»
Der Minutenzeiger der Uhr, die über der Tür hängt, schiebt sich gerade auf die volle Stunde. Der Zeiger vibriert kurz, scheint innezuhalten, als sei er erschrocken über die plötzliche Begradigung. Der Stundenzeiger steht auf der Vier. Der Mann rührt sich nicht. Macht keine Anstalten zu gehen. Er hat noch eine Frage auf den Lippen. Ich sehe es schon, bevor er den Mund öffnet.
«Wie denkst du eigentlich über diesen Meteoriten?», fragt er.
Sechs Tage. Sechs Tage, in denen es nur ein Thema gab, den Meteoriten. Sechs Tage und sechs Nächte, in denen jeder nur über das eine gesprochen hat. Der Meteorit hier, der Meteorit da.
«Ich denke eigentlich gar nichts darüber», sage ich.
Das ist die Wahrheit. Wahr ist allerdings auch, dass ich dem Komitee des Dorfes angehöre, das sich zur Aufgabe gemacht hat, das Militärmuseum zu bewachen, solange dieser Meteorit dort aufbewahrt wird. Das soll noch einige Tage lang der Fall sein, dann wird er nach Helsinki gebracht und von dort nach London, wo er in einem Weltraumlaboratorium untersucht werden soll. Die Entscheidung, die Bewachung des Objektes Freiwilligen anzuvertrauen, ist letztlich der Tatsache geschuldet, dass wir uns im Dorf gar keinen Sicherheitsdienst leisten könnten. Die nächste Polizeiwache befindet sich in Joensuu, etwa 90 Kilometer entfernt. Ich habe meine Nachtwache im Museum abgeleistet, aber auch da wenig über den Meteoriten nachgedacht. Ich habe eine halbe Stunde lang in der Bibel gelesen und dann ausgiebig in einem Roman von James Ellroy.
«Er ist vom Himmel gefallen», sagt der Mann.
«Ja. Das tun sie in der Regel.»
«Vom Himmel. Von Gott.»
«Ich würde eher sagen, er kam aus dem All.»
«Ich werde nicht schlau aus dir», sagt der Mann.
Die Evolutionstheorie hat mich geprägt, denke ich, aber das spreche ich nicht aus. Ich will das Gespräch nicht unnötig in die Länge ziehen.
«Nun, es ist vier Uhr.»
«Tarvainen sagt, dass der Meteorit ihm gehört.»
Das sagen viele. Etwa die Hälfte aller Dorfbewohner. Tarvainen ist mit Jokinens Wagen unterwegs gewesen, vorbei an Koskirantas Grund und Boden, mit Benzin von Eskola, und er hat vom Haus der Liesmaas aus bei Ojanperä angerufen und ihn um Hilfe gebeten. Der kam, gemeinsam mit Vihinen, in einem Wagen der Spedition Vihinen&Laitakari, die wiederum zur Hälfte Paavola gehört. Und so weiter.
«Die Zeit schreitet nun wirklich voran …»
«Das Ding ist eine Million wert. Habe ich gehört.»
«Möglich», sage ich. «Wenn sich herausstellen sollte, dass er tatsächlich eine solche Seltenheit ist, wie zunächst vermutet worden ist.»
Der Mann erhebt sich. Er geht so aufreizend zögerlich zur Tür, dass ich intuitiv den Atem anhalte. Er erreicht die Tür, es gelingt ihm, die Klinke hinunterzudrücken.
«Ich bin gar nicht dazu gekommen, über die zweite Phase der Ebolaepidemie zu sprechen», sagt er.
«Gott sei mit dir», sage ich.
Endlich allein. Ich ziehe die Jalousien hoch. Hinter dem Fenster ist alles dunkel. Eine Dunkelheit, die an Wasser erinnert, durch das man tauchen könnte. Ich habe den ganzen Tag lang Menschen zugehört, und alle haben, auf die eine oder andere Weise, von Kindern gesprochen. Eine Zeitlang blieb ich von der Thematik verschont.
Von dem großen Geheimnis.
Es wäre eine Verharmlosung, in diesem Zusammenhang von einem inneren Konflikt zu sprechen.
Es gehört zu meinem Beruf, mir tagtäglich Geheimnisse anvertrauen zu lassen, aber im Moment trage ich das größte von allen in mir selbst. Ich fühle mich noch immer nicht dazu in der Lage, Krista die Wahrheit zu sagen. Nein, keiner von uns beiden hat vergessen, dass ich während meiner Zeit in Afghanistan in eine Nagelmine getreten bin. Aber ich habe ihr verschwiegen, dass ich bei dieser Gelegenheit auch meine Fähigkeit eingebüßt habe, Kinder zu zeugen. Obwohl äußerlich alles einwandfrei funktioniert und auch so aussieht, wie es aussehen sollte, ist eine Lücke geblieben, ein toter Winkel in den Verknüpfungen. Als die Chirurgen mich wieder zusammengeflickt haben. Irreparabel, von Dauer.
Krista.
Sieben gemeinsame Jahre.
Krista hat mir von Anfang an ungeheuer gutgetan, in jeder erdenklichen Hinsicht.
Ihr seligster Wunsch ist es, Kinder zu haben, eine Familie zu gründen. Das zu tun war der Plan. Sobald ich von meinem Einsatz als Militärpfarrer zurückkehren würde.
Zunächst habe ich es verschwiegen, weil ich das Gefühl hatte, es würde einer Explosion gleichkommen. Ich war mir nicht sicher, ob ich nach der ersten noch eine zweite würde überleben können. Hinzu kommt, dass inzwischen einige Zeit vergangen ist. Je länger ich zögere, desto komplizierter erscheint es mir, diese zweite Bombe platzenzulassen. Wir sind wieder im Alltag angekommen, es ist überstanden, warum soll ich uns jetzt wieder zurückwerfen? Das wäre, als würden wir in einem Brettspiel zurück aufs Startfeld gehen. Oder noch weiter. Vielleicht an einen Punkt, an dem ich mich ganz sicher nicht wiederfinden möchte. In einem Leben ohne Krista.
Daran will ich gar nicht denken.
Ich hüte ein weiteres Geheimnis. Ich zweifle. Weil Gott das, was ich gesehen habe, eigentlich nicht für gut befinden kann. Ich habe Gott dazu befragt, wohl wissend, wie absurd das ist.
Er hat geschwiegen.
Ich tausche die Turnschuhe gegen die Winterstiefel ein, streife meine Daunenjacke über, ziehe meinen dicken roten Schal, die Mütze und die Fausthandschuhe an. Dann gehe ich los. Der Schnee knirscht, während ich durchs Zentrum des Dorfes laufe. Pipsas Hotel, der K-Supermarkt, die Teboil-Tankstelle, der Golden Moon Night Club. Der S-Supermarkt, Hurmes Assecoires, Lasses Bar, die Genossenschaftsbank, die Firma Hirvonen, die Pleasure Island Thai Massage. Am Ende der wenig befahrenen Hauptstraße befinden sich das Rathaus und das Militärmuseum. Auf dem Parkplatz stehen Autos, mit laufenden Motoren, die grellroten Rücklichter erinnern mich an übernächtigte Augen. Die Bewohner dieses Dorfes befinden sich im Meteoritenfieber. Das gilt auch für die Mitglieder des Dorfkomitees.
Ich biege gerade in die Straße ein, in der ich wohne, als mir etwas einfällt. Gestern gab es ein paar Unstimmigkeiten, es ging um die Bewachung des Meteoriten und um die Aufteilung der Schichten.
Ich drehe um, gehe zum Museum. Ein wuchtiger Geländewagen kommt mir entgegen. Zwei Männer sitzen darin, ein Kleiner ohne Mütze fährt, der Beifahrer wirkt wie ein Riese. Das Wort ist durchaus angemessen, er füllt den Wagen fast zur Hälfte aus. Ein Wagen mit russischem Kennzeichen. Neuschnee wirbelt auf, wie Pulver, er kühlt meine rechte Wange.
Auf dem Parkplatz stehen vier Männer in ein Gespräch vertieft. Ich kenne sie. Erkenne jeden von ihnen schon von weitem.
Jokinen, der Lebensmittelhändler, aus dessen Angeboten ich nicht immer schlau werde, die ich aber zu schätzen weiß. Sein Joghurt schmeckt nicht so, als stamme er aus dem Großhandel, auch das Fleisch ist frischer als das aus dem Supermarkt. Turunmaa, ein Bauer, der Kartoffeln und Steckrüben anbaut und mit seinem Land einen Kleinstaat gründen könnte. Räystäinen, ein Handwerker und Betreiber des Fitnessstudios vor Ort. Er übt Bodybuilding mit großer Ernsthaftigkeit aus und versucht andauernd, mich zu überreden, Mitglied zu werden und ordentlich zu trainieren. Er meint, dass ich von Natur aus für dieses Ansinnen geeignete Schultern habe und fast kein Fett zum Verbrennen. Und dann Himanka, ein Rentner, der so betagt und fragil aussieht, dass ich nicht recht weiß, ob er sich bei 20 Grad minus überhaupt im Freien aufhalten sollte.
Sie sehen mich. Unterbrechen ihr Gespräch.
«Hallo Joel», sagt Turunmaa. Er trägt eine Pelzmütze und eine Lederjacke. Die anderen tragen Steppjacken und ebenfalls Mützen. Wie üblich ist es Turunmaa, der das Gespräch an sich reißt. «Wir halten hier eine kleine Beratung ab», sagt er.
«Zu welchem Thema?», frage ich.
«Na, wegen der Schichtwechsel in der kommenden Nacht», sagt Räystäinen.
Dann schweigen sie wieder. Ich sehe hinüber zu Jokinen.
«Ich muss mit meiner Tochter skypen, in die USA», sagt er.
«Wie bitte?», fragt Himanka. Er schlottert vor Kälte.
Ich suche Turunmaas Blick.
«Ich habe eine Wette laufen», sagt Turunmaa. «Und will unbedingt das Spiel sehen.»
«Stimmt», sagt Räystäinen. Er hat eine Frau, die deutlich jünger ist als er, und die beiden tun das, was Krista gerne tun würde. Sie ziehen die Sache durch, zwecks Familienplanung. Ich weiß das, weil Räystäinen es mir erzählt hat, ziemlich reich an Details.
Himanka ziehe ich natürlich nicht in Betracht.
«Na gut, ich kann die Nacht übernehmen», sage ich.
Die Häuser stehen vereinzelt an der Straße, in großen Abständen. Fast in jedem brennt Licht. Hier pflegt man zeitig zu Hause zu sein. In Helsinki gehen die Lichter frühestens gegen sechs an, hier gegen drei Uhr am Nachmittag.
Ein Wagen kommt mir entgegen, ich erkenne die Fahrerin. Sie hat dunkle Haare, singt ab und zu im Nachtclub, dem Golden Moon. Sie sieht mich auch, wirft mir einen Blick zu, den ich kenne. Kein freundlicher Blick, eher einer, der zu sagen scheint, dass ich ihr im Weg bin. Sie raucht, spricht mit einem Mann, der neben ihr auf dem Beifahrersitz sitzt. Sie fahren an mir vorbei, in Richtung Museum.
An der Kreuzung biege ich ab, sehe schon die Lichter. Ich laufe noch einige Minuten zu Fuß, dann betrete ich das Grundstück.
Auf der Treppe unseres angemieteten Einfamilienhauses lege ich eine Pause ein, fege einen Teil des Schnees von meinen Schuhen. Ich öffne die Haustür, der Duft von Krautwickeln steigt mir in die Nase. Ich ziehe Schuhe und Mantel aus, trete ein.
Krista ist in der Küche, sie wendet mir den Rücken zu und kocht, wie an so vielen Abenden, wenn ich nach Hause komme. Liebe meines Lebens, denke ich unwillkürlich. Was würde ich ohne dich machen? Der Gedanke hallt nach, dreht und wendet sich in meinem Hirn, er ist häufig da gewesen in letzter Zeit.
Ich umarme sie, versenke meinen Kopf in ihren dichten braunen Haaren, atme ein. Ich betrachte ihre schmalen, feinen Finger, sie hält eine knallrote Tomate in der linken, ein metallisch glänzendes Messer in der rechten Hand.
«Ich übernehme die Nachtschicht im Museum», sage ich.
«Ich bin schwanger», sagt Krista.
2
Vielleicht ist das Kriegsmuseum bei Nacht der richtige Ort für mich. Alte Waffen, Uniformen, Panzerfäuste, Helme, Granaten, eine Kanone. Alte Landkarten und Frontskizzen. Bilder von Gefechten, die hier in der Nähe einst stattgefunden haben.
Ich bin nicht in der allerbesten seelischen Verfassung. Wie man so sagt. Etwa die Hälfte meiner Schicht ist vorüber.
Ich laufe, denn ich kann nicht stillsitzen. Ich kann mich auch nicht darauf konzentrieren zu lesen. Ich habe das vage Gefühl, als würde mich die Bibel einer Tat anklagen, und eigentlich sollte es genau umgekehrt sein. Auch Ellroys in Flammen stehendes Los Angeles scheint mir in dieser Nacht weit weg zu sein. Ich bin im Osten Finnlands, im Zentrum des abgelegenen Dörfchens Hurmevaara. Der Weg bis an die russische Grenze beträgt rund zwanzig Kilometer. Die Außentemperatur liegt bei minus 23 Grad. Früheste Morgenstunde, bald halb drei. Ich ertappe mich bei dem Gedanken, dass ich mich – sollte Gott einen Rücken besitzen – dahinter befinde. Er hat sich abgewendet. In mehrfacher Hinsicht.
Ich erreiche den sogenannten Saal. Betrachte den Meteoriten. Ein schwarzer Stein aus dem All. Genau so sieht er auch aus.
Ich erinnere mich an einige Fakten aus dem Artikel der örtlichen Tageszeitung. Erste Untersuchungen haben ergeben, dass es sich allem Anschein nach um einen äußerst seltenen Eisenmeteoriten handelt, ziemlich genau vier Kilo schwer. Er besteht wohl auch aus diversen Platinlegierungen. Es gibt weltweit nur wenige Funde dieser Art. Einer von ihnen wurde öffentlich versteigert, ein Klotz, der im Norden der USA das Dach einer Sporthalle durchschlug und dabei in Einzelteile zerfiel. Der Preis für ein Gramm kann mit etwa 250 Euro beziffert werden. Im Info-Kasten der Lokalpresse, am unteren Seitenrand, hieß es, dass «unser» Meteorit einem Verkäufer, würde er ihn in kleinen Grammstückchen anbieten, rund eine Million Euro einbringen könnte.
Na gut, ein paar Tage wirst du noch hier in Hurmevaara verbringen, denke ich, ohne den schwarzen Brocken aus den Augen zu lassen.
Ich jedenfalls …
Ich bin sofort aufgebrochen, sobald sich die Gelegenheit geboten hat. Habe Kristas Neuigkeiten zur Kenntnis genommen, sie umarmt, geküsst. Sie hat die Küsse erwidert. Ich habe ihr zugehört, während sie ihrer Begeisterung Ausdruck verlieh. Wie sehr sie mich liebt und dass wir endlich eine Familie sein werden. Dann hatte ich irgendwann den Eindruck, mich ein wenig von der frohen Botschaft erholt zu haben. Sie fragte, ob ich glücklich sei, ich habe die Frage bejaht. Ich sei glücklich, sehr glücklich.
Krista ist schwanger. Sie ist sich dessen vollkommen sicher. Sie sagte, sie habe den Test dreimal gemacht. Auch ich bin mir sicher, durchaus. Ich habe diverse Laboruntersuchungen durchlaufen und einige Ärzte und Chirurgen in deren Sprechzimmer konsultiert. Ich kann keine Kinder bekommen. Und nein, ich glaube nicht an die unbefleckte Empfängnis. Die einzige Erklärung lautet, dass ein anderer Krista in ihren segensreichen Zustand versetzt hat. Und bei diesem anderen kann es sich nur um ein Wesen handeln, dass Spermien produziert.
Einen Mann.
Das ist schwer nachzuvollziehen. Schwerer fast als die Schwangerschaft an sich. Krista war immer und jederzeit gut zu mir. Sie hat nicht ein einziges Signal der Unzufriedenheit ausgesendet. Wann ist auch nur ein Tag vergangen, ohne dass sie mir ihre Zuneigung gezeigt hätte? Mit Worten, mit Taten. Gab es eine einzige Nacht, in der wir nicht in einer Umarmung eingeschlafen sind? Sie eingehakt unter meinem Arm, ihr linkes Bein über meinem liegend, der linke Arm auf meiner Brust?
Ein Mann.
Der Gedanke schnürt mir den Hals zu und verursacht ein Stechen im Magen. In meinem Hirn scheint ein dunkler Strom zu fließen.
Natürlich konnte ich Krista nicht darauf hinweisen, dass ich zwar herzlich gratuliere, der Vater aber irgendwo anders im Dorf gesucht werden muss. Das ging nicht, ich konnte es einfach nicht. Was wäre dann passiert? Würde Krista zu diesem Mann gehen? Würde sie das Kind allein großziehen? Es würde dann auch zutage treten, dass ich seit zwei Jahren und vier Monaten ein Geheimnis hüte, dessen Enthüllung erheblich auf unsere Beziehung eingewirkt hätte.
In jedem Fall würde ich Krista verlieren.
Ein Leben ohne Krista … das will ich mir sogar jetzt nicht vorstellen.
Der Meteorit ruht in der Vitrine. Auf Hüfthöhe. Milliarden von Kilometern hat er zurückgelegt, um genau an diesem Ort zu landen.
Ich hebe meinen Blick. Im Zentrum des quadratischen Saals befinden sich weitere Vitrinen. Der Raum liegt im Halbdunkel der spärlichen Nachtbeleuchtung. Wir sparen, sowohl an der Bewachung dieses Meteoriten als auch an Energie. Ich gehe an den Vitrinen vorüber, lasse meinen Blick an ihnen entlanggleiten, ohne wirklich zu sehen, was darin liegt. Ich weiß es natürlich, kenne als ehemaliger Soldat jeden hier im Militärmuseum ausgestellten Gegenstand fast persönlich.
Es ist gut, in Bewegung zu sein. Ich kann jetzt unmöglich stillsitzen, es fühlt sich an, als würde ich ersticken. Am Ende der Reihe bleibe ich stehen. Ich habe etwas gehört. Ich weiß nicht, was. Ein stumpfes, fernes Geräusch. Ein Schlag, der widerhallt, etwas zerbirst. Habe ich das wirklich gehört? Ich halte inne, lausche. Da ist nichts.
Ich schalte das Licht an, das den Saal unmittelbar flutet. Doch, da ist wieder ein Geräusch, es kommt aus dem anderen Flügel des Museums. Ich höre Schritte. Vielleicht. Der rückwärtige Flügel ist nachts unbeleuchtet. Ich schleiche in die Halle, deren Dach in der Mitte pyramidenartig in die Höhe ragt. Leider ist es wasserdurchlässig und nicht dafür gemacht, große Schneemassen zu tragen. Ich lausche, höre nichts, aber ich rieche etwas.
Einen kräftigen Duft, er steigt mir ganz unerwartet in die Nase, ich brauche einen Moment, um zu begreifen, was das ist.
Parfum.
Damenduft.
Hier, in der Halle des Militärmuseums, bei Nacht. Unmöglich. Oder?
Ich kneife die Augen zusammen, suche den Eingang. Tisch und Stuhl stehen da, auf dem Tisch liegen die Bibel und der Roman von Ellroy. Ich sehe auch mein Telefon. Die Stehlampe, die ich neben dem Tisch aufgestellt hatte, beleuchtet die Tischplatte und zeichnet einen goldenen Halbkreis auf den Kunststoffboden.
Ich höre wieder Geräusche, jetzt ganz sicher Schritte. Ich atme tief ein und aus, erleichtert. Die Putzfrau. Natürlich. Wir haben eine Frau angestellt, die das nebenbei macht, je nachdem, wann sie Zeit hat, sie arbeitet eigentlich in der Papierfabrik in Joensuu. Anscheinend nutzt sie dieses Mal die frühen Morgenstunden. Allerdings verwirrt mich das Parfum ein wenig. Komisch auch, dass sie im Dunkeln arbeitet.
Wieder Schritte. Ich folge ihnen, nähere mich an. Ich erreiche eine Tür, will gerade eintreten, als mich etwas Schweres am Kopf trifft, direkt über dem Ohr. Ich wanke, falle aber nicht und bleibe auch bei Bewusstsein, bis mich der zweite Schlag trifft. Ich stürze. Liege am Boden.
Ich höre Glas, das zersplittert. Laufschritte. Noch mehr zersplitterndes Glas. Wie lange war ich bewusstlos? Nur kurz, denke ich. Glas zersplittert. Jemand rennt direkt an mir vorüber. Ich erlebe so etwas nicht zum ersten Mal. Einen Hinterhalt, eine überraschende Attacke. Immerhin muss ich nicht darüber rätseln, was die Eindringlinge wollen. Einen eine Million schweren Meteoriten.
Die Schritte entfernen sich. Ich richte mich mühsam auf. Versuche zu laufen, zu rennen, sehe den Lichtkegel einer Taschenlampe. Mein Kopf schmerzt, an meinem Ohr läuft in Rinnsalen Blut hinab.
Ich sehe, wie eine Gestalt durch das eingeschlagene Fenster hinausspringt, in die sternenklare Nacht. Ich laufe zum Fenster, sehe jetzt zwei, beide dunkel bekleidet, sie stapfen durch den Schnee. Ich springe. Falle sanft, in den Schnee. Mein Kopf brummt noch von dem heftigen Schlag, die beiden schreiten voran, ich rieche wieder den Duft von Parfüm.
Ich richte mich auf, will losrennen, dann begreife ich zweierlei. Erstens bin ich schlecht ausgestattet, zu dünn bekleidet, zweitens wird mir bewusst, in welche Richtung die beiden steuern. Zum Wald, fünfhundert Meter weiter beginnt die Landstraße. Sie werden sich gewiss nicht im Wald verstecken wollen, sondern zu ihrem Wagen eilen, der vermutlich am Waldrand parkt. Ich renne zum Parkplatz des Museums, taste schon nach den Schlüsseln, während ich noch laufe. Mir geht durch den Kopf, dass diese Sache hier ausgerechnet während meiner Nachtschicht passiert ist. Wenn ich jetzt nicht die richtigen Entscheidungen treffe, werden die beiden entkommen. Ich muss sie finden, muss zumindest irgendwas über sie herausfinden, irgendwas erkennen. Habe schon Schlimmeres mitgemacht.
Ihr Plan war gut. Ich muss einen weiten Schlenker fahren, um den Punkt zu erreichen, an dem sie vermutlich ihren Wagen abgestellt haben. Ich fahre viel zu schnell. Unser kleiner Škoda kennt so etwas nicht. Ich stoße einen Schrei aus, als mir bewusst wird, dass mein Handy neben meinen vom goldenen Licht der Stehlampe beleuchteten Büchern liegt. Umso wichtiger, dass ich die Einbrecher erwische.
Ich biege auf die Landstraße ab, drücke das Gaspedal durch. Das Risiko ist überschaubar, denn der Škoda beschleunigt geruhsam, braucht seine Zeit. Ich erreiche die Stelle, an der ich den Wagen des Duos vermuten würde. Von hier aus kann man direkt durch den Wald zum Museum laufen. Im Schnee finde ich Spuren, Fußabdrücke, an der Seite ist die Wand aus Schnee ein wenig aufgebrochen, da könnte ein Wagen gestanden haben. Mir ist niemand entgegengekommen, also fahre ich weiter geradeaus. Es dauert auf dieser Straße eine gefühlte Ewigkeit, bis ein Weg seitlich abzweigt, etliche Kilometer. Also, immer geradeaus. Ich wische mir mit einem Taschentuch das Blut vom Ohr, und dann sehe ich die rot schimmernden Rücklichter.
Ich beschleunige, nähere mich dem Wagen Meter für Meter an. Einen Moment lang verliere ich ihn aus den Augen, als er sich in eine Kurve legt, dann ist er wieder da. Der andere Wagen fährt zügig. Warum auch nicht, es gibt hier keine Verkehrspolizisten. Riskant ist nur der Wildwechsel. Wenn ein Elch gegen die Windschutzscheibe prallt, ist es aber letztlich egal, ob man mit 80 oder 130 Stundenkilometern unterwegs ist.
Wir fahren so hintereinander etwa zwanzig Minuten lang. Dann verliere ich das Licht aus den Augen. Als ich aus einer Kurve zurückkehre, bin ich allein. Vor mir liegt weit ausgestreckt die Straße. Unmöglich, dass der Wagen so schnell gewesen ist. Da ist nur eine schmale Straße linker Hand, ich biege ab und sehe die Reifenspuren. Der Weg mündet bald in einen Fußpfad. Der Škoda schiebt sich mühsam voran. Ich vermute, dass es nicht mehr weit ist. Schalte die Scheinwerfer aus, befahre inzwischen einen noch schmaleren, tief verschneiten Weg, der vermutlich vor einer Woche zuletzt geräumt worden ist. Ich lasse den Wagen im Leerlauf rollen, halte an, steige behutsam aus, lausche.
Ich höre das Surren eines laufenden Motors, sehe ein Licht zwischen den Bäumen.
3
Der Wagen steht vor dem Haus, mit laufendem Motor. Die Lichtkegel tasten die Vorderseite einer Hütte ab. Ein kleines, altes Häuschen. Es ähnelt anderen in dieser Gegend. Häuser, Hütten, deren langjährige Bewohner längst verstorben sind und in denen anschließend jüngere Verwandte ein paar Sommerwochen verbringen. Und auch das nur in den ersten Jahren, dann kommen sie gar nicht mehr, und das Haus beugt sich der Zeit und dem Wetter. Wie ein Mensch, der erschöpft seinen Griff um den Rettungsring löst.
Ich betrachte alles wie eine Szene in einer Inszenierung – das Auto, die beiden Personen.
Das Duo ist in einen Ringkampf verstrickt. Nein, nicht wirklich, es ist eher so, dass der eine zuschlägt, und der andere hat nichts entgegenzusetzen. Die Schläge, die Schreie werden durch das Motorengeräusch abgedämpft. Ich schleiche mich an, durch den Schnee, im Schutz der Bäume. Folge den Spuren des Wagens. Ich habe eine Nahkampfausbildung absolviert, beherrsche ein wenig mehr als nur die Grundlagen der Selbstverteidigung. Ich versuche, mir das Erlernte in Erinnerung zu rufen, während ich mich annähere.
Mir wird auch klar, warum ich hier bin, warum ich so hartnäckig war. Man hat mich heute nämlich bereits mehr als genug gedemütigt. Es reicht.
Jeans, Pulli, darunter ein Flanellhemd, das ist nicht angemessen bei Frost und massiven Minusgraden, aber ich nehme mir vor, schnell zu sein. Ich werde es kurzmachen. Ich bin schon fast bei dem hellblauen Nissan Micra, die Abgase steigen mir in dieser stillen, sternenklaren Nacht besonders rauchig in die Nase. Der Wagen ist vom Rost bereits deutlich angefressen. Ich präge mir das Kennzeichen ein. Verberge mich hinter dem Auto, versuche, mir den bestmöglichen Weg zurechtzulegen. Einer der Einbrecher liegt im Schnee, mit dem Gesicht Richtung Boden. Den kann ich erstmal vernachlässigen. Der andere läuft schwungvoll auf das Haus zu, öffnet die Tür, tritt ein.