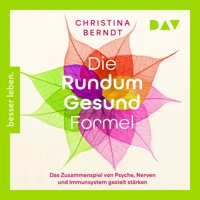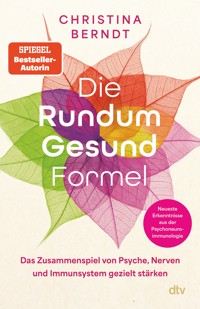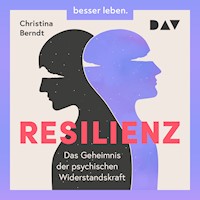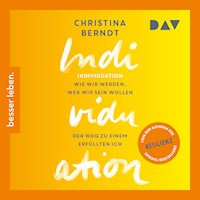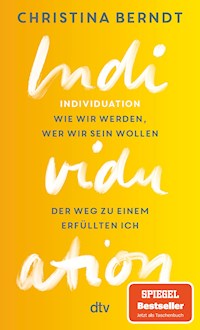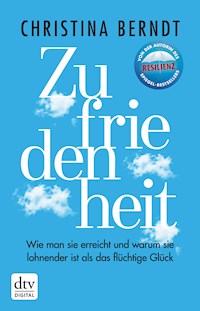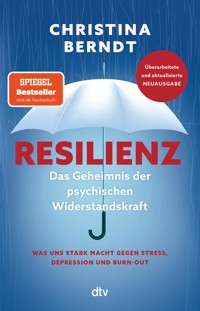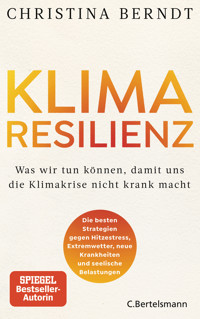
20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Wie wir trotz Klimakrise gesund bleiben – das neue Buch der SPIEGEL-Bestsellerautorin Christina Berndt
Immer heißere Sommer, schneearme Winter, extreme Unwetter – der Klimawandel belastet uns körperlich und seelisch. Fundiert recherchiert zeigt die renommierte Wissenschaftsjournalistin und Bestsellerautorin Christina Berndt, wie vielfältig unser Leben von seinen teils gravierenden Folgen betroffen ist – und gibt uns zahlreiche alltagstaugliche Strategien an die Hand, um unsere körperliche und seelische Klimaresilienz gezielt zu stärken.
Sie erläutert unter anderem,
• das immer größer werdende Hitzeproblem und was wir im Umgang mit Hitzewellen lernen müssen,
• inwiefern der Klimawandel unsere frische Luft »trübt« und welche Wege es gibt, die gesundheitlichen Risiken hoher Ozonwerte, direkter UV-Strahlung und zunehmender Luftverschmutzung zu minimieren,
• warum die umherfliegenden Pollen zunehmend aggressiver werden und wie Allergiker sich schützen können,
• was die schrumpfende Biodiversität mit unserer Gesundheit zu tun hat,
• wie die veränderten Umweltbedingungen die Gefahr für die Entstehung ganz neuer Krankheitserreger erhöhen – und wie man sich auf sie vorbereiten kann,
• inwiefern man die nötige seelische Widerstandskraft entwickeln und Lebensfreude bewahren kann, wenn einem die Klimakrise mental zu schaffen macht.
In ihrem neuen Buch plädiert Christina Berndt nicht nur dafür, dem Klimawandel offen ins Auge zu blicken, sondern motiviert uns auch, ins Handeln zu kommen – für die eigene Gesundheit, das seelische Gleichgewicht und den Schutz unseres Planeten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 382
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Zum Buch:
Immer heißere Sommer, schneelose Winter, bedrohliche Unwetter: Der Klimawandel fordert uns körperlich und seelisch. Auf der Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse gibt uns die renommierte Wissenschaftsjournalistin und Bestsellerautorin Christina Berndt eine Fülle an leicht umzusetzenden Strategien an die Hand, wie wir uns gegen Hitzewellen, Luftverschmutzung, Starkregen, Dürren und andere Folgen der Erderwärmung wappnen. Viele praktische Beispiele zeigen zudem, wie man mit neu entstandenen Allergien, sich rasch ausbreitenden Krankheitserregern und Klimaangst umgeht – und so seine ganz persönliche körperliche und psychische Klimaresilienz aufbaut.
Zur Autorin:
Christina Berndt, geboren 1969, zählt zu Deutschlands renommiertesten Wissenschaftsjournalisten. Sie arbeitet als Autorin, Journalistin und Rednerin zu Themen aus Medizin, Psychologie und Lebenswissenschaften und ist Leitende Redakteurin im Wissenschaftsressort der Süddeutschen Zeitung. Für ihre Arbeiten erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, u. a. 2013 Wächterpreis der deutschen Tagespresse, 2019 Ehrenpreis der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie für nachhaltig gute Berichterstattung zur psychischen Gesundheit. Mehrfach wurde sie unter die Wissenschaftsjournalisten des Jahres gewählt. Sie ist Autorin mehrerer Bestseller, allen voran Resilienz. Das Geheimnis der psychischen Widerstandskraft, der zwei Jahre lang auf der SPIEGEL-Bestsellerliste stand, Zufriedenheit (2016) und Individuation (2019). Zuletzt erschien von ihr Die Rundum-Gesund-Formel. Das Zusammenspiel von Psyche, Nerven und Immunsystem gezielt stärken (2023).
www.cbertelsmann.de
Christina Berndt
Klimaresilienz
Was wir tun können, damit uns die Klimakrise nicht krank macht
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2025 C.Bertelsmann
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-32573-2V001
www.cbertelsmann.de
Für das Klima – es gibt kaum Wichtigeres
Inhalt
Vorwort
Einleitung: Ein Plädoyer für Klimaresilienz
1 Ein heißes Thema
Beim Thema Hitze und Gesundheit denkt man zuerst an heiße Sommer – die immer häufigeren und längeren Hitzewellen. Nicht nur ältere Menschen, auch jüngere leiden zunehmend darunter. Doch die warmen Temperaturen bedeuten weitere Herausforderungen: Sie verlangen uns einen neuen Umgang mit Medikamenten, Sport und Ernährung ab. Auch steigt in der Hitze die Hitze des Gemüts. Es kommt zu mehr Aggressionen unter Menschen, die Konzentration lässt nach, das Gehirn nimmt Schaden. Was wir im Umgang mit der Hitze lernen müssen.
2 Gefährlich frische Luft
Sich draußen aufzuhalten, gehörte zu Recht zu den wichtigsten Gesundheitstipps aus dem Repertoire vergangener Generationen. Bewegung an frischer Luft stimuliert das Immunsystem und hellt die Stimmung auf. Doch der Klimawandel trübt die frische Luft. Die Ozonwerte erklimmen im Freien immer häufiger ungesunde Höhen, schützende Wolken verschwinden und machen den Himmel frei für direkte UV-Einstrahlung. Die Luftverschmutzung macht die Sache nicht besser. Welche Wege es gibt, die gesundheitlichen Risiken zu minimieren.
3 Allergien nonstop
Die meisten Pflanzen mögen es warm, sie blühen in der Sonne auf. Deshalb fliegen bei wärmeren Temperaturen mehr und noch dazu aggressivere Pollen umher. Zudem hat der Heuschnupfen mittlerweile quasi nonstop Saison. Und schließlich verbreiten eingeschleppte Arten wie die Beifuß-Ambrosie noch einmal ein ganz neues Allergiepotenzial. Viele Allergiker spüren den Klimawandel bereits an ihren zunehmenden Beschwerden, und Menschen, die bisher keine Symptome hatten, erkranken – selbst in höherem Lebensalter noch. Wie man sich am besten schützen kann.
4 Ungesundes Artensterben
Von manchen Veränderungen, die der Klimawandel mit sich bringt, denkt man zunächst, dass sie mit dem Menschen wenig zu tun haben. Doch diese Hoffnung erfüllt sich oft genug nicht. Auch das Artensterben ist keineswegs nur für die Umwelt ein Problem, es betrifft direkt das Leben der Menschen. Was die schrumpfende Biodiversität mit unserer Gesundheit zu tun hat.
5 Mücken, Zecken und anderes Getier
Dengue-Alarm am Gardasee, Riesenzecken in Baden-Württemberg und Vibrionen in der zu warmen Nordsee: Mildere Winter erlauben es immer mehr Mikroben, Parasiten und anderen Tieren, die unserer Gesundheit schaden können, sich auszubreiten. Selbst tropischen Mücken gelingt es mittlerweile, in Europa zu überwintern und hier heimisch zu werden. Welche Tiere uns gefährlich werden können und wie man sich gegen die Krankheiten, die sie mitbringen, wappnet.
6 Angriff der kleinen großen Unbekannten
Dass die nächste Pandemie kommt, ist keine vage Prophezeiung, sondern eine Gewissheit. Fraglich ist nur, wie schnell es passieren wird und was für eine Art Keim dann um die Welt zieht. Die veränderten Umweltbedingungen und das immer tiefere Eingreifen des Menschen in die Natur erhöhen jedenfalls die Gefahr für die Entstehung ganz neuer Krankheitserreger und machen es bereits existierenden Keimen leichter, sich auszubreiten und den Menschen zu befallen. Von wo die größte Gefahr droht und wie man sich auf sie vorbereiten kann.
7 Wütende Natur
Auf Sylt ertranken jüngst Menschen, weil sie die Sturmflut fotografieren wollten. Beim Sturm Kilian stürzte ein Bauer vom Dach, der dort etwas befestigen wollte. In einem Münchner Biergarten wurden im Sommer mehrere Menschen vom Blitz erschlagen. Autofahrer sterben regelmäßig, weil sie bei Sturm Alleen entlangfahren: Das Leben war zuletzt so sicher geworden, dass viele Menschen gar nicht mehr wissen, wie sie sich im Angesicht von Naturkatastrophen verhalten sollten. Eine Anleitung.
8 Wider das ewig schlechte Gewissen
Das Reisen hat seine Unbeschwertheit verloren. Längst schon sind Touristenmassen an den schönsten Plätzen dieser Welt zum Problem nicht nur für die Einheimischen geworden, sondern auch für die Umwelt. Mit jeder Meile, die man zurücklegt, fährt oder fliegt ein umso schlechteres Gewissen mit. Aber es geht auch anders.
9 Luft für die Seele
Wer in eine Umweltkatastrophe gerät, wird oft psychisch krank. In von Fluten oder Stürmen betroffenen Regionen steigt die Zahl der Menschen mit Depressionen und Angststörungen drastisch an. Doch es leiden nicht nur diejenigen, die direkt den schweren Folgen der Klimakrise ausgesetzt sind. Allein das Wissen um die Erderwärmung schlägt vielen auf die Seele. Wie man den Klimawandel ernst nimmt und trotzdem die Freude am Leben bewahrt.
Dank
Literaturverzeichnis
Register
Vorwort
Natürlich weiß ich schon lange um den Klimawandel und seine Folgen. Im Alltag bestimmt das Thema fast täglich über mein Verhalten mit. Und oft genug macht es mich auch traurig. Aber als Autorin habe ich mich vor der Auseinandersetzung mit dem Klimawandel lange gedrückt. Das galt auch noch, als in den vergangenen Jahren immer deutlicher wurde, dass die Erderwärmung nicht nur in den Zuständigkeitsbereich von Wissenschaftsautorinnen und -autoren fällt, die über Wetter und Atmosphärenphysik schreiben, sondern dass der Klimawandel zunehmend zu einem gesundheitlichen Problem wird. Gesundheit – das ist mein Thema.
Seit vielen Jahren schon beschäftige ich mich intensiv mit Gesundheit und vor allem mit psychischer Gesundheit. Zum Thema Resilienz ist von mir ein Best- und Longseller erschienen: Resilienz. Das Geheimnis der psychischen Widerstandskraft – Was uns stark macht gegen Stress, Depressionen und Burn-out. Das Buch zeigt auf, wie man Krisen bewältigt, ohne dabei krank zu werden. Seither ist mir die Stärkung der psychischen Gesundheit ein großes Anliegen. Ich möchte dazu beitragen, dass es Menschen besser gelingt, ihre Sorgen und ihren Alltag zu bewältigen. Auch bei der Klimakrise gibt es da genug zu tun.
Trotzdem habe ich in den vergangenen Jahren nur äußerst selten über den Klimawandel geschrieben. Der Grund dafür? Ich habe befürchtet, dass es mich zu sehr belastet, wenn ich auch noch beruflich tief in diese Thematik eintauche.
Doch dann hat eine Lektorin vom C.Bertelsmann Verlag, Julia Hoffmann, die Idee für dieses Buch über Klimaresilienz an mich herangetragen – und ich fand das einen wunderbaren Vorschlag. Es war ein bisschen, als hätte ich auf diesen Anstoß gewartet: Ich fand es sehr reizvoll, für dieses Buch das Faktenwissen zum Klimawandel und seinen vielfältigen Auswirkungen auf die körperliche und psychische Gesundheit mit konkreten Vorschlägen zu verbinden, wie man persönlich damit umgehen kann. Denn ein solches Buch kann für alle, die wir nun einmal keine Atmosphärenforscher sind und bisher vielleicht nicht einmal echte Klimaaktivisten, ungeheuer wertvoll sein. Weil es Lösungsmöglichkeiten aufzeigt. Weil wir so ins Handeln kommen. Weil wir den Klimawandel auf diese Art besser ertragen. Körperlich wie psychisch.
Bei mir selbst hat das Schreiben dieses Buches jedenfalls bestens funktioniert: Dass ich nach der umfassenden Recherche zu den Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit nun noch deutlich besser informiert bin als früher, gibt mir Kraft. Probleme werden greifbarer und auch handhabbarer, wenn man viel darüber weiß – das gilt für alle Krisen, auch für die Klimakrise. Und die Handlungsmöglichkeiten, die ich in diesem Buch aufzeige, eröffnen mir auch selbst eine positive Perspektive. Der Klimawandel macht mir weniger Angst, ich sehe, dass ich jeden Tag etwas dagegen tun kann.
Ich wünsche mir, dass es Ihnen nach dem Lesen des Buches ebenso gehen wird.
München, im Januar 2025
Einleitung: Ein Plädoyer für Klimaresilienz
Das Leben verändert sich gerade gewaltig. Ein Temperaturrekord jagt den nächsten. Auf den heißesten August folgt der heißeste September folgt der heißeste Oktober, den die Menschheit je gemessen hat. Klimaforscher warnen ebenso wie die Aktivisten und Aktivistinnen von Fridays for Future und anderen Organisationen immer wieder und mit immer drastischeren Szenarien vor Kipppunkten, die durch die zunehmende Erderwärmung erreicht werden und nach denen nichts mehr jemals wieder so sein wird wie zuvor. Naturkatastrophen in beliebten Urlaubsregionen lassen uns ahnen, dass sie recht haben könnten. Das nagt an fast allem, was uns lieb und teuer ist. Weiße Weihnachten stehen ebenso grundsätzlich in Frage wie die Möglichkeit, im nächsten Jahrzehnt noch in den Alpen Ski fahren zu gehen oder einen Gletscher bestaunen zu können. Sorgen muss man sich nicht nur um Eisbären, Pinguine und manch schöne, bunte Froschart aus den Tropen machen, sondern sogar um Allerweltsinsekten, die schon so wenige geworden sind, dass man sie mit seiner Windschutzscheibe selbst dann nicht mehr einfangen würde, wenn man sich noch trauen würde, Auto zu fahren. Wer künftig die Obstbäume bestäubt? Womöglich Landarbeiter mit Pinseln in Handarbeit, so wie schon heute in China.
Der Klimawandel ist in vollem Gange, und er ist längst auch bei uns in Mitteleuropa angekommen – mit Folgen für jede und jeden Einzelnen von uns. Letzteres vergessen wir allzu oft. Angesichts der Sorgen um den Planeten, die Natur und die Menschen im von Waldbränden bedrohten Griechenland oder im flachen Südseeparadies Tuvalu nehmen wir viel zu wenig zur Kenntnis, dass die Veränderungen der Umwelt schon heute auch uns und unserer Gesundheit zusetzen – und in nicht allzu ferner Zukunft noch mehr zusetzen werden.
Wir sehen nicht gerne hin, weil uns die erschreckenden Zukunftsszenarien mittlerweile oft genug schwer auf die Stimmung schlagen, weil wir nicht mehr wissen, wie wir uns verhalten sollen und dürfen, und Scham für Dinge entwickeln, die wir früher ganz selbstverständlich genossen haben – ob das nun Reisen, Autofahren oder Fleischessen ist. Doch die Klimakrise ist bereits zur Gesundheitskrise geworden – auch wenn wir das noch mit großem Engagement ignorieren.
Dabei sind die Folgen für die Gesundheit eigentlich schon nicht mehr zu übersehen. Hitzewellen sind auch in unseren Breiten immer üblicher geworden und fordern ihren gesundheitlichen Tribut: Das gilt nicht nur für Senioren. Die Sommerhitze wird auch für jüngere Menschen, allen voran für Schwangere und ihre Babys, zum echten Gesundheitsproblem. Allergien kennen keine Pause mehr und betreffen immer mehr Menschen, weil Pollen durch die größere Wärme aggressiver werden und die Heuschnupfensaison klimabedingt zum Nonstop-Ereignis wird, sie dauert inzwischen von Januar bis Dezember. Stürme werden häufiger und gewaltiger. Auch Hochwasser, Blitze und Ozon bedrohen uns zunehmend, und weil die schützenden Wolken aufgrund sich verändernder Bedingungen in der Atmosphäre in Frühjahr und Sommer immer mehr verschwinden, prasseln UV-Strahlen stärker auf uns ein und erhöhen unser Risiko für Hautkrebs. Noch dazu breiten sich hiesige Krankheiten aus, manche ganz neue Erreger entstehen, wie uns die Coronapandemie sehr drastisch vor Augen geführt hat, und wieder andere kommen mit bislang nur in den Tropen verbreiteten Tieren mittlerweile bis nach Westeuropa. Mückenstiche, die man in unseren Breiten bislang nur lästig fand, bergen nach und nach echtes Krankheitspotenzial. Zuletzt gab es gar Dengue-Alarm am Gardasee.
Doch nicht nur solch real erlebte Schreckensszenarien lasten auf unseren Seelen. Manche Menschen leiden auch bei den Gedanken daran, wie sehr das Leben, wie es bisher war, bedroht ist. Mittlerweile haben sich eigene Begriffe für dieses Phänomen etabliert: Man spricht von Klimaangst oder von Solastalgie – einem Gefühl von Verlust, das Menschen erfasst, deren Heimat zerstört wird. Mit Blick auf den Klimawandel ist es die Erde als Heimat in ihrer bisherigen Form, die einem so rasanten Wandel unterworfen ist, dass immer mehr Verbindungen gekappt werden und Erinnerungen nicht mehr erlebbar, nicht mehr zu wiederholen sind. Schlittschuhlaufen auf zugefrorenen Seen, wie damals als Kind, ist nahezu passé. Durch den kahlen Winterwald laufen, ohne dabei an Waldbrände und Waldsterben zu denken, oft nicht mehr möglich. Der alljährliche Sommerurlaub in Italien, den man so lieb gewonnen hat? Da hält man es wegen der Hitze ja kaum noch aus.
So legt sich bei vielen Menschen ein schaler, traurig machender Schatten auf ihr Wohlbefinden. Die warmen Herbsttemperaturen genießen? Sich über das erstaunlich schöne Wetter im Sommerurlaub in Schweden freuen? Den wegen der vielen Sonnenstunden besonders gelungenen Weinjahrgang? Spaß beim Betrachten von Tieren haben – in der Natur oder einfach nur im Tierfilm? Immer häufiger ist damit auch ein Gefühl der Bedrohung, der Zerstörung, des Verlusts verbunden. Selbst oder gerade die jungen Klimaaktivisten, die sich bei Fridays for Future oder anderen Bewegungen engagieren, sind regelrecht psychisch belastet. Ein Großteil der jungen Menschen ist bereits depressiv oder leidet an einer Angststörung – unter jenen, die sich tagtäglich mit der Klimakrise befassen, sind es noch weitaus mehr.
Die Liste der Leiden am Klimawandel ließe sich noch seitenweise fortführen. Fest steht: Der Klimawandel mit seinen gewaltigen Veränderungen für das Leben auf der Erde setzt Menschen in vielerlei Hinsicht zu, er belastet nicht nur ihr Selbstvertrauen, ihr Selbstverständnis und ihr Glück, sondern ist auch eine körperliche Herausforderung. Die Klimakrise verlangt uns Menschen somit weit mehr an Veränderungen ab, als uns lieb ist. Doch diesen Veränderungen sollten wir uns stellen. Denn das bietet auch eine Chance: Wenn wir unseren persönlichen Umgang mit den zahlreichen Herausforderungen für Seele und Körper finden, die mit der Erderwärmung einhergehen, setzen sie uns weniger zu.
Nun mag man denken: Wie soll man das schaffen, zumal die Abkehr von Gewohnheiten nicht zu den Lieblingsaktivitäten des Menschen gehört und man sich – um wenigstens seine Seele zu schützen – bestenfalls gar nicht so viel mit den Folgen des Klimawandels beschäftigen möchte? Es gibt glücklicherweise zahlreiche Möglichkeiten, die jeder von uns ergreifen kann: Kluge Maßnahmen helfen, den Körper vor der bedrohlicher werdenden Umwelt zu schützen, und Methoden zur psychischen Stärkung können uns dabei unterstützen, uns gegen die Zumutungen zu rüsten, die aus der Klimakrise entstehen.
Aus der Forschung ist seit Langem bekannt, wie sehr persönliche Strategien dabei helfen, psychische und auch körperliche Widerstandskraft gegen die Widrigkeiten des Lebens aufzubauen. Diese Resilienz hilft, in der Krise zu bestehen. Sie gibt Menschen Rüstzeug an die Hand, wie sie durch den Ausbau bereits bestehender, hilfreicher persönlicher Eigenschaften und Stärken sowie mit dem Einüben neuer Denk- und Verhaltensweisen den Herausforderungen des Lebens standhalten und Chancen ergreifen können. Denn Chancen bieten sich auch in schwierigen Situationen immer. Das gilt für gesundheitliche Krisen etwa bei einer anstehenden Operation oder im Umgang mit schweren Krankheiten ebenso wie im Angesicht von Schicksalsschlägen wie Unfällen, einer bevorstehenden Scheidung oder schmerzhaftem Verlust.
Auch wenn die Klimakrise sehr speziell und besonders umfassend ist: Sie ist nichts anderes als eine weitere Krise im Leben von uns Menschen. Deshalb hilft Resilienz auch im Umgang mit den Veränderungen, welche uns die Klimakrise abverlangt, und mit den Sorgen, die sie bei uns auslöst. Wie genau wir unsere persönliche Klimaresilienz aufbauen können, zeigt dieses Buch mit vielen praktischen Beispielen auf. So kann es helfen, uns körperlich wie psychisch gegen den Klimawandel und seine vielfältigen Folgen zu wappnen.
1 Ein heißes Thema
Beim Thema Hitze und Gesundheit denkt man zuerst an heiße Sommer – die immer häufigeren und längeren Hitzewellen. Nicht nur ältere Menschen, auch jüngere leiden zunehmend darunter. Doch die warmen Temperaturen bedeuten weitere Herausforderungen: Sie verlangen uns einen neuen Umgang mit Medikamenten, Sport und Ernährung ab. Auch steigt in der Hitze die Hitze des Gemüts. Es kommt zu mehr Aggressionen unter Menschen, die Konzentration lässt nach, das Gehirn nimmt Schaden. Was wir im Umgang mit der Hitze lernen müssen.
Am Ende der Coronapandemie machten wilde Gerüchte und auch manche respektablen Sorgen die Runde. Woher nur kamen die vielen Toten in jenem Sommer 2022, als sich das Virus doch eigentlich in die Sommerpause zurückgezogen hatte, die allermeisten Menschen im Land doppelt und dreifach geimpft waren und kaum jemand mit Covid-19 auf der Intensivstation lag? Einige Verschwörungserzähler hatten gleich eine Erklärung parat: Das seien alles Impftote, verbreiteten sie. Und so fragten sich auch manche, die sich hatten impfen lassen, beunruhigt, wie es zu der hohen Zahl von Todesfällen mitten im Sommer kommen konnte.
Tatsächlich starben im Sommer 2022 ungewöhnlich viele Menschen. Vor allem in der älteren Bevölkerung ab 60 Jahren waren in jenem dritten Pandemiesommer deutlich mehr Todesfälle aufgetreten, als sich dies durch das Coronavirus hätte er klären lassen. Jedes Jahr kommen in Deutschland im Durchschnitt knapp 900 000 Menschen zu Tode, im Jahr 2022 waren es rund 88 500 mehr, als laut Statistischem Bundesamt zu erwarten gewesen wären. Die allermeisten dieser zusätzlichen Todesfälle waren auf das Coronavirus zurückzuführen, aber nach Abzug aller Coronatoten und aller statistischen Bereinigungen gab es im Sommer 2022 immer noch rund 4500 Tote zu viel.
Und doch gab es eine naheliegende Erklärung dafür. Der Sommer 2022 war nämlich ungewöhnlich heiß. Die Sommermonate seien »von Hitzerekorden geprägt gewesen«, notierte das Statistische Bundesamt. Die Temperaturen kletterten vor allem im Juli und August häufig über 35 Grad Celsius.
Alle Rekorde brach die Woche zwischen dem 18. und dem 23. Juli des Jahres. Am extremsten war der 20. Juli, da knackte die sonst eher für sommerliche Kälterekorde verlachte norddeutsche Metropole Hamburg erstmals seit Menschengedenken die 40-Grad-Marke. »Das war wirklich ein Tag für die Geschichtsbücher«, sagte der Wettermoderator und Meteorologe Alexander König damals beeindruckt im Rundfunk.
»In Hitzewellen sind regelmäßig zahlreiche Hitzetote zu beklagen«, sagt Dmitri Jdanov, Leiter des Labors für demografische Daten am Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock. Gemeinsam mit seinen Kollegen beobachtet er seit vielen Jahren, wie viele Menschen in Deutschland wann und woran sterben. Demnach klettern in heißen Sommern immer wieder die Sterberaten nach oben.
Kein Wunder also, dass im Rekordsommer 2022 die Sterberaten außergewöhnlich hoch waren. Sie waren im Vergleich zu durchschnittlichen Jahren im Juli um 12 und im August um 11 Prozent erhöht, in besagter Juliwoche sogar um 25 Prozent. Die wesentliche Ursache der vermehrten Todesfälle seien fraglos die ungewöhnlich hohen Temperaturen gewesen, sagt Jdanov.
Zweifelsohne trifft diese wohl extremste Auswirkung, der Tod durch Hitze, vor allem ältere und kranke Menschen. Im Sommer 2022 gab es die meisten hitzebedingten Sterbefälle bei Personen über 60 Jahre. In der Gruppe der über 80-Jährigen waren die Sterbefallzahlen in manchen besonders heißen Wochen gar um 30 Prozent im Vergleich zu durchschnittlichen Jahren erhöht.
Als junger und gesunder Mensch muss man sich in einer Hitzewelle hingegen eher keine akuten Sorgen um sein Leben machen – jedenfalls dann nicht, wenn man sich vernünftig verhält. Nur: Was vernünftig ist, das gilt es in vielen Lebensbereichen angesichts der zunehmenden Erderwärmung neu zu lernen. Und auch wenn das Leben jüngerer Menschen selten bedroht ist, ihre Gesundheit ist es schon. So bedeutet Klimaresilienz zuallererst, klug mit den heißen Temperaturen umzugehen – das gilt vom Sport im Freien über hitzekompatible Ernährung bis zur Lagerung von Medikamenten. Denn das Hitzeproblem wird gerade immer größer.
Die Jagd der Hitzerekorde
Ein Hitzeweltrekord jagt zurzeit den nächsten. Am Ende jedes Jahres heißt es wieder, das vergangene Jahr sei das heißeste seiner Art seit Menschengedenken gewesen. So war das Jahr 2024 global betrachtet das wärmste Jahr, seit Meteorologen im Jahr 1881 mit ihren Wetteraufzeichnungen begannen. Zuvor war das Jahr 2023 zum heißesten aller Jahre gekürt worden, davor das Jahr 2022, so teilte es jeweils der EU-Erdbeobachtungsdienst Copernicus mit. Eine Dekade lang geht das nun schon mehr oder weniger so. Dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt, daran gibt es mittlerweile nichts mehr zu deuteln.
Das gilt auch für hiesige Breiten. Auch wenn es zwischendurch mal außergewöhnlich kühl ist und sich im Mai 2024 ganz Süddeutschland darüber geärgert hat, dass der Frühling nicht so recht in die Gänge kommen wollte: In Deutschland geht der Temperaturtrend wie fast überall auf der Welt deutlich nach oben. Es gebe hierzulande »eine regelrechte Erwärmungsserie«, warnt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: »Neun der zehn wärmsten je in Deutschland gemessenen Jahre liegen im 21. Jahrhundert.«
Das ist nicht nur ein Problem für den Planeten und die Pflanzen und Tiere, die auf ihm leben. Das tut auch dem Menschen nicht gut. Selbst in den gemäßigten Breiten Mitteleuropas, wo die Temperaturen im Vergleich zu vielen anderen Gegenden auf der Erde stets sehr zivil waren und man bisher immer bestens ohne Klimaanlagen auskam, wird die Erderwärmung vor allem im Sommer zu einem Gesundheitsrisiko, das man ernst nehmen sollte.
Weshalb Hitze so gefährlich ist
Aber weshalb kämpfen so viele Menschen eigentlich mit Hitze und sterben im schlimmsten Fall sogar? Im Grunde kann der moderne Mensch nämlich ganz gut mit hohen Temperaturen umgehen. Viele Leute lieben sie sogar und suchen ganz bewusst nach ihnen, zum Beispiel im Urlaub, in dem es sie alljährlich in den so sonnigen Süden zieht, wo sie den ganzen Tag am Strand verbringen oder gar auf Berge kraxeln. Das mag daran liegen, dass die Wiege des modernen Menschen in Afrika stand. Auch die nackte Haut, die übrig bleibt, wenn wir unseren im Kaufhaus erworbenen Fellersatz aus Wolle oder Kunstfaser abwerfen, deutet darauf hin, dass wir wohl keine Kältewesen sind. Nur eine relativ dünne Haut hindert die von unserem Körper produzierte Wärme am Verschwinden, eine echte Barriere ist das nicht.
Allerdings täuscht das alles darüber hinweg, dass der Mensch ursprünglich eher nicht für ein Leben in der Hitze erschaffen wurde. Dass wir überhaupt mit Hitze umgehen können, ist eine erhebliche Leistung unserer in vielerlei Hinsicht beeindruckenden Evolution. Denn eigentlich ist der Mensch für die Kälte gemacht. Er entwickelte sich vor rund 2,5 Millionen Jahren, als es auf der Erde so kalt war wie nie zuvor. Erst mit der Zeit, als die kräftige Eiszeit, die damals herrschte, zu Ende ging, hat sich der Mensch dank seiner Intelligenz und seines Erfindungsreichtums an die wärmeren Temperaturen angepasst, aber auch dank schneller genetischer Evolution. Zunächst entledigte er sich seines dichten Fells, dann entwickelte er – im Vergleich zu anderen Säugetieren, selbst zu Affen – ganz besonders viele und effektive Schweißdrüsen. Sie helfen uns bis heute dabei, unsere Körpertemperatur zu regulieren, falls uns trotz unserer Nacktheit doch einmal zu warm wird.
Mehr als zwei Millionen solcher die Temperatur justierenden Schweißdrüsen sind über unseren Körper verteilt, im Vergleich zu Schimpansen sind das zehnmal so viele. Nur deshalb konnte der Mensch im heißen Afrika hinter Antilopen herrennen und Zebras erlegen. »Während unserer Evolution haben wir fantastische Fähigkeiten erworben, um Hitze zu verlieren«, sagte der Thermophysiologe Hein Daanen von der Freien Universität Amsterdam der Süddeutschen Zeitung. Sind Menschen der Kälte ausgesetzt, arbeitet ihr Stoffwechsel normal weiter, in der Hitze aber werden plötzlich zahlreiche physiologische Mechanismen in Gang gesetzt. So würden selbst in der heutigen Zivilisation noch rund zehnmal mehr Menschen erfrieren als an Hitze sterben, sagte Daanen: »Das deutet darauf hin, dass Menschen noch tropische Wesen sind.«
Doch die Situation hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Denn die Temperaturen auf der Erde steigen durch das Verhalten ebendieser Menschen mittlerweile in atemberaubendem Tempo und damit schneller an, als es die Evolution erlaubt. Ein so heißes Klima wie jetzt hat es auf der Erde seit Jahrmillionen nicht mehr gegeben. Ebenso wie für viele Tiere und Pflanzen wird das auch für uns Menschen zum Problem, weil unsere Entwicklung trotz aller Anpassungsfähigkeit mit diesem Rekordtempo nicht mithalten kann. In einem aufgeheizten Erdklima wird uns schnell zu heiß. Unter Umständen lebensgefährlich heiß.
Wie die Körper aller anderen Säugetiere arbeitet auch der menschliche Organismus nur in einem engen Temperaturbereich optimal. Gut geht es ihm, wenn die Temperatur in seinem Inneren 36,8 Grad Celsius beträgt – etwas mehr als ein halbes Grad nach unten und nach oben wird noch toleriert, aber alles andere macht uns das Leben schwer. Ab 38,5 Grad Celsius funktioniert unser Gehirn schon nicht mehr richtig, Bewegungen werden verlangsamt und unsicher, Lethargie macht sich breit. Von dieser Temperatur an spricht man auch von Fieber, wir fühlen uns krank und möchten nur noch eins: uns ausruhen. Spätestens ab 42 Grad Celsius aber droht ernste Gefahr. Die Blutgerinnung wird gestört, das Gehirn schwillt an, auch die übrigen Organe des Körpers können ihre Funktion nicht mehr richtig erfüllen.
Die kritische Schwelle für Mensch und Ei
Als kritische Schwelle gilt diese Temperatur vornehmlich wegen der Eiweiße, aus denen der Körper zu gut 15 Prozent besteht. Sie sind die Grundlage der Muskeln, vieler Hormone und Antikörper, zudem erfüllen sie als kleine Biomaschinen (»Enzyme«) lebenswichtige Funktionen im Organismus. Doch die Eiweiße sind nicht sehr hitzestabil, sie beginnen ab 42 Grad Celsius ihre natürliche Form zu verlieren, sie »denaturieren«.
Was dabei passiert, kann man sehen, wenn man ein Spiegelei brät: Aus einer flüssigen, klaren Masse wird in der Hitze der Pfanne das feste Eiweiß. Das mag appetitlicher aussehen und angenehmer zu verzehren sein als das rohe Ei, aber die biologische Funktion des Eiweißes ist in diesem Zustand dahin, und der Prozess lässt sich nicht mehr umkehren. Im Körper passiert in der Hitze genau das Gleiche wie mit dem Spiegelei in der Pfanne. Zwar versucht der Organismus bei hohen Temperaturen noch gegenzusteuern, indem er eigens dafür zuständige Hitzeschock-Proteine freisetzt. Sie sollen die Eiweiße beschützen und den Zellen des Körpers dadurch helfen, trotz der bedrohlichen Umgebungstemperatur zu überleben. Weil die Hitzeschockproteine selbst besonders stabil gegen Hitze sind, können sie andere Eiweiße noch eine Weile in Form halten und sie am Verklumpen hindern. Aber auch das funktioniert nur in einem überschaubaren Temperaturbereich. Sobald die Eiweiße ab etwa 42 Grad endgültig zu denaturieren beginnen, ist der Tod nicht mehr aufzuhalten.
Deshalb versucht der gesamte Organismus, den relativ schmalen Bereich seiner Solltemperatur unbedingt einzuhalten. Er besitzt dazu im Gehirn eine Art Thermostat, der beständig misst, wie es um die Temperatur des Körpers bestellt ist. Das Wärmekontrollzentrum fragt verschiedene Sensoren auf der Haut ab, und sollte der gewünschte Temperaturbereich verlassen werden, tut das Gehirn gemeinsam mit Herz, Lunge, Muskeln oder Schweißdrüsen alles dafür, die nötige Temperatur wiederherzustellen, zum Beispiel durch Schwitzen oder Zittern. Dieser Prozess läuft vollkommen unabhängig davon ab, ob uns kalt oder warm ist, ob uns also die Überhitzung oder Unterkühlung bewusst ist.
Ist die Körpertemperatur zu hoch, dann schickt das Gehirn Botenstoffe auf die Reise, die dafür sorgen, dass sich die Blutgefäße der Haut weiten. Das Herz pumpt vermehrt Blut Richtung Haut, sodass Wärme aus dem Körperinneren heraustreten kann. Deshalb wird die Haut an Gesicht und Händen rot, wenn uns zu warm wird, und deshalb schwellen Hände und Füße an. Erst wenn das nicht reicht, beginnen wir zu schwitzen: Dazu werden die Poren der Haut geöffnet, Schweiß tritt aus. Sobald dieser verdunstet, kühlt er die Haut und sogar das Blut in den darin liegenden feinen Blutgefäßen ab, sodass das heruntertemperierte Blut beim Fließen durch den Körper auch die Organe abkühlt.
Grundsätzlich gilt: Wenn die Temperatur im Körperinneren, die Körperkerntemperatur, also die physiologischen 36,8 Grad Celsius nicht überschreiten soll, dann darf es auf der Haut nicht wärmer als 35 Grad Celsius werden. Passiert das doch, muss der Körper schwitzen. Der Kühleffekt ist so gut, dass der Körper auch weit höhere Temperaturen als 35 Grad Celsius in seiner Umgebung aushält – solange er genügend zu trinken hat, damit er weiterschwitzen kann. Ohne Wasser kommt es hingegen schnell zur lebensgefährlichen Austrocknung, der Exsikkose.
Gewöhnung funktioniert, aber in Grenzen
Ein Stück weit und mit genügend Wasser im Gepäck kann sich der Mensch somit an Hitze anpassen. Man kann sich sogar regelrecht an sie gewöhnen. Das ist nicht zu übersehen, wenn man schon im Frühjahr von der Wärme erschöpft durch Rom schnauft, während die Einheimischen noch lange Ärmel tragen. Auch seine Wohlfühltemperatur kann man mit der Zeit umstellen. Das merkt man nicht nur im Vergleich mit heißblütigen Südeuropäern, sondern jedes Jahr auch an sich selbst. Während man im Sommer die ersten heißen Tage und Nächte häufig als sehr belastend empfindet, geht man in den folgenden Wochen leichter damit um – ähnlich wie man im Frühherbst so manchen halbwegs kalten Tag unangenehmer findet als später im Winter die richtigen Frosttage. Deshalb birgt eine früh im Sommer auftretende Hitzewelle größere gesundheitliche Risiken als eine spätsommerliche.
Je länger man in einer warmen Umgebung verweilt, desto mehr Hitze hält man in der Regel aus. Diese Gewöhnung liegt auch daran, dass der Körper sich umstellt, um besser mit der Hitze umzugehen – zum Beispiel, indem er schneller und mehr schwitzt. Das kann man sogar aktiv verbessern. »Man kann rechtzeitig das Schwitzen trainieren, etwa durch regelmäßige Saunagänge und viel Bewegung oder Sport«, sagte der Physiologe Hanns-Christian Gunga, der an der Berliner Charité seit Jahrzehnten den Temperaturhaushalt der Menschen unter extremen Bedingungen erforscht, im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Damit müsse man aber anfangen, bevor die Hitzewelle kommt, am besten schon im Frühling.
Denn durch das Training kann jede einzelne Schweißdrüse bei Hitze schneller und mehr Schweiß produzieren als zuvor, so wird der Körper insgesamt besser gekühlt. Häufiges Schwitzen führt auch zu einer Veränderung der Schweißzusammensetzung. Der Schweiß wird dann dünner, er enthält weniger Salze und Mineralien. Das hat gleich zwei Vorteile: Man verliert weniger von diesen lebenswichtigen Substanzen, und verdünnter Schweiß verdunstet leichter, sodass die Kühlung effizienter wird.
Wann Hitze unmenschlich wird
Der Mensch kann sich also an viel Hitze gewöhnen, aber nicht an Hitze, die unmenschlich ist. Wo die kritische Schwelle liegt, erforschen Wissenschaftler schon seit vielen Jahrzehnten. Und diese Forschung hat Erschreckendes zutage gebracht: Die Schwelle zur Unmenschlichkeit, an der Leben nicht mehr möglich ist, wird inzwischen immer häufiger und in immer mehr Regionen der Erde überschritten – und in seltenen Momenten passiert das auch schon in Deutschland.
Dass Schwitzen eine große Hilfe gegen Hitze ist, steht außer Frage. Aber der Mensch kommt, so beeindruckend seine Schweißdrüsen auch sein mögen, mit dem Schwitzen irgendwann an seine Grenzen. Denn Kühlung durch Schwitzen kann nur funktionieren, solange der Schweiß auf der Haut verdunsten kann. Das ist aber ab einer gewissen Luftfeuchtigkeit nicht mehr der Fall. Wenn die Luft in der Umgebung mit Feuchtigkeit gesättigt ist, kann sie keine weitere Feuchtigkeit mehr aufnehmen. Schwitzen funktioniert dann nicht mehr. Welche Temperatur ein Mensch verträgt, hängt deshalb in starkem Maße davon ab, wie feucht die Luft in seiner Umgebung ist. »Wir können uns sogar in der Wüste aufhalten, solange es sehr trocken ist«, sagt der Amsterdamer Thermophysiologe Daanen. »Zum Problem wird es erst, wenn es auch noch feucht wird und der Mensch nicht mehr in der Lage ist, Körperwärme abzugeben – dann steigt die Körpertemperatur stark an.«
Das hatte erstmals vor gut hundert Jahren ein schottischer Wissenschaftler herausgefunden, zum Teil im Selbstversuch. Auf der Suche nach der Temperatur, die ein Mensch gerade noch ertragen kann, kletterte der Hygieniker und Physiologe John Scott Haldane im Jahr 1905 in eine Mine in Cornwall hinab. Je tiefer er kam, desto wärmer wurde es ihm. So hatte Haldane es auch erwartet. Vorsorglich trug der Forscher nur ein Baumwollhemd und Schuhe aus Segeltuch. Wie viel Hitze würde er aushalten?
Als er 1600 Meter hinabgestiegen war, wurde es »abnormal heiß«, wie er später in der Fachzeitschrift Journal of Hygiene berichtete. 34 Grad zeigte sein mitgeführtes Thermometer zu diesem Zeitpunkt an. Haldane glaubte damit die Temperatur erreicht zu haben, bis zu welcher Menschen noch »existieren und arbeiten« können. »Während meines ersten Besuchs fühlte ich mich sehr unwohl, und meine Mundtemperatur stieg auf 39,2 Grad Celsius«, berichtete er nach seiner Rückkehr.
Doch bei seinem nächsten Abstieg in die Mine wurde er eines Besseren belehrt. Diesmal wurde es für ihn und einen Begleiter, den er mitgenommen hatte, schon ab einer Temperatur von 31,7 Grad Celsius unerträglich. Ihre Körpertemperatur stieg in gefährliche Höhen, im Kopf wummerte es. Weshalb nur schwächelten sie diesmal so schnell?
Der Unterschied zwischen den beiden Expeditionen war die Luftfeuchtigkeit. Schon bei Haldanes erstem Abstieg war es in der Mine entsetzlich schwül gewesen, aber beim zweiten Abstieg war die Luft mit Feuchtigkeit nahezu gesättigt. Ob die Gesundheit des Menschen auf dem Spiel steht, liege also nicht daran, wie heiß es an einem Ort ist, stellte Haldane fest, sondern daran, ob die »Feuchtkugeltemperatur« erreicht sei. Heute spricht man auch von »Kühlgrenztemperatur«. Es ist die niedrigste Temperatur, die in einer Umgebung durch Verdunstung möglich ist.
Messen kann man die Feuchtkugeltemperatur an einem Ort, indem man ein Thermometer in eine feuchte Socke steckt und herumwirbelt. Darum nannte Haldane sie so. Je mehr Feuchtigkeit in dieser Umgebung verdunsten kann, desto stärker sinkt durch die Verdunstungskälte die Temperatur auf dem Thermometer. Solange die Umgebung noch Feuchtigkeit aufnehmen kann, ist die Feuchtkugeltemperatur niedriger als die Außentemperatur. Zum Problem für den Menschen aber wird es, wenn die Feuchtkugeltemperatur in einer Umgebung erreicht ist. Dann ist kein weiteres Abkühlen mehr möglich. Die relative Luftfeuchtigkeit entspricht dann 100 Prozent, die Luft ist mit Wasser gesättigt, sie kann keine weitere Feuchtigkeit mehr aufnehmen. Weil auch Schweiß dann nicht verdunsten kann, hat das Schwitzen keinerlei Kühlungseffekt mehr. Die Körperwärme staut sich im Körperinneren, der Mensch heizt sich an einem warmen Ort mit Feuchtkugeltemperatur unweigerlich immer weiter auf. Je nachdem, wie heiß es ist, kann die Körperkerntemperatur innerhalb von 10 bis 15 Minuten auf über 40 Grad Celsius steigen.
Aber was genau ist nun die kritische Grenze für den Menschen? Ab welcher Temperatur wird bei welcher Luftfeuchtigkeit der Tod durch Überhitzen unausweichlich? Dem ist ein Team um Daniel Vecellio vor Kurzem nachgegangen. Der Klimaforscher von der University of Nebraska fand einige Studierende, die bereit waren, für die Antwort auf diese Frage einiges auf sich zu nehmen.
Zunächst schluckten die jungen Freiwilligen eine Kapsel mit einem Thermometer, wie die Forschenden im Fachblatt Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA berichten. Es sollte Auskunft über ihre Körperkerntemperatur geben, während sie in Sportklamotten auf einem Fahrradergometer in einer Kammer vor sich hin strampelten. Nach und nach regelten die Wissenschaftler um Vecellio, die das Ganze durch eine Glasscheibe beobachteten, die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit in der Kammer hoch – und zwar so lange, bis die Körperkerntemperatur der Probanden stieg, bis ihnen ihr Schwitzen also keine ausreichende Kühlung mehr verschaffte. Dann stoppten die Wissenschaftler das Experiment, in der Regel geschah das schon nach ein paar Minuten. »Sie waren nie wirklich in Gefahr, einen Hitzeschlag zu kriegen«, sagte Vecellio später ungerührt der Süddeutschen Zeitung. »Dafür hätte es schon sechs Stunden bedurft.«
Seither steht in etwa fest, welche natürlichen Grenzen dem Menschen gesetzt sind. Bei 50 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit ist das eine Umgebungstemperatur von ungefähr 40 Grad Celsius. Bei 68 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit hält der Mensch jedoch nur Temperaturen bis zu 36 Grad Celsius aus. Und wenn die Luftfeuchtigkeit unfreundliche 100 Prozent beträgt, ist der Tod schon bei einer Temperatur von 30,6 Grad Celsius nicht mehr abzuwenden.
So wird der Klimawandel zu einer ernsten Gefahr. Denn ganze Erdregionen könnten Ende dieses Jahrhunderts völlig unbewohnbar für Menschen werden – und für viele andere Warmblüter noch dazu. Schon ab 2050 könnte zum Beispiel im Nahen Osten wiederkehrend ein Feuchtkugelszenario, im Englischen Wet Bulb Scenario genannt, eintreten, bei dem Hitze und Luftfeuchtigkeit eine lebensfeindliche Liaison eingehen. Solche kritischen Bedingungen sind bereits heute an einzelnen Orten der Welt immer wieder messbar, auch in Deutschland, wo mehrere Wetterstationen im Jahr 2019 die gefährliche Feuchtkugeltemperatur erreicht sahen.
Je höher die Erderwärmung also klettert, desto mehr Regionen werden umso häufiger und länger Temperaturen ausgesetzt sein, die für den menschlichen Körper schier unerträglich sind. »Klar kannst du dann noch in deinem Haus sitzen und deine Klimaanlage laufen lassen – sofern du dir das leisten kannst«, sagt Vecellio. »Aber du bist eingesperrt und kannst dein Leben nicht mehr leben.« Menschen werden diese Regionen verlassen müssen, meint auch Hanns-Christian Gunga: »Ich höre häufig, dass die Menschen in Afrika sich in der Evolution an hohe Temperaturen angepasst haben, dass sie das auch weiter tun werden. Aber das stimmt nicht. Die Menschen sind am Limit.«
Klimaanlagen sind bei all dem ohnehin nur bedingt eine Lösung. Erstens klimatisieren sie nur Räume. Sie helfen nicht beim Einfahren der Ernte und beim Bewirtschaften der Felder. Zweitens befördert ihr Betrieb die Klimakrise weiter, weil Klimaanlagen Energie verbrauchen und noch mehr Wärme in die Umwelt entlassen. »Gerade in Städten verschärfen Klimaanlagen das Problem«, warnt Gunga deshalb. Und drittens nützen sie auch jenen Menschen nur bedingt, die sich eine Klimaanlage leisten können. Denn je mehr man sich herunterkühlt, desto weniger gewöhnt man sich an die Hitze – und desto größer ist letztlich die Gefahr, dass man die nächste Hitzewelle nicht übersteht.
»Akklimatisierung an eine heißere Welt ist eine Notwendigkeit, um zu überleben«, schrieben die Epidemiologen Elizabeth Hanna und Peter Tait vor ein paar Jahren in der Fachzeitschrift International Journal of Environmental Research and Public Health. Aber eine solche Anpassung erfordere eine aktive Auseinandersetzung mit der Hitze, so die Experten. Wer in eine heißere Gegend zieht, soll sich ihnen zufolge zwei bis sechs Wochen lang täglich etwa zwei Stunden in dem neuen Klima aufhalten. Damit beschleunige man die Akklimatisierung und beuge somit einer gefährlichen Überhitzung vor.
Hitzschlag, Hitzekollaps oder Überhitzung?
Die Überhitzung des Körpers und die daraus folgende Denaturierung der Eiweiße ist eine besonders drastische Form des Hitzetods. Doch wenn Menschen bei heißen Temperaturen sterben, ist dies nicht immer auf eine erhöhte Körperkerntemperatur zurückzuführen. Es gibt vielmehr »vielfältige Gründe« für den Tod durch Hitze, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) feststellt. Und Andreas Matzarakis, der Leiter des Zentrums für Medizin-Meteorologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes, sagt sogar: »Es gibt ungefähr 35 Arten, aufgrund von Hitze zu sterben.« Die Wissenschaft unterscheidet zum Beispiel den Hitzekollaps und den Hitzschlag vom Tod durch Überhitzung.
Beim Hitzekollaps schwitzt der Körper um sein Leben. Er versucht, durch massives Schwitzen seine Kerntemperatur nicht über die gefährliche Schwelle steigen zu lassen. Das Problem ist nur: Wenn sein Besitzer nicht gleichzeitig extrem viel trinkt, geht dem Körper durch das massive Schwitzen so viel Flüssigkeit verloren, dass das Blut immer dicker wird. So können sich darin leicht Klümpchen bilden, sogenannte Thromben. Wenn sie sich in den feinen Herzkranzgefäßen oder in den feinen Äderchen im Gehirn absetzen, besteht Gefahr, einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu erleiden, die bekanntermaßen tödlich enden können.
Forschende vom Helmholtz-Zentrum München und der Universitätsklinik Augsburg präsentierten im Mai 2024 neue Daten, wie sehr gerade nächtliche Hitze das Risiko für Schlaganfälle erhöht. Sie hatten über 15 Jahre Daten zu rund 11 000 Schlaganfällen erhoben. Bei starker nächtlicher Hitze stiegen die Fallzahlen demnach um 7 Prozent an – und nächtliche Hitze gibt es nun einmal öfter. Das sei auch deshalb von Bedeutung, »weil durch den Klimawandel die nächtlichen Temperaturen deutlich schneller zunehmen als die Tagestemperaturen«, wie eine der Studienautorinnen, Alexandra Schneider, die Leiterin der Arbeitsgruppe Environmental Risks am Helmholtz-Zentrum, sagt. Das zeigt sich bereits an den Zahlen: In der Region um Augsburg, die die Wissenschaftler untersuchten, war es demnach zwischen 2006 und 2012 jährlich zu zwei zusätzlichen Schlaganfällen infolge von Hitzeperioden gekommen, zwischen 2013 und 2020 waren es schon 33 zusätzliche Fälle.
Wenn brütende Hitze dem Gehirn akut zusetzt, kann sogar ein Hitzschlag drohen. Lässt man sich viel zu lange die sengende Sonne auf den ungeschützten Kopf brennen, werden zunächst die Hirnhäute gereizt, es entstehen Schwellungen unter der Schädeldecke. Die Folge ist als Sonnenstich bekannt: Das Bewusstsein trübt sich ein, man fühlt sich unwohl, bekommt Fieber und heftige Kopfschmerzen, es wird einem schlecht. Menschen fallen dann von Treppen, Fahrrädern oder Leitern oder erleiden einen Verkehrsunfall. »Viele Menschen sterben also einen indirekten Hitzetod«, sagt der Physiologe Gunga.
Im Extremfall aber wird aus dem Sonnenstich ein Hitzschlag. Dann sind von den Schwellungen nicht nur die Hirnhäute, sondern auch das Gehirn selbst betroffen und mit ihm jene Region, die für die Wärmeregulierung des Körpers zuständig ist. Weil das Gehirn daraufhin vergisst, dem Körper zu sagen, dass er schwitzen soll, überhitzt dieser. Er wird immer heißer und die Haut immer röter.
Bevor ein Hitzekollaps oder Hitzschlag eintritt, sendet der Körper in der Regel jede Menge Warnsignale. Man verspürt Kopfschmerzen, Schwindel, Erschöpfung oder Benommenheit. Auch Müdigkeit, Schlappheit, Verwirrtheit oder Atemprobleme sind deutliche Alarmzeichen. Die sollte man ernst nehmen, sofort einen schattigen Platz aufsuchen, die Beine hochlegen und viel trinken, dann lässt sich das Schlimmste meist abwenden. Ist die Überhitzung bereits fortgeschritten oder eine stärkere Benommenheit oder gar kurzzeitige Ohnmacht erkennbar, sollte man allerdings sofort den Rettungsdienst (112) rufen.
Krank durch Hitze
In der Hitze zu sterben, ist das furchtbarste und extremste Szenario. Aber es geht bei den gesundheitlichen Auswirkungen hoher Temperaturen keineswegs nur ums Überleben. Denn zu viel Hitze macht uns krank, sie verursacht zahlreiche Gesundheitsprobleme. Bereits bestehende Krankheiten können verstärkt und neue hervorgerufen werden.
Man kann sich leicht vorstellen, dass das gesundheitliche Risiko durch eine zusätzliche Belastung steigt, wenn der Körper ohnehin schon zu kämpfen hat. So überrascht es wenig, dass Menschen mit Herz- und Lungenerkrankungen durch hohe Temperaturen besonders gefährdet sind, weil den ohnehin angeschlagenen Organen dann eine noch größere Leistung abverlangt wird. Am häufigsten passiert dies in einer Hitzewelle, wenn also richtig heißen Tagen von über 30 Grad Celsius Tropennächte folgen, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad Celsius fällt. Solche Hitzewellen belasten die Gesundheit extrem, weil Menschen nicht nur tagsüber hohen Temperaturen ausgesetzt sind, sondern darüber hinaus nachts keine Abkühlung finden. Die Erholung fehlt.
So kann die andauernde Hitze zu Hautausschlägen, geschwollenen Beinen und Wadenkrämpfen führen. Das Herz ächzt unter der erhöhten Pumpkraft, die es bei geweiteten Gefäßen erbringen muss, um das Blut durch den Körper zu befördern und diesen ausreichend mit Sauerstoff zu versorgen. Die Belastung kann sich auch durch all jene Symptome bemerkbar machen, die schon vor einem Hitzschlag oder Hitzekollaps auftreten. In jedem Fall sollte man bei Kopfschmerzen, Schwindelgefühlen, Erschöpfung oder Benommenheit unbedingt nach Abkühlung suchen.
Doch die Hitze verschlechtert auch viele weitere Erkrankungen, die man auf den ersten Blick nicht unbedingt als temperaturabhängig einordnen würde. So ergeht es Patientinnen und Patienten mit Allergien oder Autoimmunerkrankungen wie Asthma, Diabetes und Multipler Sklerose im Sommer häufig schlechter. Das liegt daran, dass die Hitze das Immunsystem anregt. Das tut diesen Patienten nicht gut, weil das Immunsystem bei ihnen nicht nur von außen eingedrungene Fremdkörper abwehrt, sondern sich auch gegen körpereigene Organe oder Gewebe richtet, die es irrtümlich als Feind erkennt. Ein durch Hitze angestacheltes Immunsystem können Menschen mit Autoimmunerkrankungen deshalb gar nicht brauchen.
Besonders stark leidet unter Hitzewellen das Gehirn. Deshalb führt Hitze nicht nur zu Schlaganfällen und Sonnenstich, wie wir oben gesehen haben, sondern auch zu vermehrten Kopfschmerzen. Zudem können hohe Temperaturen Migräne auslösen oder die Häufigkeit von Migräneattacken erhöhen. Neben der Hitze seien auch Austrocknung und Schlafmangel Triggerfaktoren für Migräneattacken, warnt die Deutsche Gesellschaft für Neurologie. Das lässt sich mittlerweile sogar klinisch belegen: In der Türkei tauchen während Hitzewellen signifikant mehr Patientinnen und Patienten wegen Migräne in der Notaufnahme auf, wie jüngst ein Team von türkischen Notfallmedizinern im American Journal of Emergency Medicine berichtete.
Hitzewellen scheinen geradezu Gift für das Gehirn zu sein. Erschreckende Daten dazu lieferte jüngst ein Wissenschaftlerteam um Mònica Guxens vom Barcelona Institute for Global Health. Die Forschenden blickten mit Kernspintomografen in die Gehirne von fast 2700 niederländischen Kindern zwischen neun und zwölf Jahren und setzten das, was sie da sahen, mit den Klimaverhältnissen am Wohnort der Kinder in Relation. Waren die Sommer in den ersten Lebensjahren der Kinder besonders heiß gewesen, dann entwickelte sich bei ihnen die weiße Substanz im Gehirn langsamer, berichteten die Forschenden Ende 2023 im Fachblatt Nature Climate Change. Die weiße Substanz ist dafür zuständig, Informationen zwischen den Gehirnregionen hin und her zu schicken. Sie scheint sowohl fürs Denken als auch für das psychische Wohlbefinden wichtig zu sein. Was dieser Befund für die Kinder bedeutet, ist allerdings noch unklar. Womöglich werde die weiße Substanz später noch nachentwickelt, sagt Guxens. In jedem Fall aber sei die Nachricht bedenkenswert, dass Hitze im Gehirn Veränderungen auslöse, man müsse auf der Hut sein.
Auch Menschen mit psychischen Erkrankungen leiden in der Hitze oft besonders. Angstsymptome können ebenso verstärkt werden wie Demenzerkrankungen, bipolare Störungen oder Schizophrenie. So werden psychiatrische Notaufnahmen an heißen Tagen sehr viel häufiger aufgesucht als an kühlen. Auch scheinen Menschen mit psychischen Erkrankungen besonders sensibel auf Hitze zu reagieren, ihre Sterblichkeit ist während einer Hitzewelle deutlich stärker erhöht als die von Menschen ohne solche Erkrankungen. Wahrscheinlich liegt auch dies daran, dass die hohen Temperaturen das Gehirn sehr belasten: Psychische Krankheiten gehen schließlich vom Gehirn aus.
In der Hitze steigt aber auch die Hitze des Gemüts. Weil das Gehirn unter den Temperaturen leidet, kommt es zu mehr Aggressionen und Feindseligkeiten unter Menschen. Wenn hingegen Temperaturen rund um die »Komforttemperatur von 21 Grad Celsius« herrschen, kehren Menschen vermehrt »sozial verträglichere Charaktereigenschaften« hervor, wie Claudia Winklmayr vom Max-Delbrück-Centrum in Berlin sagt. Das bekommt man an Sommertagen nicht nur im Straßenverkehr zu spüren, an denen Hupen und Überholmanöver dafür sorgen, dass man den Begriff »sonniges Gemüt« gerne umdefinieren würde. Wiederholt haben Studien gezeigt: Das geht sogar so weit, dass die Zahl von Gewaltdelikten in heißen Sommern steigt. Es kommt vermehrt zu Körperverletzung, Mord, Vergewaltigung und Raubüberfällen.
Amerikanische Psychiater sehen durch den Klimawandel jedenfalls große Probleme auf die Gesellschaften zukommen. Sie haben sich zur Climate Psychiatry Alliance zusammengeschlossen. Ihr Ziel: »Wir wollen über die drängenden Risiken durch die Klimakrise und ihren erheblichen Einfluss auf die mentale Gesundheit und das Wohlbefinden aufklären.« So könnten sie Menschen dazu befähigen, besser vorzubeugen.
Auch Medikamente sind hitzeempfindlich
Menschen mit Vorerkrankungen sind jedoch nicht nur wegen ihrer Erkrankungen selbst besonders hitzesensibel. Hinzu kommt ein Umstand, der den wenigsten Menschen bewusst ist: Hitze tut Medikamenten nicht gut. Ihre Wirkung kann bei hohen Temperaturen verändert sein – und zwar sowohl hin zu einem stärkeren therapeutischen Effekt als auch zu einem schwächeren. So muss gewappnet sein, wer täglich Blutdrucksenker wie zum Beispiel Betablocker einnimmt. Denn diese Medikamente wirken in der Hitze stärker, es kann dann zu einem gefährlichen Abfall des Blutdrucks kommen. Wenig überraschend ist, dass Entwässerungsmittel wie Diuretika zur Gefahr werden können, wenn der Körper allein schon wegen der Hitze an Wasser verliert.
Ein Risiko sind auch all jene Arzneimittel, die Acetylcholin enthalten. Dieser Wirkstoff, der die Kommunikation zwischen Nervenzellen vermittelt, steckt in vielen Psychopharmaka, etwa solchen gegen Depressionen und Angststörungen. Er ist aber auch in Medikamenten zur Behandlung von Parkinson und in Mitteln gegen Reiseübelkeit enthalten. Das Problem ist, dass Acetylcholin das Schwitzen unterbindet, sagt Bernd Mühlbauer