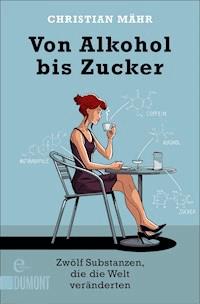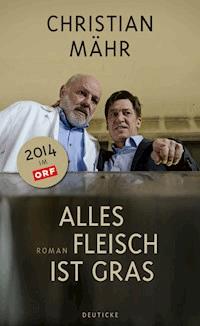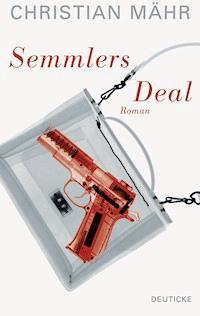Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zsolnay, Paul
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Matthias Spielberger, Wirt der "Blauen Traube" in Dornbirn, wird von seinem Schulkollegen Erasmus von Seitenstetten kontaktiert: Der aus verarmtem Adel stammende Biologe hat entdeckt, dass einer seiner Ahnen an einer rätselhaften Seuche – dem "Englischen Schweiß" – verstorben war. Nun plant er im Geheimen dessen Exhumierung, um durch die Lösung dieses wissenschaftlichen Rätsels berühmt zu werden. Mithilfe der Stammtischrunde aus der "Blauen Traube" wird im Wienerwald das Ahnengrab geöffnet. Doch das Gerippe hat mittlerweile mehrere Interessenten auf den Plan gerufen, und die Sache beginnt gründlich aus dem Ruder zu laufen ... Ein morbider, böser und sehr unterhaltsamer Krimi aus Österreich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 540
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Matthias Spielberger, Wirt der »Blauen Traube« in Dornbirn, wird von seinem Schulkollegen Erasmus von Seitenstetten kontaktiert: Der aus verarmtem Adel stammende Biologe hat entdeckt, dass einer seiner Vorfahren im 16. Jahrhundert von einer rätselhaften Seuche, die als »Englischer Schweiß« bekannt ist, dahingerafft wurde. Er plant nun eine – illegale – Exhumierung des Leichnams, um dieses wissenschaftliche Rätsel zu lösen und dadurch berühmt zu werden. Dafür braucht er Hilfe, was dazu führt, dass die Stammtischrunde aus der »Blauen Traube« anreist, um im Wienerwald das Grab des Seitenstetten-Ahns zu öffnen. Doch dessen Knochen haben mittlerweile auch andere Interessenten auf den Plan gerufen, und die Sache beginnt gründlich aus dem Ruder zu laufen … Bösartig, morbide und sehr unterhaltsam.
Deuticke E-Book
Christian Mähr
Knochen kochen
Roman
Deuticke
ISBN 978-3-552-06305-1
Alle Rechte vorbehalten
© Deuticke im Paul Zsolnay Verlag Wien 2015
Umschlag: Lübbeke Naumann Thoben, Köln Illustration: © Angela Kirschbaum
Satz: Eva Kaltenbrunner-Dorfinger, Wien
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen
finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/ZsolnayDeuticke
Datenkonvertierung E-Book:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
1
Matthäus Spielberger erwachte und wusste, dass er krank war. Es tat ihm nichts weh, die Nase lief nicht, kein Husten quälte ihn. Aber er fühlte sich krank. Ein allgemeines Unwohlsein, Gewissheit: Etwas ist nicht in Ordnung. Nach der Ursache brauchte er nicht zu suchen.
Er hatte geträumt.
Einen speziellen Traum.
Er blieb eine Zeitlang auf dem Bettrand sitzen. Mathilde schlief in einem anderen Zimmer; seine Frau hatte es schon vor Jahren aufgegeben, sich an das Schnarchen zu gewöhnen. Er stand auf, öffnete die Klappläden und schaute aus dem Fenster. Ein Frühlingstag, etwas verhalten noch, mit bedecktem Himmel, aber rein astronomisch schon Tag. Acht Uhr. Er fröstelte. Er musste sich verkühlt haben, vor zwei Tagen auf dem Bödele, dem Dornbirner Hausberg. Mit seinen Freunden Blum, Moosmann und Dr. Peratoner war er bis drei Uhr früh dort gewesen, um Galaxien zu beobachten. Frühlingszeit ist Galaxienzeit. Eine Prachtnacht. Ruhige Luft, das Seeing so gut wie selten in diesem Landstrich, der Spiegel ausgekühlt, es war ein Erlebnis gewesen. Vor allem, weil sich die Kameraden so für sein Hobby begeistern konnten. Das war auch nötig, weil er das Instrument, einen Siebzehneinhalb-Zoll-Dobson amerikanischer Provenienz, allein nicht bewegen konnte. Das Fernrohr stand neben seinem Bett und dominierte das kleine Schlafzimmer. Wer den Anblick nicht gewohnt war, erschrak. Das dunkelblaue Rohr war fast zwei Meter lang und über einen halben Meter dick, es glich mehr einer Terrorwaffe als einem astronomischen Instrument. Man konnte den Tubus zwar teilen, aber der schwerere untere Teil mit dem Spiegel wog einundvierzig Kilo, das ganze Ding zusammengebaut über achtzig. Das hatte er beim Kauf vor einigen Jahren nicht bedacht. Er war das Hantieren mit schwerem Zeug von den Bierfässern her gewohnt, aber das Ding in der freien Natur an abgelegene, dunkle Ecken zu schleppen war kein Vergnügen. Es brauchte zwei Leute zum Transport. Das war ihm erst klar geworden, als er das Monsterrohr das erste Mal zusammengebaut hatte. Mathilde war keine Hilfe, sie interessierte sich nicht für das Betrachten der Sterne und war auch über den Preis nicht erbaut gewesen (dreitausend Dollar), weil das Gasthaus, das sie führten, so eine Ausgabe für ein bloßes Hobby nicht trug. Eigentlich. Uneigentlich hatte sie sich damit abgefunden. Denn ihr Matthäus besaß sonst keine Angewohnheiten oder Eigenschaften, die eine Frau in die Nähe der Verzweiflung bringen. Er trank nicht mehr, als ein Wirt hierzulande konsumieren musste, um nicht als Sonderling zu gelten. Das war wichtig: Ein Wirt durfte ein »Original« sein, aber kein Sonderling. Die Rolle der Sonderlinge wurde von den Stammgästen übernommen; jedenfalls in Wirtshäusern vom Schlage der »Blauen Traube«, die seit mehr als hundert Jahren und mindestens drei Generationen den Zeitläuften und allen Moden trotzen.
Den Part des Sonderlings gaben seine Freunde, die an seinem Hobby Anteil nahmen; jeder auf seine Weise. Blum brachte den »Wundern des Weltalls« kindliches Interesse entgegen. Er staunte gern und wurde nicht müde zu staunen, obwohl sich Matthäus bei den Astroexkursionen nach der Vorführung einiger Highlights (Orionnebel und so weiter) nur noch mit den Sachen befasste, die ihn interessierten: dem Aufsuchen schwacher Galaxien, immer an der Grenze der Leistungsfähigkeit seines Instruments, kaum erkennbare, winzige Lichtfitzelchen, nur bei dunkelstem Himmel aufzuspüren. Diesen Himmel konnte man nicht vom lichtverseuchten Vorarlberger Rheintal aus sehen, sondern nur von den Bergen im Osten – wenn man es nicht überhaupt vorzog, mit seinem Fernrohr ins Hochgebirge zu entfliehen, am besten auf die Silvretta im Süden des Landes. Matthäus Spielberger wusste nicht, ob seine Freunde ihn aus eigener Begeisterung für die Sternguckerei begleiteten oder ihre Exkursionen als eine Art Tribut an den Spleen des Wirtes begriffen, der ihnen ein Zuhause bot. Denn alle drei hatten ihr Wohnzimmer im Gastraum der »Blauen Traube«. Dort verbrachten sie einen Großteil ihrer Freizeit. Davon hatten sie reichlich. Der Chemielehrer Dr. Lukas Peratoner war schon in Pension, ebenso der Buchhalter Franz-Josef Blum, nur der Jüngste, Lothar Moosmann, arbeitete noch. Er war Holzschnitzer, hochberühmt in ganz Süddeutschland und der Ostschweiz für seine religiösen Bildwerke. In Vorarlberg eher weniger, was mit der Rezeptionskultur künstlerischer, aber auch anderer Leistungen durch die Landsleute zusammenhing; Lothar war deswegen nicht böse, er verabscheute eben diese Landsleute sowieso. Wie auch die Religion. Seine Kunden wussten nicht, dass er Atheist war.
Lothar Moosmann war ledig.
Franz-Josef Blum war Witwer.
Dr. Lukas Peratoner war geschieden.
Ja, so war das. Alle verehrten Mathilde Spielberger, die »Lecherin«. Sie hieß nach einer berühmten Vorfahrin namens »Lecher« und hatte das Wirtshaus von ihren Eltern geerbt, die es ihrerseits von ihren Eltern geerbt hatten. Die »Blaue Traube« war eines der letzten Wirtshäuser alten Schlages, wo man für dreißig Personen, etwa einen Jahrgängerausflug, eine sogenannte Käsknöpflepartie bestellen konnte. Dieses in Vorarlberg beliebte Gericht wird aus Mehl, Wasser, einem Ei, Zwiebeln und drei verschiedenen Käsesorten hergestellt. Und Fett. Die Küche riecht danach mindestens achtundvierzig Stunden nach gebratenen Zwiebeln, was man mögen muss. Matthäus Spielberger mochte es nicht. Aber Mathilde war unerbittlich, beruhte doch der Ruhm ihres Hauses auf den unvergleichlichen Käsknöpfle und einem Dutzend anderer Gerichte, die man in der »Blauen Traube« in ihrer ursprünglichen, also nicht cholesterin- und triglyceridreduzierten Form genießen konnte. Schweinsbraten mit Knödel und Kraut zum Beispiel. Kartoffelpuffer mit grünem Salat. Manche Gäste behaupteten, in der »Blauen Traube« könne man Fettmengen konsumieren, bei denen einem anderswo schlecht würde – kurz: Es herrschten idyllische kulinarische Verhältnisse. Familiär war es auch idyllisch, ja, kann man sagen, wenn man vergleicht, wie es in anderen Häusern zugeht. Keiner der Ehepartner ging fremd oder war je fremdgegangen. Wenn sie sich stritten, dann über zu hohe Ausgaben für das Astrohobby. Tochter Angelika hatte nach langen Mühen einen Freund gefunden, einen in Bregenz beschäftigten Ingenieur, gebürtiger Spanier, der an ihr haften zu bleiben schien, was bei zahlreichen früheren Freunden nicht der Fall gewesen war. Diese Beziehung tröstete sie über die Unmöglichkeit, als promovierte Kunsthistorikerin einen adäquaten Job zu finden. Dr. Peratoner meinte, nach der Hochzeit werde ihr das gelingen, weil sie dann nach spanischer Sitte Angelika Villafuerte-Spielberger heißen würde. Angelika war sich nie sicher, ob sich der Chemiker nicht über sie lustig machte.
Es war also alles im grünen Bereich und von einer spezifischen Langeweile durchtränkt, wie sie die Hauptstädter mit dem Dasein in der Provinz verbinden. Die betreffenden Provinzler leiden aber nicht darunter, das ist das Seltsame. Ein einziger Schatten lag über dem Leben des Matthäus Spielberger. Seit einem nach außen hin glimpflich verlaufenen Autounfall hatte er Träume.
Über die Zukunft.
Nach innen hin hatte die Gehirnerschütterung etwas verändert, verschoben. Er träumte Dinge, die sich erst ereignen würden. In Farbe und 3-D und nicht etwa mit verrauschter Tonspur, sondern so, als ob er daneben stünde. Solche Träume waren selten, und darüber war er froh. Nicht, dass es darin um das Ende der Welt gegangen wäre, um den Antichrist, den Ausbruch des Supervulkans im Yellowstone-Nationalpark oder den Einschlag eines Asteroiden im Wienerwald – seine prophetischen Träume hatten nichts Apokalyptisches. Er sah darin nur Menschen, die ein Verbrechen begingen. Beziehungsweise die Begehung eines Verbrechens vorbereiteten. Mit ihm selber hatte es nichts zu tun, auch nicht mit seiner Familie oder seinen Freunden oder mit irgendjemandem, den er auch nur flüchtig kannte. Er stand nur dabei, sah und hörte zu. Die Leute in diesen Träumen schienen ihn nicht wahrzunehmen. Und ja, es ist dies natürlich die Position, die nach den Vorstellungen der Religion Gott im Leben der Menschen einnimmt. Unsichtbar, hört und sieht aber alles. Matthäus Spielberger war das klar, er hatte aber diesen Punkt seinen Freunden gegenüber nie zur Sprache gebracht. Was er zur Sprache gebracht hatte, waren die beiden Träume selber.
Das hätte er nicht tun sollen.
Er wurde dadurch in Geschehnisse verwickelt, in die er nicht hatte verwickelt werden wollen (sie wurden an anderer Stelle geschildert) – aber das war nun vorbei und hatte ihn den festen Vorsatz fassen lassen, dass er über den Inhalt seiner etwaigen Träume Stillschweigen gegen jedermann und jede Frau bewahren würde, ganz egal, welchen Inhalts diese Träume waren. Beim letzten Mal waren er, seine Familie und seine Freunde in die Sache hineingezogen worden; aber was heißt, bitte, hineingezogen? Sie hatten sich alle miteinander beträchtlichen Gefahren für Leib und Leben ausgesetzt, nur durch Geschick und Glück waren Verletzungen und Todesfälle vermieden worden. Also eher durch Glück, eigentlich, wenn man es recht bedachte, nur durch Glück, von Geschick konnte auch der Wohlmeinendste nicht reden. Sie hatten sich, wenn man ehrlich war, in dieser Sache aufgeführt wie eine Horde Idioten. Aber das sollte ihnen kein zweites Mal passieren. Und zwar deshalb, weil der Hauptverantwortliche, nämlich er selbst, Matthäus Spielberger, Wirt aus Dornbirn, das Maul halten würde.
Der Traum, der ihn dieses Mal aus der Bahn warf, diffus erkranken ließ, hatte nichts Schockierendes an sich. Nichts Kriminelles. Wenn man, wie in seinem ersten Traum dieser Art, zwei Männer sieht, die einen nackten dritten über ein Brückengeländer werfen, ist die Sache relativ klar: Niemand käme auf irgendwelche Harmlosigkeiten. So eine Szene deutet auf extreme Gewalttaten. Kein Mensch glaubt, der dritte sei im Bett gestorben.
In seinem neuen Traum deutete nichts auf Gewalt. Es sah eher aus wie eine Szene aus einer Wissenschaftsdokumentation, wie sie Nacht für Nacht in den Spartenkanälen liefen. Die sah er sich an, wenn er nicht schlafen konnte. Leute mit Spaten und Hacken gehen durch einen Wald. Vielleicht auf dem Weg zu einer Ausgrabung, kann doch sein. Aber noch oberhalb der Erdoberfläche. Und in Ägypten war das auch nicht, das erkannte er an der Vegetation und am Fehlen von Staub. Wenn sie wieder einmal ein Grab der achtzehnten Dynastie untersuchen, verschwimmt alles in gelben Staubwolken, der allgegenwärtige Christian Brückner spricht im Off-Text von fünfundvierzig Grad, die es da unten habe, und jeder glaubt das sofort, die Bilder selbst strahlen die Hitze aus; jeder sagt sich: Mein Gott, möchte ich jetzt nicht da unten sein, man hört es sogar der Stimme von Christian Brückner an, dass er jetzt nicht da unten sein will. Aber interessant ist es schon, keine Frage, man kann froh sein, dass es ein paar Verrückte gib, die freiwillig dort unten herumkriechen und das große Rätsel zu lösen versuchen, wer sich in der Mumie Nummer vierzehn verbirgt. Es steht nämlich nicht auf dem Sarg …
Von diesem Szenario war der Traum des Matthäus Spielberger weit entfernt. Es gab keinen Off-Text, Christian Brückner blieb stumm. Dafür hörte Matthäus die Personen in der Szene reden. Besonders eine Person. Diese Person fluchte auf bekannte Weise mit bekannter Stimme, die er unter Tausenden herausgehört hätte. Sein Freund Lothar Moosmann, der Holzschnitzer. Der Mann daneben war sein Freund Dr. Lukas Peratoner, der Lothar zu beruhigen versuchte. Der dritte dahinter sagte nichts. Es war Franz-Josef Blum, der alle anderen überragte. Seine Freunde reichten, um ihn zu beunruhigen. Weder Lothar noch der Doktor hatten archäologische Interessen. Was zum Henker taten sie also in einem Wald? Nach etwas graben, das konnte er an der Ausrüstung sehen. Aber was? Und warum?
Fragen konnte er sie nicht. Denn was er heute Nacht gesehen hatte, war noch gar nicht passiert. In diesem Punkt fühlte er sich sicher. Ob das Geschehen aber Wochen und Monate oder nur Tage in der Zukunft lag, konnte er nicht sagen. Zwar hätten ihm seine Erfahrungen gestattet, die Fristen zwischen Wahrtraum und Ereignis auszurechnen – aber er hatte das jeweilige Datum seiner Träume vergessen. Besser: verdrängt. Denn er wollte das Phänomen weder wissenschaftlich untersuchen noch sich überhaupt auf irgendeine Weise damit auseinandersetzen. Er wollte seine Ruhe haben. Er hegte Abscheu gegen Rätsel dieser Art. Rätsel akzeptierte Matthäus Spielberger nur in anerkannten Wissenschaften, etwa der Astronomie. Woraus besteht die geheimnisvolle dunkle Materie? Was hat es mit der noch geheimnisvolleren dunklen Energie auf sich? Solche Sachen halt, die alle interessierten, aufgeklärten Menschen betrafen – nicht so esoterisch angehauchte Materien wie die Präkognition. Er litt unter seiner Sehergabe, obwohl in seinem Fall das Hauptproblem aller Propheten nicht schlagend wurde: Seine Prophezeiungen trafen punktgenau ein, sie waren ja auch wie Videoaufnahmen aus der Zukunft – nur eben Videoaufnahmen in seinem Kopf, den die Erschütterung des darin befindlichen Gehirns auf unerklärbare Weise instand gesetzt hatte, sinnliche Erfahrungen in der Zukunft zu machen. Allerdings ungesteuert. Er konnte sich also, um ein naheliegendes Beispiel zu wählen, nicht in die paar Minuten der Lottoziehung am nächsten Samstag versetzen, was seiner Fähigkeit wenigstens einen positiven Nebeneffekt verliehen hätte. Diese Lottosache war in seiner Runde intensiv diskutiert worden – gleich als Erstes, nachdem sie aus den Folgen seiner realen Zukunftsschau mit einem blauen Auge herausgekommen waren. Dr. Peratoner verstieg sich sogar zum Ratschlag, er, Matthäus, könnte sich doch hypnotisieren oder von einem Schamanen in Trance versetzen lassen, vielleicht ergäbe sich in diesem Zustand eine Schau auf nützlichere Zukunftsereignisse … Das hatte bei Matthäus einen Wutausbruch und drei Tage währendes beleidigtes Schweigen zwischen den Beteiligten zur Folge, erst danach kamen sie stillschweigend zur Übereinkunft, den Vorschlag nicht mehr zu erwähnen.
Und jetzt hatte Matthäus ein Problem. Er konnte den neuen Traum nicht verschweigen. Etwas drängte ihn, alles auszuplaudern. Denn dieses Mal waren in seinem Traum Menschen vorgekommen, die er kannte. Peratoner und Moosmann. Eine andere Instanz in seinem geplagten Kopf opponierte heftig: »Bist du jetzt verrückt geworden? Hat das nicht gereicht, was das letzte Mal passiert ist?«
Dagegen konnte er schwer etwas sagen. Als er seinen ersten Traum den Freunden offenbart hatte, da hatten sie ihm alles geglaubt, Wort für Wort. Und darauf bestanden, dem Verbrechen, das er im Traum gesehen hatte, nachzugehen. Obwohl es noch gar nicht passiert war. Sehr kompliziert. Eine Schnapsidee natürlich, was sich sogleich zeigte, als er bei diesem »Nachgehen« einer Figur aus seinem Traum begegnete … Bald darauf kam es dann zum ersten Todesfall. Es verhielt sich ganz einfach so: Diese »Gabe« war etwas für Leute, die mit ihrem Leben nichts Rechtes anzufangen wussten, die einen gewissen Nervenkitzel brauchten. Leute, die free climbing in Arizona betreiben oder rafting in den Alpen oder sonst etwas Verrücktes mit englischer Bezeichnung in anderen Erdteilen. Abenteurer halt. Leute also, die, wie Dr. Peratoner immer sagte, »alle paar Monate ausprobieren müssen, ob Gott sie noch liebhat«. So einer war Matthäus Spielberger nun aber gerade nicht. Zu den Höhepunkten seines Lebens gehörte die Sichtung einer Galaxie sechzehnter Größe, die zu sehen ihm noch nicht vergönnt gewesen war – dann strömte ihm das Adrenalin in die Adern. Auf die gute Art. Nicht auf die Art, die sich einstellt, wenn man draufkommt, dass ein Geheimdienst die eigene Familie im Visier hat. Auch schon erlebt. Auf Adrenalin dieser Genese konnte Matthäus verzichten.
Seinen zweiten Traum hatte er aus guten Gründen seinen Freunden nicht mehr mitgeteilt. Auch nicht seiner Frau. Nur seiner Tochter. Die hatte dann entsprechend reagiert – und damit letzten Endes alles zum Guten gewendet. Für die Familie Spielberger und ihre Freunde. Nicht für die anderen Beteiligten. Aber bitte: Keiner hatte diese Herrschaften gebeten, in den Träumen des Matthäus Spielberger aufzutauchen! Die Folgen mussten sie sich schon selber zuschreiben …
Matthäus Spielberger war hin- und hergerissen. Ich bin einer von denen, dachte er, die ihr verdammtes Maul nicht halten können! Es drängte ihn, seinen Traum zu erzählen. Aber daraus würden sich die ärgsten Schwierigkeiten ergeben … Ich muss still sein, dachte er, still sein und das Ganze vergessen. Ich muss es ihnen erzählen. Ich muss still sein …
Dann kam er zu einem Entschluss.
Ich werde mich von diesen Träumen nicht verrückt machen lassen. Seit dem Aufwachen hatte er nachgedacht – so konnte es nicht weitergehen. Beim Frühstückskaffee rief er alle drei an. Zuerst Lothar Moosmann, dann Franz-Josef Blum, dann Dr. Lukas Peratoner. Er lud sie zum Mittagessen ein.
Als sie dann da waren, erzählte er ihnen seinen Traum, noch bevor die Suppe aufgetragen war (Rindssuppe mit Frittaten). Die Reaktion darauf hatte er nicht erwartet. Sie blieb aus. Seine Freunde brummelten Unverständliches und blickten zur Tür hinter der Wirtshaustheke. Durch diese Tür kam die Wirtin Mathilde mit einem großen Tablett. Sie servierte die Suppe.
»Hast du’s ihnen schon erzählt?«, fragte sie, ohne aufzusehen.
»Ich bin mir nicht sicher. Ich bilde es mir ein, aber vielleicht hab ich schon Alzheimer und noch kein Wort gesagt! Sie äußern sich nicht. Oder hörst du was?«
Zu hören war nur das Schlürfen von Lothar, der sich bei keiner Art Essen zurückhalten konnte und alles wie ein Verhungernder hinunterschlang.
»Du verstehst uns miss«, säuselte Dr. Peratoner, »wir schweigen – ich darf, denke ich, für uns alle sprechen –, weil wir den Fortgang deiner Erzählung erwarten. Wie geht es weiter in diesem Wald?«
»Das weiß ich nicht. Und was heißt ›Fortgang‹? Das war schon alles …«
»Ist Blut dran?«, fragte Lothar Moosmann.
»Blut? Was meinst du? Wo soll Blut dran sein?«
»An den Spitzhacken. Oder den Schaufeln.«
»Nein, natürlich nicht! Wie kommst du überhaupt …«
»Jetzt setz dich hin und iss!«, unterbrach ihn seine Frau.
»Dann ist es ja gut«, sagte Lothar und legte den Löffel zur Seite. Er war schon fertig mit seinem Teller. »Kein Blut – kein Verbrechen.«
»Magst du noch?«, fragte die Wirtin.
»Nein, danke, ich muss ein bisschen aufs Gewicht schauen.«
Franz-Josef Blum summte vor sich hin. Wie immer, wenn ihm etwas schmeckte. Matthäus Spielberger sah von einem zum anderen. Dr. Peratoner sah ihn an. »Mir scheint bei dir eine gewisse Spannung vorzuliegen, lieber Freund. Sag an, was bedrückt dich!« Je besser der Chemiker drauf war, desto geschwollener wurde seine Rede. Und bei gutem Essen wie jetzt war er sehr gut drauf. Matthäus hatte ihn einmal bei einem Sauerbraten in Tränen ausbrechen sehen.
»Ich hatte mir ehrlicherweise eine Art Kommentar erwartet«, sagte er. »Etwas wie ›aha‹ oder ›interessant‹ …«
»Du erwartest immer zu viel von den Menschen«, murmelte Franz-Josef Blum.
Matthäus sagte nichts darauf. Er spürte, wie eine große Spannung von ihm abfiel. Ich habe mir, dachte er, ganz umsonst Sorgen gemacht. Nicht, dass sie mir nicht glauben, ist das Problem. Sie glauben alles. Sondern das Geträumte selbst.
Es ist banal.
Davon kündet kein Bericht über mythologische oder historische Seherinnen und Seher. Kassandra sah nur Katastrophen, die ihr niemand glaubte. Aber immer bedeutende Dinge. Den Untergang Trojas und so … Wenn sie den Achsbruch eines Ochsenkarrens auf dem trojanischen Wochenmarkt vorausgesehen hätte oder einen Bauschaden an irgendeinem Tempel, wäre sie nie bekannt geworden. Während er seine Suppe aß, dachte Matthäus weiter darüber nach. Die anderen um ihn führten heitere Gespräche, der Geräuschpegel stieg; es ging nicht um ihn und seine Sehergabe. Das muss ein ernüchternder Moment im Leben jedes Propheten sein, dachte er, wenn er zum ersten Mal merkt, dass er auch Kinkerlitzchen voraussieht, nicht nur Welterschütterndes. Bis heute rätselt die Welt über die Prophezeiungen des Nostradamus – und jeder nimmt an, dass seine Strophen sich auf Wichtiges beziehen. Natürlich: Nostradamus muss seine Visionen selber so gesehen haben. Für irgendeinen Blödsinn hätte er sich nicht die Mühe gemacht, verklausulierte Verse zu verfassen. Aber wer sagt denn, dass alle Zukunftsschau des Franzosen von dieser Art war? Was, wenn auf eine bedeutende Vision fünf oder zehn ohne Relevanz kamen? Dass Matthieu, der Müller, wieder seine Frau betrügt (was ohnehin die ganze Stadt weiß), oder dass Antoine, der Wirt, einen Kapaun essen wird. Und schließlich: dass es regnen wird.
Matthäus Spielberger hatte bei Prophezeiungen noch nie von Alltäglichkeiten gehört. Weil solche nicht bekannt waren, geht man davon aus, dass die betreffenden Personen nur Bedeutendes in der Zukunft sehen. Wieso? Weil die Propheten und Prophetinnen nur wichtige Dinge erzählen, meistens fürchterliche. Alle anderen, ebenso gesehenen, behalten sie für sich. Ich hätte es auch so machen sollen, dachte Matthäus. Diese Waldpartie bedeutet … nun, keine Ahnung, was sie bedeutet, aber nichts Schlimmes. Hat er doch gesehen. Er hätte den Mund halten sollen. Anfängerfehler. Würde nicht mehr vorkommen. Hatte er auch nicht wissen können. Es gab ja keine Prophetiekurse an der Volkshochschule, wo sie einem beibringen, wie man als Seher seine Gaben medial verwertet. Da musste jeder seine eigenen Erfahrungen machen. Und seine eigenen Fehler.
»Was gibt’s jetzt noch?«, fragte er.
»Krautrouladen und Salzkartoffeln«, antwortete Mathilde, »und zum Nachtisch Vanillepudding mit Brombeersauce.« Ringsum erhob sich anerkennendes Gemurmel.
Von irgendwelchen Exkursionen in einen Wald wurde nicht mehr gesprochen.
Nicht bei diesem Essen und nicht in den folgenden Wochen.
2
Matthäus Spielberger gehörte nicht zu jenen Menschen, die in der Vergangenheit leben. Sein Leben hatte ihn nicht mehr gebeutelt als andere Menschen seiner Generation, das hätte er auf Befragen sogar selber zugegeben, er wollte sich nur nicht daran erinnern.
Und man musste sich nicht erinnern, dazu bestand kein Anlass. Es sei denn, jemand erzwang die Erinnerung. Von außen. Indem er einen zum Beispiel anrief. Wie dieser Seitenstetten, der Trottel. Matthäus hätte nur fünf Minuten früher aus dem Haus gehen müssen. Der Anruf kam übers Festnetz. Das Telefon befand sich im Gastraum hinter der Theke. Matthäus Spielberger meldete sich, wie es seine Gewohnheit war, mit einem wartenden »Ja?«, nicht mit seinem Namen oder dem des Gasthauses, eine Eigenheit, die seine Frau Mathilde auf die Palme brachte. Sie hielt es für unprofessionell. »Genau!«, sagte er dann, worauf sie nichts mehr sagte, denn dies berührte einen heiklen Punkt. Matthäus Spielberger war nicht gern Wirt, was er ab und zu durch kleine Aufsässigkeiten merken ließ.
Der Anrufer fragte nicht, ob er mit Matthäus verbunden sei, er sagte auch nicht, wer er selber war, sondern einfach nur: »Grüß dich, Lumpi!«
Und Matthäus antwortete: »Servus, Seitenstetten!«
Ein Reflex. Seitenstetten brauchte nicht zu fragen, von wem das »Ja?« kam, und Matthäus ging es mit seinem Gegenüber ebenso. Sie hatten sich an der Stimme erkannt. Zwar lag das letzte Maturatreffen schon zehn Jahre zurück, das machte aber nichts. Die Stimmen waren in die Hirne eingraviert und würden es bis ans Lebensende bleiben. Matthäus wunderte sich auch nicht, als »Lumpi« angesprochen zu werden; diesen Spitznamen hatte er zwar nie geschätzt, aber auch nicht darunter gelitten. Er stammte aus der mythischen Vorzeit der Unterstufe, die genauen Umstände der Entstehung waren niemandem mehr bekannt. Er hieß eben »Lumpi«, und Seitenstetten, der es nie zu einem Spitznamen gebracht hatte, war »Seitenstetten« geblieben; niemand war je auf die Idee gekommen, den umständlichen Namen abzukürzen.
»Wie geht’s dir?«, fragte Seitenstetten.
»Gut, danke. Und selbst?«
»Ach, man lebt. – Ich hab nur ein Problem.«
»Lass hören!«
Sie hätten diese Unterhaltung wortgleich auch vierzig Jahre früher führen können. Wenn jemand in ihrer Klasse »ein Problem« hatte, fragte er Matthäus Spielberger. Der war nicht der Primus, nur knapp dahinter, aber er konnte am besten erklären. Natürlich kam man nicht mit jedem »Problem« zu Matthäus, nur mit solchen, für die »Lumpi« eine Lösung haben würde. Also schulisch-praktisch. Wenn man Hausaufgaben vergessen hatte. Die ließ einen Matthäus abschreiben. Immer.
Als Matthäus Spielberger nun von einem »Problem« hörte, war er gespannt, was das sein konnte; wohl kaum die Mathematikhausaufgabe, die Seitenstetten oft vergessen hatte, Mathematik war nicht seine Stärke gewesen … Seitenstetten unterbrach den abschweifenden Gedankengang: »Du weißt vielleicht von meinem Onkel Albert-Matthias?«
»Tut mir leid, der Name sagt mir nichts. Er will dich enterben?«
»Wie kommst du da drauf?«
»Du sagst doch, du hast ein Problem!«
»Ja, ich hab ein Problem, es hängt mit Onkel Albert-Matthias zusammen, aber es ist nicht von der Art, die du da insinuierst. Ich darf sagen, der Onkel war mir immer zugetan, ich hab auch nie etwas unternommen, was der Familienehre nicht zuträglich gewesen wär, du verstehst schon! Also ich muss sagen, deine Andeutung ist kränkend – ich mein, dass er mich enterbt hätt. War eh nix mehr da, nebenbei …«
»Erasmus, tu mir den Gefallen und reg dich ab! Ein Problem. Was soll das sein? Hausaufgaben machst du schon lang nicht mehr. Und deine übrigen Probleme hatten alle mit deiner Familie zu tun. Was soll ich annehmen bei der begrenzten Auswahl?«
Am anderen Ende der Leitung blieb es still. Matthäus war nicht beunruhigt. Seitenstetten fiel oft mitten im Gespräch in Schweigen, um über etwas nachzudenken, was gesagt wurde. Am Telefon machte er das offenbar genauso. Man musste nur Geduld haben.
»Du hast recht, Lumpi, wie immer, möcht ich fast sagen!« Seitenstetten lachte. »Er hätt mich schon berücksichtigt, der Onkel, da kannst beruhigt sein, wir waren gut miteinander, aber es war halt nix mehr da, verstehst? Bis auf den Nachlass halt …«
»Was für einen Nachlass?« Darauf ging Seitenstetten nicht ein. »Angfangen hat alles mit dem Ferdinand, wo er sich verspekuliert hat mit dem Kieswerk anno vierundachtzig. Von da an ist alles mehr oder weniger den Bach hinunter, à fonds perdu, wie man sagt …« Seitenstetten sprach weiter, aber Matthäus schaltete ab. Er kannte die Geschichte des Niedergangs der Familie von Seitenstetten, wenn auch nicht den Teil, den sein Schulfreund nun zum Besten gab. Schon immer hatte dieser jeden, der es hören wollte, und auch die zahlreichen anderen, die es nicht hören wollten, mit der Schilderung der finanziellen Kapriolen der verschiedenen Zweige derer von Seitenstetten unterhalten beziehungsweise behelligt. Er wiederholte sich dabei, sodass man im Laufe der Gymnasialjahre diese Geschichten gewissermaßen osmotisch aufnahm, auch wenn man sich bemühte, nicht zuzuhören. Von einem Kieswerk war dabei nie die Rede gewesen. Matthäus schloss daraus, dass sich die Niedergangssaga der Seitenstettens nach der Matura fortgesetzt hatte; offensichtlich hatten diese Adligen eine umständliche, arbeitsintensive Form des Herabwirtschaftens betrieben, die bis zur Endpleite Generationen brauchte.
Worüber reden wir hier, dachte Matthäus. Es ist genau wie früher. Wie in einer Zeitkapsel. Er langweilt mich mit schwachsinnigen Entscheidungen seiner Vorfahren. Und ich höre zu. Wie immer. Und sage nichts. Man darf ihn nicht unterbrechen, sonst fängt er von vorn an. Als Seitenstetten verstummte, sagte Matthäus: »Tut mir leid für deine Familie, ich sehe aber nicht, was ich daran ändern könnte. Was ist mit diesem Nachlass?«
»Sehr gut, Lumpi, du bringst es auf den Punkt, du bist immer noch auf der Höhe, ich merk den scharfen Verstand, chapeau! Wie früher! Ja, das Problem ist tatsächlich dieser Nachlass vom Onkel Albert-Matthias. Aber das möcht ich nicht am Telefon besprechen.«
»Na schön. Ich kann aber jetzt nicht nach Wien fahren, kannst du nicht per Mail …«
»Das ist mir zu unsicher. Wir sollten schon persönlich reden.«
»Na, dann musst du halt nach Dornbirn kommen.«
»Ich bin schon da.«
»Ach? Wo bist du denn?«
»Ich steh vor deinem Gasthaus.«
Matthäus sagte nichts. Er wunderte sich nicht einmal. Dieses Verhalten war kein Scherz von Seitenstetten, sondern für den ganz normal. Auf dem Weg zur Tür dachte er darüber nach, wie sie ansatzlos in Gewohnheiten verfielen, die sie vor vierzig Jahren abgelegt hatten. Wie trockene Alkoholiker beim Rückfall. Ein Glas genügt. Matthäus war überzeugt, dass sich Erasmus von Seitenstetten im Umgang mit normalen Personen nicht so verrückt verhielt. Dazu mussten zwei aus ihrer Klasse zusammenkommen.
»Warum läutetest du nicht gleich?«, fragte er beim Öffnen der Haustür.
»Ich hab doch nicht gewusst, ob du zu Hause bist.« Seitenstetten trat ein. Kein Gruß, keine Umarmung, nicht einmal ein Händedruck. Wozu auch. Sie sahen sich ja jeden Tag. Auch wenn zwischen den Tagen, an denen sie einander begegneten, manchmal ein paar Jahre lagen.
Seitenstetten sah so aus, wie ihn Matthäus in Erinnerung hatte. Und zwar genau so. Hochgewachsen, gotischer Langschädel, dünnes Haar mit der Farbe von Straßenstaub, ein Gesicht ohne merkbare Eigenheiten, etwas weichlich. Klar, die Dekadenz durch die Verwandtenheiraterei in diesen Kreisen. Wir sind komisch, dachte er. Aber nur untereinander. Sonst weiß es ja keiner. Gott sei Dank. Der große Gastraum war leer, sie nahmen am Stammtisch Platz.
»Du fährst von Wien hierher, ohne zu wissen, ob ich überhaupt da bin?«, begann Matthäus. »Was, wenn ich verreist bin? Oder tot?«
»Ist mir unwahrscheinlich vorkommen, ehrlich gsagt. Du warst doch nie der Typus des Reisenden, sei mir nicht bös! Und sterben tun wir noch lang nicht …«
»Woher hast du die Adresse?«
»Vom letzten Rundschreiben vom Hiebeler.« Paul Hiebeler war der Klassensprecher in der Maturaklasse gewesen. Wie die sieben anderen Jahre davor und die vierzig Jahre danach. Ihn würde, wie den Papst, erst der Tod von der Bürde des Amtes befreien.
»Außerdem war mir das Risiko zu groß.«
»Welches Risiko?«
»Dass d’ mir absagst! Am Telefon, mein ich. Da tut man sich leichter beim Absagen. Wenn’st mir gegenübersitzt, ist das schwerer.«
»Um Gottes willen! So schlimm? Du hast einen umgebracht? Und ich soll dir helfen beim Vertuschen?«
Seitenstetten lachte laut auf. »Nein, mein Lieber, ich darf dich beruhigen. Umbracht hab ich keinen … Er ist schon tot.«
»Also doch was Kriminelles …«
»Das ist noch nicht heraußen …«
»Und wobei soll ich dir helfen?«
»Na, beim Ausgraben.« Matthäus ließ diese Äußerung unkommentiert und holte erst einmal die Cognacflasche aus dem Regal hinter der Theke. Sie tranken.
»Du willst deinen Onkel Albert-Matthias ausgraben?«
»Wieso? Wo denkst denn hin! Vom Albert-Matthias war doch nie die Rede!«
»Entschuldige, du hast mir doch vor kaum fünf Minuten etwas von diesem Onkel und seinem Nachlass erzählt …«
»Ja, es geht um den Nachlass, nicht um den Onkel selber. Ausgraben müssen wir einen anderen, der dort erwähnt wird. Im Nachlass. Schon länger tot.«
»Wie lang?«
»Vierhundert Jahr.«
Darauf wusste Matthäus erst einmal nichts zu sagen. Auch Erasmus von Seitenstetten versank in Schweigen, er schien über irgendetwas nachzudenken. Nach einer Weile sagte er: »Es wär alles einfacher, wenn wir das Schlössl net verloren hättn …«
»Bitte?«
»Im Wienerwald, a bissl außerhalb halt. Aber das haben s’ halt schon vor hundert Jahr verspekuliert …«
»Tja, traurig, so was … Nur, dass ich auch alles richtig mitkriege: Wieso würde es dir helfen, wenn das Schlössl noch euch gehören würde?«
»Weil mir dann ohne weiters in die Kapelle könnten und die Gruft vom Ferdinand-Erasmus aufmachen …«
»Er heißt doch Albert-Matthias?«
»Lumpi, du hörst auch nie richtig zu! Des war in der Schul schon so. Ich hab doch gsagt, um den Albert-Matthias geht’s gar net, ich hab nur in seinem Nachlass einen Hinweis gfunden auf den Tod vom Ferdinand-Erasmus, des is a Vorfahr aus der Linie Seitenstetten-Markhartsburg … wurscht jetzt. Jedenfalls steht da, der Ferdinand is am Englischen Schweiß gstorben.« Er schwieg, als ob mit dieser Äußerung alles erklärt sei. Matthäus kannte diese Eigenheit seines Schulkameraden.
»Am was?«, fragte er. »An englischem Schweiß?«
»Na, net an englischem Schweiß, des wär ja aus England importierter Schweiß, wieso soll das jemand machen, a Trottelei – sondern am Englischen Schweiß – a Krankheit, verstehst? Die heißt so, weil die Kranken wahnsinnig schwitzen.«
»Wieso dann englisch?«
»Weil’s dort das erste Mal ausbrochen is. Vierzehnfünfundachtzig. Nach der Schlacht bei Bosworth.«
»Ach die!«, rief Matthäus, »die Schlacht von Bosworth, genau …«
»Du hast keinen Schimmer, stimmt’s?«
»Ehrlich gesagt ist mir Bosworth jetzt nicht so präsent, geschweige denn eine Schlacht von dort …«
»Aber Richard III. kennst? Shakespeare? Den Buckligen, den Hundsfott?« Er sprang auf, stellte durch theatermäßige Verkrümmung einen Buckel dar und deklamierte:
»Und darum, weil ich nicht als ein Verliebter
Kann kürzen diese fein beredten Tage,
Bin ich gewillt, ein Bösewicht zu werden
Und feind den eitlen Freuden dieser Tage.«
»Schon gut, dieser Richard. Aber der wird doch am Ende umgebracht … Der ist in Wirklichkeit an der Schwitzkrankheit gestorben?«
»Na, du Depp! Gefallen is der in der Schlacht von Bosworth! Erst nach der Schlacht ist die Seuche ausgebrochen. Im Lager von Heinrich Tudor …«
»Äh …?«
»Der die Schlacht gwonnen hat, Herrschaftseiten! Denk halt a bissl mit! – Des war der spätere Heinrich VII., Begründer des Hauses Tudor, der Nachfolger war dann Heinrich VIII., den kennst sicher, der mit die vielen Ehefrauen …«
»Ja, schon gut!«, unterbrach ihn Matthäus, der sich schon in der Schule nie für politische Geschichte interessiert hatte und das immer noch nicht tat. »Englische Geschichte, schön, aber was hat das mit der Schwitzkrankheit und deinem Vorfahren Ferdinand-Erasmus zu tun, Erasmus?«
»Schwitzkrankheit? Ach so, ein Scherzerl! Sehr lustig. – Sie heißt Schweißkrankheit und war überhaupt nicht lustig, weil die Leut dran gstorben sind wie die Fliegen, schneller wie an der Pest.«
»Ich wollte deine Gefühle nicht verletzen. Dein Vorfahr ist auch daran gestorben? Er hat mitgekämpft bei dieser Schlacht? Erstaunlich als Österreicher …« Erasmus von Seitenstetten seufzte. Er nahm einen Schluck Cognac und begann, die Sache mit der Englischen Schweißkrankheit zu erklären. Die war nach 1485 noch 1507, 1517 und 1528 ausgebrochen, bei diesem vierten Ausbruch trat die Seuche aufs Festland über und verheerte die Niederlande, Deutschland, Österreich, die Schweiz, Dänemark, Schweden und Norwegen, Litauen, Polen und Russland. Frankreich und Südeuropa blieben verschont. Innerhalb weniger Wochen starben Tausende Menschen, die Mortalität schwankte stark, betrug in manchen Orten, zum Beispiel in Dortmund, hundert Prozent. Allerdings verschwand die Krankheit überall nach zwei Wochen.
Unheimlich waren die Symptome: Die Krankheit begann mit schwerem Angstgefühl, Gliederschmerzen und Schüttelfrost. Spätestens nach drei Stunden begannen die absurden Schweißausbrüche, Hitzegefühl, Durst und schwerer Kopfschmerz. Die Kranken schwitzten so stark, dass nicht nur das Bettzeug durchnässt wurde, sondern sogar der Fußboden mit stinkenden Schweißlachen bedeckt war. Die Kranken sanken ins Delirium und starben, manchmal schon nach vier Stunden. Wer vierundzwanzig Stunden überlebte, hatte gute Chancen, davonzukommen. Kinder und alte Leute wurden kaum krank, nur die Menschen im besten Alter – und unter denen wieder eher die Wohlhabenden.
Die Seuche verbreitete sich so schnell (in einem »Hui«, wie es in einer Quelle heißt) durch das ganze nördliche Europa; es hieß, wenn man die Leute reden hörte, der Englische Schweiß sei irgendwo anders ausgebrochen, dann war er auch schon da!
»Also schön«, unterbrach Matthäus die Schilderung, die Erasmus von Seitenstetten in immer größere Begeisterung zu versetzen schien, »das war eine furchtbare Sache, das verstehe ich – was war denn die Ursache?«
»Weiß kein Mensch.«
»Bitte …?«
»Na, das weiß niemand. Das is eines der großen Rätsel der Medizingeschichte. Der Englische Schweiß ist dann noch amal ausbrochen, fünfzehneinundfünfzig – und dann war Schluss! Aus, basta!«
In Matthäus’ Kopf begann sich eine Idee zu formieren. »Du willst also deinen Vorfahren ausgraben, diesen Erasmus-Ferdinand …«
»Ferdinand-Erasmus.«
»Ist doch egal jetzt! Du gräbst ihn aus und entnimmst DNA-Proben, oder? Um die Natur der Seuche aufzuklären.«
»Na ja, so is der Plan.«
Matthäus nahm einen Schluck. Wenn er das berufliche Umfeld des Schulfreundes nicht so konsequent ausgeblendet hätte, hätte er den Schluss schon früher ziehen können. Aber eben, das tat er in solchen Fällen, nämlich, wenn ihm bestimmte Leute aus der Schule begegneten. Das Umfeld ausblenden. Also verdrängen, was sie jetzt waren, was sie taten, welche Posten sie innehatten. Zum Beispiel einen Lehrstuhl für die Geschichte der Heilkunde an der Universität Wien – oder war Seitenstetten erst Dozent? Das hatte Matthäus erfolgreich verdrängt. Jedenfalls – und das hatte er nicht verdrängen können – gehörte dazu eine halbmeterlange Liste von Veröffentlichungen in anerkannten Journalen … und so weiter und so fort. Wenn man das nun verglich mit der Karriere eines Gastwirts in einem Provinzgasthaus, von Wien so weit entfernt, wie es geographisch überhaupt möglich war – dann war die Verwendung des Wortes Karriere eine hinterfotzige Beleidigung. Nicht, dass einer seiner Schulkameraden sich je so geäußert hätte. Ihm gegenüber nicht. Aber untereinander »… schad, dass aus dem Matthäus nix Besseres geworden ist …« In dieser Art eben.
Dozent (oder Professor oder weiß der Geier, was) Erasmus von Seitenstetten schwieg, gönnte Matthäus eine Erholung. Aber der sagte nichts, nippte nur ab und zu an seinem Cognac und starrte auf die Inneneinrichtung des Raumes. Täfer. Achtzig Prozent der Innenflächen waren mit Holz verkleidet. Alles eigentlich bis auf die Fenster. Matthäus blickte sich um. Er versuchte, den Raum mit den Augen Seitenstettens zu sehen. Alles schäbig. Verwahrlost.
»Du fragst dich sicher, wieso ich ausgrechnet dich frag wegen der Sach. Das is ganz einfach: I kann niemand traun!«
»Sag mir eins und gib eine ehrliche Antwort: Kommt dir mein Interieur schäbig vor?«
»Dein … was?«
»Meine Möbel, das Täfer, die … die ganze Einrichtung.«
»Deine … Möbel … Du … sag amol, spinnst jetzt komplett, wie kommst’n auf so a Idee? Moment: Hast du leicht zum Saufen angfangt? A geh, Lumpi! Tu mir des net an! An Alkoholiker mit am Moralischen – des kann i net brauchen, bitte, bitte, net jetzt!«
»Nein, ich trinke nicht mehr, als mir guttut, glaube mir! Es ist nur … wenn ich unser beider Leben vergleiche: Du in einer anerkannten Stellung als Universitätsprofessor … dagegen ich …«
»Ah, do weht der Wind her! Anerkannte Stellung – in Österreich. Du bist a Christkind, Lumpi, waaßt des? Die Stellung, den Titel kann i mir in die Hoar schmiern … Finanziell is die österreichische Universität am Oarsch …«
»Nein, das mein ich nicht. Ich denk an deine persönliche … wie soll ich sagen … Reputation … Du musst doch andere Hilfskräfte haben als mich!«
»Naa, hob i net …«
»Assistenten?«
Seitenstetten lachte auf. »Jo, klar, Assistenten! Wie viel brauch ma denn zum Abkommandiern? A Dutzend fürs Erste? – I bin doch net die NASA! Was glaubst denn, was des für a Institut is? Mir ham zwei Zimmerln am End vom Gang, im einen hock i, im andern der Laska, der Pestfetzen, der zwidere, der mir alles zu Fleiß tut, wo’s nur geht …«
»Der ist dein Assistent?«
»Jawohl. Und politisch vernetzt wia sonst was! A Ehrgeizling, a falscher Hund. Wann i den mitnimm, klaut er mir die Ergebnisse – i weiß no net, wie, aber auf das lauft’s hinaus. Alles scho erlebt …«
»Also schön. Das Arbeitsklima in eurem schnuckeligen Institut lässt zu wünschen übrig. Studenten?«
»Studentinnen! Neunzig Prozent. Von die vierzehn Kaschperln in der Vorlesung … Versteh mi richtig, die san scho in Ordnung, aber ungeeignet fürs Praktische. Die wissen alle net, wo bei aner Schaufel vorn und hintn is!«
In Matthäus’ Kopf begann sich die Sachlage zu klären. Erasmus von Seitenstetten war offenbar doch auf ihn, den Kameraden aus Gymnasialtagen, angewiesen. Die Andeutungen über das Klima in Seitenstettens Uni-Institut hatte er aufgesaugt wie ein Schwamm. Diese Worte taten gut, eine Wärme, die nicht vom Cognac stammte, begann sich in ihm auszubreiten. Denn nichts ist tröstlicher als die Erkenntnis, dass Zeitgenossen, die man für uneinholbar überlegen hielt, das nicht sind. Er schenkte Erasmus von Seitenstetten, dem Schulfreund aus verarmtem Adel, Inhaber eines marginalisierten Orchideenfachlehrstuhls, Cognac nach. Der Ärmste konnte es brauchen. Den Cognac und die Hilfe des Schulkameraden. Matthäus war geneigt, diese Hilfe zu gewähren – ach was, geneigt: Er brannte darauf!
»Also schön«, sagte er, »ich helfe dir, aber unter der Bedingung, dass ich drei Freunde von mir anheuern darf.«
»Wenn’s dich freut! Je mehr wir sind, desto schneller geht’s Ausgraben …«
»Wieso eigentlich ausgraben? Er liegt doch in einer Gruft?«
»Ich weiß doch net, in was für an Zuaschtand die is …«
»Du warst noch gar nicht dort?«
»Dort schon, aber net drin …« Er nahm einen tiefen Schluck. »Es war zuagschperrt. Und allein …«
»Ach so, also erst Zugang verschaffen. Da brauchen wir Leute, die sich handwerklich auskennen! Innen müssen wir dann graben, vielleicht eine Grabplatte heben, dazu braucht man einen Flaschenzug, ein Stützgestell, was weiß denn ich. Ich weiß nicht einmal, wo man so was herkriegt. Aber Lothar Moosmann weiß es …«
»Des is a Professionist?«
»Sozusagen. Holzschnitzer. Madonnen, Krippenfiguren, solche Sachen.«
»So, so … Schnitzer …« In Seitenstettens Gesicht blühte der Zweifel. »Und die andern?«
»Franz-Josef Moosmann. Pensionierter Buchhalter, entspricht aber nicht dem Klischee.«
»Aha. Und wieso net?«
»Erstens ist er einen Meter neunzig, bärenstark, und zweitens hat er einen schönen Bariton und erfreut uns oft mit Arien, vor allem aus dem deutschen romantischen Fach.« Das mit dem erfreuen war ein wenig überzogen, aber Matthäus hielt ein bisschen Propaganda für gerechtfertigt. Für die gute Sache. Und das war eine gute Sache, kein Zweifel! Das letzte Mal hatten sie gemeinsam eine schlechte Sache verhindert und die Menschheit vor großem Leid bewahrt (die Menschheit wusste nichts davon, das war auch besser so); aber etwas Gutes war nicht daran gewesen. Gut im Sinne von: Erkenntnisgewinn, Fortschritt des Menschengeschlechtes, ein Schritt auf dem Wege zu lichten Höhen – in dem Sinn.
Er schlug Seitenstetten vor, sich am Abend mit den dreien zu treffen. Erasmus machte keinen Hehl aus seiner mangelnden Begeisterung, sagte aber zu. Als er gegangen war, rief Matthäus seine Freunde an. Alle sagten dem Treffen zu.
Sie trafen sich zum Essen in der »Blauen Traube«. Es gab Wiener Schnitzel mit Schlosskartoffeln. Matthäus Spielberger hatte Mathilde über das Ansinnen Seitenstettens informiert. Sie befürwortete den Plan, die Geheimnisse der Englischen Schweißkrankheit zu lüften, wie sie alles befürwortete, was die medizinische Wissenschaft voranbrachte; so entlegen konnte das Thema gar nicht sein. Mathilde Spielberger war sehr interessiert an Medizin und hätte sich über eine entsprechende Studienwahl der Tochter Angelika gefreut – aber besagte Angelika hatte sich eben für Kunstgeschichte entschieden, nach Mathildes nie laut geäußerter Meinung von allem brotlosen Zimt der brotloseste …
Von Seitenstetten schien dem Schnitzer Moosmann, dem pensionierten Buchhalter Blum und dem ebenfalls pensionierten Chemieprofessor Peratoner zu gefallen, was Matthäus an ihren Mienen ablesen konnte. Alle drei waren keine Meister der Zurückhaltung. Seitenstetten auch nicht.
»Das sind ja prächtige Burschen, wie’s scheint, die du mir da mitbringst, Lumpi!« Sie hatten das Vorstellen und Händeschütteln eben hinter sich.
»Lumpi?«, fragte Lothar Moosmann.
»So hamma ihn in der Schule immer genannt«, erklärte Seitenstetten, »hat er euch das net gsagt?«
»Keinen Ton«, sagte Franz-Josef Blum. Matthäus, dem die Enthüllung nicht behagte, schob die Schar mit ausgebreiteten Armen ins Restaurant hinüber. »Zum Ecktisch!«, rief er. »Dort sind wir ungestört!«
»Jawohl, Lumpi!« Moosmann natürlich, der sich nie etwas verkneifen konnte.
»Na, so geht’s nicht!«, protestierte Blum. »Wenn schon, dann Dr. Lumpi, so viel Zeit muss sein!« Dass die beiden mit Seitenstetten über diesen schalen Scherz in Gelächter ausbrachen, war unvermeidlich. Matthäus schwieg, jede Reaktion von seiner Seite würde die Szene nur verlängern. Schulbuben. Vierzig Jahre in zwei Sekunden verdampft. Er beneidete sie darum. Dass seine Freunde Seitenstetten sympathisch fanden, wunderte ihn nicht. Die urwienerische, baroneske Aura aus Verschrobenheit, Jovialität und leichter Trottelei – manche mochten das, andere nicht, dazwischen war nichts.
Sie setzten sich, Matthäus Spielberger erklärte, worum es ging. Die Reaktion der Freunde war so, wie er das erwartet hatte. Sie brannten vor Begeisterung. Moosmann wäre am liebsten Schnall und Fall zum Bahnhof gerannt und in den nächsten Zug nach Wien gestiegen. Seitenstetten hatte eine Karte des Wienerwaldes mitgebracht, die Kapelle und mögliche Zufahrtswege eingezeichnet. Lothar studierte die Eintragungen.
»Also schön«, sagte Lothar Moosmann, »fangen wir an: Wir können natürlich nicht einfach so zu der Kapelle hinmarschieren und dann die Spitzhacke schwingen …«
»Ich glaub’s Ihnen ja, lieber Herr Moosmann, des is nämlich auch der Grund, wieso ich den Lumpi dabeihaben will. Genau so hab ich mir’s nämlich ausdenkt, i geh hin, heb den Ferdinand-Erasmus aus seiner Gruft, zieh eahm a paar Zähnd für die DNA und verschwind wieder. Gleichzeitig weiß ich, dass des sicher net so gehen wird. Es geht nie so, wie ma sich’s denkt. I komm nur net dahinter, wieso, verstehen S’? Wo is der Fehler?«
»Das kann jetzt noch keiner wissen, Herr Professor«, antwortete Lothar, den seit Menschengedenken niemand mehr mit »lieber Herr Moosmann« angesprochen hatte. Eigentlich sprach ihn selten jemand an, er hatte außerhalb der Gruppe aus der »Blauen Traube« keine Kontakte; solche versuchten sogar seine Kunden auf ein Minimum zu beschränken. Kommunikation per E-Mail war ein Segen. Es lag an seinem aufbrausenden Wesen. Die meisten Personen, die das erste Mal mit ihm zu tun hatten, beschrieben ihn als »klein«, aber »furchterregend«.
»Was Sie brauchen, Herr Professor, ist ein Praktiker. So jemanden wie mich. Wo ist der Fehler, wenn man einfach hingeht, fragen Sie … Ich sage Ihnen eins: überall. Buchstäblich jedes beschissene Detail kann der Grund sein, dass der ganze schöne Plan einfach den Bach runtergeht!« Er schlug mit der Faust auf den Tisch, seine Wangen hatten sich gerötet, die schwarzen Augen funkelten. Seitenstetten beobachtete ihn. Ein guter Mann, dieser Holzschnitzer. Leidenschaft. Leidenschaft war das Wichtigste bei so einem Vorhaben, Leidenschaft für eine Idee. Nicht für die eigene Karriere, wie beim Laska.
»Drum werden wir zuerst einen kalten Durchlauf machen«, fuhr Lothar fort. »Hinfahren, alles anschauen, mögliche Gefahrenquellen entdecken. Dann bleibt immer noch viel, was wir nicht gesehen haben, was also schiefgehen kann, aber das sollten nur Kleinigkeiten sein. Ich meine wirkliche Lappalien, die sich eben nicht zu einer verschissenen Katastrophe aufschaukeln! Die kriegen wir schon in den Griff. Improvisation. Ein gewisses Gleichgewicht, verstehen Sie, zwischen Planung und Improvisation. Das ist das Geheimnis jedes erfolgreichen Unternehmens.«
Dr. Lukas Peratoner schüttelte den Kopf, nur im Geiste natürlich. Woher wusste Lothar Moosmann etwas über Organisation? Nirgendwoher. Von Planung, dachte der Chemiker, hat der gute Lothar genauso viel Ahnung wie der Hahn vom Eierlegen. Nur bei der Improvisation, da ist er gut. Und schnell mit einem Hohlbeitel zur Hand, einem sehr spitzen Schnitzwerkzeug, das er im Ärmel seiner abgewetzten Lederjacke trägt. Ohne diesen Hohlbeitel – oder hieß es Lochbeitel?Peratoner konnte sich die korrekte Bezeichnung nicht merken – ohne dieses spitze Ding wäre das vergangene Abenteuer ganz anders verlaufen. Aber nicht so glimpflich für die vier aus der »Blauen Traube«, wie es dann der Fall war … Man konnte gegen Lothar Moosmann sagen, was man wollte, und hatte mit allem davon recht, aber im entscheidenden Moment war der Mann unverzichtbar. Deshalb durfte man halt den Kopf nur im Geist schütteln. Lothar war unheimlich sensibel …
Seitenstetten schienen die Ausführungen Lothar Moosmanns zu überzeugen. Hier hatte er den praktischen Verstand, der ihm selber abging. Er hing gleichsam an Lothars Lippen. Der würde mit Blum und Matthäus die Kapelle aufsuchen und die naturräumlichen und sonstigen Gegebenheiten aufnehmen.
»Aufnehmen wörtlich«, sagte Franz-Josef Blum, der bis jetzt geschwiegen hatte, »ich habe eine Videokamera neuester Bauart. Wir tarnen uns als Vogelkundler. Swarowski-Gläser stehen zur Verfügung.«
»Ah so – dann sind Sie der Tarnexperte im Team?« Seitenstettens Stimme klang ein wenig spöttisch. Diesen Blum konnte er noch nicht richtig einordnen.
»Nein«, sagte Franz-Josef, »das mit der Tarnung ist jetzt nur Zufall. Ich hab halt viele Hobbys, da kann man das eine oder andere verwenden …« Es klang verlegen.
»Er wird dir gleich seinen Atout demonstrieren!« Matthäus stand auf. »Franz-Josef, der Tisch«, sagte er dann.
»Meinst du wirklich …?«
»Ja, du musst den Herrn Professor überzeugen, dass du nicht nur ein Abenteuertourist bist!«
Franz-Josef Blum packte den schweren Gasthaustisch mit ausgebreiteten Armen. Und hob ihn hoch. Etwa einen halben Meter. Franz-Josefs Gesicht zeigte nicht die Spur einer Rötung, blieb blass und teigig. Kein Zittern der Arme. Wenn er wollte, hätte er den Tisch hinaustragen, auf die Schulter nehmen und damit heimgehen können. Das tat er nun nicht, sondern stellte ihn so sanft wieder ab, dass keines der Gläser auf der Tischplatte in Gefahr geriet.
»Manchmal ergibt es sich«, sagte Lothar, »dass man einen wie den Franz-Josef braucht … das kann sehr schnell gehen.«
»Er meint jemanden mit einer rohen, herkulischen Kraft«, sagte Dr. Peratoner, »der zum Beispiel ein Auto anheben kann. Oder einen Baumstamm zur Seite schieben.«
»Ich hab noch nie ein Auto hochgehoben«, sagte Franz-Josef Blum, »und auch keinen Baumstamm verschoben.«
»Ja, schon gut, es könnte aber sein, und dann ist es fein, wenn du in der Nähe bist!«
»Ich bin überzeugt«, sagte der Professor, dem der Schmäh abhandengekommen war.
»Ich bin kein Kraftlackel!« Franz-Josef schüttelte den Kopf wie bei leichtem Tremor, wodurch die ganze untere Gesichtshälfte hin und her wabbelte, besonders das Doppelkinn. Das sah sehr unvorteilhaft aus. »Marandjosef!«, murmelte Seitenstetten, dem das Leiden dieses Mannes mit einem Male klar wurde.
»Mein ganzes Streben gilt der Kunst!« Blum setzte sich wieder. »Dem Gesang, der Oper.«
Blum wollte aufstehen, Lothar hielt ihn am Arm fest. »Nicht hier, Franz-Josef, nicht jetzt.«
Leichte Röte breitete sich auf dem Gesicht des Schnitzers aus. Blum setzte sich wieder. »Ich wollte eigentlich Sänger werden, daraus ist aus finanziellen Gründen nichts geworden. Jetzt sing ich halt in einem Chor.«
»Stimmlage?«
»Bariton.«
»Ah ja … Also, mit’m Singen wird’s bei dem Unternehmen nix werden, fürcht ich. Und dass Sie uns ka Auto aufheben müssn, des hoff ich! Aber es freut mich, dass Sie mit von der Partie san, Herr Blum!« Franz-Josef Blum verbeugte sich leicht im Sitzen. Als Einziger von den dreien, fand Seitenstetten, strahlte der Buchhalter jene Würde aus, die man bei manchen Menschen findet, die von einem Schicksalsschlag getroffen, aber nicht gebrochen wurden.
Sie beredeten noch die nächsten Schritte. Seitenstetten gab sich einen Ruck, straffte das Rückgrat. Der gemütliche wienerische Akzent verschwand aus seiner Rede.
»Meine Herren, am besten fangen wir gleich an! Mit gleich meine ich morgen früh. Diese Eile hat einen bestimmten Grund. Ich bin leider nicht der Einzige, der die Englische Schweißkrankheit durch DNA-Proben eines Opfers aufklären will. Es gibt da einen Engländer, der Ausgrabungen auf einem Friedhof plant. Der Mann ist uns gegenüber im Vorteil …«
»Wieso?«, wollte Franz-Josef wissen.
»In England war die Schweißkrankheit viel weiter verbreitet. Die ersten Ausbrüche hatten sich sogar auf die Insel beschränkt. Bei den hohen Todesraten konnte man damals ganze Friedhöfe mit Schweißopfern füllen – wenn er also irgendwelche alten Dokumente gelesen hat, die auf so ein Massengrab hinweisen, findet er nicht ein Skelett, sondern ein paar Dutzend. Ich dagegen bin auf meinen Vorfahren Ferdinand-Erasmus angewiesen.«
»Wenn das in England so einfach ist, wieso hat er es dann nicht schon längst gemacht?«, fragte Lothar.
»Die Trägheit der Verhältnisse. Das Ganze ist ein Orchideenthema, darüber bin ich mir im Klaren. Die Krankheit kennt niemand, ausgestorben seit vierhundert Jahren, also, was soll’s? So eine Grabung kostet Geld, das bekanntlich knapp ist. Da sind keine Schätze zu erwarten, keine Grabbeigaben aus Gold und Diamanten. Die Einschätzung war in England sicher so ähnlich wie bei uns. Ich sage: war, denn seit Richard III. ausgegraben und zweifelsfrei identifiziert wurde, ist die Sache eine andere. In England überschlagen sie sich vor Begeisterung. Meinem Konkurrenten wird das nicht entgangen sein. Wenn man nach über fünfhundert Jahren in lehmiger Erde aus einem Knochen genug DNA extrahieren kann, um sie mit der eines Nachfahren in siebzehnter Generation zu vergleichen, stehen die Chancen nicht schlecht, auch die DNA eines Erregers zu finden, an der damals jemand gestorben ist!«
»Aber der Richard ist doch nicht an der Schweiße gestorben!«, rief Peratoner.
»Natürlich nicht!«, Seitenstetten seufzte. »Dem haben sie ganz normal den Schädel eingeschlagen. Aber die Schweißkrankheit ist nach der Schlacht von Bosworth im Lager des Siegers, Henry Tudor, ausgebrochen. Und während ich die Erforschung der Schweißkrankheit plane, weise ich darauf hin, dass in der allgemeinen patriotischen Begeisterung für ein – sagen wir: verwandtes Thema – viel leichter Mittel aufzutreiben sind. Sie sehen also: Wir haben keine Zeit zu verlieren. Der zweite Platz heißt bei solchen Sachen gar nichts.«
»Apropos Mittel …«, sagte Franz-Josef.
Seitenstetten seufzte wieder. »Ja, das müssen wir erörtern. Ich kann jedem von Ihnen eine kleine Aufwandsentschädigung zahlen. Hundert Euro pro Tag. Mehr ist leider nicht drin. Ich bezahle das aus eigener Tasche, offizielle Quellen habe ich nicht angezapft, es nicht einmal versucht. Das Unternehmen ist geheim. Bis zum Erfolg. Bei Misserfolg wird es nie stattgefunden haben, verstehen Sie?«
»Warum denn?«, fragte Lothar.
»In Wien fliegen die Hackeln so tief, da macht’s ihr euch hier keine Vorstellung! Mein Assistent hasst mich seit Jahren, weil … ah, eine elendslange Gschicht. Wenn der erfährt, was ich vorhab, haut er mir nur Knüppel in den Weg, aus purer Bosheit. Drum kann ich auch keine Studenten engagieren – am nächsten Tag weiß es die ganze Uni.«
»Schon gut!«, besänftigte Lothar Moosmann. »Hundert Euro sind völlig okay. Ich schlage vor, wir fahren morgen mit dem Frühzug los!« Die anderen hatten keine Einwände.
*
Womit die vier nicht gerechnet hatten, war, dass es in Wien regnete. Denn in den zurückliegenden Jahrzehnten war es auch für den eingefleischtesten und mit Vorurteilen behafteten Vorarlberger eine klare Sache gewesen, die er voller Neid anerkennen musste: Das Wetter ist in Vorarlberg miserabel und in Wien prima. Lothar Moosmann erinnerte sich mehrerer Gelegenheiten, als er wegen Kundenkontakten nach Wien gereist war – mit einem Schirm, weil es in Dornbirn schon eine Woche schüttete. In Wien kam er sich auf dem Weg zum Hotel dann blöd vor, war er doch der einzige Mensch, der bei blauem Himmel und linder Luft einen Schirm bei sich trug – wie der prototypische Hinterwäldler aus einer Humoreske im 19. Jahrhundert. Mit dem Schirm kam er sich vor wie mit einer Rückenkraxe mit lebenden Hühnern. Mehrmals war er versucht gewesen, den Schirm beim Aussteigen zu »vergessen«, nur um nicht als Provinzdepp durch die Menschenmassen des Westbahnhofs laufen zu müssen.
Die Zeiten hatten sich geändert. Klimawandel. Inzwischen regnete es auch in Wien, oft war das Wetter in Vorarlberg trockener. Es gab in der Hauptstadt im Winter sogar eine geschlossene Schneedecke. Als sie ankamen, lag schon lang kein Schnee mehr, aber von der fliederduftdurchtränkten Wiener Frühlingsseligkeit war auch nichts zu spüren. Es herrschte jene Witterung, bei der man immer falsch angezogen ist. Entweder man friert oder man schwitzt.
»Das liegt an der hohen Luftfeuchtigkeit«, erklärte Peratoner auf dem Bahnsteig, »wie im Regenwald, nur kühler. Und wenn man die Jacke auszieht, verkühlt man sich. Ich würde auch die Knöpfe zulassen …«
»Ja, Herr Professor«, sagte Matthäus, der sich jetzt schon vorkam wie bei einem Schulausflug mit intensiver pädagogischer Betreuung. Seitenstetten, der echte Professor, eilte ihnen voraus und hatte die Bemerkung nicht gehört. Peratoner war beleidigt und schwieg. Matthäus nahm seine Jacke über den Arm und trotzte im Hemd nicht nur dem tückischen Wetter, sondern auch den Anweisungen des Expeditionsleiters. Soll er sich doch den Tod holen, dachte Lukas Peratoner, sagte aber nur: »Du bist infantil, Matthäus, weißt du das?«
»Mir ist heiß«, erwiderte der Wirt, »ich trau mich wetten, das Gefühl kennst du gar nicht.«
Was Lukas Peratoner darauf erwiderte, hörte Franz-Josef Blum nicht mehr, er hatte sich beim ersten Wortwechsel ein paar Schritte zurückfallen lassen, er konnte die Streitereien zwischen den beiden nicht ertragen, im Lärm des Menschenschwarms, in dem sie dem Ausgang zustrebten, ging das Gekeife der beiden unter. Zur Ablenkung summte er die Arie A te o cara aus der Bellini-Oper Die Puritaner vor sich hin, das erforderte seine ganze Aufmerksamkeit, weil die Arie auch gesummt sauschwer war. Am Taxistand wartete Seitenstetten auf sie. Man brauchte zwei Taxis. Im ersten fuhren der Professor und Matthäus mit Lothar, Dr. Peratoner und Franz-Josef folgten im zweiten.
Im Zug hatten sie sich kaum unterhalten, weil Lothar wie bei jeder Fahrt die meiste Zeit schlief, Matthäus wie ein Zombie zum Fernster hinausstierte, der Professor mit seinem Laptop arbeitete und Lukas sich etwas zum Lesen mitgenommen hatte. Sie schienen die Zeitverschwendung zu fürchten, die mit einer so langen Zugfahrt einherging, darum taten sie etwas Nützliches. Schlafen, Schreiben, Lesen, Stieren. Sich Unterhalten gehörte nicht zu den nützlichen Tätigkeiten. Franz-Josef war in den Speisewagen gegangen und hatte ein paar Bier getrunken. Ein englisches Touristenpaar gesetzten Alters nahm an seinem Tisch Platz und fragte, ob er diese oder jene Sehenswürdigkeit an der Strecke kenne. Natürlich kannte beziehungsweise erfand er sie. »What you can see here right side is Saint Pantaleon with its remarkable church from fourteenth century …« Irgendein Kaff auf der deutschen Strecke, der Zug fuhr so schnell, dass man die Stationsnamen am Bahnhof sowieso nicht lesen konnte. Größere Industriebetriebe an der Strecke versah er mit einer düsteren Vergangenheit – »… founded during world war two, a notorious nazi plant. For ammunition and poisonous gas, you know …« Das Paar aus London erschauerte und fotografierte fleißig durch die Scheibe des Speisewagenfensters. Ah, dachte Franz-Josef, da hab ich den richtigen Nerv getroffen. Er versäumte nicht, darauf hinzuweisen, dass es der Royal Air Force damals nicht gelungen sei, diese Fabriken zu zerstören, weshalb der Krieg auch so lang gedauert habe … Die Sache funktionierte. Er konnte sich nicht zurückhalten und erklärte bei der Fahrt durch den Bahnhof Enns: »That’s the place Hitler was born. Alas …« Das Paar sprang auf, er fotografierte mit einer kleinen Kamera, sie mit dem Handy. Danach lag es nahe, an der Westbahnstrecke einen oder zwei KZ-Standorte zu identifizieren, aber Franz-Josef Blum erkannte, dass, was ihn da ritt, der Teufel selber war, verabschiedete sich von den beiden und kehrte, um nicht doch noch der Versuchung zu erliegen, ins Abteil zurück.
Das Taxi fuhr nach Süden, genau auf Schönbrunn zu, bog vor dem Schloss aber nach rechts ab und folgte dem Wienfluss. Franz-Josef, durch seine Speisewagenfaxen aufgekratzt wie lange nicht, erlaubte sich den Spaß und fragte, ob das die Donau sei, erntete aber kein Gelächter, sondern nur die nüchterne Antwort Seitenstettens: »Nein, die Wien. Die Donau verläuft weiter östlich und führt viel mehr Wasser.« Franz-Josefs Stimmung sank, denn aus dieser Antwort konnte er schließen, dass der Professor die Frage ernst genommen hatte und ihn, Franz-Josef Blum, für einen dieser Provinzdeppen hielt, die offenbar nicht nur im Vorurteil der Hauptstädter vorkamen, sondern auch in Wirklichkeit. Anders war seine Reaktion nicht zu erklären. Franz-Josef war beleidigt und schwieg.
Die Gründerzeitvilla, in der Seitenstetten residierte, lag in Hietzing in der Auhofstraße und machte einen heruntergekommenen Eindruck. Zwar sah man nirgends an der schwärzlichen Fassade abblätternden Putz, aber die drei Vorarlberger hatten, als sie durch den verwilderten Vorgarten auf das Gebäude zugingen, das Gefühl, beim geringsten Anlass werde er es sich anders überlegen, der Putz nämlich, und quadratmeterweise herunterbrechen. Franz-Josef dachte, der Eindruck entstehe vielleicht nur durch den Gegensatz zu der prächtig renovierten weiß schimmernden Villa direkt daneben.
»Wer wohnt denn da?«, wollte er wissen.
»Da residiert das berühmte Verlagshaus Wirth & Kutschera«, erklärte Seitenstetten. Er schloss die Tür auf. Die vier sahen einander an, keiner sagte etwas. Das Verlagshaus Wirth & Kutschera war ihnen unbekannt. Provinzbanausen halt.
Matthäus Spielberger sah sich in seiner Erwartung, im Inneren des Gebäudes einen hochmütigen Butler vorzufinden, getäuscht. Im Vorraum der Villa herrschten eisige Kälte und jene Leere, die erst dem zweiten Blick auffällt. Keine Bilder, keine hochragenden Topfpflanzen und keine schwer zuordenbaren Möbelstücke an den Wänden, deren eigentlicher Zweck darin bestand, jene Leere zu verhüllen, die Seitenstettens Heim dominierte. Es gab auch keinen Teppich, nicht das kleinste Stückchen Textil. Der Professor war sich des negativen Eindrucks bewusst.
»Jo, a bissl wia in ana U-Bahn-Station, net?«
Die Vorarlberger protestierten murmelnd, es sehe durchaus nicht aus wie in der U-Bahn. Seitenstetten winkte ab und ging voran in eine Wohnküche. Die war auch nicht stark möbliert, aber gegen die Vorhalle ein Hort heimeliger Gemütlichkeit. Der Raum wirkte kleiner, als er war. Das lag an den krautkopfgroßen Blumenmotiven der Tapete aus dem Jahre 1975; Lothar war begeistert, er hatte ein ähnliches Muster an den Wohnzimmerwänden, in demselben kränkelnden Blassgrün. Peratoner sog scharf die Luft ein und murmelte etwas Unverständliches. Der Professor behauptete, sie könnten ihre Besprechungen hier unten abhalten, weil es der gemütlichste Raum im ganzen Haus sei. Sie glaubten ihm das und nahmen am großen Küchentisch Platz. Seitenstetten entnahm einer Schublade eine Landkarte, die er auf dem Tisch ausbreitete. Sie konnten sich aber noch nicht einmal über die Himmelsrichtungen klar werden, weil die Dame des Hauses eintrat. Sie war größer als Seitenstetten, jünger und sozusagen blonder. Und sie verströmte Energie. Bevor ihr der Professor seine neuen Mitarbeiter vorstellen konnte, stellte sie sich selbst als Amalie von Seitenstetten vor, begrüßte erst ihren Mann mit Wangenkuss, dann die anderen mit Handschlag. Matthäus, Lothar, Franz-Josef und Peratoner murmelten ihre Namen, Lothar an der Verständlichkeitsgrenze, während Seitenstetten erklärte: »Meine Frau ist in meine Pläne eingeweiht, tatsächlich ist sie es, die mich darauf gebracht hat, den Matthäus zu kontaktieren.« Der Wiener Akzent war fast weg, die Dame hatte überhaupt keinen. »Ich schlage vor«, sagte sie, »ihr zieht in dein Arbeitszimmer um, wir brauchen ja die Küche. Essen um halb acht!« Seitenstetten faltete den Plan wieder zusammen. »Janine bringt euch Kaffee und Kuchen. In fünf Minuten, ist das recht?«
»Sehr recht!«, sagte Peratoner, die anderen drückten ihre Zustimmung mit beifälligem Gemurmel aus, Seitenstetten äußerte nichts, das war offenbar auch nicht notwendig, was Matthäus auffie