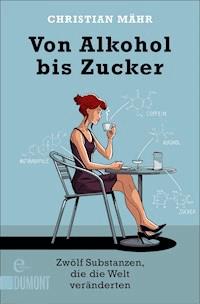Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Was der Autor Theodor Lukasch vermutet, ist so ungeheuerlich, dass er sich niemandem anvertrauen kann: Kann es denn sein, dass jemand, den er gut kennt, Unglück über seine Feinde bringt – ohne von dieser "Gabe" auch nur etwas zu ahnen? Aberglaube, Mystizismus – aber wenn sich doch, was laufend passiert, Lukaschs Vermutung bestätigt! Er muss etwas dagegen tun ... Theodor meint es gut und handelt. Doch wie so oft zeigt sich auch hier: Gut gemeint ist das Gegenteil von gut gemacht. Er setzt eine Kette von Ereignissen in Gang, die den Lauf der Geschichte verändern. – Ein Krimi über das Glauben, das Nicht-Wissen und den Unterschied zwischen beidem, eingebettet in die Eitelkeiten einer provinziellen Kultur- und Politikszene, grundiert mit Humor (dunkelgrau). Gemordet? Wird selbstredend auch. Der neue Kriminalroman mit österreichischem Lokalkolorit von Christian Mähr.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 383
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christian Mähr
Die Lukasch-Vermutung
Roman
Originalausgabe
© 2022 Hirnkost KG, Lahnstraße 25, 12055 Berlin;
[email protected]; http://www.hirnkost.de/
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage Oktober 2022
Vertrieb für den Buchhandel:
Runge Verlagsauslieferung; [email protected]
Privatkunden und Mailorder:
https://shop.hirnkost.de/
Layout: Conny Agel
Lektorat: Klaus Farin
ISBN:
PRINT: 978-3-949452-75-8
PDF: 978-3-949452-77-2
EPUB: 978-3-949452-76-5
Hirnkost versteht sich als engagierter Verlag für engagierte Literatur.
Mehr infos unter https://www.hirnkost.de/der-engagierte-verlag/
Inhalt
Der Autor
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Jeder, der mit einiger Phantasie begabt, soll,wie es in irgendeinem lebensklugheitsschweren Buchgeschrieben steht, an einer Verrücktheit leiden,die immer stiegt und schwindet, wie Flut und Ebbe.
E. T. A. Hoffmann
Der Autor
Christian Mähr, geb. 1952 in Feldkirch/Vorarlberg, lebt heute in Dornbirn. Er ist Autor, Doktor der Chemie und war jahrelang Mitarbeiter des ORF für die Redaktion Wissenschaft und Umwelt. Er veröffentlichte zahlreiche Romane und Sachbücher, u. a.: Magister Dorn (1987); Fatous Staub (1991); Simon fliegt (1998); Die letzte Insel (2001); Semmlers Deal (2008); Alles Fleisch ist Gras (2010); Der jüngste Tag des Peter Gottlieb (2018); Carbon (2020); Vergessene Erfindungen (2002, 2017); Von Alkohol bis Zucker (2010). Er schrieb auch mehrere Hörspiele und ein Theaterstück.
Für Fatous Staub erhielt er den Kurd-Laßwitz-Preis; Alles Fleisch ist Gras wurde 2013 für ORF und ZDF verfilmt.
1
Wir sehen eine Frau. Sie ist Mitte fünfzig. Sieht auch aus wie Mitte fünfzig. Sie sitzt allein in einem großen Haus und trinkt. Sie ist es gewohnt zu trinken. Die Frau heißt Gerda. Ihr Mann ist Politiker und nicht da. Er ist meistens nicht da. Bisher hat sie das so hingenommen. Vor Kurzem hat sie aber erfahren, dass ihr Mann sich nicht immer, wenn er nicht zu Hause ist, dem Wohl des Landes widmet, sondern einer bestimmten Dame. Das hat sie wütend gemacht (natürlich), aber damit ist die Sache noch nicht aus. Wenn ihr Mann kein Politiker wäre, könnte sie sich einfach scheiden lassen. Das kann sie natürlich auch. Es ist nur so: In diesem Spiel sind noch zwei andere Personengruppen zugange, was die Sache kompliziert macht und Gerdas Möglichkeiten einschränkt und erweitert, gleichzeitig. Weil das so ist, hat sie Tage für einen Entschluss gebraucht. Den hat sie nun aber gefasst.
Sie trinkt aus, zieht ihren dunklen Parka an und geht zur Garage. Das Ehepaar hat neben dem Benz noch einen robusten Geländewagen. Für die Jagd. Gerda geht gern auf die Jagd. Lieber als ihr Mann, der von seinem Vater, einem fanatischen Jäger, in das Milieu eingeführt worden war. Der Politiker begreift die Jagd als gesellschaftliche Konvention, Aufstiegschance und nützliches Werkzeug, um Dinge, die gewisse Kreise betreffen, hinter den Kulissen zu klären. Ohne großes Brimborium. Der Politiker ist Mediziner, war aber für Wirtschaft zuständig, als Arzt Außenseiter in der Szene, die Jagd ein unschätzbarer Vorteil; später haben ihn die Wechselfälle der Politik dann von der Wirtschaft zu Gesundheitswesen und Kultur verschlagen, da nützt die Jagd wenig. Aber seiner Frau gefällt das Milieu, sie schaffte auch die Jagdprüfung, was alle wunderte, die sie kannten, am meisten ihren Mann. Gerda empfindet die Jagd als einzige einerseits „reale“, andererseits zugängliche Sache, die sie mit ihrem Mann gemein hat; die Medizin wäre zwar auch „real“, aber bleibt ihr verschlossen, ebenso die Kultur, und die ist nicht einmal real im Sinne der Jagd.
Gerda steigt ein und fährt los. Sie achtet auf die Geschwindigkeit. Keine Überschreitungen, aber auch nicht übertrieben langsam, wie schuldbewusste Säufer fahren, was der Polizei erst recht auffällt. Gerda wird von den Jagdgenossen ihres Mannes auch deswegen akzeptiert, weil sie einen Stiefel vertragen kann, mehr als mancher Mann, heißt es voll Anerkennung. Der Politiker ist mit drei anderen Medizinern Pächter eines kleinen Reviers im Großen Walsertal, „a Jägdle“, wie sie es nennen, sie werden aber oft in Großreviere eingeladen. Ich erwähne das alles, um begreiflich zu machen, dass Gerda Pontisek als Jägerin über praktische Fähigkeiten verfügt, die über das rein Hausfrauliche hinausgehen; sie kann ein Reh waidgerecht ausnehmen – was nun aber nichts mit dem Plan zu tun hat, der sich aus diffusem Nebel während der Fahrt nach Feldkirch in ihrem Kopf herausschält. Und nein, sie hat natürlich kein Gewehr mit, auch kein Messer oder sonst eine Waffe – sind Sie verrückt? Jäger sind nicht so, das sind alles alberne Vorurteile! Leute, die Lebendiges töten, haben nämlich weniger Tötungsphantasien als die Normalbürger. Doch, ist so. Fragen Sie einen Jäger. Oder eine Jägerin.
Gerda Pontisek hat nicht vor, jemanden zu erschießen oder ihm den Hirschfänger ins Herz zu stoßen. Sie besitzt keine Waffe dieser Art, die auch heute in der Jagd nicht mehr verwendet wird (sondern für den Fangschuss Revolver bestimmter Kaliber). Sie hat etwas anderes vor. Sie hat keinen Plan im Sinne einer ausgearbeiteten Handlungsanweisung, die man in einem Ratgeberbüchlein abdrucken könnte, mit Alternativen und Klauseln: „Wenn A einritt, ist nach B zu verfahren, tritt dagegen C ein, empfiehlt sich eher ein Vorgehen nach D …“ So ist das nicht. Das Ganze ist auch kein Computerstrategiespiel. Es ist die reine Tat.
Sie parkt den Wagen auf einer Straße hinter dem Gebäude, zieht die Kapuze des Parkas über den Kopf, die gefütterten Handschuhe über die Hände und steigt aus. Aus dem vorderen Fach nimmt sie zwei Gegenstände, einen größeren und einen kleineren. Dann geht sie, ohne sich umzusehen, zur Rückseite des Gebäudes.
Von hinten gleicht es weit mehr der Industriehalle, die es gewesen war, als von vorn, wo Morselli sich bemüht hat, den trist barackösen Eindruck durch Fassadengestaltung zu kaschieren; da hat er einiges an Geld reingesteckt. Eine Rundumverschönerung wäre zu teuer gewesen, außerdem versteckt sich die graue Betonziegelwand hinter Essigbäumen und Robiniengebüsch, das sieht gar nicht so übel aus, naturnah. Es gibt ein großes Tor, das durch eine Kette gesichert ist, eine Reihe kleiner, dreckverschmierter Fenster und eine normale Tür, blechbeschlagen. Gerda sondiert die Rückfront, dann den Anbau. Die andere Seite liegt im Licht einer Straßenlampe, die kommt nicht infrage. Sie entscheidet sich für die Blechtür, die dem großen Schraubenzieher nicht lange standhält.
Sie tritt ein, zieht die aufgebrochene Tür so weit zu, wie es geht, und macht die Taschenlampe an (der kleine Gegenstand). Es ist keine Industriehalle mehr, alles zugebaut mit Gipswänden, verschachtelt. Gerda hat Mühe, sich zu orientieren, findet dann doch den Weg nach vorn, wo sich ein riesiger schwarzer Raum öffnet. Sie beleuchtet den Bretterboden, um nicht zu stolpern. Da vorn ist die Kante. Und darunter die Stühle. Die Taschenlampe reicht nicht weit ins Dunkel, drei Reihen kann sie erkennen. Da hat sie schon gesessen mit ihrem Mann. Sie weiß nicht mehr, was gespielt wurde, sie weiß nicht einmal mehr, ob es ihr gefallen hat. Es war auszuhalten. Es gibt schlimmere Arten, zwei Stunden totzuschlagen. Sie hätte nie gedacht, dass sie je hier oben stehen würde.
Sie setzt sich auf den großen Bretterboden und zündet sich eine Zigarette an. Gerda ist noch vom alten Schlag und raucht. Sie muss jetzt entscheiden, was sie macht. Feuer oder Wasser. Wie in der Zauberflöte, hat sie in Wien gesehen. War ganz nett. Wasser oder Feuer. Was tun?
Wir lassen Gerda ein wenig nachdenken. Sie glaubt, sie hat Zeit genug. So viel Zeit, wie sie glaubt, hat sie gar nicht. Aber: Gerdas Problem, nicht unseres. Während sie um eine Entscheidung ringt, stellen wir uns die Frage, wie so eine offensichtlich praktisch veranlagte Frau (Jägerin!) dazu kommt, mitten in der Nacht in ein Theater einzubrechen? Warum macht sie so einen Blödsinn? Das hat doch sicher eine Vorgeschichte … Was? Nein, es schleicht kein verrückter Serienmörder im Keller herum! Wie kommen Sie auf die Idee? Weil dort steht: „So viel Zeit, wie sie glaubt, hat sie gar nicht?“ Wenn wirklich ein verrückter Serienkiller im Keller herumschliche, stünde dort: „So viel Zeit, wie sie glaubt, hat sie gar nicht mehr.“ Gerda ist allein in dem Gebäude. Ich hab nicht gesagt, sie bleibt allein, aber bis jetzt ist sie allein. Und Serienkiller, damit das klar ist, kommt auch keiner vor. Serienkiller sind Junkfood.
Gerda wird nichts passieren. Anderen schon. Und Gerda hat gute Gründe für ihre Handlungen. Wir werden diese Gründe kennenlernen. Dazu müssen wir in der Zeit zurückgehen. Keine Panik: Nicht weit, nicht in Gerdas Kindheit, nur zwei, drei Monate oder so. Man wird sehen, dass alles ganz harmlos beginnt. Mit einem falschen Wort, einem falschen Tonfall. Wie kann aus so etwas Kleinem etwas Furchtbares entstehen?
* * *
Sehen Sie, ich habe lange nachgedacht, wie ich diese Geschichte erzählen soll. Erzählt werden muss sie, das steht fest, das bin ich der Gesellschaft schuldig. Von Anfang an, von vorne nach hinten? Das ist schwierig, weil der erste Keim der Geschichte ein so unbedeutendes Ereignis war, ein solches Nichts, dass ich mich selbst kaum daran erinnere, obwohl ich dabei war. Kann man damit anfangen? Ich glaube nicht. Und dann die andere Schwierigkeit: Erzählen, wie es „eigentlich gewesen ist“? Da nicken alle beifällig, da hat niemand Einwände, genau das wollen alle hören. Wie es eigentlich gewesen ist … Also schön, borgen Sie mir Ihre Zeitmaschine? Sie haben keine? Ich nämlich auch nicht. Eine Zeitmaschine bräuchten wir aber, um festzustellen, „wie es eigentlich gewesen ist“. – Diese Forderung ist Humbug aus dem neunzehnten Jahrhundert, tut mir leid, Leute, das geht nicht. Ging auch damals nicht, ging nie. Wir kriegen immer nur, was uns Leute erzählen. Direkt oder in ihren Schriften oder ihren materiellen Artefakten. All das müssen wir interpretieren. Weil die Leute nicht das sagen, was war, sondern das, von dem sie annehmen, es sei gewesen. Manchmal lügen sie natürlich auch, das kommt dann noch dazu. Nicht einmal von dem, was wir mit eigenen Augen und Ohren sehen und hören, dürfen wir überzeugt sein. Wir irren uns. Dauernd. Daran würde auch eine Zeitmaschine nichts ändern.
Ich habe nicht vor, Ihnen zu erzählen, wie es eigentlich gewesen ist. Ich erzähle Ihnen dafür, wie ich mir vorstelle, dass es gewesen ist. Vermutlich, mit größter Wahrscheinlichkeit. Vieles vom dem, was Sie von mir erfahren werden, kann ich gar nicht wissen, weil ich nicht dabei war. Andere waren viel mehr dabei. Der Morselli. Oder Theodor Lukasch. Aber den kann ich nicht fragen. Also erzähle halt ich das Ganze … ja, wie einen Roman. Bei der wörtlichen Rede stelle ich mir die handelnden Personen vor und lasse sie reden. Ja, das geht. (Immer allerdings nicht.) Manchmal wird mir ein „ich“ entschlüpfen, das weiß ich jetzt schon. Regen Sie sich deswegen nicht auf, wegen Erzählperspektive und dem ganzen Germanistenkokolores und so weiter. Lassen Sie das „ich“ einfach stehen! Das ist kein Trick, sondern soll nur daran erinnern, dass ich auch noch eine Rolle spiele. Vor allem mich soll es erinnern.
* * *
Fangen wir also mit Theodor Lukasch an.
Er hasste Streit. Nicht nur veritablen Streit mit Schreiereien, Beleidigungen und dem kompletten Programm, sondern jede Art von Auseinandersetzungen, die den Rahmen nüchterner Meinungsverschiedenheiten überstiegen. Er ging Streit aus dem Weg. Das gelang ihm fast immer, weil zu seiner Abneigung eine Art sechster Sinn gehörte, der ihn befähigte, Auseinandersetzungen schon in ihren Vorformen zu erkennen, die andere Menschen noch lang nicht wahrnehmen konnten, und das Weite zu suchen, bevor der Streit für jeden sichtbar ausbrach.
Mir geht diese Fähigkeit leider ab. Vielleicht bin ich zu nüchtern dafür; mir fehlt die Phantasie, mir auszumalen, was aus einem Streit alles entstehen kann. Ich stelle auch nicht die Verbindungen zwischen Ereignissen her, die Theodor Lukasch fand, ich würde auf solche Sachen nicht kommen. Ich möchte das auch nicht, das ist keine gute Gabe, dieses Finden von Zusammenhängen, was sich dann zu einer fixen Idee verfestigt … Wie soll ich sagen: Mir wäre bei allem, was passiert ist, nicht diese verrückte Sache eingefallen, die Theodor Lukasch eingefallen ist. Bitte, er ist Schriftsteller, aber trotzdem, irgendwo muss es doch eine Grenze geben. Vom gesunden Menschenverstand gesetzt. Von der Literaturpolizei (nein, das war ein Scherz!) – ich will nur sagen, wenn es um Menschenleben geht, hört der Spaß auf, oder etwa nicht?
Theodor Lukasch, wie gesagt, ging Streit aus dem Weg. Diese Fähigkeit versagte manchmal, aber so selten, dass er sich an jenem kalten Herbstabend nicht mehr an das letzte Mal erinnern konnte – nicht an einen Streit, an dem er selbst beteiligt gewesen wäre (das kam überhaupt nie vor), sondern an einen Streit zwischen anderen, dessen Zeuge er werden musste. Wenn die Früherkennung funktionierte, suchte er in solchen Fällen unter abenteuerlichsten Ausreden das Weite, was seinem Ruf als Sonderling nicht schadete; Theodor Lukasch war als Schriftsteller ja eine Art Künstler; denen lässt man alle möglichen Marotten durchgehen. Wie etwa die, mitten in einem Gespräch Unverständliches murmelnd aufzuspringen und das Lokal zu verlassen – als sei ihm plötzlich die nicht abgeschaltete Herdplatte eingefallen. Er leistete dadurch einen Beitrag zur Konfliktvermeidung, ungewollt, aber doch, weil diese Fluchtaktionen dem Gespräch der Zurückbleibenden eine andere Richtung gaben und der aufkeimende Konflikt erstickte. Niemand nahm ihm sein Verhalten übel, im Gegenteil. „Jetzt ist ihm wieder was eingefallen!“, hieß es nur. Er hatte seine plötzlichen Aufbrüche mit ebenso plötzlichen und leider sehr flüchtigen Eingebungen erklärt, die er daheim auf dem Computer notieren müsse (nur daheim und nur auf seinem angestammten Computer, nicht woanders und nicht etwa auf einen Zettel oder Notizblock) – widrigenfalls diese Einfälle unwiederbringlich verloren seien. Da Theodor Lukasch Kriminalromane schrieb, wurde die Erklärung akzeptiert; jeder weiß, dass die Kriminalliteratur von den klugen Einfällen des Autors lebt und nicht von seiner literarischen Kunstfertigkeit.
Mit dieser Ausrede war es Theodor Lukasch gelungen, unangenehmer Zeugenschaft aus dem Weg zu gehen. Natürlich nicht immer. Nichts funktioniert zu hundert Prozent, alles hat Aussetzer, Fehler. So versagte manchmal auch sein Konfliktsensorium und der Konflikt brach aus, bevor er es merkte. In diesen Fällen half auch keine Flucht, weil er dazu nicht imstande war; es befiel ihn eine Art mentale Lähmung, er konnte noch atmen und herumsitzen, aber sonst nicht viel mehr. Jedenfalls nicht sprechen oder einfach weggehen. Er musste dableiben und warten, bis die Streiterei zu Ende war.
Genau so etwas war jetzt passiert. Sie saßen zu dritt in Fulterers Wohnzimmer: Theodor Lukasch, Sebastian Morselli und natürlich Hans-Jörg Fulterer. Ja, genau, der berühmte Fulterer, der dann … Aber ich will nicht vorgreifen.
„Das lass ich mir von dir nicht bieten“, sagte Fulterer eben.
Er sprach leise, ohne Betonung. Schon daran konnte jeder, der ihn kannte, ersehen, dass er es ernst meinte. Die übliche theatralische Aufladung, die ihn im Fernsehen so gut ankommen ließ, unterblieb; die großen Gesten, die volltönende Stimme. Wenn er richtig sauer war, klang er wie ein gekränkter Subalternbeamter, etwas Quengelndes in der Rede, etwas Stures. Mit nichts konnte er Sebastian Morselli schneller auf die Palme bringen, als mit dieser Art zu reden, weil den Sebastian das an seinen Vater erinnerte, mit dem er nie ausgekommen war; dazu kam, dass sich Fulterer im Alter jetzt dem lang verstorbenen Morselli-Vater näherte, was bei Morselli im Konfliktfall eine Art Déjà-vu auslösen musste – so legte sich das Theodor Lukasch zurecht; vielleicht hätte sein Einfall, seine Sicht der Dinge, auf die beiden anderen befreiend gewirkt (die Wahrheit befreit ja angeblich), wenn er nur ausgesprochen hätte, was ihm durch den Kopf ging. Aber dazu war er eben nicht in der Lage, nicht, wenn die Sache schon so weit fortgeschritten war, wenn keine Diskussion mehr bevorstand, sondern ein veritabler Krach.
Sebastian Morselli wurde blass, sein großer Adamsapfel bewegte sich auf und ab, was einen Zuschauer an große Brocken denken ließ, die der Theatermann hinunterwürgte. Er starrte über Fulterers Kopf hinweg auf Fulterers Porträt in Öl an der gegenüberliegenden Wand, das Markus Rosenthal geschaffen hatte und das so gelungen war, dass Fulterers Verlag es auf Werbeplakate drucken ließ.
Theodor Lukasch verwünschte sich, nicht besser aufgepasst zu haben, sonst hätte er gemerkt, worin es in dem Streit eigentlich ging; er hätte dann begütigend eingegriffen. Das konnte er, das war keine Einbildung, das war ihm oft und oft bestätigt worden, dass er gut schlichten konnte. Harmonie erzeugen. Meistens mit einem Scherz, den er einwarf. Ja, das konnte er, sich Scherze ausdenken, bevor es brenzlig wurde, ich kann es bezeugen, ich kannte ihn lange genug. Aber eben: bevor. Nicht, wenn die Hütte schon in Flammen stand. Er hätte dazu dem Gespräch folgen sollen. Und nicht darüber grübeln, ob das Motiv des Mörders in seinem neuen Roman auch stark genug sei; denn dieser Mörder war jemand, auf den auch gewiefte Krimileser nicht ums Verrecken kommen würden; in so einem Fall muss das Motiv über alle Zweifel erhaben sein.
Jetzt war es zu spät.
In dem Konflikt zwischen Fulterer und Morselli ging es um ein Theaterstück, das Fulterer geschrieben hatte. Für Morsellis Bühne, die „aufstrebendste“ Spielstätte des ganzen Landes. Morselli und Fulterer kannten sich schon zwanzig Jahre; es war auch nicht das erste Theaterstück, das der eine für den anderen geschrieben hatte, da gab es noch zwei, drei andere, an deren Titel sich Theodor Lukasch nicht erinnern konnte, geschweige denn an die Inhalte. Theodor interessierte sich nicht fürs Theater, das war die platte Wahrheit; die Theaterleute kamen ihm alle miteinander hysterisch vor. Er ging nie ins Theater. Auch das neue Fulterer-Stück würde er sich nicht anschauen. Wenn es denn überhaupt zu einer Aufführung käme. Im Augenblick sah es nicht danach aus. Denn Sebastian Morselli beendete die Betrachtung des Fulterer-Gemäldes über dem realen Fulterer mit den Worten:
„Wenn das so ist, erübrigt sich alles Weitere. Vergessen wir die Sache einfach. Ich muss jetzt gehen.“
Damit stand er auf und verließ das Zimmer. Gleich darauf hörte man die Haustür. Fulterer schnellte aus seinem Sessel, rannte dem Theatermacher nach und schrie ihm hinterher. Was, konnte Theodor nicht verstehen. Oder besser: Er konnte es sehr wohl verstehen, verdrängte das Gehörte aber sofort und wirksam aus seinem Gedächtnis, denn es war klar, dass es aus einer Reihe unsühnbarer Beleidigungen bestand, die sich um die Miserabilität des Theaters im Allgemeinen und des Morselli-Theaters im Besonderen drehten. Theodor wollte davon nichts wissen. Fulterer hatte die Türen offengelassen, sodass man die Geschehnisse bis ins Haus hinein hörte. Neben dem Geschimpfe des Schriftstellers waren das Starten eines Autos und hohlblechern klingende Geräusche zu hören, weil Fulterer offenbar mit der Faust dem Morselli-Auto aufs Dach schlug oder gegen die Karosserie trat, bis der Wagen kiesspritzend davonfuhr. Dann kam Fulterer zurück.
„Hast du das gesehen?“, rief er. „Hast du das gehört?“
Theodor nickte. Er hatte die Schrecklähmung so weit überwunden, dass er einen Schluck kalt gewordenen Kaffee nehmen konnte.
„Ich frage nur, damit ich sicher bin, dass ich mir das nicht alles einbilde, verstehst du?“
Fulterer begann zu lachen. Das war bei ihm kein Zeichen von Fröhlichkeit.
„Da kommt mir dieser kleine Wichser in meinem eigenen Haus auf die dumme Tour – das passt nicht … und das passt nicht … und da solltest du vielleicht noch etwas ändern …“
Bei den letzten Worten hatte er begonnen, Morsellis Stimme nachzuäffen, wozu er ein ausgesprochenes Talent besaß; er hätte als Imitator im Kabarett Triumphe feiern können, benutzte diese Gabe aber nur, um seine Feinde lächerlich zu machen. Und sie wurden lächerlich, wie Theodor wohl wusste. Wenn man das Opfer später traf, fiel einem sofort die Parodie ein, sobald derjenige den Mund aufmachte. Das blieb an ihm hängen, es war wie ein Brandzeichen. Fulterer, das musste Theodor zugeben, ließ sich nicht oft dazu hinreißen. Nur wenn er sehr verärgert und gekränkt war. Ein gekränkter Fulterer war ungefähr so angenehm wie ein angeschossener Grizzly.
„Ich habe den Eindruck“, sagte Theodor so neutral wie möglich, „der Konflikt zwischen euch schwelt schon lang, das mit dem Stück jetzt war nur der Auslöser …“
„Du hast recht, du hast natürlich recht!“, rief Fulterer. „Wie immer eigentlich. Möchtest du noch einen Kaffee?“
Theodor nickte. Fulterer ging in die Küche, um neuen Kaffee aufzubrühen. Das dauerte. Und gab dem Schriftsteller Gelegenheit, sich zu beruhigen. Das machte er immer so, wenn noch jemand anwesend war. Er wusste, dass er dazu neigte, den Streit mit dem Zufallsgast fortzusetzen – wenn ihn vorher ein anderer geärgert hatte. Er hatte das Theodor gegenüber sogar einmal zugegeben. „Ich bin dann wie verschüttetes Benzin“, hatte er gesagt, „die kleinste Flamme, ein Funke und …“
Theodor verstand auch, dass Fulterer eine Auseinandersetzung vermeiden wollte. Zu leicht würde etwas gesagt, was man später bedauerte. Und Theodor Lukasch vertrieb. Seinen Freund. Den einzigen Freund, wenn man es genau betrachtete. Hans-Jörg Fulterer war kein Mensch, der leicht Freunde gewann. Nur welche zu verlieren fiel ihm leicht. Wegen seines ungestümen Wesens.
Und wegen seiner Gicht.
Die hatte er geerbt, schon der Vater und der Großvater hatten darunter gelitten. Befallen waren die Großzehengelenke, manchmal aber auch die Daumengelenke, besonders unangenehm für einen Schriftsteller, weil die starke Schwellung die ganze Hand in Mitleidenschaft zog und das Schreiben zur Qual machte. Das heißt, während der Gichtanfälle konnte Hans-Jörg Fulterer gar nicht schreiben. Das wäre für einen normalen Menschen das geringste Problem gewesen, aber Fulterer war kein normaler Mensch. Er schrieb jeden Tag. Buchstäblich jeden einzelnen Tag seines Lebens, seit seinem vierzehnten Lebensjahr. Nicht immer Manuskripte, aber Notizen, Betrachtungen, Ideen, Einfälle, alles Mögliche. Mit der Hand in große und kleine Notizbücher, die er nach einem undurchschaubaren System verwaltete. In seinem Schreibzimmer füllten sie ganze Regale. Wenn er nicht schreiben konnte, wurde er unleidlich. Und zwar so, dass er der Öffentlichkeit nicht mehr zugemutet werden konnte. Er wusste das selbst und hasste es.
Hans-Jörg Fulterer kam mit dem Kaffee ins Wohnzimmer zurück. Und mit einer Flasche. Theodor unterdrückte ein Seufzen.
„Magst du ein bisschen was Stärkeres rein?“, fragte Fulterer.
„Nein danke, ich muss ja noch fahren.“
„Ja, richtig … Aber ich brauch jetzt einen Schluck zur Beruhigung.“
Er schenkte sich in einen Cognac ein. Einen großen. Es war nicht einmal ein besonders guter, eine Wald-und-Wiesen-Marke aus dem Supermarkt, mit buntem Etikett. Er nahm einen großen Schluck, bei dem würde es aber nicht bleiben. Es ist erstaunlich, dachte Theodor, wie wenig Notiz die Öffentlichkeit von der Tatsache nimmt, dass der große Hans-Jörg Fulterer ein ausgemachter Säufer ist. Das wurde einfach ausgeblendet, obwohl Fulterer kein Geheimnis aus seiner Vorliebe für harte Getränke machte und seiner Sucht nicht im stillen Kämmerlein frönte, sondern bei praktisch jedem offiziellen Termin, zu dem er eingeladen war. Eine halbe Stunde nach Beginn des „gemütlichen“ Teils hatte der Schriftsteller einen in der Krone, weil er zuerst zwei harte Drinks oder zwei Gläser Wein runterschüttete, das reichte schon, danach trank er langsamer weiter; es ging nicht um Genuss und solchen Kokolores, sondern um den gewissen Zustand, der mit einem bestimmten Alkoholpegel assoziiert war; es kam ihm nur darauf an, dass dieser Pegel den ganzen Abend nicht mehr absackte.
HJF soff. Das wusste jeder. Ebenso, wie ihn jeder HJF nannte, wenn er nicht dabei war. Er hasste die Abkürzung, was wiederum auch alle wussten, auf die es ankam. Und er wurde ausfällig, wenn er getrunken hatte. Aber das machte nichts aus, niemandem. Sogar die Opfer seiner bösartigen Sottisen lächelten, zwar gequält, aber doch. Das war halt HJF, wie er leibt und lebt.
Denn Hans-Jörg Fulterer genoss die Gunst des Publikums. Keiner seiner Kollegen verkaufte auch nur annähernd so viel wie er. Seine Romane überschritten regelmäßig die Hunderttausender-Auflage, ausnahmslos alle erschienen dann als Taschenbuch und erzielten noch weit höhere Zahlen. Das ging schon seit vielen Jahren so. HJF war eine Literatur-Institution.
Die Kritik blieb mit erstaunlicher Konstanz in zwei Lager gespalten. Das eine liebte, das andere hasste ihn. Wenn man Besprechungen desselben Romans las, ergab sich der Eindruck zweier verschiedener Werke; beim Kritiker X in der Zeitung A stand etwas von einem „Leuchtturm in einer mediokren Literaturlandschaft“, beim Kritiker Y in der Zeitung B war die Rede vom „Durchschnittsprodukt eines überbewerteten Vielschreibers“. Darauf antwortete HJF dann in Interviews, wobei er irgendeine Peinlichkeit aus der Vergangenheit des Kritikers Y ans Licht brachte, denn es gab ein ganzes Heer von fanatischen HJF-Anhängern, die sich als Zuträger betätigten. Sie saßen in allen Redaktionen, die Spaltung ging quer durch Parteiungen und Gruppen. Wenn jemand überhaupt las, hatte er zu HJF eine dezidierte Meinung, Neutralität existierte nicht. Mit jeder Neuerscheinung ging der Literaturkrieg in eine neue Phase. Theodor bewunderte an Fulterer nicht sein schriftstellerisches Vermögen, sondern seine Fähigkeit, bei jeder einzelnen Veröffentlichung diesen Krawall zu inszenieren.
Um Theodors eigene Arbeiten wurde nicht so ein Wesen gemacht, da blieb es ruhig. Alle zwei Jahre oder so brachte er einen Krimi heraus, der in der Presse „freundlich“ aufgenommen wurde. Vom Publikum auch. In der Schule hätte es geheißen: zwei minus. Gut. Gerade noch so eben. Aber nichts Herausreißendes. Für den Absatz seiner Romane galt das nicht, da musste man eine Note besser geben. Die Kritiken der Leser auf Amazon waren durchwachsen, der Absatz aber erstaunlich gut.
Fulterer hatte zwei Kinder, Sohn und Tochter. Martin war Diplomingenieur bei einem internationalen Konzern, verheiratet war er mit einer Spanierin aus reichem Hause. Martin bekam man selten zu Gesicht, weil er auf allen Kontinenten damit beschäftigt war, irgendwelche Prestigebauten hochzuziehen. Wenn dieser Martin mit seiner Familie zu Weihnachten nach Dornbirn kam, benahm er sich gehemmt und introvertiert, als habe er Angst, etwas kaputt zu machen oder umzustoßen. Wie ein Elefant im Porzellanladen – aber einer, der weiß, dass er ein Elefant und dass es ein Porzellanladen ist, wie er vorsichtig ein Stampfbein vor das andere setzt. Für Martin Fulterer war in der Heimat alles zu klein geworden. Seine Frau Mercedes sprach kein Wort Deutsch, ihren Abscheu allen Sachen, Sitten und Menschen gegenüber, die nördlich der Alpen beheimatet waren, konnte man ihr ansehen, auch wenn sie versuchte, dieses Gefühl zu verbergen. Mit mir konnte sie Spanisch sprechen und machte dann keinen Hehl aus ihrer Abneigung gegen die Heimat ihres Mannes. Ich fand es weniger unhöflich als grotesk – wenn es ihr so zuwider ist, warum fährt sie dann jedes Jahr mit?
Nur die beiden Kinder verhielten sich normal, freuten sich auf den Großvater. Die Lage wurde allerdings durch die Anwesenheit von HJFs zweiter Frau kompliziert, die nicht Martins Mutter war. Martins Mutter wohnte ihn Wien, war wieder verheiratet und kam an manchen Feiertagen auch, natürlich mit ihrem Anhang; von ihr war HJF geschieden. Von der zweiten Frau, Marianne, auch, aber zu beiden hatte er ein gutes Verhältnis. Marianne brachte dann auch oft ihren Bruder mit, der irgendwelche Schwierigkeiten hatte, die Theodor und mir ebenso entfallen waren wie sein Name oder der Name seiner Freundin. Zu Weihnachten tummelte sich in der Fultererischen Villa eine zusammengewürfelte Personengruppe, die allein vom Zentralgestirn Hans-Jörg Fulterer beieinandergehalten wurde, von der mit eins neunzig alle überragenden Patriarchengestalt mit wehendem Haupthaar und blondem Vollbart, den die Leserinnen liebten.
Ja, er wurde geliebt. Drum kauften sie auch seine Bücher wie geschnitten Brot. Die Masse der Pro-Fulterer-Kritiker erklärte seinen Erfolg mit der einfachen Behauptung, dass der große Schriftsteller seinerseits die Menschen liebe und die das merken würden; die Anti-Fulterer-Fraktion äußerte sich naturgemäß nicht über seinen Erfolg.
Das mit der Liebe war natürlich Quatsch. Hans-Jörg Fulterer liebte die Menschen nicht. Aber er war imstande wie sonst keiner, diesen Eindruck zu erwecken. Das Herz der Menschen zu berühren, wie auch immer. „Berührend“ war überhaupt die häufigste Vokabel in den positiven Besprechungen und Internet-Blogs. HJF liebte seine Familie (wenn man dieses obsessive Gefühl „Liebe“ nennen wollte) und hielt den Großteil vom Rest der Menschheit für ein Lumpenpack. Das hatte er Theodor oft und oft gesagt. Aber er berührte bei diesem Lumpenpack die Herzen, was soll man machen? Verkaufszahlen lügen nicht. Die Leute kaufen, was sie glücklich macht. Fulterers Bücher machten sie glücklich.
Von Theodors Büchern konnte man das nicht behaupten. Die wurden gekauft, weil sie spannende Unterhaltung boten. Jedenfalls behaupteten das die Buchhändler. Die kamen der Kundschaft immerhin am nächsten, also glaubte Theodor, was sie sagten. „Spannende Unterhaltung“ war nichts als eine Chiffre, wie Theodor wohl wusste. Es ging in Wahrheit darum, dass die Menschen schlecht waren (nicht böse, sondern schlecht!), dass die Menschen von denen verraten wurden, die sie liebten, und sich dafür rächten. Jedenfalls in den Romanen von Theodor Lukasch. So war das. In Wahrheit schrieb er immer nur über dieses eine Thema. Verrat und grausame Rache. Das gefiel einer bestimmten Teilmenge des lesenden Publikums; Theodor hatte so etwas wie eine Gemeinde, er sah sie bei Lesungen, saß ihnen dort gegenüber. Auffällig viele Männer im sonst frauendominierten Pulk der Lesenden. Das allein war schon ein Alarmzeichen, wenn man den Verkaufserfolg im Auge hatte: Ein Roman, der vielen Männern gefiel, ließ sich gut verkaufen, aber nicht überragend.
HJF hatte sich beruhigt, wie immer, wenn er trank. Eine paradoxe Wirkung des Alkohols, es gab bei ihm kein Exzitationsstadium, eher das Gegenteil; er wurde ruhig und besonnen, fast angenehm. Zuerst. Später dann rührselig und mäkelig, weinerlich verdrossen. Und bei Gelegenheit auch ausfallend. Zum Scheusal.
Er hatte auf dem Sofa Platz genommen, den Arm über die breite Lehne gelegt. Als ob er Modell säße. Für den Szene-Maler Markus Rosenthal, der schon das große Porträt angefertigt hatte, das über der Eingangstür hing. Ein Kritiker, der im Rahmen einer größeren Gesellschaft zu einem Essen eingeladen war, hatte es nicht unterdrücken können, nachher herumzuerzählen, Fulterer wirke auf dem Gemälde wie „zur Kenntlichkeit entstellt“, was Fulterer natürlich erfuhr und ja auch erfahren sollte. Der Kritiker wurde nicht mehr eingeladen. Der war dann nach Wien gezogen, Theodor hatte ihn aus den Augen verloren, was macht der jetzt eigentlich … der … wie hieß er noch? Theodor fiel es nicht mehr ein.
„Du siehst so besorgt aus“, sagte Fulterer, „ist dir nicht gut?“
„In letzter Zeit fallen mir Namen nicht mehr ein, ist das schon Alzheimer?“
„Keine Ahnung. Aber die Person hast du noch präsent?“
„Natürlich, nur wie der heißt, da komm ich ums Verrecken nicht drauf. Dieser Kritiker. Der nach Wien gezogen ist …“
Fulterer blickte ihn mit großen, arglosen Augen an.
„Kannst du nicht ein bisschen genauer werden? Kritiker gibts wie Sand am Meer.“
Theodor Lukasch wollte so kurz nach dem Morselli-Zwischenfall die unangenehme Kritikerepisode nicht erwähnen, aber HJF war jetzt interessiert und würde nicht lockerlassen. Also rief ihm Theodor die Einladung, das Essen, den Kritiker ins Gedächtnis – das heißt, er versuchte es, aber vergeblich. Hans-Jörg Fulterer konnte sich nicht erinnern.
„Tut mir leid“, sagte er, „muss ich vergessen haben. Damals hatte ich diese Phase, du weißt schon, dauernd einen Haufen Leute im Haus, furchtbar im Grunde. Ich weiß nicht, wen du da meinst.“
Er wirkte ruhig, sein Interesse an der Sache ließ bereits nach, er verstellte sich nicht. Theodor kannte ihn über zwanzig Jahre. Wenn HJF ein Talent abging, war es das zur Verstellung.
„Ist auch nicht so wichtig. War mir halt grad eingefallen, das alles. Bis auf den Namen. Aber du weißt ja überhaupt nichts mehr davon. Vielleicht hast ja du Alzheimer …“
Fulterer lachte laut auf, als sei das ein besonders gelungener Witz.
„Warum ist dir jetzt dieser Kritiker eingefallen?“
„Weil er über das Bild am Gang was gesagt hat, über dein Porträt. Du bist darauf zur Kenntlichkeit entstellt, hat er gesagt …“
Fulterer sah ihn an, die Augen glänzten vor Erwartung.
„Ja – und weiter?“
„Nichts weiter, das hat er gesagt.“
„Ach so, ich dachte, das ist eine Geschichte …“
„Du hast dich damals wahnsinnig aufgeregt darüber.“
„Tatsächlich? Über den Spruch? Und wieso?“
„Was meinst du mit ‚wieso‘?“
„Ich meine, wieso mich das aufgeregt hat? Ich kann mich nicht erinnern, da muss doch noch etwas gewesen sein, irgendwelche Umstände …“
„Nein, da war sonst nix. Er hat es halt herumerzählt.“
„Wer?“
„Der Kritiker. Der, von dem mir der Name nicht mehr einfällt.“
„Ach so … Wo hat er denn geschrieben?“
„Das weiß ich auch nicht mehr.“
„Du bist manchmal ein bisschen mühsam, weißt du das?“
„Kann schon sein. Ist ja auch nicht so wichtig, dieser Kritiker.“
„Das seh ich genauso. Und im Ernst: Mach dir keine Gedanken wegen Alzheimer. Ich vergess auch einen Haufen Sachen. Deinen Typen zum Beispiel – und wenn du mich erschlägst, ich weiß nicht, wen du meinst!“
Theodor ließ es dabei bewenden. Einen Augenblick dachte er: Vielleicht ist er dement, fängt das so an? Er selbst hatte vergessen, wie der Mann hieß, aber alles andere an der Geschichte war ihm noch präsent – wie HJF herumgebrüllt hatte, als er von der Formulierung erfuhr, wie das Ganze tagelang Thema gewesen war im Hause Fulterer. Sogar die Putzfrau Jovanka, die zweimal in der Woche kam, musste ihrer Empörung Ausdruck geben:
„Schmutzige Kritikerschwein soll verrecken, fahren zur Hölle!“
Dazu noch originalsprachliche Flüche aus Slawonien, die zu übersetzen sich Slovanka unter dem Vorwand weigerte, ihr Deutsch reiche dazu nicht aus, in Wahrheit aber, um ihrem Dienstherrn einen Schock zu ersparen, wie sie Theodor gestand, ging es in den Flüchen doch um Gott, die Mutter des Kritikers und ihre Geschlechtsteile in Verbindungen, die Westler nicht für möglich halten würden. Jovankas Anhänglichkeit an Fulterer war legendär. Sie hätte für ihn gestohlen und gemordet. Denn Fulterer hatte ihrer Tochter eine komplizierte Knieoperation bezahlt. Das war eben auch HJF. Großzügig. Aber auch nachtragend. Immer schon gewesen. Aber wenn er jetzt anfing, Leute zu vergessen, denen er etwas nachtrug – dann … ja, dann … Theodor wusste nicht, was er davon halten sollte. Dann würde ein ganz neues Kapitel aufgeschlagen, dann würde sich auch seine eigene Beziehung zu HJF verändern. Das beunruhigte ihn.
Sie unterhielten sich noch eine Weile über belanglose Dinge, Theodor verabschiedete sich und fuhr heim, das heißt, er fuhr bis zur Ecke der kurzen Wohnstraße, in der Fulterers Haus lag, blieb stehen und betrachtete das Haus im Rückspiegel. Er machte das oft. Es tröstete ihn über vieles hinweg. Dass nämlich der berühmte und maßlos erfolgreiche Hans-Jörg Fulterer in einem so hässlichen Kasten wohnte. Theodor stand mit dieser Auffassung allein im ganzen Land. Fulterers Wohnhaus galt als Inbegriff jener Architektur, die Vorarlberg in ganz Europa bekannt gemacht hatte. Eine Kiste. Das Haus sah aus wie eine überdimensionale Obstkiste, ein Quader aus Holz mit Fenstern. Also keinen Fenstern im alten Sinn, sondern ausgestanzten Rechtecken mit Glas. Es waren nicht so viele, wie der Architekt vorgesehen hatte, denn dann hätte man von Norden nach Süden und von Osten nach Westen quer durchs Gebäude schauen können und keinen Platz für Regale gehabt, auf die ein Schriftsteller der vielen Bücher wegen angewiesen war; HJF hatte mit Erfolg einige Änderungen in den Plan reklamiert, aber jetzt fehlten die Fenster im ästhetischen Konzept, das heißt, das Haus sah noch viel deutlicher nach einer Kiste aus als die anderen Exemplare dieses Stils.
„Du bist ungerecht“, sagte Lisa, wenn Theodor mit seinem Lamento über die Holzhausarchitektur anfing und das Fultererhaus als besonders übles Beispiel anführte. „Und außerdem“, sagte sie jedes Mal, „ist es nicht ein Quader, es sind zwei, das unterschlägst du immer.“
Lisa hatte recht, es waren zwei Holzquader, die einen rechten Winkel bildeten, in diesem Winkel lag der quadratische Pool. Kein Biogewässer mit selbstreinigendem Schilfbewuchs, Schlammboden und Amphibien, sondern ein richtiger Swimmingpool mit einer Wasseraufbereitungsanlage, Umwälzpumpen und jeder Menge Chlor. HJF hatte das so gewollt. Der Pool verhöhnte durch sein bloßes Dasein den ganzen Rest der Anlage. Fulterer gefiel das so. Er nutzte ihn auch vom ersten Frühlingstag an, eine Solaranlage sorgte schon im März für temperiertes Wasser. Die übrige Heizung lief natürlich nach Passivhausstandard; HJF liebte es, damit zu prahlen, mit wie wenig Geld er das Ganze heize.
Theodor hasste das Haus. Dennoch faszinierte es ihn, zog ihn an. Manchmal unternahm er auf Autofahrten Umwege, nur, um daran vorbeizufahren. Er konnte sich diese Anziehungskraft selbst nicht erklären und hatte niemandem etwas davon erzählt, auch Lisa wusste nichts, Fulterer erst recht nicht.
Zu Hause erzählte er Lisa von dem ereignisreichen Nachmittag bei seinem Kollegen; das heißt, „ereignisreich“ schien nur er selbst den Nachmittag zu finden – Lisa sagte nichts, sie hörte nur zu und fuhr mit ihrer Arbeit, Einpflanzen kleiner Topfblumen, fort. Sie blieb unbeeindruckt, um nicht zu sagen, uninteressiert. Noch während er die Geschichte vom Zerwürfnis Fulterer/Morselli erzählte, kam sie ihm selbst uninteressant vor. Langweiliger Literaturinsiderquatsch. Ja, Lisa hatte recht. Wieso regte ihn auf, was diese beiden taten oder ließen? Wieso war er überhaupt hingegangen? Letzteres konnte er leicht beantworten: um der Fron am Computer zu entkommen, einen Nachmittag lang.
Sein Roman war fertig. Das hieß bei ihm: fertig. Nicht: in der ersten Fassung, im Rohentwurf und was an dergleichen Begriffen die Kollegen verwendeten, die ihr Opus dann noch vier Mal umschrieben. Theodor Lukasch machte das nicht und verwies in diesem Zusammenhang gern auf den Tischler, der ja eine fertige Kommode auch nicht „umkonstruierte“, „umleimte“ oder „umhobelte“. Die beiden letzten Verba existierten gar nicht, aus gutem Grund, sagte Theodor Lukasch; wer am Schluss noch einen Haufen „um“-manipulieren musste, beherrschte einfach das Handwerk nicht. Es ist klar, dass ihm solche Äußerungen nicht viel kollegiale Sympathie einbrachten.
Umso ärgerlicher war die aktuelle Situation. Das Ding hakte irgendwie. Er war vom ausgearbeiteten Plan abgewichen und hatte seiner Hauptfigur zu viel Eigeninitiative zugestanden – immer ein Fehler, wenn man Genreliteratur schrieb; seine Hauptfigur, ein Betrüger, hatte sich in eine Nebenfigur verliebt – soweit war das noch im grünen Bereich und diente nur der Tarnung der allzu offensichtlichen dramaturgischen Funktion eben dieser weiblichen Nebenfigur. Theodor wollte mit dem Emotionsschlenker an dieser Stelle das kausale Räderwerk seiner Romanmaschine verbergen, das ihm hier durchzuschimmern schien; aber die Sache war aus dem Ruder gelaufen und über mehrere Kapitel hinweg zur vollgültigen Nebenhandlung geworden, die aber jetzt zum Hauptstrang nicht mehr recht passte. Er konnte das ganze Zeug wieder rausstreichen und beträchtliche Teile des Romans neu schreiben, oder er konnte es lassen, wie es war. Direkt schlecht war es nicht, es war nur anders geworden als geplant. Das gefiel ihm nicht, erinnerte zu sehr an das frischfröhliche Drauflosfabulieren seiner Anfangsjahre; da kamen auch Romane heraus, die der Autor toll fand, aber sonst niemand. Schon seit Langem zwang er sich, bevor die erste Zeile auf den Bildschirm kam, zur Totalkonstruktion des Romans in mehreren Ausarbeitungsstufen vom ersten Entwurf bis zu einer alle Figuren und Details umfassenden Synopsis, Szene für Szene. Die Fron am Computer bestand im Durchlesen und dem nagenden Begleitgefühl, etwas nicht richtig gemacht zu haben.
Aber jetzt wollte er nicht mehr daran denken, der Tag war sowieso im Eimer. Man soll nicht vor unangenehmen Aufgaben davonlaufen, dachte er, das Alternativprogramm ist um nichts besser. Was war noch gewesen? Außer dem unerquicklichen Streit Fulterer/Morselli? Etwas, das mit ihm selbst zu tun hatte und Lisa mehr interessieren würde – ja, die Sache mit dem Kritiker, der ihm beim Betrachten des Fultererporträts eingefallen war. Er erzählte Lisa davon.
„Nürnberger, meinst du den?“, fragte sie. „Stefan Nürnberger. Der vom ORF.“
„Genau! Nürnberger. Ist mir auf der Zunge gelegen …“
Das war gelogen. Theodor hatte nicht die geringste Ahnung gehabt, wie der Mann heißen mochte; er hatte sich nur an den Spruch von der Kenntlichkeit erinnert und dass derjenige Kritiker war. Jetzt fiel ihm noch Verschiedenes ein.
„Hat der dann nicht auch in Wiener Zeitungen geschrieben?“
„Nein“, sagte sie, „damals noch nicht. Erst nach dem Umzug.“
„Nach welchem Umzug?“
„Seinem. Hat hier die Zelte abgebrochen und ist Schnall und Fall nach Wien gezogen, weißt du das nicht mehr?“
„Sollte ich? Dauernd ziehen irgendwelche Leute nach Wien …“
„Schon, aber der Nürnberger hat dann richtig Karriere gemacht. Ich weiß nur nicht mehr genau, was das war; eine tolle Position … im Ministerium, glaub ich. Erstaunlich.“
„Und dann hat er angefangen, in Wiener Zeitungen zu schreiben? Typisch. Die machen sich einen Lenz, die Herren Beamten! Das war schon bei Grillparzer so …“
„Grillparzer war sehr fleißig, das nur nebenbei. Und Stefan Nürnberger hat erst später mit den Kritiken angefangen. Er hat diese Stelle nämlich wieder verloren.“
„Woher weißt du das?“
„Hat mir irgendwer erzählt.“
Sie drehte den Hahn der Regenwasseranlage auf, um sich die Hände zu waschen. Im Inneren des Hauses sprang die Pumpe an.
„Und warum?“
„Das weiß ich nicht. Ist aber schon ein paar Monate her.“
„Das hab ich nicht gewusst.“
Lisa drehte den Hahn zu. Das Geräusch der Pumpe erstarb.
„Gehen wir rein“, sagte sie dann. „Es wird kühl.“
Lisa hatte recht. Die Sonne war hinter einer Wolkenwand verschwunden, es wurde kühl im Garten.
Aber nicht so kühl wie in der Seele des Theodor Lukasch.
Sie gingen ins Haus, Lisa begann zu kochen. Spaghetti mit Tomatensugo, das sie selbst machte. Sie erzählte von ihrer Arbeit bei der Bank, er versuchte zuzuhören, während er die Zwiebeln schnitt; sie konnte fuchsteufelswild werden, wenn sie dahinterkam, dass er nicht zuhörte. Aber lange Ehejahre hatten ihn gelehrt, dieses Zuhören nicht direkt zu simulieren, aber doch nicht alle Aufmerksamkeit darauf zu verwenden, sodass noch ein Rest blieb. Von der Aufmerksamkeit nämlich, die er auf andere Dinge lenken konnte. Nur wusste er in diesem Fall nicht, worauf genau. Dieser Typ, dessen Name ihm nicht eingefallen war, hatte seine Stelle verloren. Das kam vor. Warum beschäftigte ihn das so? Und das tat es, er konnte es nicht abstreiten. Er hatte Nürnberger kaum gekannt, im ganzen Leben vielleicht zehn Worte mit ihm gewechselt, Small Talk bei irgendwelchen Veranstaltungen.
Etwas stimmte nicht.
Er war sich sicher. Dafür hatte er ein Gespür. Nicht in Richtung des Kriminellen, das nicht, keine Verschwörung gegen Nürnberger oder so. Kein Verbrechen. Er schrieb zwar Kriminalromane, aber die hatten nichts mit der wirklichen Welt zu tun, wie er wohl wusste; genauso wenig wie die Romane der Kollegen. Reale Verbrechen folgten nicht den verzwickten Mustern, die sie sich ausdachten, sondern anderen, unverständlichen Regeln. Oder gar keinen Regeln. Reale Verbrecher waren schon deshalb keine guten Romanfiguren, weil die meisten unglaublich dumm waren. Leute, die lesen, ertragen kluge Köpfe in einem Roman ohne Weiteres, aber keine Personen, die dümmer sind als sie selbst. Eine wenig bekannte Tatsache: Er hatte keine Ahnung, warum das so war, und hätte es auch nicht beweisen können, aber er war davon überzeugt und behielt es beim Schreiben immer im Auge.
Hier ging es nicht um ein kaschiertes Verbrechen; er spürte nur, dass an der Nürnberger-Geschichte noch etwas anderes dranhing, etwas Verborgenes. Er hätte nicht sagen können, was das war. Lisa hatte ihm sicher nicht absichtlich etwas verschwiegen; sie hatte erzählt, was ihr dazu eingefallen war. Das war aber nicht annährend alles, was es darüber zu wissen gab.
Wenn man das nun noch wüsste, dieses Andere, ergab sich vielleicht der Kern einer Geschichte, die man erzählen konnte – auf Papier natürlich, in einem Roman. Wie Schnitzkünstler in den bizarr verdrehten Formen alpiner Wurzelstöcke schon die Fabelwesen sehen, die sie dann mit ihren Schnitzwerkzeugen daraus befreien, so sah Theodor Lukasch in einer kleinen Erzählung die spätere großartige Geschichte, die einen ganzen Roman tragen konnte. Ganz einfach: An der Nürnberger-Geschichte fehlten wesentliche Teile. Diese galt es zu finden.
Nach dem Essen verschwand Theodor in seinem Arbeitszimmer. Das Internet wusste über Stefan Nürnberger erstaunlich wenig. Die meisten Fundstellen betrafen Kritiken, die er verfasst hatte. Der Artikel auf Wikipedia war kurz und von beleidigender Nüchternheit, ein einzelner Absatz, in dem Nürnberger geboren wurde, unmittelbar darauf sein Doktorat in Literaturwissenschaft machte und dann ein paar Bücher und Kritiken für verschiedene Presseorgane „schreibt“, nicht „schrieb“, die alle angeführt wurden. Mit Stefan Nürnberger war alles in Ordnung, eine langweilige Erfolgsstory. Nur eben nicht auf dem neuesten Stand. Aber was heißt das? Würde man das hineinschreiben: Hat im Jahre soundso seine Stelle verloren? Wohl kaum. Was sagten die Wikipedia-Regeln bei einem solchen Karriereknick? Vielleicht warteten die Autoren taktvoll, bis der Betreffende tot war, und ergänzten den Artikel dann mit dem Sterbedatum und änderten das „… ist ein österreichischer Literaturkritiker“ in „… war ein österreichischer Literaturkritiker“. So einem Fall haftete etwas Peinliches an, wobei die Peinlichkeit der Aktualität des Netzes geschuldet war. In den Lexika früherer Zeiten standen fast nur tote Menschen oder so alte, dass man ein gewisses Resümee ziehen konnte, ohne falsch zu liegen. Dagegen waren die Netzbiografien lebender Menschen unbefriedigende Momentaufnahmen – davon abgesehen hätte es die große Mehrzahl dieser Lebenden nie in ein gedrucktes Lexikon geschafft, er selbst ja auch nicht, da war sich Theodor sicher. Und ebenso wenig Nürnberger.
Theodors Stimmung sank. Nürnberger war nun zu einer „Sache“ geworden, der er nachzugehen hatte – um daraus eventuell ein „Projekt“ zu machen. Das Ganze hatte jetzt schon mit Arbeit zu tun; absichtsloses Interesse konnte er sich, wie er meinte, nicht leisten. Und Widerstände in der Arbeit ärgerten ihn. Er arbeitete sowieso nicht gern. Wenn er sich beklagte, tröstete ihn Lisa mit dem Rat, er solle sich doch vorstellen, wie es wäre, wenn er gar keine Arbeit hätte: Wenn etwa der Verlag seine Manuskripte nicht mehr nähme und auch sonst niemand … Diese Vorstellung war so schrecklich, dass er jedes Mal froh war, sich ärgern zu dürfen. Lisa war überhaupt ein Schatz. Er ging in die Küche hinunter.
„Ich komm mit diesem Nürnberger nicht weiter“, sagte er. „Ich find nirgendwo einen Hinweis, was mit dem los ist.“
„Nürnberger also“, sagte sie.
Nach einer Erklärung fragte sie nicht, sie kannte seine Arbeitsweise.
„Dann solltest du den Morselli fragen“, sagte sie, „der war mit dem Nürnberger befreundet.“
„Wieso?“
„Die sind zusammen in die Schule gegangen, glaub ich.“
„Nein … Wieso weißt du das?“
„Morselli hat’s mir erzählt.“
„Wann?“
„Auf einer Lesung. Im November im Felder-Archiv.“
„Morselli hat dort was vorgelesen?“
„Aber geh! Wolfgang Hermann hat gelesen, ich hab halt hinterher noch mit ein paar Leuten gesprochen.“
Das war ihre Spezialität, hinterher „mit ein paar Leuten zu sprechen“. Und Marketing für ihren Mann zu machen. Networking. Er wusste nicht, wie genau sie dabei vorging, wie es ihr gelang, den diversen Kulturamtsleitern und sonstigen Veranstaltern attraktive Lesungen für Theodor herauszuleiern. Er war ja nie dabei. Vielleicht lag gerade darin das Geheimnis ihres Erfolgs. Sie konnte den Leuten Sachen über ihn erzählen, die sie nie glauben würden, wenn er in natura danebenstünde.