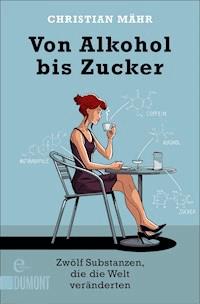7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Wer kennt noch die geniale Natronlok, die jahrelang lärm- und abgasfrei durch Berlin und Aachen fuhr, ehe sie aus dem Verkehr gezogen wurde? Oder den Stirlingmotor und das Ionentriebwerk? Für jeden verständlich erklärt Christian Mähr verblüffende Ideen aus der Technikgeschichte. Er bettet sie geistreich ein in die Umstände ihrer Entwicklung und ihres Verschwindens. Dabei wirken die zehn spannendsten Erfindungen, die zu ihrer Zeit keine Chance hatten, heute erstaunlich zeitgemäß.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Vom Abstellgleis der Erfindungsgeschichte
Wer kennt noch die geniale Natronlok, die jahrelang lärm- und abgasfrei durch Berlin und Aachen fuhr, ehe sie aus dem Verkehr gezogen wurde? Oder den Stirlingmotor und das Ionentriebwerk? Für jeden verständlich erklärt Christian Mähr verblüffende Ideen aus der Technikgeschichte. Er bettet sie geistreich ein in die Umstände ihrer Entwicklung und ihres Verschwindens. Dabei wirken die zehn spannendsten Erfindungen, die zu ihrer Zeit keine Chance hatten, heute erstaunlich zeitgemäß. Christian Mähr
Christian Mähr
VERGESSENE ERFINDUNGEN
Geniale Ideen und was aus ihnen wurde
eBook 2015
DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
© 2002 DuMont Buchverlag, Köln
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildungen: Papierfond: © Fotolia.com
Fluggerät: © akg-images/bilwissedition
Satz: Fagott, Ffm
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN eBook 978-3-8321-8612-8
www.dumont-buchverlag.de
Vorwort
Ich durfte als Vierjähriger einen Lokschuppen besuchen, wo ein Dutzend Dampfloks qualmend im Halbkreis stand, so etwas prägt. Wenn mir ein Lexikon unterkommt, schaue ich schon wegen der Abbildungen unter dem Stichwort »Lokomotiven« nach. Beim Blättern in einem Lexikonartikel stieß ich auf eine merkwürdige Zeichnung. »Honigmanns Natronlokomotive. Längsschnitt.« Die Beschreibung hat mich fasziniert. Ich wusste, wie eine Dampflok funktioniert, »immer schon«, die Lok muss das erste technische Gerät gewesen sein, das mir erklärt wurde. Aber von einer »Natronlok« hatte ich nie auch nur ein Wort gehört; das wäre bis heute so geblieben, wenn ich nicht in einem alten Lexikon aus dem Jahr 1876 geblättert hätte. In einem jüngeren von 1905 gibt’s zwar noch die Natronlok, aber die Schnittzeichnung ist verschwunden – und ohne die Zeichnung fällt sie nicht mehr auf, geht unter als Verweis unter vielen anderen.
Lexikonwissen verschwindet – es kann nicht anders sein. Das Wissen der Menschheit verdoppelt sich in immer kürzeren Abständen, die Lexika haben immer noch ihre kanonischen vierundzwanzig Bände. Da muss viel Altes raus. Aber was? Und was bedeutet es, wenn die Natronlok verschwindet?
Ich habe in den folgenden Jahren viele Techniker nach dieser Lok gefragt. Kein Einziger wusste auch nur von ihrer Existenz. Ich begann nachzuforschen. Die Bewunderung der Zeitgenossen stand in merkwürdigem Gegensatz zum völligen Verschwinden der Natronlok aus dem technischen Bewusstsein schon wenige Jahre nach der Erfindung. Sie wurde getilgt, ausgelöscht. Warum? Es gab einen kryptischen Hinweis auf Materialprobleme, sonst nichts. Nun hat es beim Material, egal bei welchem, nie größere Fortschritte gegeben als im 20.Jahrhundert – man hätte doch mit neuen Werkstoffen die Natronlok wieder aufleben lassen können … man hat es nicht getan.
Die Natronlok war »vergessen« worden; kein Einzelschicksal, wie ich im Lauf der Jahre herausfand. Es gab da einen Dachboden der Technikgeschichte, wo sich die vergessenen Erfindungen stapelten. Da gab es, wie auf einem realen Speicher, allerhand Gerümpel. Da gab es aber auch Sachen, die man hätte brauchen können, brauchen kann oder in naher Zukunft brauchen können wird; Erfindungen, die hierher verbannt wurden, weil eine Rahmenbedingung nicht mehr passte. Diese Rahmenbedingung, meist eine ökonomische, hat sich dann geändert, andere Bedingungen wurden maßgebend – aber die Erfindung war auf dem Dachboden, verstaubt und vergessen. Ich hatte bis dahin geglaubt, die technische Entwicklung folge einer Art innerem Entwicklungsgesetz vom »Niederen« zum »Höheren«; dann bestünde der Ausdruck »überholt« zu Recht. Das ist blanke Mythologie. »Überholt« in Bezug auf Technik ist ein buchstäblich sinnloser Begriff, weil er voraussetzt, dass sich alle Erfindungen auf einer in die Zukunft gerichteten »Entwicklungsautobahn« ein Wettrennen liefern. Das ist nicht der Fall. Es gibt keine solche Autobahn, es gibt nur ein verästeltes Netz von Entwicklungswegen; manche Erfindungen – durchaus nicht alle – sind einfach Abzweigungen, die in ganz neue, nie geahnte Räume führen, in sumpfige Niederungen vielleicht, aber vielleicht auch in lichte Höhen. Das wissen wir nicht von vornherein. Die merkwürdig antitechnische Einstellung der Gegenwart speist sich nicht nur aus der Angst vor realen Gefahren und dem »Tempo« der Entwicklung, sondern auch aus einem Unbehagen vor diesem falschen Bild des alternativlos Geradlinigen. Wir ahnen, dass wir an manchen Abzweigungen vorbeigerannt sind, die wir hätten erkunden sollen. Die Führungsgruppe weiß, wo’s langgeht. Sagt sie. Aber sie hat keinen Kompass. Und keine Karte …
Dieses Buch stellt zehn vergessene Erfindungen vor, zehn Abzweigungen, an denen wir vorbeigelaufen sind. Ich habe versucht, sie zu erkunden, wenigstens ein Stück weit. Manche dieser Wege waren angenehm zu gehen, verloren sich dann aber im Gebüsch. Erstaunlich häufig fanden sich Wege, die breiter und besser wurden – sie führen wahrscheinlich auch in schönere Gegenden als der Holzweg, auf dem die Mehrheit gegenwärtig trottet. Nur für den Fall, dass wir umkehren müssen, könnte ja sein.
Aber Sie können dieses Buch auch ohne Nützlichkeitserwägungen lesen, einfach so, ohne philosophischen Hinterkopf. Es hat mir Spaß gemacht, diese Dinger vom Speicher zu holen, abzustauben, die Messingschildchen zu putzen … da stehen sie jetzt in der Sonne. Vielleicht ist etwas dabei, was Ihnen gefällt. Suchen Sie sich etwas aus!
Der Flettner-Rotor
Bei dieser Erfindung der zwanziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts wird alles von einem Bild ausgedrückt. Die folgende Abbildung zeigt im Vordergrund ein kleineres Schiff mit der Aufschrift des Erfindernamens – und zwei riesigen schornsteinartigen Gebilden. Nur kommt aus ihnen kein Rauch – im Gegensatz zu den Schornsteinen beim gewöhnlichen Dampfschiff im Hintergrund. Optisch ansprechende und »belehrende« Komposition, man schaut bei dem Bild nicht gleich wieder weg. Die runden Dinger sind keine Kamine, so viel ist klar. Was sind sie dann? Rotierende Zylinder, Flettner-Rotoren. Hohle Zylinder aus ein Millimeter dickem Stahlblech, innen durch eine Gitterkonstruktion ausgesteift, 2,8Meter dick und gut 15Meter hoch. Sie stehen drehbar gelagert auf einer Art Zapfen, ähnlich dem Unterbau bei einem Kran. Dort ist auch der jeweilige Elektromotor eingebaut. Er leistet 11Kilowatt bei 750Umdrehungen pro Minute. Den Strom bekommen die beiden E-Motoren von einer Dynamomaschine, die wiederum von einem 45 PS starken Dieselmotor angetrieben wird. Das Schiff hat nicht immer so ausgesehen. Die »Buckau« war als Dreimastgaffelschoner gebaut worden, 45Meter lang, neun Meter breit mit 900Tonnen Wasserverdrängung, sie hatte einen Hilfsmotor für Flauten und schwierige Manöver im Hafen. Sie entsprach dem üblichen Typ des kleinen Segelfrachtschiffs vom Anfang des letzten Jahrhunderts.
Die zum »Rotorschiff« umgebaute Buckau beim Auslaufen. Die rotierenden »Garnrollen« wirken wie Segel von der zehnfachen Fläche. [1]
So weit die nüchterne Beschreibung, das rein Technische. Jemand hatte offenbar dem schmucken Schiff Masten und Takelage weggenommen und durch diese unmöglichen Zylinder ersetzt. Die konnten sich nun um ihre Längsachse drehen, dieselelektrisch. Aber warum nur, um alles in der Welt, was hatte man davon?
Titelbild des 1926 erschienenen Bandes »Mein Weg zum Rotor« [2]
In seinem Buch »Mein Weg zum Rotor« verwendet Anton Flettner den Begriff nur ein einziges Mal: Walzensegel. Er hat sich nicht durchgesetzt. Schon damals sprach man nur vom »Flettner«-Rotor, der Name des Erfinders steht auch viermal größer als der Name »Buckau« auf der Seitenwand. Wir sind im Jahre 1924. Es gibt beim Auslaufen einen »Medien-Hype«, obwohl der Begriff erst siebzig Jahre später erfunden wird. »In wenigen Tagen waren die Nachrichten über das Rotorschiff und seine Einzelheiten über die ganze Erde verbreitet«, schreibt Flettner. »Aus allen Erdteilen gingen meiner Gesellschaft und mir Telegramme mit Glückwünschen und Finanzierungsangeboten zu. Monate hindurch erreichte die Geschäfts- und meine Privatpost einen Umfang, der kaum zu bewältigen war.« Es folgen Klagen, wie unmöglich es gewesen sei, die Autogrammwünsche zu befriedigen etc. – Ing. Flettner genießt spürbar die öffentliche Anerkennung nach Überwindung vieler Widerstände, Anfeindungen. Davon später.
»Walzensegel« trifft es genau. Die schornsteinförmigen Gebilde auf dem Schiff sind einfach Segel. In Form senkrechter (rotierender) Walzen. Eben Walzensegel. Einen Zweck erfüllen Segel nur, wenn der Wind weht. Ebenso die Walzensegel. Stehen sie still, übt der Wind einen geringen Druck aus, drehen sich aber die Walzen, wirken unheimlich anmutende Kräfte. Dass es wirklich funktioniert, hat nicht einmal die Germaniawerft so richtig glauben können, die den Umbau der »Buckau« durchführte. Denn kaum war der erste Rotor installiert, ließ man ihn mit Werftstrom anlaufen – nur um zu sehen, ob sich wenigstens die Haltetaue ein bisschen strafften. Schon nach wenigen Umdrehungen versuchte das Schiff sich in Bewegung zu setzen (es herrschte wohl leichter Wind). Flettner erhielt einen aufgeregten Anruf über das Vorkommnis. »Ja, was haben Sie denn anderes erwartet?« war seine einigermaßen entgeisterte Antwort.
Anton Flettner wurde am 1. November 1885 in Eddersheim am Main geboren. Er arbeitete als Lehrer, seine freie Zeit nutzte er zum autodidaktischen Studium der Naturwissenschaft. So wurde er zum Techniker und Erfinder. Mit 29 entwickelte er den »Landtorpedo«, eine Art ferngelenkten Panzer, der jedoch nie eingesetzt wurde. Nach dem Ersten Weltkrieg erfand er das »Flettner-Ruder« und den »Flettner-Rotor«, während des Zweiten Weltkriegs wandte er sich der Luftfahrt zu und wurde zum Hubschrauberpionier. Er wanderte nach Amerika aus und starb am 29. Dezember 1961 in New York. [3]
Die Zweifel der Beteiligten leuchten auch heute noch ein. Die beiden Zylinder stellten dem Wind eine Querschnittsfläche von 85Quadratmetern entgegen. Die frühere Takelung des Schiffes war zehnmal so groß gewesen. Trotzdem erreichte es beim selben Wind dieselbe Geschwindigkeit wie früher. Dort, wo die Rotoren stehen, wirken »unsichtbare« Segelflächen von zehnfacher Größe. Der offensichtliche Vorteil der Rotoren liegt in der leichteren Bedienung. Drehrichtung und Drehgeschwindigkeit der Rotoren lassen sich in Sekunden an einem Schaltpult einstellen. Von einer Hand. Dem stehen die stundenlangen komplizierten Segelmanöver des klassischen Segelschiffs gegenüber, ausgeführt von sehr vielen Händen (eine Viermastbark mit 2400 Quadratmeter Segelfläche braucht drei Dutzend Matrosen).
Das Flettner-Schiff ist ein Segelschiff, angewiesen auf den Wind. Ohne Wind keine Fahrt. Keine unbekannten mystischen Kräfte treiben es an, nur der Wind. Statt Segeln hat es aber eine Segelmaschine in Form senkrecht stehender, sich drehender Zylinder. Der Effekt, der diese Walzen zu Segeln macht, ist der Magnuseffekt.
Heinrich Gustav Magnus (1802–1870) war Chemiker und Physiker in Berlin. Er hatte unter anderem bei Berzelius in Stockholm studiert und war seit 1845 ordentlicher Professor der Physik und Technologie an der Berliner Universität. Er scheint in der ganzen Fülle der Erscheinungen ziemlich weitläufig herumexperimentiert zu haben, ein »wilder« Experimentator im Unterschied zum heute aktuellen »wilden« Denker. So bestimmte er die Ausdehnungskoeffizienten von Gasen, konstruierte ein Thermometer für Bohrlöcher, entdeckte ein nach ihm benanntes Platinsalz und so fort – über den Effekt, der seinen Namen bekannt gemacht hat, steht im Lexikon der Jahrhundertwende seltsamerweise kein Wort. Nebenamtlich war Magnus auch noch Lehrer an der Artillerieschießschule. Da gab es ein Problem: Seit dem Ende des 17.Jahrhunderts verwendete man bei den Kanonen gezogene Rohre, die dem Geschoss einen Drall mitgaben. Solche schnell rotierenden Geschosse trafen wesentlich besser. Bei Seitenwind wurden die Kanonenkugeln abgelenkt, natürlich seitlich, was niemanden wunderte, aber merkwürdigerweise auch in der Höhe, was eigentlich nicht sein durfte, dafür hatte man keine Erklärung. Professor Magnus untersuchte 1852 das Problem systematisch. Als Modell verwendete er einen senkrechten rotierenden Messingzylinder. Wird der nun von der Seite angeblasen, so wirkt eine Querkraft, ziemlich genau im rechten Winkel zur Windrichtung. Und zwar auf der Seite des Zylinders, wo er sich in dieselbe Richtung dreht, wie der Seitenwind weht. Magnus hat diesen Effekt im Modell festgestellt, aber nicht gemessen und auch nicht erklärt. In der Folge gab es zum Magnuseffekt mehrere Versuche in England, Frankreich und Deutschland, die Sache wurde als gelehrte Spielerei betrachtet; interessanter Vorlesungsversuch ohne weiteren praktischen Wert. Anton Flettner kam auf die Idee, die entstehende Querkraft zum Antrieb eines Schiffes zu nutzen, ähnlich, wie das bei einem Segelschiff der Fall ist.
Wind umströmt einen stehenden Zylinder (oberes Bild). Der Zylinder rotiert in ruhiger Luft (mittleres Bild). Das untere Bild zeigt die Kombination: Wind umströmt einen rotierenden Zylinder. Wo die Stromlinien eng stehen, herrscht Unterdruck – in diese Richtung zieht die Querkraft. [4]
Wie kommt es aber zum Magnuseffekt? Verblüffend einfach. Die schematischen Abbildungen stammen aus der Originalarbeit Flettners. Im oberen Teil wird ein stehender Zylinder vom Wind umströmt, er bläst in Pfeilrichtung von links nach rechts. Oberhalb und unterhalb des Zylinders erscheinen die Stromlinien etwas zusammengedrängt, vor und hinter dem Zylinder etwas voneinander entfernt; das heißt, der Luftstrom beginnt sich schon eine kleine Strecke vor dem Zylinder zu teilen. Die Luft ist eben ein zusammenhängendes Gebilde und rast nicht als wildes Gemisch einzelner Teile blindlings auf das Hindernis zu, um dort von ihm abzuprallen. Diese Auffassung von der Luft hatte Newton vertreten; sie gilt nur in sehr verdünnten Gasen und bei sehr hohen Geschwindigkeiten der Luftmoleküle. Normale Luft folgt den Gesetzen der Fluiddynamik. Bei nicht zu hohen Geschwindigkeiten strömt Luft wie durch eine Unzahl paralleler Kanäle, die so genannten »Stromröhren«, die sich gegenseitig fast nicht beeinflussen. Jedenfalls kommen vernünftige Werte heraus, wenn man so tut, als gäbe es in der Strömung solche Röhren tatsächlich, wenn man also dieses Modell für die Berechnung verwendet. Ihre Wände sind unsichtbar, eben nur »gedacht«, in der Mitte jeder Röhre kann man sich gleich eine Stromlinie dazudenken. Dass die Vorstellung nicht falsch ist, kann man beweisen, wenn man aus kleinen Öffnungen Rauch in den Wind entlässt, er bildet dann einzelne Fäden, eben die Stromlinien. Wo Stromlinien sich zusammendrängen, herrscht Unterdruck, wo sie sich voneinander entfernen, Überdruck. Warum? Was geschieht, wenn Luft (oder Wasser) auf ein Hindernis zuströmt? Die tägliche Erfahrung von der Autobahn weist unglücklicherweise in die falsche Richtung. Die Autos »strömen« wie die Luftteilchen auf ein Hindernis zu, das Ergebnis ist bekannt und immer dasselbe: Stau. Luftteilchen verhalten sich anders. Nach dem Gesetz der Energieerhaltung müssen nach dem Hindernis pro Sekunde genauso viele Luftteilchen durch den Querschnitt strömen wie davor. Das heißt aber, dass sie sich beim Hindernis selbst schneller bewegen müssen, links und rechts »außen rum« ist der Weg ein wenig länger als mitten durch. Wer sich schneller bewegt, hat höhere Bewegungsenergie. Die muss irgendwoher kommen. Die Luft entnimmt sie ihrem eigenen Druck, der Druck am Hindernis fällt etwas ab. Auf der oberen Zeichnung tritt auf beiden Seiten des Zylinders ein leichter Unterdruck auf, davor und dahinter ein leichter Überdruck (auch hier ein gewisser »Staueffekt«). Diese Drücke wirken aber völlig symmetrisch.
Betrachten wir die mittlere Abbildung. Es weht kein Wind, dafür rotiert der Zylinder im Uhrzeigersinn. Die Luft rundherum wird das nicht unbeeinflusst lassen. Auf Grund der inneren Reibung rotiert sie auch, wie die in sich geschlossenen Pfeile andeuten; der Zylinder nimmt sie mit. Die Geschwindigkeit dieser Umlaufströmung wird nach außen zu natürlich immer kleiner. Messbar ist diese Geschwindigkeit aber noch bis zum zehnfachen Zylinderdurchmesser.
Der Magnuseffekt entsteht, wenn wir einfach die obere und die mittlere Abbildung übereinander legen, also Wind und Zylinderdrehung kombinieren. Das Ergebnis sehen wir unten: Über dem Zylinder gehen Wind und Rotation in dieselbe Richtung, der rotierende Zylinder beschleunigt die Luft zusätzlich, unter dem Zylinder sind Windrichtung und Drehrichtung einander entgegengesetzt; hier bremst der Zylinder den Wind ab. Als Folge sind auf der einen Seite die Stromlinien noch mehr zusammengedrängt, es entsteht massiver Unterdruck, auf der anderen Seite streben die Stromlinien auseinander, dort haben wir Überdruck. Als Resultat zieht der Zylinder als Ganzes auf die Seite mit der hohen lokalen Windgeschwindigkeit. Nun stellen wir uns vor, der Zylinder sei nicht fest am Boden montiert, sondern auf einem Schiff, der rotierende Zylinder wirkt wie ein Segel und treibt das Schiff quer zur Windrichtung. Wenn ich die Drehrichtung umkehre, wirkt die Querkraft natürlich in die entgegengesetzte Richtung. Und wie stark ist die Querkraft? Das hängt davon ab, wie schnell sich der Zylinder dreht. Wenn die Zylinderwand dieselbe Geschwindigkeit hat wie der Wind, ist die erzeugte Kraft schon stärker als bei einem Segel gleicher Querschnittsfläche. Dreht sich der Rotor schnell, steigt die Kraft auf Werte, die sich mit einem Segel nur mit einer sehr viel größeren Segelfläche erreichen lassen. Wenn sich die Rotorwand zum Beispiel dreieinhalbmal schneller bewegt als der Wind, erreicht man dieselbe Querkraft wie bei einem zehnmal so großen Segel. Erhellender ist vielleicht der Vergleich mit einer Flugzeugtragfläche: die Querkraft dort heißt »Auftrieb« und entsteht durch den Unterdruck auf der Oberseite und den Überdruck auf der Unterseite des Flugzeugflügels. Beim Flettnerrotor ist diese Kraft siebenmal so stark wie bei einer guten Tragfläche.
Bevor das Rotorschiff gebaut wurde, gab es umfangreiche Modellversuche an der Aerodynamischen Versuchsanstalt in Göttingen. Flettner war dort kein Unbekannter. Er hatte immerhin schon das »Flettner-Ruder« erfunden, eine Hilfsvorrichtung zur leichteren Handhabung von Schiffsruderblättern. Die Göttinger Herren standen der Rotoridee zunächst sehr reserviert gegenüber. Sie wussten natürlich vom Magnuseffekt, die Versuchsanstalt war in Europa führend auf dem Gebiet der Fluiddynamik. Die Vorteile des »Walzensegels« vermochten sie nicht recht zu sehen, wohl aber die technischen Probleme bei der Durchführung. Doch Flettner ließ sich nicht beirren. Die Modellexperimente im Windkanal bestätigten, dass der Rotor einem Segel in allen Beziehungen überlegen war.
Ein Schiff mit Flettner-Rotoren ist viel leichter zu manövrieren als ein Segelschiff. Es kann auch härter am Wind segeln, das heißt, in kleinerem Winkel »in den Wind hineinfahren«.
Einen Einwand hörte Flettner von jedem, der sein Schiff zu Gesicht bekam: Was ist bei Sturm? Würde das Schiff wegen der hohen Rotoren nicht leicht kentern? Dazu muss man sich klarmachen, dass auch bei einem Segel bei fast allen Stellungen zum Wind eine Auftriebskraft wirkt. Diese Kraft in Verbindung mit Windrichtung und Steuerruder ermöglicht erst ein Segeln »gegen den Wind«. Die Auftriebskraft wirkt immer senkrecht zur Segelfläche, auf der gebauchten Seite nach außen. Man kann sich diese Kraft in zwei Komponenten zerlegt denken: eine in Fahrtrichtung des Schiffes, das ist der »Schub«, der das Schiff vorantreibt, die andere wiederum senkrecht dazu, die »Drift«. Der Drift muss durch entsprechende Stellung des Steuerruders entgegengewirkt werden, sie führt auch dazu, dass sich das Schiff zur Seite neigt, es »krängt«. Das Krängen ist umso stärker, je mehr der Wind von der Seite kommt. Bei einer hohen Takelage kann das gefährlich werden. Für den Flettner-Rotor gelten dieselben Gesetze, das Krängen ist aber unproblematisch: Der Schwerpunkt liegt viel tiefer (das Schiff kann also weniger leicht umkippen), und bei heftigen Böen kann man den Rotor in Sekundenschnelle »abtakeln«, indem man die Drehzahl herunterfährt. Tatsächlich könnte man bei einem modernen Rotorschiff durch elektronische Drehzahlregelung genau jene Minimalfahrt erzeugen, die das Schiff noch sicher steuern lässt. Bei zwei Rotoren ist das Rotorschiff schon fast so wendig wie ein Motorschiff mit Schiffsschraube. Es kann am Ort drehen, seitwärts und sogar rückwärts fahren. Das wäre, schreibt Felix von König, auch einem Segler möglich, die dazu nötigen Segelmanöver sind aber derart aufwendig, dass sie sich von selbst verbieten. Und der Antrieb der Rotoren? Erfordert das nicht viel Energie? Flettner gibt elf Kilowatt für die Elektromotoren an, die seine Zylinder rotieren lassen. Für ein Schiff ein lächerlicher Wert. Eine kleine Hilfsmaschine, nicht vergleichbar mit Schraubenschiffen, wo die Antriebsleistung in Tausenden von Kilowatt gemessen wird.
Die Vorteile der Rotoren stellten sich schon bei den ersten Fahrten der »Buckau« auf der Ostsee heraus. Sie machten Flettner weltberühmt. Er erhielt Zuschriften und Verbesserungsvorschläge in Massen. Was den Magnuseffekt betraf, schien ein Damm gebrochen: es kam zu zahlreichen Versuchen, Patente zum Magnuseffekt anzumelden, weil die Erfinder irrtümlich annahmen, Flettner habe seinen Rotor nur für den Schiffsbetrieb patentieren lassen.
»Ich bekam durch die vielen Zuschriften einen Einblick in Dinge, die mir früher unbekannt waren«, schreibt er mit einem gewissen Behagen. »Ich sah und sehe heute noch, wie in allen Schichten des Volkes, trotz der schwierigen Zeitverhältnisse, eine unglaubliche Begeisterung und Empfänglichkeit für neue Ideen vorliegt. Unter den Absendern der an mich gerichteten Briefe sind alle Berufe und jedes Lebensalter vertreten – vom Schüler, der mir mit schüchternen Worten einen Vorschlag schickt, bis zum Greis, der mit zitternder Hand mir seine Ideen entwickelt, vom ungelernten Arbeiter bis zum Universitätsprofessor; sogar aus dem Gefängnis haben sich viele Unglückliche an mich mit Anregungen und Ideen gewandt.« Also schon die ganze »Volksgemeinschaft«. Es ist schwer vorstellbar, dass eine Erfindung wie die Flettnersche heute noch solche Reaktionen auslösen würde. Sie wäre eher Anlass für Medienwitze, Kandidat für die Skurrilitätenseite der Zeitungen. Die Begeisterung für Flettner und seine Erfindung hat wohl mit dem Trauma des verlorenen Weltkriegs zu tun. Flettner hatte 1915 den »Landtorpedo« erfunden, eine Art ferngelenkten Panzer, mit dem die Drahtverhaue an der Westfront durch eine Autogenschweißanlage zerstört werden konnten. Das Ding hat im Versuch auch funktioniert; die maßgeblichen militärischen Stellen haben den Tank abgelehnt, wie Flettner in seinem Rotorbuch berichtet. Der Weltkrieg ist also durch die Blasiertheit der Militärs verloren worden, deutsche Erfindergenialität hätte ihn zweifellos gewonnen – dies ist der Eindruck, den der zeitgenössische Leser gewinnen sollte. Das Kapitel mit dem Tank ist gleich das erste in seinem Buch »Mein Weg zum Rotor«. Überschrift: »Meine erste Erfindung: Die drahtlose Fernsteuerung«. Mit dem Rotor hat sie überhaupt nichts zu tun. Erfindungen zu machen, das drängt sich bei der Lektüre auf, scheint eine ganz einfache, natürliche Sache zu sein – wie Atmen. Der Titanenkampf beginnt immer erst danach, ein Kampf gegen die unverständige Umwelt. Flettner spricht von einer »jahrelangen, nervenzerstörenden Arbeit … eine praktisch für unausführbar gehaltene Idee der Fachwelt beinahe aufzuzwingen« und führt, als wäre das eigene Schicksal nicht Beispiel genug, ein langes Zitat Rudolf Diesels an, in dem dieser wortreich den »Kampf gegen Dummheit und Neid, Trägheit und Bosheit« beklagt, »die entsetzliche Zeit des Kampfes mit Menschen, ein Martyrium, auch wenn man Erfolg hat.« Ein merkwürdig saturnischer Ton schleicht sich dann ein, etwas typisch Deutsches, etwas Düsteres. Flettner spricht so ja nicht nach einem missglückten Leben und im Rückblick auf die Trümmer enttäuschter Hoffnungen, sondern auf dem Höhepunkt des Erfolges. Er bedient damit auch eine Erwartungshaltung der Leser. Erfinden ist etwas Ernstes, wenn es etwas Leichtes, Lockeres ist, gehört es auf den Jahrmarkt. Das Erfinderschicksal hat schwer, fast tragisch zu sein, ins Antlitz des Erfinders haben sich Schicksalsfalten einzugraben, Zeugen übermenschlicher Anstrengung; alles, was leicht geht, kann von vornherein nichts wert sein. Der deutsche Erfinder nimmt es auch auf sich, durch »übermenschliche Anstrengung« die Schmach des verlorenen Krieges zu tilgen und die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Gegenwart zu bezwingen. Das erwartet die Leserschaft: vom »schüchternen Schüler« bis »zum zitternden Greis«. Alles Neue, in die Zukunft gerichtete fasziniert.
Anfang 1925 machte die »Buckau« ihre erste kommerzielle Reise von Danzig nach Grangemouth in Schottland. Die Ladung bestand aus Holz. Der Februar auf der Nordsee ist kein angenehmer Monat. Es herrschte Sturm. Schiffe ähnlicher Größe mussten schützende Häfen aufsuchen, die »Buckau« lief ihren Kurs wie eine Eins. Sie schlingerte viel weniger als die Schiffe, denen sie begegnete. Auch die Rückfahrt nach Cuxhaven war ein voller Erfolg. Wieder Sturm und hoher Seegang, Frachtgut war Kohle, Brecher zerschlugen ein auf Deck festgezurrtes Rettungsboot, die Rotoren blieben unversehrt. Auf »Baden-Baden« umgetauft, fuhr das Rotorschiff nach Amerika und wieder zurück, insgesamt 6200 Seemeilen zur vollen Zufriedenheit ihres Konstrukteurs. Dieses erste Rotorschiff sollte nur die grundsätzliche Brauchbarkeit des Antriebs beweisen. Dass die Sache auch wirtschaftlich zu betreiben war, bewies die »Barbara«, ein im staatlichen Auftrag neu erbauter Frachter mit 3000 Tonnen Nutzlast. Dieses Schiff war schon 93Meter lang, 13Meter breit und acht Meter hoch. Zunächst plante Flettner einen einzelnen Rotor mit 27Meter Höhe. Es stellte sich aber heraus, dass keine Fabrik ein entsprechend großes Kugellager für die Monsterwalze liefern konnte, also wurde auf drei kleinere Rotoren umkonstruiert, jeder immerhin vier Meter dick und siebzehn Meter hoch, aus ein Millimeter starkem Alublech, die Elektromotoren für alle drei leisteten nur 105 PS. Bei Windstille fuhr das Schiff mit Schraube, angetrieben von zwei Dieselmotoren mit zusammen 1060 PS. Die »Barbara« lief im April 1926 vom Stapel und wurde im Linienverkehr als Frachter für Südfrüchte im Mittelmeer eingesetzt. Sie lief bei Windstärke 5 mit Schraube und Rotoren 13,5Knoten, etwa 25km/h. Ohne die Rotoren kam sie auf 10Knoten. Ohne die Schiffsschraube, nur mit Rotoren und Wind, war sie fast gleich schnell: 9,5Knoten.
Dann kam die Wirtschaftskrise, die »Barbara« hatte keine Fracht mehr. In den dreißiger Jahren wurde sie verkauft, man entfernte die Rotoren und ließ das Schiff als normalen Motorfrachter laufen. Damit war das Schicksal des Flettnerrotors besiegelt. In den zwanziger Jahren stieg die Leistung der Dieselmotoren so stark an, dass kein wie immer gearteter Windantrieb mithalten konnte, nicht einmal dort, wo es auf die Geschwindigkeit nicht ankam. Das Öl war zu billig – der große Vorteil des Rotorschiffs, der geringe Energieverbrauch für den Antrieb der Rotoren, fiel nicht mehr ins Gewicht.
Es gibt für Erfindungen ein noch schlimmeres Schicksal als nur »vergessen« zu werden. Den Beweis liefert die »Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung« vom 12.Mai 2002. Dort erscheint nämlich die »Barbara« – in einem zweiseitigen Artikel über Sammelbildchen des vergangenen Jahrhunderts in höchst naturalistischer, offenbar von einer Photographie inspirierter Abbildung. Das Problem ist die Bildunterschrift: »›Das Segelrotorschiff‹ ist reinste Phantasie. Vertikal drehbare Säulen sollten die Kraft des Windes zum Antrieb der Schiffsschraube nutzbar machen.« Für ein Schiff, das immerhin einige Jahre auf dem Mittelmeer herumgefahren ist, bedeutet »reinste Phantasie« wohl den höchsten Grad an Irrealität, den man sich vorstellen kann. Die Erklärung des Antriebs ist sowieso Unsinn: Da versetzt der Wind die Zylinder in Drehung, die sich auf die Schraube überträgt. Hübsche Idee, aber warum sollte der Wind das tun, einen glatten Zylinder drehen? Die böse Fee an Flettners Wiege hat nicht etwa gesagt: »Deine Erfindung soll vergessen werden!«, sondern sie hat gesagt: »Deine Erfindung soll noch in hundert Jahren in der Zeitung stehen!«
Der Flettner-Rotor ist das typische Beispiel einer »verspäteten« Erfindung. Der Magnuseffekt wurde um die Mitte des 19.Jahrhunderts entdeckt. Und dann wurden siebzig Jahre mit Laborspielereien vertrödelt. Warum? Die Erfindung des Rotors als Schiffsantrieb erfordert keine überragenden visionären Fähigkeiten, es erfordert auch keine tiefen physikalischen Kenntnisse, das Prinzip zu verstehen. Und schon gar nicht den bis zum Erbrechen zitierten Kuhnschen »Paradigmenwechsel«. Der Flettner-Rotor hätte eigentlich schon viel früher erfunden werden müssen. Wenn es um Erfindungen geht, dominiert in den Köpfen aber die Vorstellung einer gesetzmäßigen Entwicklung: »sie liegen in der Luft«, die Erfindungen, heißt es dann, darum wird ja auch oft von mehreren Erfindern fast zur selben Zeit das Gleiche erfunden. Eben, weil »die Zeit reif« dafür ist. Das merkwürdige Bild einer »reifenden Zeit« entstammt einer grundsätzlich materialistischen Geschichtsauffassung; der Flettner-Rotor ist ein gutes Gegenbeispiel für diese Art von Determinismus. Eine Erfindung, so die These, hat immer geistige, technische und ökonomische Voraussetzungen, sie muss zur jeweiligen Zeit vorstellbar, herstellbar und brauchbar sein. Sie wird gemacht, wenn diese Voraussetzungen alle gegeben sind. Heron von Alexandria soll schon im 1.Jahrhundert n.Chr. ägyptische Tempeltore mit Dampfkraft geöffnet haben, eine Spielerei, ein Gag, etwa wie ein heutiger Varietétrick – zu einem Dampfzeitalter ist es in der Antike nicht gekommen. Es fehlten die technischen Möglichkeiten (Kolbendichtung, gedrehte Metallteile, fossile Brennstoffe) für eine richtige Dampfmaschine. Und es fehlte der Bedarf. Wofür hätte man sie brauchen können? Berühmt geworden ist der Ausspruch eines römischen Kaisers, der den Erfinder einer Wassermühle fragt, wer in Zukunft seine Sklaven ernähren soll (die in knochenbrechender Schwerarbeit die Mühlen mit ihren Körpern antrieben).
Man darf hier nicht das Notwendige mit dem Hinreichenden verwechseln. Denn die nötigen Voraussetzungen für den Flettner-Rotor waren schon vor der Geburt Flettners alle gegeben. Irgendein Ingenieur Müller oder Meier hätte den Rotor schon um 1870 erfinden können. Auch der Bedarf war da: Noch bis in die zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts fuhren fünfmastige Segelriesen mit modernen Metallrümpfen als Massengutfrachter um Kap Hoorn – eine einfach zu bedienende, sichere »Segelmaschine« hätte die Seefahrt nötig gehabt wie einen Bissen Brot. Zum Antrieb der Walzen hätte es auch keinen Elektromotor gebraucht, eine kleine, schnell laufende Dampfmaschine hätte genügt. – Aber es hat niemand das Walzensegel erfunden, kein Ing. Meier oder Müller. Erst Anton Flettner 1924. Die notwendigen Voraussetzungen waren wohl gegeben, nur waren die nicht hinreichend. Welche sind dann hinreichend? Das weiß niemand. Wer es behauptet, weiß nicht, was er redet. Es ist ein Rätsel.
Es liegt nahe, den blanken Zufall als Wirkmacht anzunehmen. Was passieren kann, muss nicht. Es gibt keinen Determinismus. Manches, was »in der Luft liegt«, wird tatsächlich erfunden. Aber nicht alles. Diese Ansicht der Sache hat auch eine freundliche, utopische, offene Seite: Erfindungen, die »eigentlich« hätten gemacht werden sollen, aber nicht gemacht wurden, sind eben noch nicht gemacht – können noch gemacht werden, liegen noch im Reich des Möglichen. Nicht alles, heißt das, was vor hundert Jahren durchdacht wurde, ist deshalb ausgedacht. Vielleicht wurde es ja nur angedacht. Dann bliebe uns noch auf Feldern zu ernten, von denen wir glaubten, der letzte Halm sei dort schon aufgelesen.
Es hat nicht an Überlegungen gefehlt, Flettners Erfindung für andere Zwecke dienstbar zu machen. Da der Rotor ein aerodynamisches Profil ersetzt, lag es nahe, ihn an einem Windrad anzubringen. Flettner selbst plante ein Windrad mit hundert Metern Durchmesser auf einem zweihundert Meter hohen Turm. Statt Windradflügeln sollten vier Rotoren montiert sein, die Leistung sollte nicht direkt von der großen Hauptachse des Windrades abgenommen werden, sondern von vier kleinen Windrädern, die an den äußeren Spitzen der Rotorflügel angebracht sind – wenn das Rad sich erst dreht, herrscht dort eine viel höhere Windgeschwindigkeit als in der Ebene des großen Rades. Die vier kleinen Windräder laufen praktisch in einem »Gegenwind«, den die Drehung des Hauptrades erzeugt. Da die Leistung eines Windrades mit der dritten Potenz der Windgeschwindigkeit zunimmt, erhält man schon bei doppelter Geschwindigkeit des Windes achtfache Leistung. Die Hilfswindräder könnten also viel kleiner sein und würden sich viel schneller drehen. Dadurch wäre das Übersetzungsgetriebe auf den Stromgenerator leichter zu bauen.
Die Zeitgenossen entwickelten bald neue Einsatzgebiete für Flettners Erfindung. [5]
Ein Versuchsrad mit zwanzig Meter Durchmesser wurde gebaut, allerdings ohne Hilfswindräder an den Flügelspitzen. Von einer solchen Version hat man danach nie wieder etwas gehört. Moderne Rechnungen zeigen, dass Flettners Idee mit den Hilfswindrädern wohl bei einem normalen Windrad mit zwei oder drei Flügeln funktionieren würde, bei einem Rotorwindrad aber nicht. Es dreht sich viel zu langsam für den Antrieb eines Generators. Das Flettner-Windrad wäre allerdings als so genannter »Langsamläufer« für den Betrieb von Mühlen und Wasserpumpen geeignet. Es liefe schon bei schwächsten Winden an. Viel besser als die »amerikanische Windturbine«, das aus Blechstreifen aufgebaute, langsam drehende Windrad im Hintergrund vieler Westernszenen.