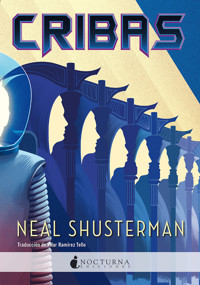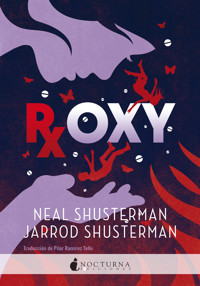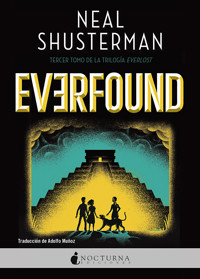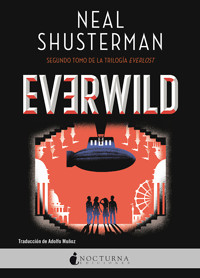Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Caden hält sich für einen normalen Jungen. Doch sein Verstand ist ein krankhafter Lügner, der sich auf fantastische Reisen begibt. Manchmal befindet Caden sich auf dem Weg zum tiefsten Punkt der Erde im Marianengraben, auf einem Schiff, auf dem die Zeit seitlich läuft wie eine Krabbe, verwittert von Millionen Fahrten, die bis in die finstere Vergangenheit zurückreichen. Und in der Realität lässt Cadens Verstand harmlose Dinge wie einen Gartenschlauch zur tödlichen Gefahr werden. Als die Grenze zwischen realer und fantastischer Welt verschwimmt, begreift Caden: In den Tagen der Bibel hätte er vermutlich als Prophet gegolten, doch heute lautet die Diagnose: Schizophrenie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 391
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Caden hält sich für einen normalen Jungen. Doch sein Verstand ist ein krankhafter Lügner, der sich auf fantastische Reisen begibt. Manchmal befindet Caden sich auf dem Weg zum tiefsten Punkt der Erde im Marianengraben, auf einem Schiff, auf dem die Zeit seitlich läuft wie eine Krabbe, verwittert von Millionen Fahrten, die bis in die finstere Vergangenheit zurückreichen. Und in der Realität lässt Cadens Verstand harmlose Dinge wie einen Gartenschlauch zur tödlichen Gefahr werden. Als die Grenze zwischen realer und fantastischer Welt verschwimmt, begreift Caden: In den Tagen der Bibel hätte er vermutlich als Prophet gegolten, doch heute lautet die Diagnose: Schizophrenie.
Neal Shusterman
Kompass ohne Norden
Roman
Mit Illustrationen von Brendan Shusterman
Aus dem Englischen von Ingo Herzke
Carl Hanser Verlag
Für Dr. Robert Woods
Bemerkung des Autors
Kompass ohne Norden ist keinesfalls fiktiv. Die Orte, an die Caden sich begibt, sind alle nur zu real. Jede dritte Familie ist in den USA von psychischen Erkrankungen betroffen. Das weiß ich, weil unsere Familie eine davon ist. Wir haben in vieler Hinsicht das Gleiche durchlebt wie Caden und seine Familie. Ich musste ohnmächtig zusehen, wie ein Mensch, den ich liebe, in die Tiefe sank.
Mithilfe meines Sohnes Brendan habe ich festzuhalten versucht, wie dieser Abstieg aussieht. Die Eindrücke aus der Klinik, die Gefühle von Angst, Paranoia, Manie und Depression sind echt, ebenso wie das »Götterspeise-Gefühl« und die Taubheit, die durch die Medikamente hervorgerufen werden können (wie ich selbst aus erster Hand erfahren konnte, als ich versehentlich zwei Seroquel nahm, die ich für Dolopyrin gehalten hatte). Doch auch die Genesung ist echt. Psychische Erkrankungen gehen nie ganz weg, aber sie können in gewisser Weise zum Abklingen gebracht werden. Wie Dr. Poirot in Kompass ohne Norden sagt, ist die Psychiatrie keine exakte Wissenschaft, aber sie ist das Einzige, was wir haben – und es wird jeden Tag besser, je mehr wir über das Gehirn, über Geist und Seele lernen und je bessere, zielgerichtete Medikamente wir entwickeln.
Vor zwanzig Jahren hat sich mein engster Freund, der an Schizophrenie litt, das Leben genommen. Mein Sohn hingegen hat sein Stück Himmel gefunden und ist strahlend aus der Tiefe entronnen, ist mit der Zeit eher wie Carlyle als wie Caden geworden. Die Skizzen und Zeichnungen in diesem Buch stammen alle von ihm und sind während der Tiefen entstanden. Für mich gibt es auf der ganzen Welt keine größere Kunst. Noch dazu sind einige von Hals Betrachtungen über das Leben Brendans Gedichten entnommen.
Unsere Hoffnung ist es, dass Kompass ohne Norden all jene trösten kann, die in den Tiefen gewesen sind, indem es sie wissen lässt, dass sie nicht allein sind. Wir hoffen außerdem, dass es auch anderen helfen kann, Mitgefühl zu entwickeln und zu verstehen, wie es tatsächlich ist, die finsteren, unberechenbaren Gewässer der psychischen Krankheit zu befahren.
Wenn der Abgrund in dich hineinschaut – und das wird er –, mögest du den Blick unerschrocken erwidern.
Neal Shusterman
1 Fee, Fie, Foe, Fum
Zwei Dinge weißt du. Erstens: Du warst da. Zweitens: Du kannst nicht da gewesen sein.
Diese beiden unvereinbaren Wahrheiten gleichzeitig festzuhalten, erfordert Jongliergeschick. Natürlich braucht man beim Jonglieren einen dritten Ball, damit der Rhythmus im Fluss bleibt. Dieser dritte Ball ist die Zeit – die viel unbändiger herumspringt, als wir glauben mögen.
Die Zeit jetzt: fünf Uhr morgens. Das weißt du, weil an deiner Schlafzimmerwand eine batteriebetriebene Uhr hängt, die so laut tickt, dass du sie manchmal mit einem Kissen dämpfen musst. Doch während es hier fünf Uhr morgens ist, ist es irgendwo in China fünf Uhr abends – was beweist, dass unvereinbare Wahrheiten durchaus Sinn ergeben können, wenn man sie global betrachtet. Du hast jedoch gelernt, dass es nicht immer gut ist, deine Gedanken nach China wandern zu lassen.
Deine Schwester schläft nebenan, und ein Zimmer weiter deine Eltern. Dein Vater schnarcht. Bald wird deine Mutter ihn so lange anstupsen, bis er sich umdreht und das Schnarchen aufhört, vielleicht bis zum Morgengrauen. Das alles ist normal und deshalb sehr tröstlich.
Auf der anderen Straßenseite gehen die Rasensprenger eines Nachbarn an und zischen so laut, dass sie das Ticken der Uhr übertönen. Du kannst den Dunst des Wassers durch das offene Fenster riechen – leicht gechlort, heftig fluoridiert. Ist es gut zu wissen, dass die Rasenflächen in der Nachbarschaft gesunde Zähne haben werden?
Das Geräusch des Rasensprengers ist nicht das Zischen von Schlangen.
Und die bei deiner Schwester an die Wände gemalten Delfine können keine mörderischen Pläne schmieden.
Und die Augen einer Vogelscheuche sehen nichts.
Dennoch gibt es Nächte, in denen du nicht schlafen kannst, weil die Dinge, die du jonglierst, deine volle Konzentration erfordern. Du hast Angst, dass dir ein Ball herunterfallen könnte, und was dann? Weiter als bis zu diesem Augenblick wagt sich deine Fantasie nicht. Denn just in diesem Augenblick wartet der Kapitän. Er ist geduldig. Und er wartet. Immer.
Noch bevor es ein Schiff gab, war der Kapitän schon da.
Diese Reise hat mit ihm begonnen, du vermutest, sie wird auch mit ihm enden, und alles dazwischen ist das pulvrige Mehl von Windmühlen, die auch Riesen sein könnten, die Knochen zermahlen und Brot daraus machen.
Tritt leise auf, sonst weckst du sie.
2 Endlos da unten
»Lässt sich nicht sagen, wie weit es abwärts geht«, sagt der Kapitän, und die linke Seite seines Schnurrbarts zuckt wie der Schwanz einer Ratte. »Fällst du in diesen unerforschlichen Abgrund, so wirst du Tage zählen, ehe du den Grund erreichst.«
»Aber der Graben ist doch schon vermessen worden«, wage ich einzuwenden. »Da unten waren schon Menschen. Ich weiß zufällig, dass er elf Kilometer tief ist.«
»Du weißt?«, spottet er. »Wie kann ein bibberndes, unterernährtes Küken wie du mehr wissen, als dass ihm die Nase läuft?« Dann lacht er über seine eigene Einschätzung meiner Person. Das Gesicht des Kapitäns ist voller verwitterter Falten von einem Leben auf See – auch wenn sein dunkler, verfilzter Vollbart viele davon verdeckt. Wenn er lacht, spannen sich die Falten glatt, und man sieht die Muskeln und Sehnen seines Halses. »Ja, ja, es ist wohl wahr: Die sich in die Wasser des Grabens gewagt haben, berichten davon, den Grund gesehen zu haben, doch sie lügen. Sie lügen wie gedruckt, und sie liegen wie gedrückt – doch geholfen hat ihnen beides wenig.«
Ich versuche nicht mehr zu entschlüsseln, was der Kapitän so von sich gibt, doch seine Worte lasten schwer auf mir. Als ob ich womöglich etwas verpasst hätte. Etwas Wichtiges und trügerisch Offensichtliches, das ich erst verstehen werde, wenn es zu spät ist und keine Rolle mehr spielt.
»Es ist endlos da unten«, sagt der Kapitän. »Und lass dir von niemandem was anderes einreden.«
3 Besser gehen
Ich habe so einen Traum. Ich liege auf einem Tisch in einer zu hell erleuchteten Küche, wo alle Geräte strahlend weiß glänzen. Sie sind nicht unbedingt brandneu, sie tun eher so. Plastik mit Chromverzierungen, aber hauptsächlich Plastik.
Ich kann mich nicht bewegen. Oder ich will nicht. Oder ich habe Angst davor. Jedes Mal, wenn ich diesen Traum habe, ist es ein bisschen anders. Um mich herum stehen Leute, bloß sind es keine Leute, sondern getarnte Monster. Sie sind in meinen Geist eingedrungen und haben Bilder herausgerissen, und aus diesen Bildern haben sie Masken gemacht, die wie Menschen aussehen, die ich liebe – aber ich weiß, es ist bloß Täuschung.
Sie lachen und reden über Sachen, die ich nicht verstehe, und ich liege erstarrt unter all diesen falschen Gesichtern, im Zentrum ihrer Aufmerksamkeit. Sie betrachten mich bewundernd, aber eher so, wie man etwas betrachtet, was bald nicht mehr da sein wird.
»Ich glaube, du hast es zu früh rausgenommen«, sagt das Monster mit dem Gesicht meiner Mutter. »Es war nicht lange genug drin.«
»Gibt nur eine Möglichkeit, das rauszufinden«, sagt das Monster, das wie mein Vater aussieht.
Ich spüre Lachen in der Runde – nicht aus ihren Mündern, denn die Münder ihrer Masken bewegen sich nicht. Das Lachen ist in ihren Gedanken, und die richten sie auf mich wie vergiftete Pfeilspitzen, die aus ihren ausgeschnittenen Augenschlitzen schießen.
»Es wird dir davon besser gehen«, sagt eins der Monster. Dann knurren ihre Mägen so laut wie ein Bergrutsch, als sie nach mir greifen und ihre Hauptspeise mit den Klauen in Stücke reißen.
4 So kriegen sie dich
Ich kann mich nicht erinnern, wann diese Fahrt anfing. Es ist fast so, als wäre ich immer hier gewesen, aber das kann nicht sein, denn es gab ein Vorher, erst letzte Woche oder letzten Monat oder letztes Jahr. Ich bin allerdings ziemlich sicher, dass ich immer noch fünfzehn bin. Die Zeit läuft hier anders. Nicht vorwärts; eher so seitlich, wie eine Krabbe.
Ich kenne nicht viele von der Mannschaft. Oder vielleicht vergesse ich sie bloß von einem Augenblick zum nächsten wieder, weil sie alle so etwas Namenloses an sich haben. Da sind die Älteren, die anscheinend ihr Leben auf See verbracht haben. Das sind die Offiziere an Bord, wenn man sie so nennen kann. Sie sind Halloween-Piraten mit künstlich geschwärzten Zähnen, so wie der Kapitän, und sie spielen Süßes oder Saures an der Schwelle zur Hölle. Ich würde über sie lachen, wenn ich nicht von ganzem Herzen glaubte, dass sie mir dann mit ihren Plastikhaken die Augen ausstechen würden.
Dann gibt es noch die Jüngeren, so wie mich: Jugendliche, die ihrer Vergehen wegen aus dem warmen Nest verstoßen wurden, oder aus dem kalten Nest, oder aus gar keinem Nest, jedenfalls von einer elterlichen Verschwörung, deren Big-Brother-Augen sich niemals schließen und alles sehen.
Meine Schiffskameraden, Jungen wie Mädchen, sind mit ihren Aufgaben beschäftigt und reden nicht mit mir, außer gelegentlich Sätze wie »Du stehst mir im Weg« oder »Finger weg von meinen Sachen«. Als hätte irgendwer von uns Sachen, die zu verteidigen sich lohnte. Manchmal versuche ich ihnen bei ihren Pflichten zu helfen, aber sie wenden sich ab oder schubsen mich weg, verärgert, weil ich meine Hilfe überhaupt angeboten habe.
Ich bilde mir ständig ein, meine kleine Schwester an Bord zu sehen, obwohl ich weiß, dass sie nicht hier ist. Sollte ich ihr nicht bei ihren Rechenaufgaben helfen? Im Geist sehe ich sie auf mich warten und warten, aber ich weiß nicht, wo sie ist. Ich weiß nur, dass ich nie auftauche. Wie kann ich ihr das antun?
Alle an Bord werden ständig vom Kapitän überwacht, der irgendwie vertraut wirkt und dann auch wieder nicht. Er scheint alles über mich zu wissen, obwohl ich nichts über ihn weiß.
»Meine Sache ist es, die Finger fest um das Herz eurer Angelegenheit zu schließen«, hat er zu mir gesagt.
Der Kapitän hat eine Augenklappe und einen Papagei. Der Papagei hat eine Augenklappe und einen Sicherheitsausweis um den Hals hängen.
»Ich sollte gar nicht hier sein«, beschwöre ich den Kapitän und frage mich, ob ich ihm das schon mal gesagt habe. »Ich habe Halbjahresprüfungen und Referate zu schreiben und Klamotten, die ich vom Zimmerfußboden aufsammeln muss, und ich habe Freunde, jede Menge Freunde.«
Das Kinn des Kapitäns bleibt steinern, er lässt sich zu keiner Antwort herab, doch der Papagei sagt: »Hier wirst du auch Freunde, jede Menge Freunde haben!«
Dann flüstert mir einer der anderen Jugendlichen ins Ohr. »Erzähl dem Papagei nichts. So kriegen sie dich.«
5 Ich bin der Kompass
Was ich fühle, lässt sich nicht in Worte fassen, oder wenn doch, dann in einer Sprache, die niemand versteht. Meine Gefühle reden in Zungen. Freude wandelt sich in Wut wandelt sich in Angst wandelt sich in ironische Belustigung, so als würdest du mit ausgebreiteten Armen aus einem Flugzeug springen, zweifelsfrei überzeugt, dass du fliegen kannst, und dann plötzlich merken, dass du es doch nicht kannst und nicht nur keinen Fallschirm hast, sondern auch keine Klamotten an, und dass sich die Leute unten am Boden alle Ferngläser vor die Augen halten und lachen, während du deinem höchst peinlichen Ende entgegen stürzt.
Der Steuermann sagt, ich solle mir deswegen keine Sorgen machen. Er deutet auf den Pergamentblock, auf dem ich oft zeichne, um mir die Zeit zu vertreiben. »Halt deine Gefühle mit Strich und Farbe fest«, rät er mir. »Farben, Garben, Narben, darben – deine Zeichnungen machen mich hungrig, schreien mich an, zwingen mich zu sehen. Meine Karten zeigen uns die Route, aber deine Visionen weisen uns den Weg. Du bist der Kompass, Caden Bosch. Du bist der Kompass!«
»Wenn ich der Kompass bin, dann bin ich ziemlich nutzlos«, antworte ich. »Ich kann Norden nicht finden.«
»Natürlich kannst du das«, sagt er. »Bloß dass sich der Norden in diesen Gewässern ständig in den Schwanz beißt.«
Dabei fällt mir ein früherer Freund ein, der meinte, Norden sei immer die Richtung, in die er schaute. So langsam glaube ich, er könnte recht gehabt haben.
Der Steuermann hat darum gebeten, dass ich sein Kojennachbar werde, als sein alter Mitbewohner, an den ich mich kaum erinnern kann, ohne Erklärung verschwunden ist. Wir teilen uns eine Kajüte, die schon für einen zu klein ist, von zweien ganz zu schweigen. »Du bist der Anständigste unter den Unanständigen hier«, sagt er zu mir. »Dein Herz ist noch nicht von der See erkaltet. Außerdem hast du Talent. Talent, Patent, Temperament: Du hast so viel Talent, das ganze Schiff wird vor Neid grün werden – denk an meine Worte!«
Der Bursche ist schon oft zur See gefahren. Und er ist weitsichtig. Will sagen, wenn er dich anschaut, sieht er nicht dich, sondern irgendetwas hinter dir in einer ganz anderen Dimension. Aber meistens sieht er gar keine Menschen an. Er ist zu sehr mit seinen Navigationskarten beschäftigt. So nennt er sie jedenfalls. Sie sind voller Zahlen und Wörter und Pfeile und Linien, die Punkte zu Sternbildern verbinden, die ich noch nie gesehen habe.
»Der Himmel ist hier draußen anders«, sagt er. »Man muss neue Muster in den Sternen entdecken. Muster, Schuster, Schuhmacher, Uhrmacher. Es geht darum, das Vergehen des Tages zu messen. Verstehst du?«
»Nein.«
»Von Deck an Land, vom Land an Deck, meck-meck macht die Ziege. Das ist die Antwort, sag ich dir. Die Ziege. Sie frisst alles, sie verdaut die Welt, verleibt sie ihrer eigenen DNA ein und spuckt sie wieder aus, steckt ihr Revier ab. Revier, Brevier, Bravour, Futur – hör mir zu: Das Zeichen der Ziege zeigt die Antwort auf unsere Zukunft, unser Ziel. Alles hat seinen Zweck. Suche die Ziege.«
Der Steuermann ist genial. So genial, dass ich von seiner Gesellschaft Kopfschmerzen kriege.
»Warum bin ich hier?«, frage ich ihn. »Wenn alles seinen Zweck hat, was ist dann mein Zweck hier an Bord dieses Schiffes?«
Er wendet sich wieder seinen Karten zu, schreibt Wörter und zeichnet neue Pfeile über das, was schon da ist, schichtet seine Gedanken so dicht aufeinander, dass nur er sie noch entziffern kann. »Zweck, Heck, Deck, Bord, Pforte. Du bist die Pforte zur Errettung der Welt.«
»Ich? Bist du sicher?«
»So sicher, wie wir in diesem Zug sitzen.«
6 Alles durcheinander
Pforte, Tür, Türmer, Tümmler: Delfine tanzen an den Zimmerwänden meiner Schwester, als ich in ihren Türrahmen trete. Es sind sieben. Das weiß ich, weil ich sie gemalt habe – jeder Delfin steht für einen von Kurosawas Sieben Samurai, denn ich wollte, dass sie die Bilder immer noch leiden kann, wenn sie älter wird.
Heute Abend starren die Delfine mich böse an, und auch wenn sie mich mangels Daumen kaum zum Schwertkampf herausfordern können, finde ich sie viel bedrohlicher als sonst.
Mein Vater bringt Mackenzie gerade ins Bett. Für sie ist es spät, aber nicht für mich. Ich bin gerade fünfzehn geworden; sie wird bald elf. Es wird noch Stunden dauern, bis ich schlafe. Falls ich schlafe. Vielleicht auch nicht. Nicht heute Nacht.
Meine Mutter telefoniert unten mit Oma. Ich höre sie über das Wetter und über Termiten reden. Unser Haus wird zernagt. »… aber Ausräuchern bringt alles durcheinander«, höre ich meine Mutter sagen. »Es muss doch eine bessere Lösung geben.«
Dad gibt Mackenzie einen Gutenachtkuss, dreht sich um und sieht mich im Türrahmen stehen, nicht ganz im Zimmer und nicht ganz draußen. »Was gibt’s, Caden?«
»Nichts, es ist bloß … ach, egal.«
Er steht auf, meine Schwester dreht sich zu ihrer Delfinwand und macht deutlich, dass sie bereit für das Land der Träume ist. »Wenn etwas nicht in Ordnung ist, kannst du es mir sagen«, sagt mein Vater. »Das weißt du doch, oder?«
Ich rede leise, damit Mackenzie mich nicht hören kann. »Na ja, also … da ist so ein Junge in der Schule.«
»Ja?«
»Ich weiß es natürlich nicht sicher …«
»Ja?«
»Also …Ich glaube, er will mich umbringen.«
7 Der wohltätige Abgrund
Im Einkaufszentrum gibt es so einen Spendensammler. Ein großer gelber Trichter, in dem Geld für irgendein Kinderhilfswerk gesammelt wird, an das man nur ungern denkt. Amputierte Kinder ferner Kriege oder so ähnlich. Man soll eine Münze in einen Schlitz stecken und sie dann loslassen. Die rollt dann immer im Kreis um den großen gelben Trichter herum, ungefähr eine Minute lang, und schnarrt dabei in einem immer schneller und enger werdenden Rhythmus, immer intensiver und verzweifelter, je näher sie dem Loch kommt. Immer schneller kreist die Münze – so viel Bewegungsenergie, die in den Trichterhals gezwungen wird, bis sie wie eine Alarmsirene schrillt – und verstummt dann, wenn sie in den schwarzen Abgrund des Trichters stürzt.
Ich bin diese Münze auf dem Weg nach unten, ich schreie im Hals des Trichters, und nur meine eigene Bewegungsenergie und die Zentrifugalkraft bewahren mich vor dem Sturz ins Dunkel.
8 Realitätscheck
»Was soll das heißen, er will dich umbringen?« Mein Vater tritt hinaus in den Flur und schließt die Zimmertür meiner Schwester hinter sich. Schwaches Licht fällt in einem zaghaften Winkel aus dem Bad weiter hinten. »Caden, das ist eine ernste Sache. Wenn dich ein Junge in der Schule bedroht, musst du mir erzählen, was los ist.«
Er steht vor mir und wartet, und ich wünschte, ich hätte nicht davon angefangen. Mom redet unten immer noch mit Oma, und allmählich frage ich mich, ob Oma wirklich dran ist oder ob Mom nur so tut – vielleicht spricht sie auch mit jemand anderem, vielleicht über mich, vielleicht verschlüsselt. Aber wieso sollte sie? Das ist doch irre. Nein, sie spricht einfach nur mit Oma. Über Termiten.
»Hast du den Jungen bei deinen Lehrern gemeldet?«
»Nein.«
»Was hat er denn getan? Hat er dich offen bedroht?«
»Nein.«
Dad holt tief Luft. »Okay, wenn er dich nicht offen und direkt bedroht hat, dann ist es vielleicht nicht so schlimm, wie du denkst. Bringt der Junge irgendwelche Waffen mit zur Schule?«
»Nein. Na ja, vielleicht. Ja – ja, doch, ich glaube, er hat womöglich ein Messer.«
»Hast du es gesehen?«
»Nein, ich weiß es einfach. Er ist so der Typ, der ein Messer hat, weißt du?«
Dad holt wieder tief Luft und kratzt sich im dünner werdenden Haar. »Sag mir mal genau, was dieser Junge zu dir gesagt hat. Versuch dich an alles zu erinnern.«
Ich grabe tief nach Worten, mit denen ich es erklären kann, aber ich finde keine. »Es ist nicht, was er gesagt hat, sondern was er nicht gesagt hat.«
Mein Vater ist Buchhalter: sehr rational und linear, ganz linke Hirnhälfte, darum überrascht mich seine Reaktion nicht. »Ich kann dir nicht folgen.«
Ich drehe mich um und fummele an einem Familienfoto herum, bis es schief hängt. Das stört mich, also hänge ich es rasch wieder gerade hin. »Vergiss es«, sage ich. »Ist nicht so wichtig.« Ich versuche die Treppe hinunterzuflüchten, weil ich eigentlich Moms Gespräch mithören will, aber Dad fasst mich sanft am Arm. Das reicht, um mich am Gehen zu hindern.
»Moment noch«, sagt er. »Damit ich das richtig verstehe. Dieser Junge, der dich so beunruhigt – er hat irgendeinen Kurs mit dir, und du findest irgendwas an seinem Verhalten bedrohlich.«
»Ehrlich gesagt habe ich überhaupt kein Fach mit ihm zusammen.«
»Und woher kennst du ihn dann?«
»Ich kenne ihn gar nicht. Aber ich begegne ihm manchmal im Flur.«
Mein Vater senkt den Blick und zählt in Gedanken eins und eins zusammen. Dann sieht er mich wieder an. »Caden … wenn du ihn nicht kennst und er dich nie bedroht hat, und wenn er dir bloß ein paar Mal im Flur begegnet ist, wieso denkst du dann, dass er dir etwas tun will? Wahrscheinlich kennt er dich überhaupt nicht.«
»Ja, du hast recht, ich bin bloß gestresst.«
»Wahrscheinlich eine Überreaktion.«
»Genau, eine Überreaktion.« Jetzt, nachdem ich es laut ausgesprochen habe, merke ich, wie albern ich mich angehört habe. Ich meine, dieser Junge weiß überhaupt nicht, dass es mich gibt. Und ich weiß nicht mal, wie er heißt.
»Die Highschool bringt einen manchmal ein bisschen durcheinander«, sagt Dad. »Da gibt es vieles, was dir Angst machen kann. Tut mir leid, dass du das mit dir herumtragen musstest. So was im Kopf zu haben! Aber manchmal braucht man einfach einen Realitätscheck, richtig?«
»Richtig.«
»Und, geht es dir jetzt besser?«
»Ja, es geht mir besser. Danke.«
Aber er beobachtet mich weiter, während ich weggehe, als wüsste er womöglich, dass ich lüge. Meine Eltern haben bemerkt, wie angespannt ich in letzter Zeit bin. Mein Vater meint, ich sollte irgendeinen Sport anfangen, um meine nervöse Energie rauszulassen. Meine Mutter meint, ich sollte Yoga machen.
9 Du bist nicht der Erste, und du wirst nicht der Letzte sein
Das Meer dehnt sich in alle Richtungen. Vor uns, hinter uns, nach Steuerbord, nach Backbord, und nach unten, unten, unten. Unser Schiff ist eine Galeone, verwittert von einer Million Fahrten, die zurückreichen bis in viel finsterere Zeiten als die heutige.
»Sie ist das beste Schiff ihrer Art«, hat mir der Kapitän einmal verraten. »Wenn du ihr ganz vertraust, wird sie dich nicht in die Irre führen.«
Das ist auch gut so, denn es steht nie jemand am Ruder.
»Hat sie einen Namen?«, habe ich den Kapitän gefragt.
»Ihr einen Namen zu geben, heißt, sie zu versenken«, hat er geantwortet. »Was wir benennen, bekommt mehr Gewicht als das Wasser, das es verdrängt. Frag jeden Schiffbrüchigen.«
Am Lukenbogen über dem Hauptniedergang hängt ein Holzschild mit eingebrannten Buchstaben – Du bist nicht der Erste, und du wirst nicht der Letzte sein –, und ich staune, wie ich mich bei diesem Satz zugleich unbedeutend und herausgehoben fühle.
»Spricht es dich an?«, fragt der Papagei, der über dem Niedergang sitzt und mich beobachtet, mich ständig beobachtet.
»Eigentlich nicht«, sage ich.
»Sollte es dich ansprechen«, weist mich der Papagei an, »schreib alles auf, was es sagt.«
10 In der Küche des Schreckens
Fast jede Nacht besuche ich die Weiße Plastikküche. Die Einzelheiten verändern sich jedes Mal – gerade so viel, dass ich den Ausgang des Traumes nicht vorhersagen kann. Wäre alles immer genau gleich, wüsste ich zumindest, was ich erwarten kann – und wenn ich das wüsste, könnte ich mich gegen das Schlimmste wappnen.
Heute Nacht verstecke ich mich. Nur sehr wenige Verstecke in der Küche. Ich bin in einen hochmodernen Kühlschrank gequetscht. Ich bibbere und denke an den Kapitän. Dass er mich ein bibberndes Küken genannt hat.
Jemand öffnet die Tür: eine Maske, an die ich mich nicht erinnern kann. Sie schüttelt den Kopf.
»Armes Ding, dir muss doch kalt sein.« Sie schenkt sich Kaffee aus einer vollen Karaffe ein, doch anstatt mir welchen anzubieten, greift sie direkt durch meinen Nabel und nimmt sich die Milch, die irgendwo hinter mir im Kühlschrank steht.
11 Alles Schlimme hat auch seine schöne Seite
Unter dem Hauptdeck liegen die Mannschaftsquartiere. Das Mannschaftsdeck ist viel größer, als das Schiff von außen wirkt. Unmöglich groß. Ein langer Flur dehnt und dehnt und dehnt sich endlos.
Die Fugen zwischen den Planken, aus denen Rumpf und Decks des Schiffes gebaut sind, sind mit einem übelriechenden schwarzen Pech abgedichtet, damit kein Wasser durchdringt. Nirgendwo ist der Gestank heftiger als unter Deck. Ein scharfes, organisches Aroma, als hätten jene Lebensformen, die sich im Lauf langer Zeit in Teer verwandelt haben, ihre Verwesung noch nicht ganz abgeschlossen. Es riecht wie konzentrierter Schweiß und Körpergeruch, und wie das Zeug, das sich unter den Zehennägeln sammelt.
»Der Geruch des Lebens«, sagte der Kapitän stolz, als ich ihn einmal danach fragte. »Leben im Wandel womöglich, aber dennoch Leben. Das ist wie die brackige Ausdünstung eines Gezeitenbeckens, Junge – streng und faulig, aber zugleich erfrischend. Wenn eine Welle sich an diesem Ufer bricht und dir Gischt in die Nasenlöcher spritzt, verfluchst du sie? Aber nein! Denn sie erinnert dich daran, wie sehr du das Meer liebst. Dieser sommerliche Strandgeruch trägt dich in den heitersten Winkel deiner Seele und ist nichts weiter als ein sanfter Hauch ozeanischer Verwesung.« Dann holte er tief und zufrieden Luft, um seine Ausführungen zu unterstreichen. »Denn es ist wahr: Alles Schlimme hat auch seine schöne Seite.«
12 Rausch
Als meine Freunde und ich jünger waren und wir uns in der Shopping Mall zu Tode langweilten, haben wir immer so ein Spiel gespielt. Wir nannten es Psychokaufrausch. Dabei suchten wir uns einen Kunden, manchmal auch ein Paar oder gar eine ganze Familie – allerdings funktionierte das Spiel besser, wenn es eine einzelne Person war. Dann dachten wir uns eine Geschichte aus, was dieser Mensch insgeheim vorhatte. Normalerweise spielten dabei eine Axt und/oder eine Kettensäge eine Rolle, außerdem ein Keller und/oder ein Dachboden.
Einmal hatten wir uns auf eine kleine alte Frau geeinigt, die mit so verkniffener Entschlossenheit durch das Einkaufszentrum schlurfte, dass wir beschlossen, sie sei die perfekte Serienmörderin des Tages. Unsere Story für sie war, dass sie in der Mall lauter Zeug – viel zu viel, um es selbst zu tragen – kaufen und sich dann nach Hause liefern lassen würde. Und dann würde sie den Lieferanten gefangen nehmen und mit dem Gegenstand umbringen, den er selbst gebracht hatte. Sie hatte eine ganze Sammlung frisch erworbener Mordwaffen und toter UPS-Fahrer im Keller und/oder auf dem Dachboden.
Wir folgten ihr also ungefähr zwanzig Minuten lang und fanden es zum Totlachen … bis sie in einen Haushaltswarenladen ging und ein schönes neues Schlachtermesser kaufte. Dann wurde es noch witziger.
Aber als sie aus dem Geschäft kam, schaute ich ihr in die Augen – hauptsächlich, weil ich mir selbst eine Mutprobe stellte. Ich weiß, es war reine Einbildung, doch ihre Augen blickten so grausam und boshaft, dass ich es nie vergessen werde.
In letzter Zeit sehe ich ihre Augen überall.
13 Es gibt kein Unten
Ich stehe mitten im Wohnzimmer und kralle die Zehen in den flauschigen, aber seelenlos beigefarbenen Teppich.
»Was machst du?«, fragt Mackenzie, als sie aus der Schule nach Hause kommt und ihren Rucksack auf die Couch schleudert. »Wieso stehst du einfach bloß da?«
»Ich lausche«, sage ich.
»Auf was?«
»Auf die Termiten.«
»Du kannst die Termiten hören?« Der Gedanke entsetzt sie.
»Vielleicht.«
Sie nestelt nervös an den großen blauen Knöpfen ihrer blauen Fleecejacke herum, als könnte sie die Termiten so wie die Kälte damit abwehren. Dann legt sie zögernd das Ohr an die Wand, weil sie sich wohl denkt, dass man sie dort leichter hören kann als in der Mitte eines stillen Raumes. Sie lauscht ein paar Augenblicke und sagt dann leicht unbehaglich: »Ich höre nichts.«
»Keine Sorge«, sage ich so beruhigend ich kann, »Termiten sind bloß Termiten.« Neutraler kann man es kaum ausdrücken, doch es zerstreut alle Insektenfurcht, die ich ihr womöglich eingepflanzt habe. Zufrieden geht sie in die Küche, um etwas zu essen.
Ich rühre mich nicht. Ich kann die Termiten nicht hören, aber fühlen. Je mehr ich über sie nachdenke, desto mehr fühle ich, und das lenkt mich ab. Ich bin heute sehr abgelenkt. Und vor allem von den Dingen, die ich nicht sehen kann. Von Dingen in den Wänden und unter meinen Füßen, die mich schon immer eigenartig fasziniert haben. Diese Faszination hat mich heute befallen wie die Holz fressenden Insekten, die langsam unser Haus vernichten.
Ich sage mir, dass es eine gute Ablenkung ist, weil sie mich davon abhält, dem Strudel der Gedanken an Widerwärtigkeiten zu folgen, die womöglich in der Schule passieren könnten. Das hilft, also lasse ich mich eine Weile ablenken.
Ich schließe die Augen und fühle, presse meine Gedanken durch meine Fußsohlen.
Meine Füße stehen auf sicherem, festem Boden, aber das ist bloß eine Illusion. Unser Haus gehört uns, richtig? Aber eigentlich auch nicht, denn wir haben bei der Bank eine Hypothek dafür aufgenommen. Was gehört uns also? Das Land? Wieder falsch, denn wir haben zwar eine Besitzurkunde für das Grundstück, auf dem unser Haus steht, aber die Schürfrechte besitzen wir nicht; wir können also nichts Wertvolles abbauen, was darunter liegt. Keine Mineralien, nichts, was im Boden ist. Wenn es wertvoll ist oder eines Tages wertvoll werden könnte, gehört es nicht uns. Wir besitzen nur, was nichts wert ist.
Was ist also wirklich unter meinen Füßen, abgesehen von der Lüge, dass es uns gehört? Wenn ich mich konzentriere, kann ich spüren, was da unten ist. Unterm Teppich ist eine Betonplatte, die auf Erdboden ruht, der vor zwanzig Jahren von Baumaschinen komprimiert wurde. Und darunter liegt verlorenes Leben, das niemand je wiederfinden wird. Das könnten Überreste von Zivilisationen sein, die durch Kriege oder Untiere zerstört wurden, oder durch Immunsysteme, die einen unangekündigten Bakterientest nicht bestanden. Ich spüre die Knochen und Panzer prähistorischer Wesen. Dann schicke ich meine Gedanken noch tiefer ins Grundgestein, wo Gasblasen blubbern und brodeln, erzeugt von den aufgewühlten Eingeweiden der Erde, in denen die lange und oft traurige Geschichte des Lebens auf ihr verdaut wird. Der Ort, an dem alle Kreaturen Gottes letztlich durch den Fels zu zähem schwarzen Schleim destilliert werden, den wir dann wieder aus dem Boden saugen und in unseren Autos verbrennen, wobei wir diese ehemaligen Lebewesen in Treibhausgase verwandeln, was vielleicht besser ist, als die Ewigkeit in Form von Schlamm zu verbringen.
Noch tiefer spüre ich, wie die Kälte der Erde allmählich von Wärme verdrängt wird, bis Hohlräume voll rot glühendem, dann weiß glühendem Magma sich bilden, das sich unter unfassbarem Druck herumwälzt. Der äußere Erdkern, dann der innere Erdkern, bis hin zum Gravitationszentrum, wo sich die Wirkung der Schwerkraft umkehrt. Hitze und Druck nehmen allmählich ab. Geschmolzener Fels wird wieder fest. Ich schiebe mich durch den Granit, den schwarzen Schlamm, die Knochen, die Erde, die Würmer und die Termiten, bis ich durchbreche und auf einem Reisfeld in China ankomme, womit bewiesen wäre, dass es gar kein Unten gibt, weil Unten irgendwann wieder Oben ist.
Ich öffne die Augen und bin überrascht, dass ich noch in unserem Wohnzimmer stehe. Mir wird klar, dass es eine schnurgerade senkrechte Linie von meinem Zuhause nach irgendwo in China gibt, und ich frage mich, ob es wohl gefährlich war, meine Gedanken an dieser Linie entlangzuführen, wie ich es gerade getan habe. Könnten meine Gedanken durch die Hitze und den Druck im Erdinneren verstärkt werden und auf der anderen Seite als Erdbeben ankommen?
Ich weiß zwar, das ist bloß so ein streunender Gedanke, der mich zwickt, aber am nächsten Morgen – und auch am übernächsten und von nun an jeden Morgen – kontrolliere ich in heimlicher Furcht die Nachrichten, ob es in China ein Erdbeben gegeben hat.
14 Von hier aus kommt man nicht hin
Obwohl mich verschiedene verschreckte Seeleute gewarnt haben, mich nicht in die unbekannten Ecken des Schiffes zu wagen, kann ich nicht anders. Etwas zwingt mich, gerade die Dinge aufzuspüren, die man lieber in Frieden lassen sollte. Wie kann man denn auch auf einer großen Galeone segeln, ohne sie zu erforschen?
Eines Morgens stehe ich, anstatt mich zum Appell an Deck einzufinden, früh genug für einen Erkundungsgang auf. Zuerst gehe ich den langen, trübe beleuchteten Gang im Mannschaftsdeck entlang. Ich nehme meinen Pergamentblock mit und zeichne rasch ein paar Impressionen auf.
»Entschuldigung«, sage ich zu einem Besatzungsmitglied, das ich noch nie gesehen habe. Sie drückt sich im Schatten ihrer Kabine herum, hat groß aufgerissene Augen, ihre Wimperntusche ist verlaufen, und sie trägt ein enges Perlenhalsband, das ihr anscheinend fast die Luft abdrückt. »Wo geht dieser Gang hin?«
Sie sieht mich misstrauisch an. »Er geht nirgendwohin, er bleibt hier.« Dann geht sie wieder in ihre Kabine und knallt die Tür zu. Ich behalte ihr Bild im Gedächtnis, und auf meinen Block zeichne ich ihr Gesicht, so wie es aussah, als sie in den Schatten zurückwich.
Ich gehe weiter und versuche die Entfernung einzuschätzen, die ich im Gang zurücklege, indem ich die Leitern zähle. Ein, zwei, drei. Ich komme bis zur zehnten Leiter, doch der Gang erstreckt sich immer weiter vor mir. Schließlich gebe ich auf, steige die zehnte Leiter hinauf und gelange durch die Mittschiffsluke an Deck. Mir wird klar, dass alle diese Leitern, ganz egal, wo sie sich im Gang befinden, durch die gleiche Luke nach oben führen. Ich bin zwanzig Minuten den Gang entlanggestiefelt und doch nirgendwo hingekommen.
Über mir auf der Reling sitzt der Papagei, als hätte er bloß darauf gewartet, mich zu verspotten.
»Von hier aus kommt man nicht hin«, sagt er. »Weißt du das nicht? Weißt du das nicht?«
15 Der Raum vergeht nicht
Meine Aufgabe an Bord ist die eines »Stabilisators«. Ich kann mich nicht erinnern, wann mir diese Pflicht zugewiesen wurde, aber ich weiß noch, wie der Kapitän sie mir erklärt hat.
»Du sollst spüren, wie das Schiff auf dem Meer von einer Seite zur anderen krängt, und dich dann jeweils gegenüber der Neigung positionieren, von Steuerbord nach Backbord, von Backbord nach Steuerbord«, hatte der Kapitän gesagt.
Mit anderen Worten: Wie die meisten Besatzungsmitglieder soll ich an Deck hin und her rennen, um das Rollen des Schiffes im Seegang auszugleichen. Total sinnlos.
»Wie kann denn unser bisschen Gewicht bei einem Schiff dieser Größe irgendetwas ausrichten?«, fragte ich ihn.
Darauf hatte er mich mit seinem blutunterlaufenen Auge böse angestarrt. »Wärst du etwa lieber Ballast?«
Das brachte mich zum Schweigen. Den »Ballast« hatte ich schon gesehen. Seeleute, die wie Sardinen ganz unten in den Frachtraum gequetscht waren, um den Schwerpunkt des Schiffes zu senken. Wenn sich an Bord dieses Schiffes keine andere Aufgabe für dich findet, wirst du Ballast. Ich hätte es besser wissen sollen, anstatt mich zu beschweren.
»Wenn wir unserem Ziel näher kommen«, hatte der Kapitän mir einmal verraten, »werde ich eine spezielle Truppe für unsere große Mission zusammenstellen. Verrichte deine Arbeit mit Schweiß und Herzblut, dann verdienst du dir und deinem beinahe wertlosen Kadaver einen Platz in dieser Truppe.«
Ich bin zwar nicht sicher, ob ich das will, aber vielleicht ist es besser, als nutzlos an Deck hin und her zu huschen. Einmal hatte ich den Kapitän gefragt, wie weit wir noch vom Marianengraben entfernt wären, weil das Meer Tag für Tag genau gleich aussieht. Wir scheinen weder näher an irgendwas noch weiter von irgendwas entfernt zu sein.
»Liegt in der Natur eines flüssigen Horizonts, dass der Raum nicht vergeht«, sagte der Kapitän. »Doch wir werden wissen, wenn wir uns dem Graben nähern, denn es wird Omen und dunkle Vorzeichen geben.«
Ich wage es nicht, den Kapitän zu fragen, was für düstere Vorzeichen das sein mögen.
16 Moses
Wenn die See ruhig ist und ich nicht hin und her rennen muss, hänge ich manchmal mit Carlyle an Deck ab. Carlyle ist der Schiffsjunge an Bord – ein Typ mit leuchtend roten Haaren, die kurz wie Pfirsichflaum geschnitten sind, und dem freundlichsten Lächeln auf dem ganzen Schiff. Er ist gar kein Junge mehr, sondern älter, so alt wie die Offiziere, aber er gehört nicht zu ihnen. Anscheinend bestimmt er seine Arbeitszeiten selbst, macht seine eigenen Regeln, und der Kapitän kommt ihm kaum in die Quere. Er ist der Einzige an Bord, mit dem man vernünftig reden kann.
»Ich bin Moses aus freien Stücken«, hat er mir erzählt. »Ich mache das, weil es nötig ist. Und weil ihr alle solche Schmutzfinken seid.«
Heute sehe ich Ratten, die vor dem Wasser aus seinem Wischmopp davonrennen und in den dunklen Winkeln des Decks verschwinden.
»Verfluchte Dinger«, sagt Carlyle, taucht den Mopp in einen Eimer mit trübem Wasser und wischt weiter das Deck. »Die werden wir nie wieder los.«
»Auf alten Schiffen gibt es immer Ratten«, sage ich.
Er zieht eine Augenbraue hoch. »Ratten? Du hältst sie für Ratten?« Allerdings bietet er mir keine alternative Erklärung an. Tatsächlich huschen sie so schnell und verbergen sich so tief im Schatten, dass ich gar nicht genau weiß, was sie sind. Das macht mich nervös, darum wechsle ich das Thema.
»Erzähl mir was über den Kapitän, was ich noch nicht weiß.«
»Er ist dein Kapitän. Alles, was sich zu wissen lohnt, musst du schon wissen.«
Aber wie er das sagt, macht mir klar, dass er ein Insider ist wie wenige andere. Wenn ich Antworten kriegen will, muss ich vermutlich konkretere Fragen stellen.
»Erzähl mir, wie er sein Auge verloren hat.«
Carlyle seufzt, sieht sich um, ob wir unbeobachtet sind, und fängt an zu flüstern. »So wie ich es verstanden habe, hat der Papagei sein Auge vor dem Kapitän verloren. Mir wurde es so erzählt, dass der Papagei sein Auge an eine Hexe verkauft hat, damit die ihm einen Zaubertrank braut, der ihn in einen Adler verwandelt. Die Hexe hat ihn aber reingelegt, den Trank selbst getrunken und ist davongeflogen. Der Papagei wollte nicht der Einzige mit Augenklappe sein und hat dem Kapitän ein Auge ausgekratzt.«
»Das ist doch nicht wahr«, sage ich grinsend.
Carlyle bleibt ernst und spritzt Seifenwasser aufs Deck. »Es ist so wahr wie nötig.« Der Teer zwischen den Planken scheint sich vor seiner Wasserflut zurückzuziehen.
17 Ich würde Eintritt zahlen
Der Steuermann sagt, die Aussicht aus dem Krähennest brächte mir »Trost, Trennschärfe, Treue, Tugend«.
Wäre das ein Multiple-Choice-Test, würde ich eigentlich A und B wählen, aber wenn ich so über die Besatzung nachdenke, vielleicht doch eher Lösung D mit dem weichen Bleistift schwärzen.
Das Krähennest ist eine kleine runde Wanne, die hoch oben am Großmast hängt. Sie ist gerade groß genug, einen oder vielleicht zwei Seeleute aufzunehmen, die dort Ausschau halten. Ich komme zu dem Schluss, dass es ein guter Ort wäre, mit meinen Gedanken allein zu sein, aber eigentlich müsste ich inzwischen wissen, dass meine Gedanken niemals allein sind.
Am frühen Abend klettere ich die zerfransten Wanten hinauf, die das Schiff wie Leichentücher umhüllen. Der letzte Schimmer der Dämmerung versinkt langsam hinterm Horizont, und die Abwesenheit der Sonne zwingt die eigenartigen Sterne zum Leuchten.
Das Seilgitter der Wanten verengt sich, je näher ich dem Krähennest komme, was den Aufstieg immer tückischer macht. Schließlich stemme ich mich über den Rand in das kleine Holzfass, das den Mast umgibt – nur um festzustellen, dass es überhaupt nicht klein ist. Wie das Mannschaftsdeck sieht es von außen klein aus, aber wenn man erst mal drin ist, hat der runde Raum offenbar dreißig Meter Durchmesser. Besatzungsmitglieder lümmeln sich in Samtsesseln, den Blick in die Ferne gerichtet, nippen an neongrellen Martinis und lauschen einer Liveband, die Cocktail-Jazz spielt.
»Eine Person? Bitte hier entlang«, sagt eine Hostess und führt mich zu meinem eigenen Samtsessel, von dem aus ich das Mondlicht auf dem Wasser schimmern sehe.
»Bist du ein Springer?«, fragt ein bleicher Mann aus dem Nachbarsessel, der etwas Blaues und womöglich Radioaktives trinkt. »Oder willst du bloß zuschauen?«
»Ich bin hier, um einen klaren Kopf zu kriegen.«
»Nimm einen von diesen«, sagt er und zeigt auf seinen radioaktiven Drink. »Bis du deinen eigenen Cocktail findest, kannst du von meinem trinken. Hier muss jeder seinen eigenen Cocktail finden, sonst wird man tüchtig ausgepeitscht und ins Bett geschickt. So enden hier alle Kinderverse. Auch die, die sich gar nicht reimen.«
Ich schaue mich nach den zehn, zwölf Leuten um, die sich im flüchtigen psychedelischen Rausch amüsieren. »Ich verstehe nicht, wie das alles hier ins Krähennest passt.«
»Elastizität ist ein grundlegendes Wahrnehmungsprinzip«, sagt mein Gegenüber. »Aber so wie Gummibänder brüchig werden, wenn man sie zu lange in der Sonne liegen lässt, so wird mit der Zeit, nehme ich an, auch das Krähennest bemerken, dass wir seine sensible Flexibilität missbraucht haben, und ebenfalls brüchig werden, also auf sein Normalmaß zurückschrumpfen. Und wenn das geschieht, werden alle, die sich darin aufhalten, zermalmt werden; ihr Blut, ihre Knochen, ihre gesamten Innereien werden durch die Astlöcher im Holz gequetscht werden wie Knetmasse aus einer Spielfigur.« Dann hebt er das Glas. »Ich würde Eintritt zahlen, das zu sehen.«
Ein paar Meter weiter steigt ein Matrose im blauen Trainingsanzug auf die Brüstung des Krähennests, breitet die Arme aus und springt in den sicheren Tod. Ich stehe auf und schaue hinterher, doch er ist verschwunden. Alle hier oben Versammelten applaudieren höflich, und die Band setzt mit Orange Colored Sky ein, obwohl der Abendhimmel dunkellila wie eine alte Prellung ist.
»Wieso sitzt ihr alle bloß hier rum?«, rufe ich. »Habt ihr nicht gesehen, was gerade passiert ist?«
Mein Trinkgefährte zuckt die Achseln. »Springer tun, was Springer eben tun. Unsere Aufgabe ist es, ihrem Mut Beifall zu spenden und ihr Leben zu feiern.« Er wirft einen beiläufigen Blick über die Brüstung. »Es geht so weit hinunter, dass man sie nie aufklatschen sieht.« Dann stürzt er den Rest seines Drinks runter. »Ich würde Eintritt zahlen, das zu sehen!«
18 Rätselhafter Aschenbecher
Niemand in der Schule möchte mir etwas antun.
Das sage ich mir jeden Morgen, nachdem ich die Nachrichten auf chinesische Erdbeben überprüft habe. Ich sage es mir, wenn ich von einer Unterrichtsstunde zur nächsten eile. Ich sage es mir, wenn ich dem Jungen begegne, der mich umbringen will, auch wenn er anscheinend gar nicht weiß, dass es mich gibt.
Eine Überreaktion, hatte mein Vater gesagt. Was stimmen könnte – aber es setzt auch voraus, dass da etwas war, worauf ich reagiert haben könnte. Wenn ich besser drauf bin, möchte ich mir selbst die Seele aus dem Leib prügeln, wie ich so bescheuert sein kann zu glauben, dass dieser Junge hinter mir her ist. Was sagt das über mich, dass ich mir die Seele aus dem Leib prügeln will, wenn ich besser drauf bin?
»Du musst deine Mitte finden«, sagt meine Mutter dann. Sie steht total auf Meditation und vegane Rohkost, wahrscheinlich als Ausgleich, weil sie es so grässlich findet, dass sie ihr Geld damit verdient, den Leuten Fleischreste aus den Zähnen zu pulen.
Die Mitte finden ist allerdings leichter gesagt als getan. Das habe ich beim Töpferkurs gelernt, den ich in der Schule mal belegt habe. Bei der Lehrerin sah es total einfach aus, eine Schale zu formen, aber in Wirklichkeit braucht man dazu jede Menge Können und Präzision. Man haut den Klumpen Ton genau ins Zentrum der Töpferscheibe, drückt mit ruhiger Hand den Daumen hinein und macht die Öffnung immer ein paar Millimeter breiter. Aber jedes Mal, wenn ich es versuchte, kam ich nicht weit, ehe die Schale aus dem Gleichgewicht geriet, und jeder Versuch, die Sache zu bereinigen, machte alles nur schlimmer, bis der Rand zerfaserte, die Seiten zusammenfielen und mir am Ende bloß ein »rätselhafter Aschenbecher« gelungen war – wie die Lehrerin es nannte –, der wieder in den Toneimer zurückgeschmissen wurde.
Was passiert also, wenn dein Universum allmählich aus dem Gleichgewicht gerät und du keine Erfahrung damit hast, es wieder in die Mitte zu rücken? Da stehst du auf verlorenem Posten und wartest nur darauf, dass die Seiten zusammenfallen und dein ganzes Leben ein riesiger rätselhafter Aschenbecher wird.
19 Dekonstruierter Xargon
Meine Freunde Max und Shelby und ich treffen uns manchmal freitags nach der Schule. Wir glauben, dass wir ein Computer-Rollenspiel designen, aber wir sind schon zwei Jahre damit beschäftigt, und es wird irgendwie nie fertiger. Weil wir nämlich alle drei immer besser und klüger in unserem jeweiligen Kompetenzbereich werden, müssen wir ständig alles in die Tonne treten und ganz neu anfangen, denn das alte Material kommt uns kindisch und unprofessionell vor.
Max ist die treibende Kraft hinter der ganzen Sache. Er bleibt oft viel länger bei mir, als meine Eltern eigentlich ertragen können, denn er ist zwar der Computerexperte von uns dreien, aber sein eigener Computer ist totaler Schrott und stürzt schon ab, wenn man in einem Meter Entfernung das Wort Grafik flüstert.
Shelby ist unsere Konzeptkönigin. »Ich glaube, ich habe unsere Plotprobleme gelöst«, sagt sie an diesem Nachmittag. Wie fast immer, wenn wir daran arbeiten. »Ich glaube, ich muss die biointegrierten Waffen der Figuren beschränken. Sonst wird jeder Kampf ein Blutbad, und das ist langweilig.«
»Wer sagt, dass Blutbäder langweilig sind?«, fragt Max. »Ich mag Blutbäder.«
Shelby sieht mich Hilfe suchend an, aber da sucht sie am falschen Ort.
»Ich eigentlich auch«, sage ich. »Ist wohl eine Jungssache.«
Sie starrt mich böse an und wirft mir ein paar Seiten neuer Charakterbeschreibungen hin. »Zeichne die Figuren einfach und gib ihnen genug Rüstung, damit nicht jeder Treffer gleich tödlich ist. Vor allem Xargon. Mit dem habe ich Großes vor.«
Ich klappe meinen Skizzenblock auf. »Hatten wir uns nicht vorgenommen, mit dieser Sache sofort aufzuhören, wenn wir uns wie Nerds anhören? Ich glaube, mit dieser Unterhaltung haben wir den Moment offiziell erreicht.«
»Ach bitte! Der Moment war doch schon letztes Jahr«, erklärt Shelby. »Wenn du so unreif bist, dass du Angst davor hast, von Idioten Etiketten aufgeklebt zu kriegen, dann steig aus, und wir finden einen anderen Zeichner.«
Ich fand es schon immer gut, dass Shelby allen Leuten genau sagt, was sie denkt. Nicht dass es jemals einen romantischen Funken zwischen uns gegeben hätte. Ich glaube, die Möglichkeit ist bei uns beiden bereits im Ansatz verkümmert. Wir mögen einander viel zu gern, um uns irgendwie peinlich näherzukommen. Außerdem bietet unsere Dreierfreundschaft auch Pluspunkte. Zum Beispiel die Gelegenheit, durch Shelby etwas über die Mädchen herauszufinden, auf die Max und ich stehen, und Shelby alles über einen Typen erzählen zu können, für den sie sich interessiert. Das läuft so super, dass keiner es in den Sand setzen will.
»Jetzt hört mal zu«, sagt Shelby, »das hier ist nicht unser Leben, sondern bloß ein Hobby. Wir gönnen uns das ein paar Tage im Monat. Ich fühle mich davon jedenfalls nicht gesellschaftlich eingeschränkt.«
»Klar«, sagt Max. »Du hast ja auch genug andere Einschränkungen.«
Sie schlägt ihn so heftig, dass die kabellose Maus durch die Gegend fliegt.
»Hey«, schreie ich. »Wenn die kaputtgeht, lassen meine Eltern sie mich bezahlen. Persönliche Verantwortung ist ihr großes Ding.«
Shelby sieht mich kühl, fast kalt an. »Ich sehe dich nicht zeichnen.«
»Vielleicht warte ich auf die Inspiration.« Aber – inspiriert oder nicht – ich hole tief Luft und lese ihre Charakterbeschreibungen. Dann starre ich auf das leere Blatt meines Skizzenblocks.
Das Problem mit dem leeren Raum hat mich überhaupt zur Kunst gebracht. Sehe ich einen leeren Kasten, muss ich ihn füllen. Sehe ich eine leere Seite, kann ich sie nicht so lassen. Leere Seiten schreien mich an, dass sie mit dem Mist aus meinem Hirn gefüllt werden wollen.
Es fing mit Kritzeleien an. Dann wurden aus dem Gekritzel Skizzen, aus den Skizzen Bilder, und jetzt sind die Bilder »Werke«. Oder ein »Oeuvre«, wenn man richtig prätentiös sein will, wie manche Mitschüler aus meinem Kunstkurs, die Baskenmützen tragen, als wären ihre Hirne so kreativ, dass sie eine andere Kopfbedeckung brauchen als normale Menschen. Mein eigenes »Oeuvre« besteht vor allem aus Comiczeichnungen. Manga und so ein Kram, aber nicht nur. In letzter Zeit wird meine Zeichnerei immer abstrakter, so als würden die Linien meine Hand führen und nicht umgekehrt. Mich packt jetzt immer so eine nervöse Anspannung, bevor ich loslege. So ein dringender Wunsch zu wissen, wohin die Linien mich führen werden.
Ich arbeite so gewissenhaft wie möglich an den Skizzen für Shelbys Figuren, aber mir fehlt die Geduld. Kaum habe ich einen Buntstift in der Hand, möchte ich ihn schon wieder fallen lassen und zum nächsten greifen. Ich sehe die Linien, die ich ziehe, aber nicht das ganze Bild. Ich zeichne eigentlich sehr gern Figuren, aber heute habe ich das Gefühl, die Freude ist meinen Gedanken ein paar Meter voraus und ich kann sie nicht einholen.
Ich zeige ihr meine Skizze von Xargon, ihrem neuen, verbesserten, vor Blutbädern geschützten Kampfgruppen-Anführer.