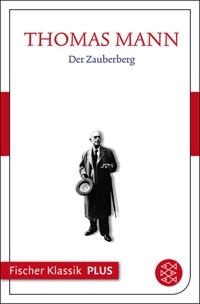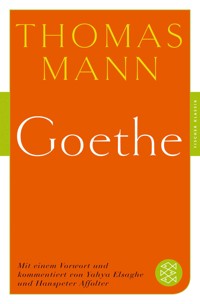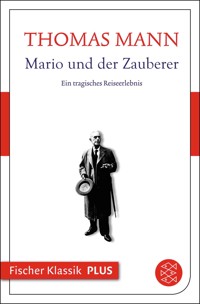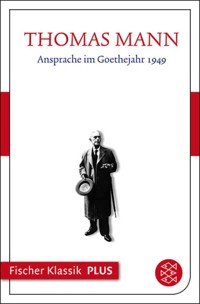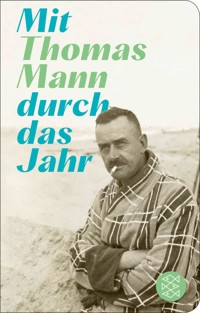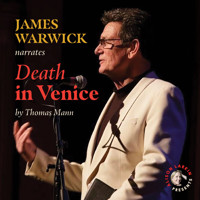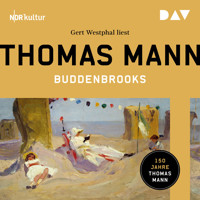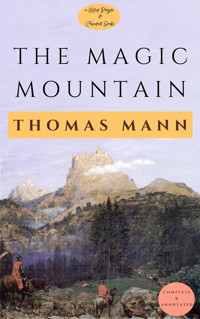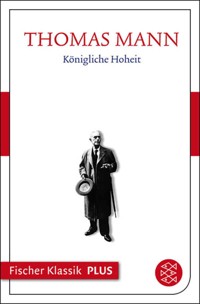
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fischer Klassik Plus
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2009
Thomas Manns 1909 erschienener Roman hat lange Zeit »die Rolle des Aschenbrödels« im Werk dieses Autors gespielt, und trotzdem, so Thomas Mann, wären die späteren Werke ›Der Zauberberg‹ und ›Joseph und seine Brüder‹ ohne die Arbeit an diesem Roman nicht möglich gewesen. Es ist an der Zeit, diesen Roman neu zu lesen. In der Textfassung der Großen kommentierten Frankfurter Ausgabe (GKFA), mit Daten zu Leben und Werk.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 545
Ähnliche
Thomas Mann
Königliche Hoheit
Roman
FISCHER E-Books
In der Textfassung derGroßen kommentierten Frankfurter Ausgabe(GKFA)Mit Daten zu Leben und Werk
Inhalt
VORSPIEL
Es ist auf der Albrechtsstraße, jener Verkehrsader der Residenz, die den Albrechtsplatz und das Alte Schloß mit der Kaserne der Garde-Füsiliere verbindet, – um Mittag, wochentags, zu einer gleichgültigen Jahreszeit. Das Wetter ist mäßig gut, indifferent. Es regnet nicht, aber der Himmel ist auch nicht klar; er ist gleichmäßig weißgrau, gewöhnlich, unfestlich, und die Straße liegt in einer stumpfen und nüchternen Beleuchtung, die alles Geheimnisvolle, jede Absonderlichkeit der Stimmung ausschließt. Es herrscht ein Verkehr von mittlerer Regsamkeit, ohne viel Lärm und Gedränge, entsprechend dem nicht sehr geschäftigen Charakter der Stadt. Trambahnwagen gleiten dahin, ein paar Droschken rollen vorbei, auf den Bürgersteigen bewegt sich Einwohnerschaft, farbloses Volk, Passanten, Publikum, Leute. – Zwei Offiziere, die Hände in den Schrägtaschen ihrer grauen Paletots, kommen einander entgegen: ein General und ein Leutnant. Der General nähert sich von der Schloß-, der Leutnant von der Kasernenseite her. Der Leutnant ist blutjung, ein Milchbart, ein halbes Kind. Er hat schmale Schultern, dunkles Haar und so breite Wangenknochen, wie viele Leute hierzulande sie haben, blaue, ein wenig müde blickende Augen und ein Knabengesicht von freundlich verschlossenem Ausdruck. Der General ist schlohweiß, hoch und breit gepolstert, eine überaus gebietende Erscheinung. Seine Augenbrauen sind wie aus Watte, und sein Schnurrbart überbuscht sowohl Mund als Kinn. Er geht mit langsamer Wucht, sein Säbel klirrt auf dem Asphalt, sein Federbusch flattert im Winde, und langsam schwappt bei jedem Schritte der große rote Brustaufschlag seines Mantels auf und nieder. So kommen sie aufeinander zu. – Kann dies zu Verwickelungen führen? Unmöglich. Jedem Beobachter steht der naturgemäße Verlauf dieses Zusammentreffens klar vor Augen. Hier ist das Verhältnis von Alt und Jung, von Befehl und Gehorsam, von betagtem Verdienst und zartem Anfängertum, hier ist ein gewaltiger hierarchischer Abstand, hier gibt es Vorschriften. Natürliche Ordnung, nimm deinen Lauf! – Und was, statt dessen, geschieht? Statt dessen vollzieht sich das folgende überraschende, peinliche, entzückende und verkehrte Schauspiel. Der General, des jungen Leutnants ansichtig werdend, verändert auf seltsame Art seine Haltung. Er nimmt sich zusammen und wird doch gleichsam kleiner. Er dämpft sozusagen mit einem Ruck den Prunk seines Auftretens, er tut dem Lärm seines Säbels Einhalt, und während sein Gesicht einen bärbeißigen und verlegenen Ausdruck annimmt, ist er ersichtlich nicht einig mit sich, wohin er blicken soll, was er so zu verbergen sucht, daß er unter seinen Wattebrauen hinweg schräg vor sich hin auf den Asphalt starrt. Auch der junge Leutnant verrät, genau beobachtet, eine leichte Befangenheit, die aber seltsamerweise bei ihm in höherem Grade als bei dem greisen Befehlshaber von einer gewissen Grazie und Disziplin bemeistert scheint. Die Spannung seines Mundes wird zu einem Lächeln von zugleich bescheidener und gütiger Art, und seine Augen blicken vorläufig mit einer stillen und beherrschten Ruhe, die den Anschein der Mühelosigkeit hat, an dem General vorbei und ins Weite. Nun sind sie auf drei Schritt aneinander. Und statt die vorschriftsmäßige Ehrenbezeigung auszuführen, legt der blutjunge Leutnant ein wenig den Kopf zurück, zieht gleichzeitig seine rechte Hand – nur die rechte, das ist auffallend – aus der Manteltasche und beschreibt mit eben dieser weißbehandschuhten Rechten eine kleine ermunternde und verbindliche Bewegung, nicht stärker, als daß er, die Handfläche nach oben, die Finger öffnet; aber der General, der dieses Zeichen mit hängenden Armen erwartet hat, fährt an den Helm, biegt aus, gibt in halber Verbeugung sozusagen den Bürgersteig frei und grüßt den Leutnant von unten herauf aus rotem Gesicht mit frommen und wässerigen Augen: Da erwidert der Leutnant, die Hand an der Mütze, das Honneur seines Vorgesetzten, erwidert es, indem eine kindliche Freundlichkeit sein ganzes Gesicht bewegt, erwidert es – und geht weiter.
Ein Wunder! Ein phantastischer Auftritt! Er geht weiter. Man sieht ihn an, aber er sieht niemanden an, er sieht zwischen den Leuten hindurch geradeaus, ein wenig mit dem Blick einer Dame, die sich beobachtet weiß. Man grüßt ihn: dann grüßt er zurück, fast herzlich und dennoch aus einer Ferne. Wie es scheint, so geht er nicht gut; es ist, als sei er des Gebrauches seiner Beine nicht sehr gewohnt oder als behindere ihn die allgemeine Aufmerksamkeit, so ungleichmäßig und zögernd ist sein Schritt, ja, bisweilen scheint er zu hinken. Ein Schutzmann macht Front, eine elegante Frau, aus einem Laden tretend, sinkt lächelnd ins Knie. Man blickt nach ihm um, man weist mit dem Kopfe nach ihm, man zieht die Brauen empor und nennt gedämpft seinen Namen …
Es ist Klaus Heinrich, der jüngere Bruder Albrechts II. und nächster Agnat am Throne. Dort geht er, man kann ihn noch sehen. Gekannt und doch fremd bewegt er sich unter den Leuten, geht im Gemenge und gleichsam doch von einer Leere umgeben, geht einsam dahin und trägt auf seinen schmalen Schultern die Last seiner Hoheit.
DIE HEMMUNG
Schüsse wurden gelöst, als auf den verschiedenen Verständigungswegen der Neuzeit in die Residenz die Nachricht gelangte, daß auf Grimmburg die Großherzogin Dorothea zum zweiten Male von einem Prinzen entbunden sei. Es waren zweiundsiebzig Schüsse, die über Stadt und Land hinrollten, abgefeuert von militärischer Seite auf dem Wall der »Zitadelle«. Gleich darauf kanonierte auch die Feuerwehr mit den städtischen Salutgeschützen, um nicht zurückzustehen; aber es entstanden lange Pausen dabei zwischen einzelnen Detonationen, was viel Heiterkeit in der Bevölkerung erregte.
Die Grimmburg beherrschte von einem buschigen Hügel das malerische Städtchen des gleichen Namens, das seine grauen Schrägdächer in dem vorüberfließenden Stromarm spiegelte und von der Hauptstadt in halbstündiger Fahrt mit einer unrentablen Lokalbahn zu erreichen war. Sie stand dort oben, die Burg, in grauen Tagen vom Markgrafen Klaus Grimmbart, dem Ahnherrn des Fürstengeschlechts, trotzig erbaut, mehrmals seither verjüngt und instand gesetzt, mit den Bequemlichkeiten der wechselnden Zeiten versehen, stets wohnlich gehalten und als Stammsitz des Herrscherhauses, als Wiege der Dynastenfamilie auf eine besondere Weise geehrt. Denn das Hausgesetz und Herkommen bestand, daß alle direkten Nachkommen des Grimmbartes, alle Kinder des jeweils regierenden Paares hier geboren werden mußten. Diese Überlieferung war nicht wohl außer acht zu lassen. Das Land hatte geistesklare und leugnerische Souveräne gesehen, die ihren Spott daran geübt hatten, und dennoch hatten sie sich ihr achselzuckend gefügt. Nun war es längst zu spät geworden, noch davon abzugehen. Vernünftig und zeitgemäß oder nicht – warum denn ohne Not mit einer ehrwürdigen Gepflogenheit brechen, die sich gewissermaßen bewährt hatte? Im Volke stand fest, daß etwas daran sei. Zweimal im Wandel von fünfzehn Generationen hatten Kinder regierender Herren infolge irgendwelcher Zufälligkeiten auf anderen Schlössern das Licht erblickt: mit beiden hatte es ein unnatürliches und nichtswürdiges Ende genommen. Aber von Heinrich dem Bußfertigen und Johann dem Gewalttätigen nebst ihren lieblichen und stolzen Schwestern bis auf Albrecht, den Vater des Großherzogs, und diesen selbst, Johann Albrecht III., waren alle Souveräne des Landes und ihre Geschwister hier zur Welt gebracht worden; und vor sechs Jahren war Dorothea mit ihrem ersten Sohne, dem Erbgroßherzog, hier niedergekommen …
Übrigens war das Stammschloß ein Zufluchtsort, so würdig als friedevoll. Als Sommersitz mochte man ihm, der Kühle seiner Gemächer, des schattigen Reizes seiner Umgebung wegen, sogar vor dem steif-lieblichen Hollerbrunn den Vorzug geben. Der Aufstieg vom Städtchen, jene ein wenig grausam gepflasterte Gasse zwischen ärmlichen Heimstätten und einer geborstenen Mauerbrüstung, durch massige Torwege bis zu der uralten Schenke und Fremdenherberge am Eingang zum Burghof, in dessen Mitte das Steinbild Klaus Grimmbarts, des Erbauers, stand, war pittoresk, ohne bequem zu sein. Aber ein ansehnlicher Parkbesitz bedeckte den Rücken des Schloßberges und leitete auf gemächlichen Wegen hinab in das waldige und sanft gewellte Gelände, das voller Gelegenheit zu Wagenfahrten und stillem Lustwandeln war.
Das Innere der Burg angehend, so war es zuletzt noch zu Beginn der Regierung Johann Albrechts III. einer umfassenden Auffrischung und Verschönerung unterzogen worden – mit einem Kostenaufwand, der viel Gerede hervorgerufen hatte. Die Einrichtung der Wohngemächer war in einem zugleich ritterlichen und behaglichen Stil ergänzt und erneuert, die Wappenfliesen des »Gerichtssaales« waren genau nach dem Muster der alten wiederhergestellt worden. Die Vergoldung der verschmitzten, in vielfachen Spielarten wechselnden Kreuzbogengewölbe zeigte sich glänzend aufgemuntert, alle Gemächer waren mit Parkett ausgestattet, und der große sowohl wie der kleine Bankettsaal war durch die Künstlerhand des Professors von Lindemann, eines hervorragenden Akademikers, mit großen Wandmalereien geschmückt worden, Darstellungen aus der Geschichte des landesherrlichen Hauses, angefertigt in einer leuchtenden und glatten Manier, die fernab und ohne Ahnung von den unruhigen Bedürfnissen jüngerer Schulen war. Es fehlte an nichts. Da die alten Kamine und seltsam bunten, in runden Terrassen sich deckenhoch aufbauenden Öfen der Burg nicht wohl verwendbar waren, so hatte man, im Hinblick auf die Möglichkeit eines winterlichen Aufenthaltes, sogar Anthrazitöfen gesetzt.
Aber am Tage der zweiundsiebzig Schüsse war beste Jahreszeit, Spätfrühling, Frühsommer, Juni-Anfang, ein Tag nach Pfingsten. Johann Albrecht, in aller Frühe telegraphisch benachrichtigt, daß gegen Morgen die Geburt begonnen habe, traf um acht mit der unrentablen Lokalbahn auf Station Grimmburg ein, von drei oder vier offiziellen Persönlichkeiten, dem Bürgermeister, dem Amtsrichter, dem Pastor, dem Arzt des Städtchens, mit Segenswünschen empfangen, und begab sich sofort zu Wagen auf die Burg. In der Begleitung des Großherzogs langten der Staatsminister Dr. Baron Knobelsdorff und der Generaladjutant General der Infanterie Graf Schmettern an. Ein wenig später fanden sich noch zwei oder drei Minister, der Hofprediger Oberkirchenratspräsident D. Wislizenus, ein paar Herren mit Hof- und Oberhofchargen und ein noch jugendlicher Adjutant, Hauptmann von Lichterloh, auf dem Stammschloß ein. Obwohl der großherzogliche Leibarzt, Generalarzt Dr. Eschrich, sich bei der Wöchnerin befand, hatte Johann Albrecht die Laune, den jungen Ortsarzt, einen Dr. Sammet, der obendrein jüdischer Abstammung war, aufzufordern, ihn auf die Burg zu begleiten. Der schlichte, arbeitsame und ernste Mann, der alle Hände voll zu tun hatte und sich solche Auszeichnung nicht vermutend gewesen war, stammelte mehrmals: »Ganz gern … ganz gern …«, was einiges Lächeln hervorrief.
Der Großherzogin diente als Schlafzimmer die »Brautkemenate«, ein fünfeckiges, sehr bunt ausgemaltes Gemach, welches, im ersten Stockwerk gelegen, durch sein feierliches Fenster eine prangende Fernsicht über Wälder, Hügel und die Windungen des Stromes bot und rings mit einem Fries von medaillonförmigen Porträts geziert war, Bildnissen fürstlicher Bräute, die hier in alten Tagen des Gebieters geharrt hatten. Dort lag Dorothea; ein breites und starkes Band war um das Fußende ihres Bettes geschlungen, daran sie sich hielt wie ein Kind, das Kutschieren spielt, und ihr schöner, üppiger Körper tat harte Arbeit. Doktorin Gnadebusch, die Hebamme, eine sanfte und gelehrte Frau mit kleinen feinen Händen und braunen Augen, die durch runde und dicke Brillengläser einen mysteriösen Glanz erhielten, unterstützte die Fürstin, indem sie sagte:
»Nur fest, nur fest, Königliche Hoheit … Es geht geschwinde … Es geht ganz leicht … Das zweite Mal … das ist nichts … Geruhen: die Knie auseinander … Und stets das Kinn auf die Brust …«
Eine Wärterin, gleich ihr in ein weißes Leinen gekleidet, half ebenfalls und ging in den Pausen auf leisen Sohlen mit Gefäßen und Binden umher. Der Leibarzt, ein finsterer, schwarz-grau-bärtiger Mann, dessen linkes Augenlid gelähmt schien, überwachte die Geburt. Er trug den Operationsmantel über seiner Generalarzt-Uniform. Zuweilen erschien in der Kemenate, um sich vom Fortschreiten der Entbindung zu überzeugen, Dorotheas vertraute Oberhofmeisterin, Freifrau von Schulenburg-Tressen, eine beleibte und asthmatische Dame von unterstrichen spießbürgerlichem Äußern, die jedoch auf den Hofbällen eine Welt von Busen zu entblößen pflegte. Sie küßte ihrer Herrin die Hand und kehrte zurück in ein entlegenes Gemach, wo ein paar magere Schlüsseldamen mit dem diensttuenden Kammerherrn der Großherzogin, einem Grafen Windisch, plauderten. – Dr. Sammet, der das Linnengewand wie einen Domino über seinen Frack gezogen hatte, verharrte in bescheidener und aufmerksamer Haltung am Waschtisch.
Johann Albrecht hielt sich in einem zur Arbeit und Kontemplation einladenden Gewölbe auf, das von der »Brautkemenate« nur durch das sogenannte Frisierkabinett und einen Durchgangsraum getrennt war. Es führte den Namen einer Bibliothek, im Hinblick auf mehrere handschriftliche Folianten, die schräg auf dem wuchtigen Schranke lehnten und die Geschichte der Burg enthielten. Das Gemach war als Schreibzimmer eingerichtet. Globen schmückten die Wandborte. Durch das Bogenfenster, das geöffnet stand, wehte der starke Wind der Höhe. Der Großherzog hatte sich Tee servieren lassen, Kammerdiener Prahl hatte selbst das Geschirr gebracht; aber es stand vergessen auf der Platte des Sekretärs, und Johann Albrecht schritt in einem rastlosen, unangenehm angespannten Zustande von einem Winkel in den anderen. Sein Gang war vom unaufhörlichen Knarren seiner Lackstiefel begleitet. – Flügeladjutant von Lichterloh horchte darauf, indem er sich in dem beinahe leeren Durchgangszimmer langweilte.
Die Minister, der Generaladjutant, der Hofprediger und die Hofchargen, neun oder zehn Herren, warteten in den Repräsentationsräumen des Hoch-Erdgeschosses. Sie wanderten durch den großen und den kleinen Bankettsaal, wo zwischen den Lindemannschen Gemälden Arrangements von Fahnen und Waffen hingen; sie lehnten an den schaftartigen Pfeilern, die sich über ihnen zu bunten Gewölben entfalteten; sie standen vor den deckenhohen und schmalen Fenstern und blickten durch die in Blei gefaßten Scheibchen hinab über Fluß und Städtchen; sie saßen auf den Steinbänken, die um die Wände liefen, oder auf Sesseln vor den Kaminen, deren gotische Dächer von lächerlich kleinen, gebückt schwebenden und fratzenhaften Kerlchen aus Stein getragen wurden. Der heitere Tag machte den Tressenbesatz der Uniformen, die Ordenssterne auf den wattierten Brustwölbungen, die breiten Goldstreifen an den Beinkleidern der Würdenträger erglitzern.
Man unterhielt sich schlecht. Beständig hoben sich Dreimaster und weißbekleidete Hände vor Münder, die sich krampfhaft öffneten. Fast alle Herren hatten Tränen in den Augen. Mehrere hatten nicht Zeit gefunden zu frühstücken. Einige suchten Zerstreuung, indem sie das Operationsbesteck und das kugelförmige, in Leder gehüllte Chloroformgefäß, das Generalarzt Eschrich hier für alle Fälle niedergelegt hatte, einem furchtsamen Studium unterzogen. Nachdem Oberhofmarschall von Bühl zu Bühl, ein starker Mann mit schwänzelnden Bewegungen, einem braunen Tupee, goldenem Zwicker und langen, gelben Fingernägeln, in seiner abgerissen plappernden Art mehrere Geschichten erzählt hatte, machte er in einem Lehnstuhl von seiner Gabe Gebrauch, mit offenen Augen zu schlafen, – reglosen Blicks und in bester Haltung das Bewußtsein von Zeit und Raum zu verlieren, ohne die Würde des Ortes im mindesten zu verletzen.
Dr. von Schröder, Minister der Finanzen und der Landwirtschaft, hatte an diesem Tage ein Gespräch mit dem Staatsminister Dr. Baron Knobelsdorff, Minister des Inneren, des Äußeren und des großherzoglichen Hauses. Es war eine sprunghafte Plauderei, die mit einer Kunstbetrachtung anhob, zu finanziellen und ökonomischen Fragen überging, eines hohen Hofbeamten in ziemlich abfälligem Sinne gedachte und sich auch mit den Personen der allerhöchsten Herrschaften beschäftigte. Sie begann, als die Herren, die Hände mit ihren Hüten auf dem Rücken, vor einem der Gemälde im Großen Bankettsaal standen, und beide dachten mehr dabei, als sie aussprachen. Der Finanzminister sagte: »Und dies? Was ist dies? Was passiert da? Exzellenz sind so orientiert …«
»Oberflächlich. Es ist die Belehnung zweier jugendlicher Prinzen des Hauses durch ihren Oheim, den römischen Kaiser. Exzellenz sehen da die beiden jungen Herren knien und in großer Zeremonie ihren Eid auf das Schwert des Kaisers leisten …«
»Schön, ungewöhnlich schön! Welche Farben! Blendend. Was für reizende goldene Locken die Prinzen haben! Und der Kaiser … es ist der Kaiser wie er im Buche steht! Ja, dieser Lindemann verdient die Auszeichnungen, die ihm zuteil geworden sind.«
»Durchaus. Die ihm zuteil geworden sind; die verdient er.«
Dr. von Schröder, ein langer Mann mit weißem Bart, einer zart gebauten goldenen Brille auf der weißen Nase, einem kleinen Bauch, der sich unvermittelt unter dem Magen erhob, und einem Wulstnacken, der den gestickten Stehkragen seines Fracks überquoll, blickte, ohne die Augen von dem Bilde zu wenden, ein wenig zweifelhaft drein, von einem Mißtrauen berührt, das ihn zuzeiten im Gespräch mit dem Baron überkam. Dieser Knobelsdorff, dieser Günstling und höchste Beamte war so vieldeutig … Zuweilen waren seine Äußerungen, seine Erwiderungen von einem ungreifbaren Spott umspielt. Er war weit gereist, er kannte den Erdball, er war so mannigfach unterrichtet, auf eine befremdende und freie Art interessiert. Dennoch war er korrekt … Herr von Schröder verstand sich nicht völlig auf ihn. Bei aller Übereinstimmung war es nicht möglich, sich ganz im Einverständnis mit ihm zu fühlen. Seine Meinungen waren voll heimlicher Reserve, seine Urteile von einer Duldsamkeit, die in Unruhe ließ, ob sie Gerechtigkeit oder Geringschätzung bedeute. Aber das Verdächtigste war sein Lächeln, ein Augenlächeln ohne Anteil des Mundes, das vermöge strahlenförmig an den äußeren Augenwinkeln angeordneter Fältchen zu entstehen schien oder umgekehrt mit der Zeit diese Fältchen hervorgerufen hatte … Baron Knobelsdorff war jünger als der Finanzminister, ein Mann in den besten Jahren damals, obwohl sein gestutzter Schnurrbart und sein glatt in der Mitte gescheiteltes Haupthaar schon leicht ergraut waren, – untersetzt übrigens, kurzhalsig und von dem Kragen seines bis zum Saume betreßten Hofkleides sichtlich beengt. Er überließ Herrn von Schröder einen Augenblick seiner Ratlosigkeit und fuhr dann fort: »Nur wäre vielleicht im Interesse einer löblichen Hof-Finanz-Direktion zu wünschen, daß der berühmte Mann sich ein wenig mehr mit Sternen und Titeln begnügte und … roh gesprochen, was mag dieses gefällige Bildwerk gekostet haben?«
Herr von Schröder gewann wieder Leben. Der Wunsch, die Hoffnung, sich mit dem Baron zu verständigen, dennoch zur Intimität und vertraulichen Einhelligkeit mit ihm zu gelangen, machte ihn eifrig.
»Genau mein Gedanke!« sagte er, indem er sich wandte, um den Gang durch die Säle wieder aufzunehmen. »Exzellenz nehmen mir die Frage vom Munde. Was mag für diese ›Belehnung‹ bezahlt worden sein? Was für die übrige Farbenpracht hier an den Wänden? Denn in summa hat die Restauration der Burg vor sechs Jahren eine Million gekostet.«
»Schlecht gerechnet.«
»Rund und nett! Und diese summa geprüft und genehmigt vom Ober-Hofmarschall von Bühl zu Bühl, der sich dort hinten seiner angenehmen Katalepsie überläßt, geprüft, genehmigt und ausgekehrt vom Hof-Finanzdirektor Grafen Trümmerhauff …«
»Ausgekehrt oder schuldig geblieben.«
»Eins von beidem! … Diese summa, sage ich, auferlegt und zugemutet einer Kasse, einer Kasse …«
»Mit einem Worte: der Kasse der großherzoglichen Vermögensverwaltung.«
»Exzellenz wissen so gut wie ich, was Sie damit sagen. Nein, mir wird kalt … ich beschwöre, daß ich weder ein Knicker noch ein Hypochonder bin, aber mir wird kalt in der Herzgrube bei der Vorstellung, daß man im Angesicht der waltenden Verhältnisse gelassenen Sinnes eine Million hinwirft – wofür? für ein Nichts, eine hübsche Grille, für die glänzende Instandsetzung des Stammschlosses, auf dem geboren werden muß …«
Herr von Knobelsdorff lachte: »Ja, mein Gott, die Romantik ist ein Luxus, ein kostspieliger! Exzellenz, ich bin Ihrer Meinung – selbstverständlich. Aber bedenken Sie, daß zuletzt der ganze Mißstand fürstlicher Wirtschaft in diesem romantischen Luxus seinen Grund hat. Das Übel fängt an damit, daß die Fürsten Bauern sind; ihre Vermögen bestehen aus Grund und Boden, ihre Einkünfte aus landwirtschaftlichen Erträgnissen. Heutzutage … Sie haben sich bis zum heutigen Tage noch nicht entschließen können, Industrielle und Finanzleute zu werden. Sie lassen sich mit bedauerlicher Hartnäckigkeit von gewissen obsoleten und ideologischen Grundbegriffen leiten wie zum Beispiel den Begriffen der Treue und Würde. Der fürstliche Besitz ist durch Treue – fideikommissarisch – gebunden. Vorteilhafte Veräußerungen sind ausgeschlossen. Hypothekarische Verpfändung, Kreditbeschaffung zum Zwecke wirtschaftlicher Verbesserungen scheint ihnen unzulässig. Die Administration ist in der freien Ausnutzung geschäftlicher Konjunkturen streng gehindert – durch Würde. Verzeihung, nicht wahr! Ich sage Ihnen Fibelwahrheiten. Wer so sehr wie diese Menschenart auf gute Haltung sieht, kann und will mit der Freizügigkeit und ungehemmten Initiative minder eigensinniger und ideell verpflichteter Geschäftsleute natürlich nicht Schritt halten. Nun denn, was will gegenüber diesem negativen Luxus die positive Million bedeuten, die man einer hübschen Grille wegen, um Eurer Exzellenz Ausdruck zu wiederholen, geopfert hat? Wenn es mit dieser einen sein Bewenden hätte! Aber da haben wir die regelmäßige Kostenlast einer leidlich würdigen Hofhaltung. Da sind die Schlösser und ihre Parks zu unterhalten, Hollerbrunn, Monbrillant, Jägerpreis, nichtwahr … Eremitage, Delphinenort, Fasanerie und die anderen … ich vergesse Schloß Segenhaus und die Ruine Haderstein … vom Alten Schlosse zu schweigen … Sie werden schlecht unterhalten, aber es ist ein Posten … Da ist das Hoftheater, die Galerie, die Bibliothek zu unterstützen. Da sind hundert Ruhegehälter zu zahlen, – auch ohne Rechtspflicht, aus Treue und Würde. Und auf welch fürstliche Art der Großherzog bei der letzten Überschwemmung eingesprungen ist … Aber das ist eine Rede, die ich da halte!«
»Eine Rede«, sagte der Finanzminister, »mit der Eure Exzellenz mir zu opponieren gedachten, während Sie mich damit unterstützen. – Teuerster Baron« – und hierbei legte Herr von Schröder die Hand aufs Herz – »ich gebe mich der Sicherheit hin, daß über meine Gesinnung, meine loyale Gesinnung zwischen Ihnen und mir jedes Mißverständnis ausgeschlossen ist. Der König kann nicht unrecht tun … Die höchste Person ist über jeden Vorwurf erhaben. Aber eine Schuld … ach, ein doppelsinniges Wort! … eine Schuld ist vorhanden, und ich wälze sie ohne Zögern auf den Grafen Trümmerhauff. Daß die früheren Inhaber seines Postens ihre Souveräne über die materielle Lage des Hofes hinwegtäuschten, lag im Geiste der Zeiten und war verzeihlich. Das Verhalten des Grafen Trümmerhauff ist es nicht mehr. Ihm, in seiner Eigenschaft als Hof-Finanzdirektor hätte es obgelegen, der herrschenden … Sorglosigkeit Einhalt zu tun, ihm würde es heute noch obliegen, Seine königliche Hoheit rückhaltlos zu belehren …«
Herr von Knobelsdorff lächelte mit emporgezogenen Brauen.
»Wirklich?« sagte er. »Es ist also Euerer Exzellenz Anschauung, daß die Ernennung des Grafen zu diesem Ende erfolgt ist? Und ich, ich male mir das berechtigte Erstaunen dieses Edelmannes aus, wenn Sie ihm Ihre Auffassung der Dinge darlegten. Nein, nein … Exzellenz dürfen sich nicht darüber täuschen, daß diese Ernennung eine ganz gemessene Willensäußerung Seiner königlichen Hoheit in sich schloß, die der Ernannte als Erster zu achten hatte. Sie bedeutete nicht nur ein Ich weiß nichts, sondern auch ein Ich will nichts wissen. Man kann eine ausschließlich dekorative Persönlichkeit und dennoch befähigt sein, dies zu begreifen … Im übrigen … aufrichtig … wir alle haben es begriffen. Und für uns alle gilt zuletzt nur ein mildernder Umstand: dieser, daß in der Welt kein Fürst lebt, zu dem von seinen Schulden zu sprechen eine fatalere Sache wäre, als zu Seiner königlichen Hoheit. Unser Herr hat in seinem Wesen ein Etwas, das einem solche Mesquinerien auf der Lippe ersterben läßt …«
»Sehr wahr. Sehr wahr«, sagte Herr von Schröder. Er seufzte und streichelte gedankenvoll den Schwanbesatz seines Hutes. Die beiden Herren saßen, einander halb zugewandt, an erhöhtem Ort, einem Fensterplatz in geräumiger Nische, an welcher draußen ein schmaler Steingang vorbeilief, eine Art Galerie, die durch spitze Bögen den Blick auf das Städtchen freigab. Herr von Schröder sagte wieder:
»Sie antworten mir, Baron, Sie scheinen mir zu widersprechen, und Ihre Worte sind im Inneren ungläubiger und bitterer als die meinen.«
Herr von Knobelsdorff schwieg mit einer vagen und anheimgebenden Geste.
»Es mag sein«, sagte der Finanzminister und nickte trübe auf seinen Hut hinunter. »Exzellenz mögen recht haben. Vielleicht sind wir alle schuldig, wir und unsere Vorgänger. Was hätte nicht alles verhindert werden müssen! Sehen Sie, Baron, einmal, es ist zehn Jahre her, bot sich eine Gelegenheit, die Finanzen des Hofes zu sanieren, zu bessern auch nur, wenn Sie wollen. Sie ist versäumt worden. Wir verstehen einander. Der Großherzog hatte es damals, bestrickender Mann, der er ist, in der Hand, die Verhältnisse durch eine Heirat, die von einem gesunden Standpunkt hätte glänzend genannt werden können, zu rangieren. Statt dessen … meine persönlichen Empfindungen beiseite … aber ich vergesse niemals die Jammermiene, mit der man im ganzen Lande die Ziffer der Mitgift nannte …«
»Die Großherzogin«, sagte Herr von Knobelsdorff, und die Fältchen an seinen Augenwinkeln verschwanden fast ganz, »ist eine der schönsten Frauen, die ich je gesehen habe.«
»Eine Erwiderung, die Euerer Exzellenz zu Gesichte steht. Eine ästhetische Erwiderung. Eine Erwiderung, die Stich halten würde, auch wenn die Wahl Seiner königlichen Hoheit, wie die seines Bruders Lambert auf ein Mitglied des Hofballetts gefallen wäre …«
»O, da bestand keine Gefahr. Der Geschmack des Herrn ist schwer zu befriedigen, er hat es gezeigt. Seine Bedürfnisse haben immer das Gegenstück zu jenem Mangel an Wahl gebildet, den Prinz Lambert zeit seines Lebens an den Tag gelegt hat. Er hat sich spät zur Ehe entschlossen. Man hatte die Hoffnung auf direkte Nachkommenschaft nachgerade aufgegeben. Man bequemte sich wohl oder übel, in dem Prinzen Lambert, über dessen … Indisponiertheit wir einig sein werden, den Thronerben zu sehen. Da, wenige Wochen nach seiner Thronbesteigung, lernt Johann Albrecht die Prinzessin Dorothea kennen, er ruft aus: Diese oder keine! und das Großherzogtum hat eine Landesmutter. Exzellenz erwähnten der bedenklichen Mienen, die entstanden, als die Ziffer der Mitgift bekannt wurde, – Sie erwähnten nicht des Jubels, der gleichwohl herrschte. Eine arme Prinzessin, allerdings. Aber ist die Schönheit, solche Schönheit, eine beglückende Macht oder nicht? Unvergeßlich ihr Einzug! Sie war geliebt, als ihr erstes Lächeln über das schauende Volk hinflog. Exzellenz müssen mir gestatten, mich wieder einmal zu dem Glauben an den Idealismus des Volkes zu bekennen. Das Volk will sein Bestes, sein Höheres, seinen Traum, will irgend etwas wie seine Seele in seinen Fürsten dargestellt sehen – nicht seinen Geldbeutel. Den zu repräsentieren sind andere Leute da …«
»Sie sind nicht da. Bei uns nicht da.«
»Ein bedauerliches Faktum für sich. Die Hauptsache: Dorothea hat uns einen Thronfolger beschert …«
»In dem der Himmel einigen Zahlensinn entwickeln möge!«
»Einverstanden …«
Hier endete das Gespräch der beiden Minister. Es brach ab, es wurde unterbrochen und zwar dadurch, daß Flügeladjutant von Lichterloh die glücklich vollzogene Entbindung meldete. Eine Bewegung entstand im kleinen Bankettsaal, und alle Herren fanden sich plötzlich dort zusammen. Die eine der großen, geschnitzten Türen war lebhaft geöffnet worden, und der Adjutant stand im Saale. Er hatte ein gerötetes Gesicht, blaue Soldatenaugen, einen flächsernen, gesträubten Schnurrbart und silberne Gardetressen an seinem Kragen. Bewegt und ein wenig außer sich, wie ein Mann, der von tödlicher Langerweile erlöst und einer freudigen Nachricht voll ist, setzte er sich im Gefühl des außerordentlichen Augenblicks keck über Form und Vorschrift hinweg. Er salutierte lustig, indem er mit gespreiztem Ellenbogen den Griff seines Säbels beinahe zur Brusthöhe hinaufzog und rief mit übermütigem Schnarren: »Melde gehorsamst: Ein Prinz!«
»A la bonne heure«, sagte Generaladjutant Graf Schmettern.
»Erfreulich, sehr erfreulich, das nenne ich höchst erfreulich!« sagte Oberhofmarschall von Bühl zu Bühl in seiner plappernden Art; er war sofort ins Bewußtsein zurückgekehrt.
Oberkirchenratspräsident D. Wislizenus, ein glattgesichtiger Herr von schöner Tournüre, der als Sohn eines Generals und dank seiner persönlichen Distinktion in verhältnismäßig jungen Jahren zu seiner hohen Würde gelangt war, und auf dessen seidigem schwarzen Rock sich ein Ordensstern wölbte, faltete seine weißen Hände unterhalb der Brust und sagte mit wohllautender Stimme: »Gott segne Seine großherzogliche Hoheit!«
»Sie vergessen, Herr Hauptmann«, sagte Herr von Knobelsdorff lächelnd, »daß Sie mit Ihren Konstatierungen in meine Rechte und Pflichten eingreifen. Bevor ich nicht über die Sachlage gründlichste Erhebungen angestellt, bleibt die Frage, ob Prinz oder Prinzessin, durchaus unentschieden …«
Man lachte hierüber, und Herr von Lichterloh antwortete: »Zu Befehl, Exzellenz! Ich habe denn auch die Ehre, Euere Exzellenz in höchstem Auftrage zu ersuchen …«
Diese Wechselrede bezog sich auf des Staatsministers Eigenschaft als Standesbeamter des großherzoglichen Hauses, in welcher Eigenschaft er berufen und gehalten war, das Geschlecht des fürstlichen Kindes nach eigenem Augenschein festzustellen und amtlich aufzunehmen. Herr von Knobelsdorff erledigte diese Formalität in dem sogenannten Frisierkabinett, wo das Neugeborene gebadet worden war, verweilte sich aber länger dort, als er selbst erwartet hatte, nachträglich stutzig gemacht und angehalten durch eine peinliche Beobachtung, über die er zunächst gegen jedermann, ausgenommen gegen die Hebamme, Stillschweigen bewahrte.
Die Doktorin Gnadebusch enthüllte ihm das Kind, und ihre hinter den dicken Brillengläsern geheimnisvoll glänzenden Augen gingen zwischen dem Staatsminister und dem kleinen, kupferfarbenen und mit einem – nur einem – Händchen blindlings greifenden Wesen hin und her, als wollte sie fragen: »Stimmt es?« – Es stimmte, Herr von Knobelsdorff war befriedigt, und die weise Frau hüllte das Kind wieder ein. Aber auch dann noch ließ sie nicht ab, auf den Prinzen nieder und zu dem Baron emporzublicken, bis sie seine Augen dorthin gelenkt hatte, wo sie sie haben wollte. Die Fältchen an seinen Augenwinkeln verschwanden, er zog die Brauen zusammen, prüfte, verglich, betastete, untersuchte den Fall zwei, drei Minuten lang und fragte schließlich: »Hat der Großherzog das schon gesehen?«
»Nein, Exzellenz.«
»Wenn der Großherzog das sieht«, sprach Herr von Knobelsdorff, »so sagen Sie ihm, daß es sich auswächst.«
Und den Herren im Hoch-Erdgeschoß berichtete er: »Ein kräftiger Prinz!«
Aber zehn oder fünfzehn Minuten nach ihm machte auch der Großherzog die mißliche Entdeckung, – das war unvermeidlich und hatte für Generalarzt Eschrich eine kurze, außerordentlich unangenehme Szene zur Folge, für den Grimmburger Doktor Sammet aber eine Unterredung mit dem Großherzog, die ihn sehr in dessen Achtung steigen ließ und ihm in seiner späteren Laufbahn von Nutzen war. Kurz zusammengefaßt, ging dies alles vor sich wie folgt.
Während der Nachgeburt hatte Johann Albrecht sich wieder in der »Bibliothek« aufgehalten und sich dann einige Zeit, Hand in Hand mit seiner Gemahlin, am Wochenbette verweilt. Hierauf begab er sich in das »Frisierkabinett«, wo der Säugling nun in seinem hohen, zierlich vergoldeten und halb von einer blauseidenen Gardine umhüllten Bettchen lag, und ließ sich in einem rasch herzugezogenen Armstuhl zur Seite seines kleinen Sohnes nieder. Aber während er saß und das schlummernde Kind betrachtete, geschah es, daß er wahrnahm, was man ihm gern noch verhehlt hätte. Er zog die Decke weiter zurück, verfinsterte sich und tat dann alles, was vor ihm Herr von Knobelsdorff getan hatte, sah nacheinander die Doktorin Gnadebusch und die Wärterin an, die verstummten, warf einen Blick auf die angelehnte Tür zur Kemenate und kehrte erregten Schrittes in die Bibliothek zurück.
Hier ließ er sofort die silberne, mit einem Adler geschmückte Druckglocke ertönen, die auf dem Schreibtisch stand, und sagte zu Herrn von Lichterloh, der klirrend eintrat, sehr kurz und kalt: »Ich ersuche Herrn Eschrich.«
Wenn der Großherzog auf eine Person seiner Umgebung zornig war, so pflegte er den Betreffenden für den Augenblick all seiner Titel und Würden zu entkleiden und ihm nichts als seinen nackten Namen zu lassen.
Der Flügeladjutant klirrte aufs neue mit seinen Sporen und zog sich zurück. Johann Albrecht schritt ein paarmal heftig knarrend durch das Gemach und nahm dann, als er hörte, daß Herr von Lichterloh den Befohlenen in das Vorzimmer einführte, am Schreibtisch Audienzhaltung an.
Wie er da stand, den Kopf herrisch ins Halbprofil gewandt, die Linke, die den mit Atlas ausgeschlagenen Gehrock von der weißen Weste hinwegraffte, fest in die Hüfte gestemmt, glich er genau seinem Porträt von der Hand des Professors von Lindemann, welches, als Gegenstück zu dem Dorotheas, im Residenzschloß, im »Saal der zwölf Monate« zur Seite des großen Spiegels über dem Kamine hing und von dem zahllose Nachbildungen, Photographien und illustrierte Postkarten, im Publikum verbreitet waren. Der Unterschied war nur der, daß Johann Albrecht auf jenem Bildnis von heldischer Figur erschien, während er in Wirklichkeit kaum mittelgroß war. Seine Stirn war hoch vor Kahlheit, und unter ergrauten Brauen blickten seine blauen Augen, matt umschattet, mit einem müden Hochmut ins Weite. Er hatte die breiten, ein wenig zu hoch sitzenden Wangenknochen, die ein Merkmal seines Volkes waren. Sein Backenbart und das Bärtchen an der Unterlippe waren grau, der gedrehte Schnurrbart beinahe schon weiß. Von den geblähten Flügeln seiner gedrungenen, aber vornehm gebogenen Nase liefen zwei ungewöhnlich tief schürfende Furchen schräg in den Bart hinab. In dem Ausschnitt seiner Pikeeweste leuchtete das zitronengelbe Band des Hausordens zur Beständigkeit. Im Knopfloch trug der Großherzog ein Nelkensträußchen.
Generalarzt Eschrich war mit tiefer Verbeugung eingetreten. Er hatte sein Operationsgewand abgelegt. Sein gelähmtes Augenlid hing schwerer als sonst über den Augapfel hinab. Er machte einen finsteren und unseligen Eindruck.
Der Großherzog, die Linke in der Hüfte, warf den Kopf zurück, streckte die Rechte aus und bewegte sie, die Handfläche nach oben, mehrmals kurz und ungeduldig in der Luft hin und her.
»Ich erwarte eine Erklärung, eine Rechtfertigung, Herr Generalarzt«, sagte er mit vor Gereiztheit schwankender Stimme. »Sie werden die Güte haben, mir Rede zu stehen. Was ist das mit dem Arm des Kindes?«
Der Leibarzt hob ein wenig die Arme – eine schwache Geste der Ohnmacht und der Schuldlosigkeit. Er sagte:
»Geruhen Königliche Hoheit … Ein unglücklicher Zufall. Ungünstige Umstände während der Schwangerschaft Ihrer Königlichen Hoheit …«
»Das sind Phrasen!« Der Großherzog war so erregt, daß er eine Rechtfertigung nicht einmal wünschte, sie geradezu verhinderte. »Ich bemerke Ihnen, mein Herr, daß ich außer mir bin. Unglücklicher Zufall! Sie hatten unglückliche Zufälle hintanzuhalten …«
Der Generalarzt stand in halber Verneigung da und sprach mit unterwürfig gesenkter Stimme auf den Fußboden hinab.
»Ich bitte gehorsamst, erinnern zu dürfen, daß ich zum wenigsten nicht allein die Verantwortung trage. Geheimrat Grasanger hat Ihre königliche Hoheit untersucht – eine gynäkologische Autorität … Aber niemanden kann in diesem Falle Verantwortung treffen …«
»Niemanden … Ah! Ich erlaube mir, Sie verantwortlich zu machen … Sie stehen mir ein … Sie haben die Schwangerschaft überwacht, die Entbindung geleitet. Ich habe auf die Kenntnisse gebaut, die Ihrem Range entsprechen, Herr Generalarzt, ich habe in Ihre Erfahrung Vertrauen gesetzt. Ich bin schwer getäuscht, schwer enttäuscht. Der Erfolg Ihrer Gewissenhaftigkeit besteht darin, daß ein … krüppelhaftes Kind ins Leben tritt …«
»Wollen Königliche Hoheit allergnädigst erwägen …«
»Ich habe erwogen. Ich habe gewogen und zu leicht befunden. Ich danke!«
Generalarzt Eschrich entfernte sich rückwärts, in gebeugter Haltung. Im Vorzimmer zuckte er die Achseln, sehr rot im Gesicht. Der Großherzog schritt wieder in der »Bibliothek« auf und ab, knarrend in seinem fürstlichen Zorn, unbillig, unbelehrt und töricht in seiner Einsamkeit. Sei es aber, daß er den Leibarzt noch weiter zu kränken wünschte oder daß er es bereute, sich selbst um jede Aufklärung gebracht zu haben, – nach zehn Minuten trat das Unerwartete ein, daß der Großherzog durch Herrn von Lichterloh den jungen Doktor Sammet zu sich in die »Bibliothek« befehlen ließ.
Der Doktor, als er die Nachricht empfing, sagte wieder: »Ganz gern … ganz gern …« und verfärbte sich sogar ein wenig, benahm sich dann aber ausgezeichnet. Zwar beherrschte er die Form nicht völlig und verbeugte sich zu früh, schon in der Tür, so daß der Adjutant diese nicht hinter ihm schließen konnte und ihm die Bitte zuraunen mußte, weiter vorzutreten; dann aber stand er frei und angenehm da und antwortete befriedigend, obgleich er die Gewohnheit zeigte, beim Sprechen ein wenig schwer, mit zögernden Vorlauten anzusetzen und häufig, wie zu schlichter Bekräftigung, ein »Ja« zwischen seinen Sätzen einzuschalten. Er trug sein dunkelblondes Haar bürstenartig beschnitten und den Schnurrbart sorglos hängend. Kinn und Wangen waren sauber rasiert und ein wenig wund davon. Er hielt den Kopf leicht seitwärts geneigt, und der Blick seiner grauen Augen sprach von Klugheit und tätiger Sanftmut. Seine Nase, zu flach auf den Schnurrbart abfallend, deutete auf seine Herkunft hin. Er hatte zum Frack eine schwarze Halsbinde angelegt, und seine gewichsten Stiefel waren von ländlichem Zuschnitt. Eine Hand an seiner silbernen Uhrkette, hielt er den Ellenbogen dicht am Oberkörper. Redlichkeit und Sachlichkeit waren in seiner Erscheinung ausgedrückt; sie erweckte Vertrauen.
Der Großherzog redete ihn ungewöhnlich gnädig an, ein wenig in der Art eines Lehrers, der einen schlechten Schüler gescholten hat und sich mit plötzlicher Milde zu einem anderen wendet.
»Herr Doktor, ich habe Sie bitten lassen … Ich wünsche Auskunft von Ihnen in betreff dieser Erscheinung an dem Körper des neugeborenen Prinzen … Ich nehme an, daß sie Ihnen nicht entgangen ist … Ich stehe vor einem Rätsel … einem äußerst schmerzlichen Rätsel … Mit einem Wort, ich bitte um Ihre Ansicht.« Und der Großherzog, die Stellung wechselnd, endete mit einer vollkommen schönen Handbewegung, die dem Doktor das Wort ließ.
Dr. Sammet sah ihm still und aufmerksam zu, wartete gleichsam ab, bis der Großherzog mit seinem ganzen fürstlichen Benehmen fertig war. Dann sagte er: »Ja. – Es handelt sich also um einen Fall, der zwar nicht allzuhäufig eintritt, der uns aber doch wohlbekannt und vertraut ist. Ja. Es ist im wesentlichen ein Fall von Atrophie …«
»Ich muß bitten … ›Atrophie‹ …«
»Verzeihung, Königliche Hoheit. Ich meine von Verkümmerung. Ja.«
»Sehr richtig. Verkümmerung. Das trifft zu. Die linke Hand ist verkümmert. Aber das ist unerhört! Ich begreife das nicht! Niemals ist dergleichen in meiner Familie vorgekommen! Man spricht neuerdings von Vererbung …«
Wieder betrachtete der Doktor still und aufmerksam diesen entrückten und gebietenden Herrn, zu dem ganz kürzlich die Kunde gedrungen war, daß man neuerdings von Vererbung spreche. Er antwortete einfach: »Verzeihung, Königliche Hoheit; aber von Vererbung kann in dem vorliegenden Fall auch gar nicht die Rede sein.«
»Ach! Wirklich nicht!« sagte der Großherzog ein wenig spöttisch. »Ich empfinde das als Genugtuung. Aber wollen Sie mir freundlichst sagen, wovon denn eigentlich die Rede sein kann.«
»Ganz gern, Königliche Hoheit. Die Mißbildung hat eine rein mechanische Ursache, ja. Sie ist bewirkt worden durch eine mechanische Hemmung während der Entwicklung des Fruchtkeimes. Solche Mißbildungen nennen wir Hemmungsbildungen, ja.«
Der Großherzog horchte mit einem ängstlichen Ekel; er fürchtete sichtlich die Wirkung jedes neuen Wortes auf seine Empfindlichkeit. Er hielt die Brauen zusammengezogen und den Mund geöffnet; seine beiden in den Bart verlaufenden Furchen schienen noch tiefer dadurch. Er sagte: »Hemmungsbildungen … Aber wie in aller Welt … ich kann nicht zweifeln, daß jede Sorgfalt angewandt worden ist …«
»Hemmungsbildungen«, antwortete Dr. Sammet, »können auf verschiedene Weise entstehen. Aber man kann mit ziemlicher Gewißheit sagen, daß in unserem Falle … in diesem Falle das Amnion die Schuld trägt.«
»Ich muß bitten … ›Das Amnion‹ …«
»Das ist eine der Eihäute, Königliche Hoheit. Ja. Und unter gewissen Umständen kann sich die Abhebung dieser Eihaut vom Embryo verzögern und so schwerfällig vor sich gehen, daß sich Fäden und Stränge zwischen beiden ausziehen … amniotische Fäden, wie wir sie nennen, ja. Diese Fäden können gefährlich werden, denn sie können ganze Gliedmaßen des Kindes umschlingen und umschnüren, können zum Beispiel einer Hand völlig die Lebenswege unterbinden und sie allenfalls amputieren, ja.«
»Mein Gott … amputieren. Man muß also noch dankbar sein, daß es nicht zu einer Amputation der Hand gekommen ist?«
»Das hätte geschehen können. Ja. Aber es hat mit einer Abschnürung und infolge davon mit einer Atrophie sein Bewenden gehabt.«
»Und das war nicht zu erkennen, nicht vorauszusehen, nicht zu verhindern?«
»Nein, Königliche Hoheit. Durchaus nicht. Es steht ganz fest, daß niemanden irgendwelches Verschulden trifft. Solche Hemmungen tun im Verborgenen ihr Werk. Wir sind ohnmächtig ihnen gegenüber. Ja.«
»Und die Mißbildung ist unheilbar? Die Hand wird verkümmert bleiben?«
Dr. Sammet zögerte, er sah den Großherzog gütig an.
»Ein völliger Ausgleich wird sich nicht herstellen, das nicht«, sagte er behutsam. »Aber auch die verkümmerte Hand wird sich doch verhältnismäßig ein wenig entwickeln, o ja, das immerhin …«
»Wird sie brauchbar sein? Gebrauchsfähig? Beispielsweise … zum Halten des Zügels oder zu Handbewegungen, wie man sie macht …«
»Brauchbar … ein wenig … Vielleicht nicht sehr. Auch ist ja die rechte Hand da, die ganz gesund ist.«
»Wird es sehr sichtbar sein?« fragte der Großherzog und forschte sorgenvoll in Dr. Sammets Gesicht … »Sehr auffällig? Wird es die Gesamterscheinung sehr beeinträchtigen, meinen Sie?«
»Viele Leute«, antwortete Dr. Sammet ausweichend, »leben und wirken unter schwereren Beeinträchtigungen. Ja.«
Der Großherzog wandte sich ab und tat einen Gang durch das Gemach. Dr. Sammet machte ihm ehrerbietig Platz dazu, indem er sich bis zur Tür zurückzog. Schließlich nahm der Großherzog wieder am Schreibtisch Stellung und sagte:
»Ich bin nun unterrichtet, Herr Doktor; ich danke für Ihren Vortrag. Sie verstehen Ihre Sache, das ist keine Frage. Warum leben Sie in Grimmburg? Warum praktizieren Sie nicht in der Residenz?«
»Ich bin noch jung, Königliche Hoheit, und bevor ich mich in der Hauptstadt einer Spezialpraxis widme, möchte ich mich einige Jahre lang recht vielseitig beschäftigen, auf alle Weise üben und umtun. Dazu bietet ein Landstädtchen wie Grimmburg die beste Gelegenheit. Ja.«
»Sehr ernst, sehr respektabel. Welchem Spezialgebiet denken Sie sich später zuzuwenden?«
»Den Kinderkrankheiten, Königliche Hoheit. Ich beabsichtige, Kinderarzt zu werden. Ja.«
»Sie sind Jude?« fragte der Großherzog, indem er den Kopf zurückwarf und die Augen zusammenkniff …
»Ja, Königliche Hoheit.«
»Ah. – Wollen Sie mir noch die Frage beantworten … Haben Sie Ihre Herkunft je als ein Hindernis auf Ihrem Wege, als Nachteil im beruflichen Wettstreit empfunden? Ich frage als Landesherr, dem die bedingungslose und private, nicht nur amtliche, Geltung des paritätischen Prinzips besonders am Herzen liegt.«
»Jedermann im Großherzogtum«, antwortete Dr. Sammet, »hat das Recht, zu arbeiten.« Aber dann sagte er noch mehr, setzte beschwerlich an, ließ ein paar zögernde Vorlaute vernehmen, indem er auf eine linkisch leidenschaftliche Art seinen Ellenbogen wie einen kurzen Flügel bewegte und fügte mit gedämpfter, aber innerlich eifriger und bedrängter Stimme hinzu: »Kein gleichstellendes Prinzip, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf, wird je verhindern können, daß sich inmitten des gemeinsamen Lebens Ausnahmen und Sonderformen erhalten, die in einem erhabenen oder anrüchigen Sinne vor der bürgerlichen Norm ausgezeichnet sind. Der Einzelne wird gut tun, nicht nach der Art seiner Sonderstellung zu fragen, sondern in der Auszeichnung das Wesentliche zu sehen und jedenfalls eine außerordentliche Verpflichtung daraus abzuleiten. Man ist gegen die regelrechte und darum bequeme Mehrzahl nicht im Nachteil, sondern im Vorteil, wenn man eine Veranlassung mehr, als sie, zu ungewöhnlichen Leistungen hat. Ja. Ja«, wiederholte Dr. Sammet. Es war die Antwort, die er mit zweimaligem Ja bekräftigte.
»Gut … nicht übel, sehr bemerkenswert wenigstens«, sagte der Großherzog abwägend. Etwas Vertrautes, aber auch etwas wie eine Ausschreitung schien ihm in Dr. Sammets Worten zu liegen. Er verabschiedete den jungen Mann mit den Worten: »Lieber Doktor, meine Zeit ist gemessen. Ich danke Ihnen. Diese Unterredung – von ihrer peinlichen Veranlassung abgesehen – hat mich sehr befriedigt. Ich mache mir das Vergnügen, Ihnen das Albrechtskreuz dritter Klasse mit der Krone zu verleihen. Ich werde mich Ihrer erinnern. Ich danke.«
Dies war das Gespräch des Grimmburger Arztes mit dem Großherzog. Ganz kurz darauf verließ Johann Albrecht die Burg und kehrte mit Extrazug in die Residenz zurück, hauptsächlich um sich der festlich bewegten Bevölkerung zu zeigen, dann aber auch, um im Stadtschloß mehrere Audienzen zu erteilen. Es stand fest, daß er abends auf die Stammburg zurückkehren und für die nächsten Wochen dort Wohnung nehmen würde.
Alle Herren, welche sich zu der Entbindung auf Grimmburg eingefunden hatten und nicht zum Hofstaat der Großherzogin gehörten, wurden ebenfalls von dem Extrazuge der unrentablen Lokalbahn aufgenommen und fuhren zum Teil in unmittelbarer Gesellschaft des Monarchen. Aber den Weg von der Burg zur Station legte der Großherzog allein mit dem Staatsminister von Knobelsdorff im offenen Landauer zurück, einem der braun lackierten Hofwagen mit der kleinen goldenen Krone am Schlage. Die weißen Federn auf dem Hute des Leibjägers vorn flatterten im Sommerwinde. Johann Albrecht war ernst und stumm auf dieser Fahrt, zeigte sich bedrückt und grämlich; und obgleich Herr von Knobelsdorff wußte, daß der Großherzog es auch im intimen Verkehr schlecht ertrug, daß man ungefragt und ohne Aufforderung das Wort an ihn richte, so unternahm er es endlich doch, das Schweigen zu brechen.
»Königliche Hoheit«, sagte er bittend, »scheinen sich die kleine Anomalie, die man am Körper des Prinzen ausfindig gemacht hat, so sehr zu Herzen zu nehmen … Dennoch sollte man glauben, daß an diesem Tage die Beweggründe zur Freude und stolzen Dankbarkeit so sehr überwiegen …«
»Ach lieber Knobelsdorff«, antwortete Johann Albrecht gereizt und beinahe weinerlich, »Sie werden mir meine Verstimmung nachsehen, Sie werden nicht geradezu verlangen, daß ich trällere. Ich sehe keinerlei Veranlassung dazu. Die Großherzogin befindet sich wohl – nun gewiß. Und das Kind ist ein Knabe – nochmals gut. Aber da kommt es nun mit einer Atrophie zur Welt, einer Hemmungsbildung, veranlaßt durch amniotische Fäden. Niemand hat Schuld daran, es ist ein Unglück. Aber die Unglücksfälle, an denen niemand schuld ist, das sind die eigentlich schrecklichen Unglücksfälle, und der Anblick des Fürsten soll seinem Volke andere Empfindungen erwecken als Mitleid. Der Erbgroßherzog ist zart, man muß beständig für ihn fürchten. Es war ein Wunder, daß er vor zwei Jahren die Rippenfellentzündung überstand, und es wird nicht viel weniger als ein Wunder sein, wenn er zu Jahren gelangt. Nun schenkt mir der Himmel einen zweiten Sohn, – er scheint kräftig, aber er kommt mit einer Hand zur Welt. Die andere ist verkümmert, unbrauchbar, eine Mißbildung, er muß sie verstecken. Welche Erschwerung! Welch Hindernis! Er muß es beständig vor der Welt bravieren. Man wird es allmählich bekannt machen müssen, damit es bei seinem ersten öffentlichen Hervortreten nicht allzu anstößig wirkt. Nein, ich komme noch nicht hinweg darüber. Ein Prinz mit einer Hand …«
»Mit einer Hand«, sagte Herr von Knobelsdorff. »Sollten Königliche Hoheit diese Wendung mit Absicht wiederholen?«
»Mit Absicht?«
»Also nicht? … Denn der Prinz hat ja zwei Hände, nur daß die eine verkümmert ist und daß man, wenn man will, also sagen kann, es sei ein Prinz mit einer Hand.«
»Nun also?«
»Und daß man also fast wünschen müßte, nicht Eurer Königlichen Hoheit zweiter Sohn, sondern der unter der Krone Geborene möchte der Träger dieser kleinen Mißgestaltung sein.«
»Was sagen Sie da?«
»Nun, Königliche Hoheit werden mich auslachen; aber ich denke an die Zigeunerin.«
»Die Zigeunerin? Ich bin geduldig, lieber Baron!«
»An die Zigeunerin – Verzeihung! – die das Erscheinen eines Fürsten aus Eurer Königlichen Hoheit Haus – eines Fürsten ›mit einer Hand‹ – das ist die überlieferte Wendung – vor hundert Jahren geweissagt und an das Erscheinen dieses Fürsten eine gewisse, sonderbar formulierte Verheißung geknüpft hat.«
Der Großherzog wandte sich im Fond und blickte stumm in Herrn von Knobelsdorffs Augen, an deren äußeren Winkeln die strahlenförmigen Fältchen spielten.
»Sehr unterhaltend!« sagte er dann und setzte sich wieder zurecht.
»Prophezeiungen«, fuhr Herr von Knobelsdorff fort, »pflegen sich in der Weise zu erfüllen, daß Umstände eintreten, die man, einigen guten Willen vorausgesetzt, in ihrem Sinne deuten kann. Und gerade durch die großzügige Fassung jeder rechten Weissagung wird das sehr erleichtert. ›Mit einer Hand‹, – das ist guter Orakelstil. Die Wirklichkeit bringt einen mäßigen Fall von Atrophie. Aber damit, daß sie das tut, ist viel geschehen, denn wer hindert mich, wer hindert das Volk, die Andeutung für das Ganze zu nehmen und den bedingenden Teil der Weissagung für erfüllt zu erklären? Das Volk wird es tun, und zwar spätestens dann, wenn auch das Weitere, die eigentliche Verheißung sich irgend bewahrheiten sollte, es wird reimen und deuten, wie es das immer getan hat, um erfüllt zu sehen, was geschrieben steht. Ich sehe nicht klar, – der Prinz ist zweitgeboren, er wird nicht regieren, die Meinung des Schicksals ist dunkel. Aber der einhändige Prinz ist da – und so möge er uns denn geben, so viel er vermag.«
Der Großherzog schwieg, im Innern durchschauert von dynastischen Träumereien.
»Nun, Knobelsdorff, ich will Ihnen nicht böse sein. Sie wollen mich trösten, und Sie machen Ihre Sache nicht übel. Aber man nimmt uns in Anspruch …«
Die Luft schwang von entferntem, vielstimmigem Hochgeschrei. Grimmburger Publikum staute sich schwärzlich an der Station hinter dem Kordon. Amtliche Personen standen in Erwartung der Equipagen einzeln davor. Man bemerkte den Bürgermeister, wie er den Zylinder lüftete, sich mit einem bedruckten Schnupftuch die Stirn trocknete und einen Zettel vor die Augen führte, dessen Inhalt er memorierte. Johann Albrecht nahm die Miene an, mit der er die schlichte Ansprache entgegennehmen und kurz und gnädig beantworten würde: »Mein lieber Herr Bürgermeister …« Das Städtchen war beflaggt; seine Glocken läuteten.
Alle Glocken der Hauptstadt läuteten. Und abends war Freudenbeleuchtung dort, ohne besondere Aufforderung von seiten des Magistrats, aus freien Stücken, – große Illumination in allen Bezirken der Stadt.
DAS LAND
Das Land maß achttausend Quadratkilometer und zählte eine Million Einwohner.
Ein schönes, stilles, unhastiges Land. Die Wipfel seiner Wälder rauschten verträumt; seine Äcker dehnten und breiteten sich, treu bestellt; sein Gewerbewesen war unentwickelt bis zur Dürftigkeit.
Es besaß Ziegeleien, es besaß ein wenig Salz- und Silberbergbau – das war fast alles. Man konnte allenfalls noch von einer Fremdenindustrie reden, aber sie schwunghaft zu nennen, wäre kühn gewesen. Die alkalischen Heilquellen, die in unmittelbarer Nähe der Hauptstadt dem Boden entsprangen und den Mittelpunkt freundlicher Badeanlagen bildeten, machten die Residenz zum Kurort. Aber während das Bad um den Ausgang des Mittelalters von weither besucht gewesen war, hatte sich später sein Ruf verloren, war von den Namen anderer übertönt und in Vergessenheit gebracht worden. Die gehaltvollste seiner Quellen, Ditlindenquelle genannt, ungewöhnlich reich an Lithiumsalzen, hatte man erst kürzlich, unter der Regierung Johann Albrechts III., erschürft. Und da es an einem nachdrücklichen und hinlänglich marktschreierischen Betriebe fehlte, war es noch nicht gelungen, ihr Wasser in der Welt zu Ehren zu bringen. Man versandte hunderttausend Flaschen davon im Jahr, – eher weniger als mehr. Und nicht viele Fremde reisten herbei, um es an Ort und Stelle zu trinken …
Alljährlich war im Landtage von »wenig« günstigen finanziellen Ergebnissen der Verkehrsanstalten die Rede, womit ein durchaus und vollständig ungünstiges Ergebnis bezeichnet und festgestellt werden sollte, daß die Lokalbahnen sich nicht rentierten und die Eisenbahnen nichts abwarfen, – betrübende, aber unabänderliche und eingewurzelte Tatsachen, die der Verkehrsminister in lichtvollen, aber immer wiederkehrenden Ausführungen mit den friedlichen kommerziellen und gewerblichen Verhältnissen des Landes, sowie mit der Unzulänglichkeit der heimischen Kohlenlager erklärte. Krittler fügten dem etwas von mangelhaft organisierter Verwaltung der staatlichen Verkehrsanstalten hinzu. Aber Widerspruchsgeist und Verneinung waren nicht stark im Landtage; eine schwerfällige und treuherzige Loyalität war unter den Volksvertretern die vorherrschende Stimmung.
Die Eisenbahnrente stand also unter den Staatseinkünften privatwirtschaftlicher Natur keineswegs an erster Stelle; an erster Stelle stand in diesem Wald- und Ackerlande seit alters die Forstrente. Daß auch sie gesunken, in einem erschreckenden Maße zurückgegangen war, das zu rechtfertigen hatte größere Schwierigkeiten, wiewohl nur zu ausreichende Gründe dafür vorhanden waren.
Das Volk liebte seinen Wald. Es war ein blonder und gedrungener Typ mit blauen, grübelnden Augen und breiten, ein wenig zu hoch sitzenden Backenknochen, ein Menschenschlag, sinnig und bieder, gesund und rückständig. Es hing an dem Wald seines Landes mit den Kräften seines Gemütes, er lebte in seinen Liedern, er war den Künstlern, die es hervorbrachte, Ursprung und Heimat ihrer Eingebungen, und nicht nur im Hinblick auf Gaben des Geistes und der Seele, die er spendete, war er füglich der Gegenstand volkstümlicher Dankbarkeit. Die Armen lasen ihr Brennholz im Walde, er schenkte es ihnen, sie hatten es frei. Sie gingen gebückt, sie sammelten allerlei Beeren und Pilze zwischen seinen Stämmen und hatten ein wenig Verdienst davon. Das war nicht alles. Das Volk sah ein, daß sein Wald auf die Witterungsbeschaffenheit und gesundheitlichen Verhältnisse des Landes vom entscheidendsten günstigen Einfluß war; es wußte wohl, daß ohne den prächtigen Wald in der Umgebung der Residenz der Quellengarten dort draußen sich nie mit zahlenden Fremden füllen würde; und kurz, dies nicht sehr betriebsame und fortgeschrittene Volk hätte begreifen müssen, daß der Wald den wichtigsten Vorzug, den auf jede Art ergiebigsten Stammbesitz des Landes bedeutete.
Dennoch hatte man sich am Walde versündigt, gefrevelt daran seit Jahren und Menschenaltern. Der großherzoglichen Staatsforstverwaltung waren die schwersten Vorwürfe nicht zu ersparen. Dieser Behörde gebrach es an der politischen Einsicht, daß der Wald als ein unveräußerliches Gemeingut erhalten und bewahrt werden mußte, wenn er nicht nur den gegenwärtigen, sondern auch den kommenden Geschlechtern Nutzen gewähren sollte, und daß es sich rächen mußte, wenn man ihn, uneingedenk der Zukunft, zugunsten der Gegenwart maßlos und kurzsichtig ausbeutete.
Das war geschehen und geschah noch immer. Erstens hatte man große Flächen des Waldbodens in ihrer Fruchtbarkeit erschöpft, indem man sie beständig in übertriebener und planloser Weise ihres Streudüngers beraubt hatte. Man war darin wiederholt so weit gegangen, daß man da und dort nicht nur die jüngst gefallene Nadel- und Laubdecke, sondern den größten Teil des Abfalls von Jahren teils als Streu, teils als Humus entfernt und der Landwirtschaft überliefert hatte. Es gab viele Forsten, die von aller Fruchterde entblößt waren; es gab solche, die infolge Streurechens zu Krüppelbeständen entartet waren; und das war bei Gemeindewaldungen sowohl wie bei Staatswaldungen zu beobachten.
Wenn man diese Nutzungen vorgenommen hatte, um einem augenblicklichen Notstand der Landwirtschaft abzuhelfen, so waren sie schlecht und recht zu entschuldigen gewesen. Aber obgleich es nicht an Stimmen fehlte, die einen auf die Verwendung von Waldstreu gegründeten Ackerbau für unratsam, ja gefährlich erklärten, so trieb man den Streuhandel auch ohne besonderen Anlaß aus rein fiskalischen Gründen, wie man sagte, aus Gründen also, die bei Lichte betrachtet nur ein Grund und Zweck waren, der nämlich, Geld zu machen. Denn das Geld war's, woran es fehlte. Aber um welches zu schaffen, vergriff man sich unablässig am Kapital, bis der Tag kam, da man mit Schrecken ersah, daß eine ungeahnte Entwertung dieses Kapitales eingetreten sei.
Man war ein Bauernvolk, und in einem verkehrten, künstlichen und unangemessenen Eifer glaubte man zeitgemäß sein und rücksichtslosen Geschäftsgeist an den Tag legen zu müssen. Ein Merkmal war die Milchwirtschaft … es ist hier ein Wort darüber zu sagen. Klage ward laut, zumal in den amtsärztlichen Jahresberichten, daß ein Rückgang in der Ernährungsweise und also in der Entwicklung der ländlichen Bevölkerung zu beobachten sei. Wie das? Die Viehbesitzer waren versessen darauf, alle verfügbare Vollmilch zu Gelde zu machen. Die gewerbliche Ausbildung der Milchverwertung, die Entwicklung und Ergiebigkeit des Molkereiwesens verlockte sie, das Bedürfnis des eigenen Haushaltes hintanzustellen. Die kräftige Milchnahrung ward selten auf dem Lande, und an ihre Stelle trat mehr und mehr der Genuß von gehaltarmer Magermilch, von minderwertigen Ersatzmitteln, Pflanzenfetten und leider auch von weingeisthaltigen Getränken. Die Krittler sprachen von einer Unterernährung, ja geradezu von einer körperlichen und sittlichen Entkräftung der Landbevölkerung, sie brachten die Tatsachen vor die Kammer, und die Regierung versprach, der Sache ernste Aufmerksamkeit zuzuwenden.
Aber es war allzu klar, daß die Regierung im Grund von demselben Geiste beseelt war, wie die irregeführten Viehbesitzer. Im Staatswalde nahmen die Überhauungen kein Ende, sie waren nicht wieder einzubringen und bedeuteten eine fortschreitende Minderung des öffentlichen Besitzstandes. Sie mochten zuweilen nötig gewesen sein, wenn Schädlinge den Wald heimgesucht hatten, aber oft genug waren sie einzig und allein aus den angeführten fiskalischen Gründen verfügt worden, und statt die aus den Fällungen erzielten Einnahmen zum Ankaufe neuer Forstgrundstücke zu benutzen; statt auch nur die abgehauenen Flächen so rasch als möglich wieder aufzuforsten; statt, mit einem Worte, den Schaden, der dem Staatswalde an seinem Kapitalwert erwachsen war, auch an seinem Kapitalwerte wieder gut zu machen, hatte man die flüssig gemachten Gelder zur Deckung laufender Ausgaben und zur Einlösung von Schuldverschreibungen verbraucht. Nun schien gewiß, daß eine Verringerung der Staatsschuld nur zu wünschenswert sei; aber die Krittler meinten, die Zeiten seien nicht danach angetan, daß man außerordentliche Einkünfte zur Speisung der Tilgungskasse verwenden dürfe.
Wer kein Interesse daran hatte, die Dinge zu beschönigen, mußte die Staatsfinanzen zerrüttet nennen. Das Land trug sechshundert Millionen Schulden, – es schleppte daran mit Geduld, mit Opfermut, aber mit innerlichem Seufzen. Denn die Bürde, an sich viel zu schwer, wurde verdreifacht durch eine Höhe des Zinsfußes und durch Rückzahlungsbedingungen, wie sie einem Lande mit erschüttertem Kredit vorgeschrieben werden, dessen Obligationen tief, tief im Kurse stehen, und das in der Welt der Geldgeber beinahe schon unter die »interessanten« Länder gerechnet wird.
Die Reihe der schlechten Finanzperioden war unabsehbar. Die Ära der Fehlbeträge schien ohne Anfang und Ende. Und eine Mißwirtschaft, an der durch häufigen Personenwechsel nichts gebessert wurde, sah im Borgen die alleinige Heilmethode gegen das schleichende Leiden. Noch Finanzminister von Schröder, dessen reiner Charakter und edle Absichten nicht in Zweifel gezogen werden sollen, erhielt vom Großherzog dafür den persönlichen Adel, daß er unter den schwierigsten Umständen eine neue hochverzinsliche Anleihe zu plazieren gewußt hatte. Er war von Herzen auf eine Hebung des Staatskredits bedacht; aber da er sich nicht anders zu helfen wußte, als indem er neue Schulden machte, während er alte tilgte, so erwies sich sein Verfahren als ein wohlgemeintes aber kostspieliges Blendwerk. Denn beim gleichzeitigen Aufkauf und Verkauf von Schuldscheinen zahlte man einen höheren Preis als man erhielt, und dabei gingen Millionen verloren.
Es war, als ob dies Volk nicht imstande sei, einen Finanzmann von irgend zulänglicher Begabung aus seiner Mitte emporzuheben. Anstößige Praktiken und Vertuschungsmittelchen waren zuzeiten im Schwange. In der Aufstellung des Budgets war der ordentliche vom außerordentlichen Staatsbedarf nicht mehr klar zu unterscheiden. Man spielte ordentliche Posten unter die außerordentlichen und täuschte sich selbst und die Welt über den wahren Stand der Dinge, indem man Anleihen, die vorgeblich für außerordentliche Zwecke gemacht waren, zur Deckung eines Defizits im ordentlichen Etat verwandte … Eine Zeitlang war tatsächlich der Inhaber des Finanz-Portefeuilles ein ehemaliger Hofmarschall.
Dr. Krippenreuther, der gegen Ende der Regierung Johann Albrechts des Dritten ans Ruder kam, war derjenige Minister, welcher, gleich Herrn von Schröder, von der Notwendigkeit eifriger Schuldentilgung überzeugt, im Parlament eine letzte und äußerste Anspannung des Steuerdruckes durchsetzte. Aber das Land, steueruntüchtig von Natur, stand an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit, und Krippenreuther erntete lediglich Haß. Was er vornahm, war nichts als eine Vermögensübertragung von einer Hand in die andere, die sich obendrein mit Verlust vollzog; denn mit der Steuererhöhung lud man der heimischen Volkswirtschaft eine Last auf, die schwerer und unmittelbarer drückte als jene, die man ihr durch die Schuldentilgung abnahm …
Wo also war Abhilfe und Heilung? Ein Wunder, schien es, sei nötig – und, bis es geschähe, die unerbittlichste Sparsamkeit. Das Volk war fromm und treu, es liebte seine Fürsten wie sich selbst, es war von der Erhabenheit der monarchischen Idee durchdrungen, es sah einen Gottesgedanken darin. Aber die wirtschaftliche Beklemmung war zu peinlich, zu allgemein fühlbar. Zum Unbelehrtesten redeten die abgeholzten und verkrüppelten Waldbestände eine klägliche Sprache. Und so hatte es geschehen können, daß im Landtage wiederholt auf Abstriche an der Zivilliste, auf Verkürzung der Apanagen und der Krondotation gedrungen worden war.
Die Zivilliste betrug eine halbe Million, die Einkünfte aus dem der Krone zu eigen gebliebenen Domanialbesitz beliefen sich auf siebenhundertundfünfzigtausend Mark. Das war alles. Und der Hof war verschuldet, – in welchem Maße, das wußte vielleicht Graf Trümmerhauff, der großherzogliche Finanzdirektor, ein formvoller, aber für geschäftliche Dinge ganz und gar unbegabter Herr. Johann Albrecht wußte es nicht, gab sich wenigstens den Anschein, es nicht zu wissen und befolgte darin genau das Beispiel seiner Vorfahren, die ihre Schulden selten einer mehr als flüchtigen Aufmerksamkeit gewürdigt hatten.
Der ehrfürchtigen Gesinnung des Volkes entsprach ein außerordentliches Hoheitsgefühl seiner Fürsten, das zuweilen schwärmerische, ja überreizte Formen angenommen und sich am sichtbarsten und – bedenklichsten zu allen Zeiten als ein Hang zum Aufwand und zur rücksichtslosen, die Hoheit sinnfällig darstellenden Prunkentfaltung geäußert hatte. Ein Grimmburger hatte ausdrücklich den Beinamen des »Üppigen« geführt, – verdient hätten ihn fast alle. Und so war die Verschuldung des Hauses eine geschichtliche und altüberlieferte Verschuldung, die in jene Zeiten zurückwies, wo noch alle Anleihen Privatangelegenheiten der Souveräne gewesen waren, und wo Johann der Gewalttätige, um ein Darlehen zu erhalten, die Freiheit angesehener Untertanen verpfändet hatte.
Das war vorbei; und Johann Albrecht III., seinen Trieben nach ein echtgeborener Grimmburger, war schlechterdings nicht mehr in der Lage, diesen Trieben freien Lauf zu lassen. Seine Väter hatten mit dem Familienvermögen gründlich aufgeräumt, es war gleich Null oder glich nicht viel mehr, es war für den Bau von Lustschlössern, mit französischen Namen und Marmorkolonnaden, für Parks mit Wasserkünsten, für pomphafte Oper und jederlei goldene Schaustellung aufgegangen. Man mußte rechnen, und sehr gegen die Neigung des Großherzogs, ja ohne sein Zutun, war die Hofhaltung allmählich auf kleineren Fuß gesetzt worden.
Über die Lebensführung der Prinzessin Katharina, der Schwester des Großherzogs, sprach man in der Residenz in gerührtem Tone. Sie war mit einem Cognaten des im Nachbarlande regierenden Hauses vermählt gewesen, war, verwitwet, in die Hauptstadt ihres Bruders zurückgekehrt und bewohnte mit ihren rotköpfigen Kindern das ehemalige erbgroßherzogliche Palais an der Albrechtstraße, vor dessen Portal den ganzen Tag mit Kugelstab und Bandelier ein riesiger Türhüter in prahlerischer Haltung stand, und in dessen Innerem es so außerordentlich gemäßigt zuging …
Prinz Lambert, des Großherzogs Bruder, kam wenig in Betracht. Er lag mit seinen Geschwistern, die ihm seine Mißheirat nicht verziehen, in Unfrieden und ging kaum zu Hofe. Mit seiner Gemahlin, die ehemals ihre Pas auf der Bühne des Hoftheaters vollführt hatte und, nach dem Namen eines Gutes, das der Prinz besaß, den Titel einer Freifrau von Rohrdorf führte, lebte er in seiner Villa am Stadtgarten, und dem hageren Sportsmann und Theaterhabitué standen seine Schulden zu Gesichte. Er hatte sich seines Hoheitsscheines begeben, trat ganz als Privatmann auf, und wenn sein Hauswesen im Rufe einer liederlichen Dürftigkeit stand, so erregte das nicht viel Teilnahme.
Aber im Alten Schlosse selbst hatten Veränderungen stattgefunden, Einschränkungen, die in Stadt und Land besprochen wurden, und zwar zumeist in einem ergriffenen und schmerzlichen Sinne, denn im Grunde wünschte das Volk, sich stolz und herrlich dargestellt zu sehen. Man hatte um der Ersparnis willen verschiedene Oberhofämter in eines zusammengezogen, und seit mehreren Jahren war Herr von Bühl zu Bühl Oberhofmarschall, Oberzeremonienmeister und Hausmarschall in einer Person. Man hatte weitgehende Entlassungen im Offizendienst und der Hoflivree, unter den Fourieren, Büchsenspannern und Bereitern, den Hofköchen und Konfektmeistern, den Kammer- und Hoflakaien vorgenommen. Man hatte den Bestand des Marstalles auf das Notwendigste herabgesetzt … Was verschlug das? Des Großherzogs Geldverachtung empörte sich gegen den Zwang in plötzlichen Ausbrüchen, und während die Bewirtung bei den Hoffestlichkeiten die äußerste Grenze erlaubter Einfachheit erreichte, während zum Souper am Schlusse der Donnerstag-Konzerte im Marmorsaal ohne Abwechslung nichts als Roastbeef in Remouladensauce und Gefrorenes auf den roten Sammetdecken der goldbeinigen Tischchen serviert wurde, während an des Großherzogs eigener von Wachskerzen strotzender Tafel alltäglich gespeist wurde wie in einer mittleren Beamtenfamilie, warf er trotzig die Einkunft eines Jahres für die Wiederherstellung der Grimmburg hin.