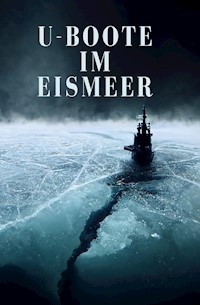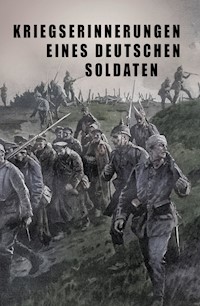
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Der Verfasser dieser Erinnerungen, ein Bergmann aus dem Saarrevier, für dessen Glaubwürdigkeit und guten Charakter wir bürgen, hat in seiner einfachen, schmucklosen Schilderung des Krieges, wie er ist, das stärkste Argument gegen den Krieg nicht nur, sondern gegen jede Art von Militarismus, gegen jede Art von Kriegsbereitschaft geliefert. Ende Juli herrschte in unserer Garnison Koblenz eine fieberhaft erregte Stimmung. Ein Teil unserer Leute war von einer nicht wiederzugebenden Begeisterung, der andere von einer unbeschreiblichen Niedergeschlagenheit beseelt. Die Kriegserklärung lag in der Luft. Ich gehörte zu den Niedergeschlagenen. War ich doch im zweiten Jahre Soldat und sollte in sechs Wochen entlassen werden. Statt der langersehnten Heimfahrt stand nun der Krieg vor der Tür . . . Ich war auch während meiner Militärzeit der Antimilitarist geblieben, der ich vordem gewesen. Ich konnte mir nicht denken, welches Interesse ich an einem Massenmord haben könnte und vertrat auch meinen Kameraden gegenüber die Ansicht, dass ein Krieg unter allen Umständen für die Menschheit das größte Unglück sei, das sie treffen könne.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 249
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kriegs-Erinnerungen eines deutschen Soldaten
_______
Erstmals erschienen im:
Verlag der deutschen Sprachgruppe,
Chicago, 1929
__________
Vollständig überarbeitete Ausgabe.
Ungekürzte Fassung.
© 2020 Klarwelt-Verlag
ISBN: 978-3-96559-217-9
www.klarweltverlag.de
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorrede
Wer ist der Feind?
Im ersten Kugelregen
Vor Lüttich mit „Tante Berta“ und Zeppelins
Vergiftete Brunnen oder Stimmungsmache?
Ein Kapitel von der Disziplin und ihrem Nutzen
Mann gegen Mann
Menschen oder Bestien?
Pardon wird nicht gegeben
„Ehe das Laub von den Bäumen fällt . . .“
Die Schlacht an der Marne
Auf wilder Flucht
Der Stellungskrieg
Auf Schleichpatrouille
Gute Kameradschaft mit dem „Feinde“
Im Argonnenwald
Weihnachten im Schützengraben
Im blutigen Handgemenge
Auf Urlaub in die Heimat
Die Flucht vor dem Massenmord
Vorrede
Die „Kriegserinnerungen eines deutschen Soldaten“ erschienen ursprünglich im Sonntagsblatt der „New Yorker Volkszeitung“, wo sie solches Aufsehen erregten, dass sich fast alle in deutscher Sprache erscheinenden sozialistischen Zeitungen der Vereinigten Staaten zum Nachdruck veranlasst sahen.
Tatsächlich handelt es sich auch um einen der bemerkenswertesten und vom Standpunkt des modernen Proletariats aus wertvollsten Beiträge zur Kriegsliteratur, der aus dem Wust konventioneller und lügenhafter Darstellungen der furchtbaren Welttragödie turmhoch hervorragt. Hier haben wir keine Schönfärbereien oder Vertuschungen, keine Übertreibungen oder Bemäntelungen — nichts als die subjektive Schilderung eines, der dabei gewesen. Der dabei war, nicht als gut bezahlter Berichterstatter für irgend ein Blatt oder eine berühmte Zeitschrift, sondern als aktiver Soldat, als einer von den Millionen, die auf Geheiß ihrer herrschenden Klassen zur Zeit Europas männliche Jugendkraft morden, Europas Länder verwüsten.
Der Verfasser dieser Erinnerungen, ein Bergmann aus dem Saarrevier, für dessen Glaubwürdigkeit und guten Charakter wir bürgen, hat in seiner einfachen, schmucklosen Schilderung des Krieges, wie er ist, das stärkste Argument gegen den Krieg nicht nur, sondern gegen jede Art von Militarismus, gegen jede Art von Kriegsbereitschaft geliefert. Er, der vor seinem Eintritt in das Militär — zwei Jahre vor Kriegsausbruch — seiner Gewerkschaft, dem Deutschen Bergarbeiter-Verband, angehörte und sich damals schon Sozialdemokrat nannte, wurde erst im Laufe der vierzehn Kriegsmonate zum bewussten Feinde der kapitalistischen Gesellschaft, die nicht nur die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen, sondern auch den Menschenmassenmord gebiert und zur höchsten patriotischen Pflicht erhebt.
Diese „Kriegserinnerungen eines deutschen Soldaten“ sind weder antideutsch noch proösterreichisch, weder prodeutsch noch antienglisch — sie sind nichts weiter als antimilitaristisch und antinational. Denn was hier der deutsche Soldat in seiner engeren Umgebung und auf dem Schlachtfelde sah, das konnte und musste jeder aufmerksam beobachtende englische, russische, französische oder italienische Soldat in der seinen wahrnehmen. Nicht die größeren Kriegsgräuel der einen oder der anderen Seite gilt es zu bekämpfen, nicht die Waffe der Kritik gegen diese militärische Ausschreitung oder gegen jene völkerrechtswidrige Mordmaschine zu richten, vielmehr heißt es, den Kampf gegen den Krieg als Ganzes zu führen, als den Gipfel bestialischer Brutalität, als den vollendetsten Ausdruck der Unmenschlichkeit und Unkultur.
Und das ist’s, was dieses Büchlein tut, ohne dass bei seinem Verfasser eine andere Absicht vorhanden war, als Erlebnisse und Gefühle zu schildern, die er mit Hunderttausenden, ja Millionen gemein hatte. Der Krieg zeigt sich uns hier in seiner ganzen unverhüllten Nacktheit; wir hören nichts von dem Heldenmut, von dem die bezahlten byzantinischen und republikanischen Barden des Großkapitalismus zu singen wissen, aber sehen dafür die hinter der Schlachtlinie aufgefahrenen Schnellfeuerkanonen, mit denen die Soldaten ins Feuer getrieben werden. Wir lernen die Leiden der Bevölkerung in den Kriegszonen kennen und erfahren, dass die ,,Verteidiger des Vaterlandes“ im Felde genauso unter der Peitsche einer Geist und Gemüt tötende Disziplin und der Rohheit ihrer Vorgesetzten zu leiden haben, wie im tiefsten Frieden in den Garnisonen. Wir begleiten den Soldaten auf seinem Auszuge ins Feld, sehen ihn umjubelt und als Helden gefeiert und durchleben mit ihm alle die Zweifel und Gewissensbisse, wenn er zu wissen verlangt, wer eigentlich der Feind ist, gegen den er sein Vaterland zu verteidigen habe. Kurz, wir können an der Hand dieser Schilderung jede einzelne Phase jenes Entwicklungsganges beobachten, der einen Kulturmenschen in einen Massenmörder umwandelt. Es gereicht der Deutschen Sprachgruppe zur höchsten Genugtuung, ihren Freunden dieses Buch zugänglich machen zu können. Weiß sie doch, dass sie dadurch dem Kampfe gegen jede Art Militarismus und Patriotismus, gegen Nationalismus und Vaterlands-Verteidigungs-Ideen eine Waffe schmieden hilft, die im Ansturm auf die Bastille Kapitalismus und Militarismus wertvolle Dienste leisten wir
Deutsche Sprachgruppe der Sozialistischen Partei
der Vereinigten Staaten.
Wer ist der Feind?
Ende Juli herrschte in unserer Garnison Koblenz eine fieberhaft erregte Stimmung. Ein Teil unserer Leute war von einer nicht wiederzugebenden Begeisterung, der andere von einer unbeschreiblichen Niedergeschlagenheit beseelt. Die Kriegserklärung lag in der Luft. Ich gehörte zu den Niedergeschlagenen. War ich doch im zweiten Jahre Soldat und sollte in sechs Wochen entlassen werden. Statt der langersehnten Heimfahrt stand nun der Krieg vor der Tür . . .
Ich war auch während meiner Militärzeit der Antimilitarist geblieben, der ich vordem gewesen. Ich konnte mir nicht denken, welches Interesse ich an einem Massenmord haben könnte und vertrat auch meinen Kameraden gegenüber die Ansicht, dass ein Krieg unter allen Umständen für die Menschheit das größte Unglück sei, das sie treffen könne.
Unser Pionier-Bataillon Nr. 30 war schon fünf Tage vor der Mobilmachung fieberhaft beschäftigt; Tag und Nacht wurde gearbeitet, so dass wir schon am 31. Juli vollkommen kriegsbereit waren, und am 30. Juli gab es schon niemanden mehr in unserer Kaserne, der am Ausbruch des Krieges gezweifelt hätte. Dazu kam die auffallende Freundlichkeit der Offiziere und Unteroffiziere, die jeden etwa noch vorhandenen Zweifel ausschloss. Offiziere, die früher niemals die Ehrenbezeugung eines Gemeinen durch Gegengruß erwiderten, taten es jetzt mit einer peinlichen Aufmerksamkeit. Zigarren und Bier wurden von den Offizieren in diesen Tagen mit großer, ungewöhnlicher Freigebigkeit gespendet, sodass es gar nicht wunder nehmen konnte, dass viele Soldaten aus einem fast ständigen Bierrausch nicht mehr herauskamen und sich des Ernstes der Situation kaum bewusst waren. Aber es gab auch andere; es gab Soldaten, die es auch in dieser Zeit der guten Laune und grinsenden Kameradschaftlichkeit von Offizier und Soldat nicht vergessen konnten, dass sie beim Militär oft bis zum Tier erniedrigt worden waren und die jetzt mit bitteren Gefühlen daran dachten, dass sich ihnen vielleicht Gelegenheit bieten möchte, Gleiches mit Gleichem zu vergelten . . .
Am 1. August wurde die Mobilmachung bekannt und der nächste Tag als eigentlicher Mobilmachungstag festgesetzt. Ohne jedoch erst die Reserven abzuwarten, verließen wir am 1. August unsere Garnison. Wer eigentlich Unser „Feind“ sein würde, wussten wir nicht; Russland war vorläufig das einzige Land, an das eine Kriegserklärung ergangen war.
Durch eine nach Tausenden zählende spalierbildende Menschenmenge marschierten wir durch die Straßen der Stadt zum Bahnhof. Aus allen Fenstern wurden wir mit Blumen beworfen; jeder wollte den Soldaten die Hand zum Abschied drücken. Alles, selbst Soldaten, weinte; viele hatten ihre Frau oder die Braut im Arme, die Musik spielte Abschiedslieder, man weinte. und sang zu gleicher Zeit. Wildfremde Menschen, Männer und Frauen, Männer und Männer, umarmten und küssten sich — ein wahrer Hexensabbat von Gefühlen war losgebrochen und ergoss sich wie ein einziger wilder Gefühlsstrom über die Menschheit. Keiner, auch der mit dem stärksten, trutzigsten Gemüt, konnte dieser Gemütsaufwallung widerstehen.
Doch all dies wurde noch übertroffen durch das Abschiednehmen am Bahnhof, den wir bald erreichten. Hier musste endgültig Adieu gesagt, hier musste die Trennung vorgenommen werden. Nie wird mir dieses Abschiednehmen aus meinem Gedächtnis verschwinden, ganz gleich wie alt ich werden mag. Wie verzweifelt klammerten sich viele Frauen an die Brust ihrer Männer; einige mussten gewaltsam entfernt werden. Gleichsam als wäre es plötzlich vor ihnen wie eine Vision aufgestiegen, was das Schicksal ihrer Geliebten sein werde, als sähen sie die stummen Gräber in fremder Erde vor sich, in denen diese armen ,,Namenlosen“ verscharrt werden würden, suchten sie sich an ihren Besitz anzuklammern, wollten sie festhalten, was ihnen ja schon nicht mehr gehörte . . .
Endlich war auch das vorüber, wir hatten den bereitstehenden Zug bestiegen und uns in unserem Viehwagen häuslich eingerichtet. Die Dunkelheit war bereits hereingebrochen, und Licht hatten wir nicht in unserem komfortablen 6. Klasse-Waggon.
Der Zug fuhr langsam rheinabwärts, ohne jede große Erschütterung nahm er seinen Weg; unter uns aber, die wir Tage größter Aufregung hinter uns hatten, trat teilweise Erschlaffung ein. Die meisten der Soldaten lagen mit dem Kopfe auf dem Tornister und schliefen. Andere wieder suchten sinnenden Auges die Ferne, als ob sie m die Zukunft zu schauen versuchten; noch andere zogen verstohlen ein Porträt aus der Brusttasche, und nur ein verschwindend kleiner Teil brachte seine Zeit mit Fragen nach dem Reiseziel zu. Wo fahren wir hin? Ja, wohin? Niemand wusste es. Da, nach langen, unendlich langen Stunden hielt der Zug; nach einer Nacht ruhig-langsamer Fahrt waren wir in . . . Aachen! In Aachen? „Was sollten wir in Aachen? Wir wussten es nicht, und die Offiziere hatten auf unsere Fragen nur ein Achselzucken.
Nach kurzer Pause ging es weiter, und abends am 2. August erreichten wir einen Bauernhof in der Nähe des deutsch-belgischen Grenzortes Herbesthal. Hier wurde unsere Kompagnie in einer Scheune einquartiert. Kein Mensch wusste, was wir hier an der belgischen Grenze zu tun hatten. Am Nachmittag des 3. August trafen Reservisten ein und unsre Kompagnie wurde auf Kriegsstärke gebracht. Noch immer nicht im Klaren über den Zweck unseres Aufenthaltes in der Nähe der belgischen Grenze, legten wir uns am Abend mit erzwungener Seelenruhe auf unser Strohlager; bald musste sich ja etwas ereignen, das uns aus dieser dumpfen Ungewissheit befreien würde. Wie wenige ahnten wohl, dass es für viele von uns die letzte Nacht sein sollte, die sie auf deutscher Erde verbrachten?
Stiller Alarm holte uns um 3 Uhr morgens aus den „Betten“. Die Kompagnie versammelte sich und der Hauptmann erklärte uns die Kriegslage. Er teilte uns mit, dass wir uns marschbereit halten müssten, über die Marschrichtung sei er selbst noch nicht unterrichtet. Kaum eine halbe Stunde später fuhren fünfzig große Lastautos vor und machten auf der Landstraße vor unserem Quartier halt. Die Führer dieser Wagen wussten aber auch noch nichts Näheres und warteten auf Befehle. Die Diskussion über unser nächstes Ziel setzte von neuem ein; die Offiziersburschen, die manches erlauscht hatten, äußerten die Ansicht, wir würden noch am selben Tage in Belgien einziehen, andere widersprachen, Bestimmtes konnte niemand von uns wissen. Aber der Befehl zum Abmarsch kam nicht, und am Abend durften wir wieder unser Strohlager beziehen. Die Ruhe währte jedoch nicht lange; um 1 Uhr morgens wurden wir wieder alarmiert und vom Hauptmann mit einer Ansprache beehrt. Wir wären, sagte er uns, mit Belgien im Kriege, sollten uns jetzt tapfer zeigen, eiserne Kreuze verdienen und dem deutschen Namen Ehre einlegen. Dann fuhr er etwa folgendermaßen fort: „Wir führen nur gegen die bewaffnete Macht Krieg, also gegen die belgische Armee. Leben und Eigentum der Zivilisten steht unter dem Schutze internationaler Verträge, des Völkerrechts, doch dürft ihr, Soldaten, nicht vergessen, dass es eure Pflicht ist, euer Leben zum Schutze des Vaterlandes so lange wie möglich zu erhalten oder so teuer wie möglich zu verkaufen. Unnützes Blutvergießen wollen wir den Zivilisten gegenüber verhindern, doch gebe ich euch zu bedenken, dass allzu große Rücksicht an Feigheit grenzt und Feigheit vor dem Feinde wird sehr schwer bestraft.“
Nach dieser ,,menschenfreundlichen“ Rede unseres Hauptmanns wurden wir auf die Autos ,,verladen“, und um vier Uhr morgens am 5. August passierten wir die belgische Grenze. Um diesen „historischen“ Augenblick extra feierlich zu gestalten, mussten wir dreimal Hurra rufen . . .
Nie sind mir die Früchte militärischer Erziehung klarer vor Augen gekommen als in diesen Augenblicken. Man sagt dem Soldaten: ,,Der Belgier ist dein Feind!“ und er hat es zu glauben. Der Soldat, der Arbeiter in Uniform, hat ja noch gar nicht gewusst, wer sein Feind ist. Hätte man uns gesagt: „Der Holländer ist euer Feind!“, wir hätten es ebenso geglaubt, glauben müssen, und hätten auf Befehl auf ihn geschossen. Wir, die ,,deutschen Bürger in Uniform“, dürfen keine eigene Meinung, keine eigenen Gedanken haben, denn man gibt uns Feind und Freund, wie man das gerade gebraucht, wie man sie in seinem Interesse braucht! Der Franzose, der Belgier, der Italiener ist dein Feind. Schieße nur ruhig, wie wir dir befehlen, und mache dir im Übrigen keine Gedanken! Pflichten hast du, erfülle sie und — halte dein Maul . . .
Das etwa waren die Gedanken, die mein Gehirn beim Überschreiten der belgischen Grenze folterten. Und, wie, um mir vor mir selbst einen Trost zu geben, wie, um mein mörderisches Handwerk, das man mir aufgezwungen hat,
vor mir selbst zu rechtfertigen, redete ich mir ein, dass ich zwar kein Vaterland, aber doch ein Vaterhaus zu verteidigen und vor Verwüstung zu bewahren habe. Doch der Trost war schwach und hielt nicht einmal in den ersten Tagen stand.
Auf den ziemlich schnell fahrenden Automobilen erreichten wir gegen acht Uhr morgens das vorläufige Ziel: ein kleines, aber schönes Bauerndorf. Die Einwohner der Dörfer, die wir bisher durchfahren hatten, staunten uns sprachlos an, so dass wir alle den Eindruck hatten, dass diese Landbewohner zum größten Teile gar nicht wussten, warum wir nach Belgien gekommen. Sie waren aus dem Schlafe aufgeschreckt worden und sahen, halb angekleidet, von ihren Fenstern aus unsern Autos nach. Als wir dann hielten und abstiegen, kamen die Bauern jenes Dörfchens ohne Scheu zu uns, boten uns Essen an und brachten Kaffee, Brot Fleisch etc. Da wir noch ohne Feldküche waren, freuten wir uns der ,,feindlichen“ Liebesgaben, umso mehr, als die Wackeren jede Bezahlung entschieden ablehnten. Sie erzählten uns, die belgischen Soldaten seien abmarschiert, wohin wüssten sie nicht.
Nach kurzer Ruhepause marschierten wir weiter, die Autos fuhren zurück. Wir waren kaum eine Stunde marschiert, da wurden wir von Kavallerie, von Dragonern und Husaren überholt, die uns berichteten, die Deutschen seien in der ganzen Gegend auf allen Landstraßen im Vormarsch, und dicht hinter uns kämen Radfahrer-Kompagnien Das war tröstliche Kunde, wir fühlten uns nicht mehr allein, nicht im fremden Lande isoliert. Bald kam auch wirklich die Radfahrer-Abteilung, die uns schnell genug überholte und uns wieder allein ließ. Ärgerliche Worte wurden jetzt laut; sie alle konnten reiten oder fahren, wir aber mussten laufen. Was wir immer als selbstverständlich empfunden, legte sich plötzlich wie eine große Ungerechtigkeit über uns. Und wenn es auch nichts nützte, unser Schimpfen und Grollen, es lenkte unsere Gedanken von der Schwere des Affen (Tornister) ab, der wie ein Bleigewicht auf unserem Rücken hing.
Die Hitze war drückend, der Schweiß drang aus allen Poren; das neue und harte Lederzeug, die neuen, kantigen Uniformen scheuerten viele Körperstellen, besonders an den Hüften, wund. Wie eine Erlösung kam daher der Befehl um zwei Uhr nachmittags, vor einem alleinstehenden Gehöft Halt zu machen und im Grase zu rasten.
Wir mochten etwa zehn Minuten im Grase gelegen haben, als wir plötzlich vor uns Schüsse fallen hörten; wie elektrisiert sprang alles auf und eilte an die Gewehre. Da aber würde das Gewehrfeuer, das wohl zwei bis drei Kilometer von uns entfernt sein mochte, auch schon immer lebhaften. Sofort setzten wir uns in Marsch.
Am Gesichtsausdruck und am Benehmen der Soldaten konnte man erkennen, dass in ihrem Innern etwas vorging, dass ein Gefühl von ihnen Besitz ergriffen hatte, dessen sie nicht Herr zu werden vermochten, das sie vordem auch nicht gekannt hatten. An mir persönlich bemerkte ich eine große Unruhe. Angst- und Neugiergefühl peitschten meine Gedanken wild durcheinander; im Kopfe wirbelte alles und im Herzen wieder schien sich alles zusammenzupressen. Aber vor meinen Kameraden wollte ich meine Angstgefühle verbergen.
Dass ich es energisch versuchte, weiß ich; ob es mir besser als den Kameraden gelungen, denen ich die Beklemmung vom Gesicht ablas, bezweifelte ich.
Trotzdem ich wusste, dass wir in einer halben Stunde im Feuer sein würden, bemühte ich mich, mir einzureden, unser Eingreifen werde nicht mehr nötig sein. Jeden Gedanken, der mir diese Hoffnung stärken oder Trostgründe vortäuschen konnte, hielt ich eigensinnig, ja beinahe krampfhaft fest. Dass nicht jede Kugel trifft, dass — wie man uns erzählt hatte — die meisten Verwundungen in den Kriegen der Neuzeit durch Streifschüsse herbeigeführt werden, die ungefährliche Fleischwunden verursachen, das waren einige dieser wider besseres Wissen in Gedanken wiederholten Selbsttäuschungen. Und sie wirkten. Nicht nur, dass ich tatsächlich etwas ruhiger wurde, ich hatte, in Gedanken versunken, kaum bemerkt, dass wir uns bereits in nächster Nähe der Gefechtslinie befanden.
Die an der Straße liegenden Fahrräder verrieten uns, dass hier die Radfahrerabteilung im Gefecht war. Wie stark der Gegner war, das wussten wir freilich nicht, als wir uns sprungweise der Schützenlinie näherten. Unwillkürlich bückte sich jeder beim Springen, während rechts und links, vor und hinter uns unablässig die feindlichen Gewehrgeschosse einschlugen; und doch erreichten wir, von den bedrängten Kameraden freudigst begrüßt, ohne jeden Verlust die Schützenlinie. Auch die Radfahrer hatten noch keine Verluste erlitten; wohl waren schon einige leicht Verwundete zu verzeichnen, doch konnten diese sich noch weiter am Gefecht beteiligen.
Wir lagen platt auf dem Boden und feuerten in der angegebenen Richtung was die Flinte halten konnte; gesehen hatten wir nämlich unseren Gegner bisher noch nicht. Das war aber anscheinend einigen unserer Soldaten zu wenig interessant, sie wollten wissen, wie die Leute aussahen, auf
die sie schossen, erhoben sich halb und feuerten in kniender Stellung. Zwei Mann meiner Kompagnie mussten ihre Neugier mit dem Tode bezahlen — fast zu gleicher Zeit erhielten sie einen Kopfschuss. Das erste Opfer unserer Abteilung sank lautlos nach vorn über, das zweite schleuderte die Arme hoch in die Luft und fiel dann auf den Rücken. Sie waren beide sofort tot. . . .
Im ersten Kugelregen
Wer könnte die Gefühle beschreiben, die einem im ersten wirklichen Kugelregen überkommen? Als wir sprungweise vorgingen und so direkt ins Feuer kamen, fühlte ich keine Angst mehr und schien nur bestrebt, so schnell wie möglich in die Schützenlinie zu kommen. Doch beim Anblick der ersten Toten überwältigt» mich ein entsetzliches Grauen. Minutenlang war ich vollkommen betäubt, hatte die Selbstbeherrschung völlig verloren und war absolut unfähig, irgendetwas zu denken oder zu tun. Gesicht und Hände drückte ich fest an die Erde, um dann plötzlich im unbezähmbaren Drang einer neuen Gefühlserregung das Gewehr zu ergreifen und wie blind darauf los zu schießen. Nach und nach beruhigte ich mich wieder etwas, ja ich ward sogar beinahe zuversichtlich, als wenn alles ganz normal wäre. Ich war plötzlich mit mir selbst und den Verhältnissen zufrieden. Und als dann nicht sehr viel später auf der ganzen Linie das Kommando ertönte: Sprung auf! . . . Marsch, marsch! da rannte ich, wie jeder andere, wie besessen voraus, als ob es gar nicht anders hätte sein können. Das Kommando „Stellung“ folgte, wie nasse Säcke plumpsten wir zu Boden, das Feuern hatte von neuem begonnen . . .
Unser Feuer wurde von Minute zu Minute lebhafter und steigerte sich zu einem rollenden ohrenbetäubenden Lärm. In solchem Höllenfeuer muss man, will man sich seinem Nebenmann verständlich machen, diesem dermaßen in die Ohren brüllen, dass einem die Kehle schmerzt. Unter der Wirkung unseres Feuers wurde der Gegner unruhig, sein Feuer schwächer; die feindliche Linie kam ins Wanken. Da uns nur ungefähr 500 Meter vom Feinde trennten, konnten wir genau beobachten, was sich dort ereignete. Wir sahen, wie etwa die Hälfte des Gegners zurückgenommen wurde, und zwar wird das so gemacht, dass z. B. jeder zweite Mann zurückgeht, während No. 1 liegen bleibt, bis der zurückgehende Teil Halt gemacht hat. Diesen Augenblick benutzten wir, um dem zurückgehenden. Gegner möglichst starke Verluste beizubringen. Soweit wir das rechts und links von uns liegende Gelände überblicken konnten, sahen wir, dass die Deutschen auf mehreren Punkten im Vorgehen waren. Auch für unsere Abteilung kam der Befehl zum Vorgehen, als der Gegner seine ganzen Kräfte zurücknahm. Uns war die Aufgabe zugefallen, dem abziehenden Feinde so hartnäckig auf den Fersen zu bleiben, dass ihm keine Zeit zum Sammeln und zur neuen Aufstellung blieb. Wir folgten ihm daher sprungweise mit ganz kurzen Atempausen, um zunächst zu hindern, dass es ihm gelang, sich in dem vor ihm liegenden Dorfe festzusetzen. Wussten wir doch, dass uns sonst ein verlustreicher Häuserkampf bevorstehen würde. Die Belgier versuchten jedoch gar nicht, sich festzusetzen, sondern lösten sich mit erstaunlicher Geschicklichkeit von uns los.
Wir hatten inzwischen weitere Verstärkung erhalten. Unsere Kompagnie war ziemlich zerstreut worden, und man marschierte mit dem Trupp, bei dem man sich gerade zufällig befand, weiter. Der meine musste im Dorfe zurückbleiben, um Haus für Haus systematisch nach verborgenen oder versprengten Soldaten abzusuchen. Dabei sahen wir denn auch, dass sich die Deutschen auf allen Seiten im Vormarsch befanden. Feldartillerie, Maschinengewehr-Abteilungen u. s. w. kamen an. und wir alle wunderten uns, wo das alles so schnell herkam.
Zu langen Betrachtungen gab es jedoch keine Zeit. Mit aufgepflanztem Seitengewehr ging es durch Haus und Haus und Tür und Tür. Und wenn auch die Ausbeute sehr mager war, da wir keine Soldaten fanden, so gingen wir doch nicht ganz leer aus, weil die Einwohner alle in ihrem Privatbesitz befindlichen Feuerwaffen, Munition etc. abliefern mussten. Der uns begleitende Ortsälteste (Gemeindevorsteher) hatte es jedem Bürger klar zu machen, dass jeder Waffenfund nach der Durchsuchung kriegsrechtlich geahndet werden werde. Und Kriegsrecht heißt — Tod!
Wieder mochte eine Stunde vergangen sein, als wir durch Gewehr- und Artilleriefeuer aufgeschreckt wurden; ein neues Treffen hatte begonnen. Ob die Artillerie auf beiden Seiten tätig war, konnte man vom Dorfe aus nicht beurteilen, aber laut genug war es, denn die Luft erzitterte fast von dem Rollen, Grollen und Stöhnen, das hin- und herüberrollte und immer stärker zu werden schien. Die Sanitätskolonnen brachten die ersten Verwundeten; Ordonnanzen sausten an uns vorbei — der Krieg hatte mit voller Wucht eingesetzt . . .
Die Dunkelheit kam über uns, ehe wir mit unseren Hausdurchsuchungen zu Ende waren. Wir schleppten Matratzen, Strohsäcke, Federbetten, was wir gerade erwischen konnten, nach der Gemeindeschule und Kirche, um dort die Verwundeten unterzubringen. So gut es ging, wurden sie gebettet; mit rührender Sorgfalt nahm man sich dieser ersten Opfer des grausen Völkerschlachtens an. Später als man schon mehr an diese grausigen Bilder gewöhnt war, machte man weniger Umstände mit den Verwundeten.
Von anderen umliegenden Ortschaften kamen nun die ersten Flüchtlinge an. Sie mochten wohl viele Stunden lang marschiert sein, denn sie sahen ermattet, aufs höchste erschöpft aus. Frauen, alte greise Männer und Kinder im bunten Gemisch, die allesamt nichts weiter hatten retten können als ihr bisschen nacktes Leben. In einem Kinderwagen oder auf einer Schubkarre bargen diese Unglücklichen alles, was rohe Kriegsgewalt ihnen gelassen hatte. Und ganz im Gegensatz zu den Flüchtlingen, die uns bisher begegnet waren, waren diese aufs äußerste eingeschüchtert, bebend voll Angst, in Schrecken vor der ihnen feindlichen Welt in sich zusammengesunken. Sobald sie nur einen von uns Soldaten ansahen, bekamen sie es so mit der Furcht zu tun, dass sie ordentlich in sich zusammenschrumpften. Wie ganz anders die Bewohner des Dorfes, in dem wir uns aufhielten, die uns freundlich, ja zuvorkommend entgegenkamen. Wir versuchten die Ursache dieser Angst zu erfahren und hörten dann, dass diese Flüchtlinge in ihrem Dorfe Zeuge erbitterter Straßenkämpfe gewesen. Sie hatten den Krieg kennen gelernt, hatten ihre Häuser brennen, ihr bisschen Hab und Gut darin untergehen sehen und die mit Leichen und Verwundeten angefüllten Straßen noch nicht vergessen können. Es wurde uns klar, nicht die Furcht allein gab diesen Leuten den Blick des gehetzten Wildes, — es war der Hass, der Hass gegen uns, die Eindringlinge, die sie — wie sie annehmen mussten — in Nacht und Nebel überfallen, von Haus und Hof vertrieben hatten. Aber nicht nur gegen uns, die deutschen Soldaten, richtete sich dieser Hass, nein, auch ihre eigenen, die belgischen Soldaten, wurden davon nicht verschont.
Am Abend marschierten wir noch ab und versuchten unsern Truppenteil zu erreichen. Die Belgier hatten sich mit Einbruch der Dunkelheit noch weiter nach rückwärts konzentriert; sie befanden sich schon ganz in der Nähe von der Festung Lüttich. Viele der Ortschaften, durch die wir zogen, standen in Flammen, die vertriebenen Einwohner zogen scharenweise an uns vorüber; Frauen, deren Männer vielleicht auch ,,ihr Vaterland“ verteidigten, Kinder, Greise, die hin und hergestoßen wurden und überall im Wege zu sein schienen. Ziel- und planlos, ohne einen Ort, an dem sie ihr Haupt niederlegen konnten, krochen diese Züge des Elends und Unglücks an uns vorüber — die beste Illustration des männermordenden; des völkervernichtenden Krieges!
Wieder erreichten wir ein Dorf, das allem Anschein nach einst von wohlhabenden Leuten, von einem zufriedenen Völkchen bewohnt gewesen. Jetzt freilich sah man nichts als wie Ruinen, verbrannte, zerstörte Häuser und Bauerngüter, tote Soldaten — deutsche und belgische — und mitten zwischen ihnen mehrere Zivilisten, die man standrechtlich erschossen hatte. . . .
Gegen Mitternacht kamen wir zur deutschen Linie, die ein Dorf in ihren Besitz zu bekommen trachtete, das schon im Festungsbereich von Lüttich lag und von den Belgiern hartnäckig verteidigt wurde. Hier mussten unsererseits alle verfügbaren Kräfte eingesetzt werden, um dem Gegner Haus um Haus, Straße um Straße zu entreißen. Es war noch nicht völlig dunkel, sodass wir den schrecklichen Kampf, der sich hier entwickelte, mit allen Nerven mit durcherleben mussten. Man kämpfte Mann gegen Mann, alle Waffen und Hilfe mussten zur Anwendung gelangen; mit dem Gewehrkolben, mit dem Messer, mit Faust und Zähnen ging es gegen den Gegner vor. Einer meiner besten Freunde kämpfte mit einem riesigen Belgier; das Gewehr war beiden entfallen. Sie bearbeiteten sich mit den Fäusten. Ich hatte grade mit einem etwa 22jährigen Belgier abgerechnet und war im Begriff, meinem Freunde beizustehen, weil der gigantische Belgier ihm so sehr an Kraft überlegen war. Da gelang es meinem Freunde plötzlich, den Belgier durch eine blitzschnelle Bewegung in das Kinn zu beißen. Und zwar so tief, dass er ihm mit den Zähnen ein Stück Fleisch herausriss. Der Schmerz des Belgiers muss ungeheuer gewesen sein — er ließ meinen Kameraden los und rannte unter wahnsinnigen Schmerzensschreien davon.
Alles hatte sich in Sekunden abgespielt. Meinem Freunde rann das Blut des Belgiers aus dem Mund; ein entsetzlicher Ekel, ein unbeschreibbares Entsetzen erfasste ihn, der Geschmack des warmen Menschenblutes brachte ihn fast an den Rand des Wahnsinns. Er, der junge, lebensfrohe, frische Bursch von 24 Jahren war in dieser Nacht um seine Jugend betrogen worden. Dem bisher Fröhlichsten unter uns konnten wir kein Lächeln mehr entlocken.
Im Verlaufe des Nachtkampfes kam ich zum ersten Male mit einem belgischen Gewehrkolben in Berührung. Während ich mit einem Belgier im Handgemenge war, schlug mich ein zweiter von rücklings mit dem Gewehrkolben dermaßen auf den Kopf, dass sich der Kopf bis unter die Ohren in den Heim hineinzwängte. Ich fühlte einen furchtbaren Schmerz am ganzen Kopf, knickte zusammen und wurde ohnmächtig. Als ich wieder zu mir kam, lag ich mit verbundenem Kopf in einer Scheune unter anderen Verwundeten.
Vor Lüttich mit „Tante Berta“ und Zeppelins
Meine Verletzung war nicht schwer, nur hatte ich das Gefühl, als ob der Kopf das Doppelte des normalen Umfangs hätte: und die Ohren sausten mir, als wären es die Räder eines Schnellzuges.
Die andern Verwundeten und die Sanitätssoldaten erzählten, die Belgier seien auf die Festung zurückgeworfen worden, wir hörten aber, dass noch immer schwer gekämpft wurde. Fortwährend kamen Verwundete an und diese erzählten uns, dass die Deutschen schon beim ersten Ansturm mehrere Festungswerke wie Zwischenforts überrannt hätten, dass sie sich jedoch nicht halten konnten, weil sie artilleristisch nicht genügend vorbereitet gewesen wären. Die Verteidigungsstellen und -werke innerhalb der Forts waren ebenso wie die Besatzung noch so gut wie völlig intakt. Die Forts waren eben noch nicht sturmreif, so dass sich die Deutschen mit geradezu ungeheuren Verlusten zurückziehen mussten. Die verschiedenen Berichte widersprachen sich, ein klares Bild daraus zu erhalten, war unmöglich.
Inzwischen hatte eine artilleristische Beschießung der Festung eingesetzt, die selbst den deutschen Soldaten Entsetzen einflößte. Die schwerste Artillerie war gegen die modernen Betonforts in Aktion gebracht. Kein Soldat wusste bis dahin etwas von der Existenz der 42 Zentimeter-Mörser. Als sich Lüttich bereits in deutschen Händen befand, konnten wir Soldaten es uns noch immer nicht erklären, wie es möglich war, dass diese gewaltigen Festungswerke, die teilweise aus einem bis zu sechs Meter dicken Eisenbeton bestanden, nach einer Beschießung von nur wenigen Stunden einen Schutthaufen darstellten. Ich selbst hatte ja, infolge meiner Verwundung, an diesen Operationen nicht teilnehmen können; aber meine Kameraden erzählten mir später, wie diese Einnahme der einzelnen Forts vor sich ging. Artillerie aller Kaliber nahm die Forts unter Feuer, aber es waren 21-Zentimeter-Mörser und die Zweiundvierziger, die die eigentliche Arbeit verrichteten. Schon von weitem hörte man das 42-Zentimeter-Geschoss ankommen. Unter einem unheimlichen Sausen und Zischen, das sich wie ein langgezogener rauer Pfiff anhörte, der die ganze Atmosphäre sekundenlang zu erfüllen schien, bohrte sich das Geschoss durch die Luft. Wo es niederfiel, wurde in einem Umkreise von mehreren hundert Metern alles vernichtet. Wie oft habe ich nicht später noch diese Hekatomben angestaunt, die sich der 42-Zentimeter-Mörser auf allen seinen Wegen errichtet! Der durch das Krepieren der Geschosse erzeugte Luftdruck war so ungeheuer, dass uns Deutschen in den vorgeschobensten Stellungen das Atemholen sekundenlang erschwert wurde. Um den Hexensabbat voll zu machen, erschienen nachts die Zeppeline, um sich am Vernichtungswerk zu beteiligen. Die Soldaten hörten plötzlich das den meisten Deutschen bekannte Propellerschwirren und das Geräusch der Motore über sich. Die Zeppeline kamen immer näher, wurden aber erst, als sie sich bereits in nächster Nähe der Forts befanden, vom Gegner entdeckt, der sofort alle verfügbaren Scheinwerfer spielen ließ, um das Firmament nach den gefürchteten fliegenden Feinden abzusuchen. Das Propellerschwirren der Luftschiffe, die sich auf die verschiedenen Forts verteilt hatten, hörte plötzlich auf; dafür tauchte ganz hoch oben in der Lust ein grelles, scharfes Licht auf — der Scheinwerfer des Zeppelin, der für einen kurzen Augenblick das Gelände unter sich beleuchtet hatte. Dann wurde es ebenso unvermittelt dunkel und still, bis — ein paar Momente später — mächtige Detonationen die Kunde brachten, der Zeppelin habe soeben „Ballast“ abgeworfen. Das ging so eine ganze Weile weiter, Explosion folgte auf Explosion, die höchstens — durch kleine, vor uns aufblitzende Feuerwölkchen abgelöst wurden — in der Luft platzende Schrapnells, die die belgische Artillerie den Luftschiffen zugedacht hatte. Dann setzte das Propellerschwirren wieder ein, erst laut und aus nächster Nähe, fast kerzengerade über uns, dann leiser und leiser, bis das gewaltige Schiff der Lüfte gänzlich unserem Gesichts- und Hörkreise entschwunden war.
So wurden die Forts dem Erdboden gleichgemacht; tausende von Belgiern lagen hinter und unter den Wällen und Verschanzungen tot und begraben. Der Generalsturm folgte, Lüttich war in den Händen der Deutschen. . . .