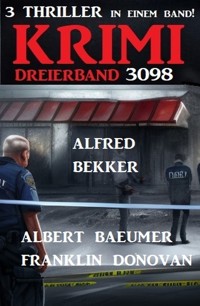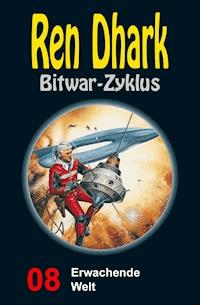Clive Hawks hatte Todesangst.
Der schmächtige Mann mit den dicken Brillengläsern saß
zwischen Milo und mir wie ein Häufchen Elend. Immer wieder fuhr er
mit zitternden Fingern durch sein schütteres Haar. Eine nervöse
Angewohnheit, die mich langsam wahnsinnig machte.
»Sie werden mich killen!« preßte er zwischen schmalen Lippen
hervor. »Diese Nacht überlebe ich nicht!«
»Wir sind ja auch noch da«, beruhigte mein Freund und Kollege
Milo Tucker den genialen Physiker, der sich fast in die Hosen
machte. »Solange der FBI Sie beschützt, kann Ihnen nichts
passieren. Wir bringen Sie jetzt in Ihr Hotel. Dort sind Sie so
sicher wie in Abrahams Schoß. Und morgen…«
In diesem Moment zersprang die Heckscheibe des Buick.
Milo und ich reagierten mit den Reflexen, die man in
jahrelanger Tätigkeit als Special Agent des FBI entwickelt. Wir
drückten den panisch aufschreienden Hawks auf den Wagenboden und
schoben uns beschützend über ihn.
Am Lenkrad saß unser Kollege Jay Kronburg, auf dem
Beifahrersitz Clive Caravaggio. Beide waren ebenfalls sofort in
Alarmbereitschaft. Jay wollte wohl Vollgas geben, doch da
versperrte ein plötzlich aus der West 57th Street hervorschießender
Van die Fahrbahn der Lexington Avenue Richtung Algonquin
Hotel.
»Gib Alarm!« rief ich Clive zu. »Wir brauchen
Verstärkung.«
Durch die nicht mehr vorhandene Heckscheibe flog eine
Tränengasgranate in den Buick. Es gibt wenig, was man gegen diese
wirkungsvolle, aber heimtückische Waffe tun kann. Das Gefühl, als
würde einem roter Pfeffer in die Augen gestreut, ist schon schlimm
genug. Doch man sieht wirklich kaum noch etwas. Auch wenn rtian
noch so sehr gegen die Wirkung anzukämpfen versucht.
Ich nahm schemenhafte Gestalten wahr, vermutlich mit Gasmasken
versehen. Sie kamen über das Wagenheck herein, enterten den Buick
förmlich. Längst hatte ich schon den .38er gezogen. Aber wie hätte
ich sicher sein können, jemanden zu treffen? Daher benutzte ich ihn
zunächst als Schlagwaffe. Der Schmerzensschrei einer der dunklen
Typen sagte mir, daß ich damit Erfolg gehabt hatte. Milo schien
ebenfalls mit einem Eindringling zu ringen.
Nun barst auch noch die Frontscheibe. Offenbar wollte man uns
von zwei Seiten in die Zange nehmen. Von vorne drangen
Kampfgeräusche an mein Ohr. Was dort passierte, konnte ich nicht
sagen. Es war zu weit weg. Und ich war genügend mit mir selbst
beschäftigt. Mein Gegner kam wieder heran, schneller diesmal. Ich
stieß mit dem Griff meiner Dienstwaffe in seine Richtung. Doch er
schien mir aus weichen zu können. Ich hörte ein Sausen nahe meinem
Kopf, roch für einen Moment intensiv den typischen Geruch von
Leder.
So riechen Gürtel, Damenhandtaschen - und Totschläger! Es
bedurfte nicht viel Phantasie, um sich auszurechnen, mit welchem
dieser Gegenstände der Fremde auf mich eindrosch.
In dem engen Auto hatte ich keine Chance. Ich mußte nach
draußen, die Tür aufstoßen. Dort würde auch der beißende
Tränengasgeruch nachlassen. Doch bevor ich die Tür öffnen konnte,
sauste der Totschläger noch einmal heran. Und diesmal konnte ich
nicht mehr ausweichen.
***
»Ihr Vollidioten!« Mit schneidender Stimme kanzelte Ray
Mitchell seine Handlanger ab. Wie begossene Pudel standen die vier
Männer in den schwarzen Trainingsanzügen vor dem herrischen
Vorstandschef des Inno Tech Konzerns.
Mitchell war der geborene Anführer. Seine hochgewachsene,
drahtige Gestalt, der stechende Blick, die scharf konturierten
Kinnbacken, sein auftrumpfendes Gehabe - all das zeichnete einen
Mann aus, der besessen ist von Macht. Und davon, sie weiter wachsen
zu sehen.
In der Chefetage des multinationalen McKee Tech Unternehmens
mit mehr als drei Millionen Mitarbeitern in fünfzig Ländern war er
der unbestrittene King. Alle tanzten hier nach seiner Pfeife. Und
er haßte es, wenn jemand bei einem Auftrag versagte.
So wie diese vier Trauerklöße, die ihm als gewissenlose
Halsabschneider empfohlen worden waren. Fünfzig Riesen pro Nase
sollten sie für die Entführung von Clive Hawks bekommen. Und nun
wagten sie es, ihm ohne den Physiker vor die Augen zu treten!
Ray Mitchell stand auf und knöpfte mit einer automatischen
Handbewegung sein maßgeschneidertes anthrazitgraues Jackett zu.
Immer korrekt aussehen, sich nie eine Blöße geben. Das war sein
Motto. Wie verrottet er in seinem Inneren war, ging niemanden etwas
an.
Der Vorstandschef kam hinter seinem riesigen
Designerschreibtisch aus Chrom hervor. Er baute sich vor einem der
Gangster auf, fixierte ihn. Und versetzte ihm eine schallende
Ohrfeige.
»Da hast du deine fünfzig Riesen!« stieß Mitchell mit
beißender Ironie hervor. »Für ausgezeichnete Arbeit!«
»Wir können nix dafür, Chef«, versuchte einer der anderen
seinem Kumpan beizuspringen. »Wir haben die G-men fertiggemacht,
wollten uns Hawks schnappen - und da war er weg!«
»Und da war er weg«, äffte der Oberboß den Brooklynslang des
Kriminellen nach. »Und wohin war er weg, bitte schön?«
»Der muß stiftengegangen sein, als wir noch mit den Feds
gekämpft haben«, meinte ein dritter. »Das waren ganz schön harte
Brocken.«
Mitchell verdrehte resigniert die Augen Richtung Himmel. »Aber
ihr seid sicher, daß er in dem Buick gesessen hat?«
»Klar!« strahlte ein zahnlückiger Ganove. »Wir haben den Wagen
schließlich den ganzen Tag osser… obser… also beobachtet, bevor wir
zugeschlagen haben.«
»Mit der bekannten Präzision«, ätzte der Vorstandschef, doch
sein Sarkasmus prallte an dem Quartett ab. Entweder waren sie zu
dumm oder zu abgebrüht, um seine Worte zu verstehen. Oder
beides.
»Ich gebe euch noch eine Chance, das Honorar zu verdienen«,
sagte Ray Mitchell, wobei er jedes Wort betonte. Er war nun ruhig.
Gefährlich ruhig. »Findet diesen Clive Hawks und schafft ihn an
einen sicheren Ort. Dann bin ich bereit, eure heutige Schlappe zu
vergessen.«
»Und was ist, wenn wir heute schon unser Geld haben wollen?«
fragte der Mutigste unter den vieren.
»Dann«, säuselte Mitchell, »werden die Dollarnoten nur so
fließen. Aber in die Taschen desjenigen, der die Erde von eurem
Anblick befreien soll. Und dieser Mann versagt nie.«
***
Ali war der bessere Fahrer, aber Ibrahim konnte gut mit
Menschen umgehen. Deshalb ergänzten sich diese beiden Männer
erstklassig. Kein Wunder, daß die Regierung ihrer Heimat im Nahen
Osten gerne die Dienste des ›Dattel-Duos‹ in Anspruch nahm. So
wurden sie wegen ihrer gemeinsamen Vorliebe für die süßen Früchte
ihres Landes genannt, nach denen sie beinahe süchtig waren. Ob
Fememorde in Südamerika, Industriespionage in Frankreich,
Entführungen in Rußland, Erpressungen in Hongkong -bei diesen und
vielen anderen Verbrechen hatten sie eine Spur aus Dattelkernen
zurückgelassen.
Doch seltsamerweise brachte niemand die Untaten miteinander in
Verbindung. Auf den ersten Blick schienen sie nichts miteinander zu
tun zu haben. Der gemeinsame Nenner bestand in einem geheimen
Schweizer Nummemkonto, auf dem nach erfolgreicher Tat jeweils
riesige Dollarbeträge eingingen. Genug, um sowohl für Ali als auch
für Ibrahim großflächige Dattelplantagen zu erwerben.
Momentan sah es allerdings so aus, als würden die beiden
Auftragsgangster diesmal leer ausgehen.
Mit ohnmächtigem Zorn hatten sie gerade miterleben müssen, wie
eine Gruppe Schwarzgekleideter die FBI-Limousine überfallen hatte
und die G-men mit Tränengas kampfunfähig zu machen versuchte.
Der Miet-Chevrolet der beiden Männer befand sich ungefähr 50
Yard hinter dem gekaperten Buick. Plötzlich schrie Ibrahim auf. Er
deutete auf eine kleine Gestalt, die eine der Fondtüren des
FBI-Fahrzeugs öffnete und auf den Bürgersteig kroch. Weder die
Tränengas-Gangster noch die G-men schienen sein Verschwinden zu
bemerken. Dazu waren sie viel zu sehr miteinander
beschäftigt.
»Das ist unsere Zielperson!« meinte Ibrahim aufgeregt und
öffnete schon die Beifahrertür. »Ich schnappe ihn mir. Folge mir
mit dem Wagen!«
»Viel Glück!« murmelte Ali. »Allah sei mit dir.«
Die Lexington Avenue ist in den frühen Abendstunden nicht
gerade ausgestorben. Auf den Gehsteigen wimmelte es von Passanten.
Viele waren schon neugierig stehengeblieben, um den Kampf im Buick
zu verfolgen. Wenn die Cops kämen, würde sich die Menge freilich
schnell zerstreuen. Als Zeuge aussagen? Womöglich ›in etwas
hineingezogen werden‹. Es gibt kaum etwas, was einem echten New
Yorker mehr Angst macht.
Ibrahim hatte Clive Hawks zwischen den Schaulustigen
verschwinden sehen. Es war wohl niemand auf die Idee gekommen, ihm
zu helfen, obwohl der Physiker heulen mußte wie ein
Schloßhund.
Der Araber biß die Lippen zusammen. Er verachtete die
Amerikaner wegen ihrer Gleichgültigkeit und ihres Egoismus. Doch
wenn diese Eigenschaften ihm dabei halfen, Clive Hawks zu fangen,
sollte es ihm nur recht sein…
Dort vorne torkelte der Wissenschaftler die Lexington Avenue
hinauf in Richtung Chrysler Building. Er war vielleicht noch zehn
Yard vor Ibrahim. Clive Hawks schwankte hin und her, als wäre er
betrunken. Die Passanten wichen ihm aus. Man sah nur noch selten
Betrunkene in dar Öffentlichkeit, seit Bürgermeister ›Rudy‹ mit
eiserner Hand regierte. Doch völlig unmöglich war ihr Anblick
natürlich nicht. Wie in New York überhaupt nichts unmöglich
ist.
»He! Knoblauchfresser!« Ibrahim wollte gerade an dem
bierbäuchigen Baseballkappenträger vorbeieilen, als dieser den
Araber am Jackett packte.
»Was fällt dir ein, mich anzurempeln, Knoblauchfresser?«
Ibrahim wußte, daß er den Mann nicht berührt hatte. Aber er
wußte auch, daß ihm das nichts nützen würde. Baseballkappe suchte
Streit.
»Ich habe Sie nicht angerempelt«, versuchte Ibrahim trotzdem
dem Konflikt auszuweichen. Er durfte die Spur von Clive Hawks nicht
verlieren!
»Soooo? Dann lüge ich wohl, wie? Lüge ich, dreckiger
Ausländer?«
Der Bierbauch fühlte sich stark, weil er in Begleitung von
drei Kumpels war, die ihm verblüffend ähnlich sahen. Sie alle
gehörten zu dem, was wir in den USA ›poor white trash‹ nennen. Die
unterste Unterschicht der Weißen, die immer dringend jemanden
sucht, der in der gesellschaftlichen Hackordnung noch unter ihnen
steht. Meistens Farbige, Indianer oder Ausländer.
Ibrahim beachtete den pöbelnden Mann nicht und wollte
weiterhasten. Doch der Bierbauch verpaßte ihm unter dem Gejohle
seiner Freunde einen Fausthieb.
»Dir werde ich Manieren beibringen, dreckiger
Ausländer!«
Nun riß Ibrahims Geduldsfaden. Baseballkappe bekam das in Form
von einer Schuhspitze zu spüren, die plötzlich auf seinem
Solarplexus landete. Jaulend klappte der Mann zusammen. Der Araber
hielt sich nicht lange mit großen Volksreden auf, sondern erledigte
die Kumpane gleich mit. Der erste von ihnen ging unter einem
fürchterlichen Karatehieb zu Boden. Nummer zwei kam immerhin noch
dazu, seine Bierflasche zu heben. Doch Ibrahims Kopfstoß ließ ihn
ebenfalls den rauhen Boden Manhattans küssen. Der dritte im Bunde
hatte anscheinend den Glauben an die Überlegenheit der weißen Rasse
plötzlich verloren, denn er gab kräftig Fersengeld.
Aus den Augenwinkeln sah Ibrahim, daß Ali ihm mittlerweile mit
dem Wagen gefolgt war und sich am Straßenrand bereithielt. Es wäre
nicht die erste Entführung gewesen, die das ›Dattel-Duo‹
erfolgreich über die Bühne gebracht hätte…
Der Araber rannte weiter den Bürgersteig entlang, doch er
hatte Clive Hawks aus den Augen verloren. Nun ergossen sich auch
noch einige Hundertschaften Kinobesucher in das abendliche Gewimmel
der Lexington Avenue.
Ibrahim hielt sich an einige Mitmenschen, die sich von Berufs
wegen auf den Boulevards aufhielten.
»Haben Sie einen Mann mit dicker Brille und schütterem Haar
gesehen?« fragte er einen Hotdog-Verkäufer mit Bauchladen. »Er
braucht dringend ärztliche Hilfe!«
Fehlanzeige. Als nächster wurde ein Mann ausgequetscht, der
›Pretzels‹ anbot - eine typische New Yorker Brezelspezialität, die
einst von ostjüdischen Einwanderern dem gastronomischen Angebot des
›Big Apple‹ hinzugefügt wurde. Doch auch der Pretzelmann hatte
nichts gesehen.
Schließlich löcherte der Araber noch einen kleinen schwarzen
Schuhputzerjungen, der mit seinem ›Laden‹ vor einem Pfandhaus
hockte. Nichts.
Es ist, dachte Ibrahim, als ob sich die Hölle aufgetan hätte,
um diesen verdammten Physiker Clive Hawks zu verschlucken!
Resigniert schob er sich eine Dattel in den Mund.
***
Unser Katzenjammer hätte nach einem ausgiebigen Biergelage
nicht größer sein können. Milo und ich spürten immer noch die
Nachwirkungen des Tränengasangriffs, als wir am nächsten Morgen im
FBI-Building an der Federal Plaza zur Berichterstattung
antraten.
Unser Vorgesetzter Jonathan D. McKee empfing uns in seinem
Büro hinter dem wie immer perfekt aufgeräumten Schreibtisch. Auf
der Arbeitsfläche lag lediglich einer der schmalen FBI-Pappordner,
auf dem allerdings in großen roten Buchstaben die Warnung ›Top
secret‹ prangte -streng geheim.
Der Special Agent in Charge forderte uns mit einer
Handbewegung auf, Platz zu nehmen. Obwohl er bleich und
übernächtigt wirkte, war seine äußere Erscheinung wie immer
tadellos. Zu einem dunkelgrauen Anzug mit Nadelstreifen trug er ein
blütenweißes Hemd und eine dezente Krawatte. Mr. McKee ist Witwer,
seit Gangster vor Jahren als Racheakt seine gesamte Familie getötet
haben. Doch unser Chef bietet jeden Tag aufs Neue den Beweis, daß
sich auch alleinlebende Männer gepflegt geben können.
Ich hatte keine Lust, um den heißen Brei herumzureden. »Wir
haben versagt, Sir«, knurrte ich. »Dafür gibt es keine
Entschuldigung.«
»Wir hätten mit einem Angriff rechnen müssen«, pflichtete Milo
mir bei. »Die Gangster haben uns kalt erwischt - wie absolute
Anfänger.«
»Ich mache Ihnen keinen Vorwurf«, erklärte unser Chef mit
seiner ruhigen und sonoren Stimme. »Vielleicht lag der Fehler auch
bei mir. Ich hätte Sie in alles einweihen sollen, was ich selber
erfahren habe.«
Milo und ich sahen uns erstaunt an.
»Jesse, berichten Sie von gestern abend und geben Sie mir
Ihren jetzigen Kenntnisstand«, forderte Jonathan D. McKee mich
auf.
»Milo und ich bekamen am Montag von Ihnen den Auftrag, den
Physiker Clive Hawks zu beschützen, weil er sich bedroht fühlt. Mr.
Hawks arbeitet für das Wirtschaftsministerium in Washington. Daher
ist der FBI für ihn zuständig. Zumal die Gefahr, die ihm droht, mit
seiner Arbeit Zusammenhängen könnte. Worin die besteht, wissen wir
allerdings nicht.«
Mr. McKee nickte und warf mir einen Blick zu, der mich
weitersprechen ließ.
»Clive Hawks nahm an einem Physiker-Kongreß der Columbia
University teil. Wir sollten ihn während seines gesamten
New-York-Aufenthalts gegen mögliche Angriffe abschirmen. Deshalb
wurde er auch von uns vom Algonquin Hotel zur Universität und
zurück gefahren.«
»Leider haben wir ihn nicht ganz ernst genommen«, warf Milo
ein. »Er hat aber auch nie ausgespuckt, weswegen ihm die Muffe
ging.«
Die Ausdrücke meines Freundes brachten ihm einen leicht
tadelnden Blick von Mr. McKee ein, aber Milo hatte den Nagel auf
den Kopf getroffen. Wenn ich ehrlich war, dann hatte ich Clive
Hawks für einen durchgeknallten Wissenschaftler gehalten, dem die
Bodenhaftung schon lange fehlte.
»Wir verließen gestern abend die Columbia University um acht
Uhr«, fuhr ich fort. »Wegen des starken Verkehrs waren wir erst um
zwanzig nach acht an der Lexington Avenue. Etwa um die Zeit
erfolgte der Angriff.«
Milo übernahm den Erzählstrang. »Die Heckscheibe unseres
Fahrzeuges wurde zertrümmert, vermutlich mit einem
Baseballschläger. Es war überhaupt auffällig, daß keine Schußwaffen
eingesetzt wurden. Mr. Hawks sollte offenbar unbedingt lebend
gefangen werden. Die Angreifer warfen eine Tränengasgranate in
unseren Buick.«
»Es müssen mindestens vier gewesen sein«, ergänzte ich und
rieb meine Beule am Hinterkopf. »Jeder von uns hatte alle Hände
voll zu tun, sich seiner Haut zu wehren. Nach höchstens fünf
Minuten ließen sie von uns ab. Seitdem ist Mr. Hawks
verschwunden.«
»Davon hast du doch gar nichts mitbekommen«, frotzelte Milo.
»Du warst doch k.o.«
»Hat überhaupt jemand gesehen, wie Clive Hawks entführt
wurde?« fragte Mr. McKee.
»Negativ, Sir«, erwiderte Milo. »Er ist jedenfalls innerhalb
dieser fünf Minuten verschwunden.«
»Dann könnte er also auch selbst geflohen sein, um seiner
Entführung zu entgehen«, überlegte unser Chef.
»Aber warum hat er sich dann noch nicht beim FBI
zurückgemeldet?« wollte ich wissen.
Wir schwiegen alle drei. Waren ratlos. Mr. McKee unterbrach
die Stille. »Eine Großfahndung nach Clive Hawks läuft seit gestern
abend. Aber Sie brauchen mehr Informationen, um ihn wiederzufinden.
Öenn das wird Ihre nächste Aufgabe sein.«
Er unterbrach sich, um bei seiner Sekretärin Mandy drei Tassen
des köstlichsten Kaffees der westlichen Welt zu bestellen.
Jedenfalls war er das nach Ansicht sämtlicher G-men des FBI Field
Office New York.
Als er das duftende Getränk serviert bekommen hatte und den
ersten Schluck genießerisch schlürfte, klingelte das Telefon.
Er nahm den Hörer ab. An seiner versteinerten Miene konnte man
nichts ablesen. Doch ich spürte, daß es Ärger geben würde.
»Möglicherweise hat sich der Fall für Sie erledigt«, meinte
Mr. McKee, nachdem er aufgelegt hatte. »Die Metropolitan Police hat
soeben die Leiche von Clive Hawks gefunden.«
***
Es gibt viele schäbige Bars an der Delancy Street an der Lower
East Side. Und die schmierigste unter ihnen ist ›Adam's Place‹.
Damit ist allerdings nicht der biblische erste Mann gemeint. Obwohl
der Zustand der Kneipe jeden Besucher durchaus an die Vertreibung
aus dem Paradies denken läßt. Adam ist vielmehr der Besitzer, der
wegen seiner beachtlichen Leibesfülle hinter der Theke
steckengeblieben zu sein scheint. Deshalb trifft man ihn auch Tag
und Nacht dort an. Und deshalb trägt er vermutlich auch immer
dasselbe Hemd.
In der dunkelsten aller dunklen Ecken dieser Abfüllstation für
verlorene Seelen hingen vier Männer über ihrem lauwarmen
Budweiser.
Das Bier war lauwarm, weil ihnen allen der Durst vergangen
war. Und das wollte bei diesen Schluckspechten schon etwas
heißen.
»Scheiße«, sagte Henry Wagner, dessen deutscher Nachname das
einzig europäische an ihm war. Ansonsten wirkte er in seinem
Dodger-Shirt und den Basketballschuhen so amerikanisch wie ein
Truthahn zum Thanksgiving.
Mike Rollins hielt den Mund und drückte seinen Unmut mit der
rechten Faust aus, die in seine linke Handfläche klatschte.
»Dieses Arschloch Mitchell«, brachte Brian O'Leary den Unmut
aller auf den Punkt. Der dürre Ire war früher einer der
gefürchtetsten Schläger aller New Yorker Jugendbanden gewesen. Und
das wollte etwas heißen.
»Der hat uns beschissen«, stellte Jayy Melone traurig fest. Er
war der intelligenteste dieses kriminellen Quartetts. Unter seinen
zahlreichen Vorstrafen fanden sich auch je eine wegen Scheckbetrug
und Urkundenfälschung. Die anderen konnten nur mit Gewaltverbrechen
aufwarten und nannten ihn deshalb halb ironisch, halb ehrfürchtig
›Professor‹.
Sie alle hatten den sicheren Tod vor Augen. Keiner von ihnen
glaubte, daß der gewissenlose Vorstandschef von Inno Tech bluffen
würde. Wahrscheinlich stand der Auftragskiller schon
Schnellfeuergewehr bei Fuß, um ihnen allen das Lebenslicht
auszublasen. Wenn, ja wenn sie es nicht doch schafften, Clive Hawks
wieder herbeizubringen.
»Wo sollen wir ihn suchen?« fragte Henry Wagner in den Raum.
»Der Scheißkongreß an der Uni ist zu Ende.«
»Und sein Zimmer im Algonquin ist nur bis hfeute gebucht«,
ergänzte Mike Rollins. »Das habe ich gecheckt.«
»Wir sind des Todes, wenn der Sack nicht wieder auftaucht«,
wimmerte Henry Wagner. Er war trotz - oder wegen - seiner
Gewalttätigkeit im Grunde ein Feigling, der sich nur an Schwächeren
vergreifen konnte.
»Vielleicht sitzt er ja schon längst wieder in seiner Wohnung
in Washington?« fragte Brian O'Leary hoffnungsvoll.
»Vergiß es«, raubte ihm der ›Professor‹ die Illusion. »Das
habe ich als erstes versucht herauszubekommen. Seine Adresse ist
geheim. Top secret. Und wir haben keine Mittel, sie in Erfahrung zu
bringen.«
»Scheiße«, wiederholte Henry Wagner. Offenbar sein
Lieblingswort.
Ein bedrückendes Schweigen senkte sich über den Tisch der vier
Verbrecher. Jeder von ihnen brütete über der Lösung des
Problems.
»Ich hab's!« schrie der ›Professor‹ plötzlich auf. Die anderen
sehen ihn erwartungsvoll an.
»Wir haben Clive Hawks nicht, aber der FBI hat ihn auch nicht,
oder?« Die Komplizen nickten zustimmend. Sie hatten am vorigen
Abend aus sicherer Entfernung beobachtet, wie die Bullen
schließlich ohne ihren Schützling abziehen mußten.
»Einen der G-men habe ich erkannt«, grinste Jayy Malone.
»Jesse Trevellian, einer der besten FBI-Bullen Amerikas. Ich wette,
daß sie den auf die Spur von Clive Hawks setzen. Und wenn es einen
gibt, der ihn wiederfindet, dann ist es Jesse Trevellian!« .
Nun schaltete auch Henry Wagner. »Du meinst, wir brauchen
diesen Trevellian bloß zu osser… obser…«
»Wir brauchen ihn bloß zu beobachten«, nickte der ›Professor‹.
»Dann wird er uns ganz von allein zu Clive Hawks führen.«
***
Die Männer des Coroners hatten schon den Zinksarg
bereitgestellt und drehten den steifen Körper nun vorsichtig auf
den Rücken. Ich sah ihnen bei der Arbeit zu, die ich schon
tausendfach beobachtet hatte und an die ich mich nie gewöhnen
werde.
»Halt! Stopp!« brüllte ich plötzlich und rannte auf den Toten
zu. Die Männer vom Coroner hielten ihre Last zwischen Erdboden und
Sarg in der Schwebe und blickten mich erstaunt an.
Milo war mir gefolgt. »Das gibt es doch nicht!« rief mein
Freund. »Siehst du auch, was ich sehe, Jesse?«
Ich nickte, hin- und hergerissen zwischen Erleichterung und
Ratlosigkeit. »Das ist nicht Clive Hawks.«
***
»Laßt mich in Ruhe, ihr Idioten!« Der Mann mit den dicken
Brillengläsern versuchte, drohend zu klingen. Doch seine Stimme
hörte sich nur verängstigt an. Was er zweifellos auch war.
»Wir verstehen dich nicht, Kaner«, höhnte der betrunkene
Rotbart. Dann schubste er den Brillenträger in die Arme seines
ebenfalls nicht nüchternen Kumpels, der eine Pudelmütze trug. »Wir
sind hier auf Island! Sprich gefälligst Isländisch!«
Meist waren die beiden Freunde die feindlichsten Gesellen der
Welt. Doch an diesem Morgen in der isländischen Hauptstadt
Reykjavik standen sie noch voll unter der Wirkung des ›schwarzen
Todes‹, wie der illegal gebrannte Schnaps auf der Insel im
Nordatlantik genannt wird. Und da beschlossen sie, sich mit dem
merkwürdigen Typen einen Spaß zu machen, der ihnen unten am Hafen
über den Weg gelaufen war.
Sie waren der festen Überzeugung, daß es sich um einen ›Kaner‹
handelte, wie die Amerikaner von der Air Base Kevlavik auf der
Insel leicht abschätzig genannt werden. Und gegen Kaner hatten die
beiden Trawlerfischer etwas.
»Ich glaube, Mr. Rockefeller hier muß Wegegeld zahlen, bevor
wir ihn gehen lassen können«, lallte nun Pudelmütze und stieß sein
Opfer wieder in Richtung seines Freundes.
»Ja!« schrie Rotbart begeistert. »Wie wäre es mit ein paar
Dollars, Mr. Kaner-Großkotz?«
Der Bebrillte hatte von den unverständlichen Sätzen, die aus
den Mäulem seiner Peiniger drangen, nur die Worte ›Rockefeller‹ und
›Dollars‹ verstanden. Wollten sie Geld? Von ihm? Außer einem
T-Shirt trug er nur ein Paar Turnschuhe und eine rote Jogginghose.
Deren Taschen drehte er nun nach außen. Sie waren leer.
»Na so was«, staunte Rotbart. »Der Kaner ist pleite. Er kann
seinen Wegezoll nicht bezahlen. Dann muß er uns aber wenigstens die
Schuhe putzen, was, Jon?«
Pudelmütze lachte dreckig und versuchte, den Oberkörper des
Wehrlosen zu Boden zu drücken. Seine schweren Stiefel stanken nach
den Millionen von Fischen, über die er damit getrampelt war.
»Laßt mich doch gehen«, flehte der Brillenträger. Doch je mehr
er wimmerte, desto stärker wurden die Trawlerfischer in ihrem
unseligen Tun angestachelt.
»Küß mir die Füße, Kaner!« johlte Rotbart.
»Was geht hier vor?« Polizeikonstabler Ljot Hannibalsson und
sein Kollege Herjolf Gunnarsson waren von den beiden Betrunkenen
unbemerkt aus Richtung Innenstadt herangekommen.
»Misch dich nicht ein, Bulle!« röhrte Pudelmütze und stürzte
sich auf den Beamten in der blauen Uniform. Doch obwohl der Seemann
über Riesenkräfte verfügte, war er zu betrunken, um sie richtig
einsetzen zu können. Sein Fausthieb traf nur die Luft. Der Polizist
hatte reichlich Gelegenheit gehabt, sein Kinn wegzudrehen.
Pudelmütze war einfach zu langsam.
Grölend trat er dorthin, wo er den Leib seines Gegners
vermutete, doch wieder war Hannibalsson schneller. Als der
Betrunkene schwankte, trat ihm der Streifenpolizist die Beine weg.
Und kaum war der Brocken stöhnend auf dem harten Pflaster gelandet,
als auch schon eiserne Armfesseln seine behaarten Handgelenke
umschlossen.
Rotbart war etwas zäher und vielleicht nicht ganz so
weggetreten wie sein Kumpan. Er landete einige Boxhiebe auf
Gunnarssons Körper. Einige Minuten rangen der Polizist und der
Trawlerfischer miteinander. Inzwischen forderte Hannibalsson mit
seinem Walkie-talkie einen Streifenwagen an. Schließlich schickte
Gunnarsson seinen Gegner mit einem Gummiknüppelhieb ins Land der
Träume.
»Sind Sie in Ordnung?« fragte Ljot Hannibalsson den
Bebrillten, der die Kampfszene mit furchtsamer Miene verfolgt
hatte.
»Ich verstehe nicht…« erwiderte der Mann in der Jogginghose
mit einem bedauernden Schulterzucken.
»Sind Sie in Ordnung?« wiederholte der isländische Polizist
auf Englisch. Wie alle seine Kollegen beherrschte er diese
Fremdsprache fließend. Das war ein besonderer Service für die
130.000 Touristen, die jedes Jahr das Land mit den 252.000
Einwohnern besuchten. Hauptsächlich zum Bergwandem und für andere
Naturtrips.
»Ich bin in Ordnung«, murmelte der Brillenträger
gedankenverloren.
»Wir müssen ein Protokoll aufnehmen«, verkündete Hannibalsson,
plötzlich vom Kämpfer zum Bürokraten geworden. »Wie heißen
Sie?«
Der amerikanische Brillenträger schwieg. »Ich - ich weiß
meinen Namen nicht«, stammelte er nach einer Weile. »Und ich habe
keine Ahnung, wo ich bin und wie ich hierhergelangte.«
***
Nachdem wir in unser gemeinsames Büro zurückgekehrt waren,
beorderte uns Mr. McKee umgehend telefonisch zu sich.
Unser Chef war ebenfalls froh, daß es sich bei der Leiche
nicht um Clive Hawks handelte. Der Tod des Unbekannten ließ ihn
trotzdem nicht kalt. Gefühllosigkeit ist ein Zustand, den kein
FBI-Agent anstreben sollte, auch nicht nach jahrelangem
Dienst.
»Gibt es eigentlich einen Grund, warum Mr. Hawks entführt
worden ist und sich permanent bedroht fühlte?« wollte ich
wissen.
»Den gibt es, Jesse. Den gibt es«, sagte Mr. McKee versonnen
und legte die Spitzen seiner Finger gegeneinander. »Was würden Sie
zu einer Erfindung sagen, mit der man den Treibstoffverbrauch eines
jeden Kraftfahrzeugs auf fast die Hälfte des bisherigen reduzieren
kann?«
Milo und ich sahen uns an. »Das wäre revolutionär!« stieß ich
hervor.
»Das ist das richtige Wort«, bekräftigte Mr. McKee. »Unsere
Erdölimporte würden sich radikal kürzen lassen, Panzer und andere
Armeefahrzeuge könnten ihre Reichweite verdoppeln.«
»Und Clive Hawks hat eine solche Erfindung gemacht?« Milo
konnte es nicht glauben.
»Er steht kurz vor der Verwirklichung, arbeitet Tag und Nacht
daran«, berichtete Mr. McKee. »Aber er hat auch anonyme Drohungen
erhalten. Daher seine Angst, den Kongreß an der Columbia University
zu besuchen. Und daher der Auftrag für den FBI, Mr. Hawks zu
beschützen.«
»Wieso sind überhaupt Informationen über sein Projekt nach
außen gedrungen?« fragte ich. »Ich denke, er war in einem geheimen
Regierungslabor beschäftigt.«
»Das stimmt«, nickte Mr. McKee. »Wir vermuten, daß es dort
eine undichte Stelle gibt.«
»Vielleicht führt ja die Spur von dem unbekannten Toten zu
Clive Hawks«, hoffte Milo. »Der Mann trug Mr. Hawks Anzug, sein
Hemd, seine Schuhe, seine Brieftasche, sogar seine Socken. Es muß
doch eine Verbindung zwischen den beiden geben.«
»Zumindest ist das momentan unsere einzige Chance«, räumte
Jonathan D. McKee ein. »Finden Sie den Namen des Toten
heraus!«
***
In Murattis Augen flackerte die helle Panik auf. Das war auch
kein Wunder. Er wurde nämlich gerade vom ›Dattel-Duo‹ durch die
Mangel gedreht. Und wer einmal mit den beiden Verbrechern zu tun
gehabt hatte, der wußte genau, daß die Vorliebe für die süßen
Früchte ihrer Heimat das einzig Harmlose an ihnen war.
»Bitte nicht!« wimmerte Pete Muratti, als Ali zu einem neuen
Schlag ausholte. Bei der ›Überzeugungsarbeit‹ waren die beiden
Männer einander ebenbürtig. Deshalb lösten sie sich ja auch ab. Und
aus diesem Grund sah man auch keinem ihrer Opfer an, daß es gerade
fürchterlich vermöbelt worden war.
»Was habe ich denn getan?« keuchte Muratti, als ihm Ali das
Ohr verdrehte. Ich hätte mich nie mit diesen Typen einlassen
dürfen, dachte der Regierungsbeamte. Trotz all meiner Spielschulden
nicht!
»Du hast gar nichts getan, Pete«, flötete Ibrahim mit
zuckersüßer Stimme, während er sich gleich drei Datteln in den Mund
schob. »Nachdem Clive Hawks verschwunden ist, hast du gar nichts
mehr, getan. Obwohl wir ihn doch so gerne haben möchten.« Und er
spuckte seinem Opfer die Dattelkerne ins Gesicht.
»Aber was soll ich machen?« heulte Muratti auf. Er war kein
starker Mann. In den Staatsdienst war er eingetreten, weil seine
Mutter es so gewollt hatte. Und dem Spielteufel hatte er auch nie
widerstehen können. Wie konnte man erwarten, daß er diesen beiden
Eisenfressern etwas entgegensetzte?
»Clive Hawks ist offenbar entführt worden«, winselte er. »Der
FBI ermittelt. Und ihr habt ihn ja wohl nicht, soviel ist
sicher!«
»Der FBI ermittelt!« rief Ibrahim erfreut aus. »Und da fragst
du, was du machen sollst? Sobald die Bundespolizei weiß, wo sich
Hawks befindet, wirst du es an uns weiterleiten!«
»Du bist schließlich Hawks Arbeitskollege!« warf Ali ein und
befaßte sich noch etwas mit Murattis Ohr. Der Beamte schrie wie am
Spieß. »Und du bist selbst Geheimnisträger. Warum sollten die G-men
dir nicht vertrauen?«
***
Der unbekannte Tote war an Herzversagen gestorben. Das war die
einzige Überraschung, die der Obduktionsbericht für uns
bereithielt. Es handelte sich um einen etwa 50 Jahre alten Weißen,
dessen von schwerem Alkoholmißbrauch gezeichneter Körper einfach in
der vergangenen Nacht den Dienst versagt hatte. Sein schlechter
Gesamtzustand ließ darauf schließen, daß er jahrelang auf der
Straße gelebt haben mußte.
»Die Spur führt also in die Obdachlosenszene«, meinte Milo.
Ich nickte. Zum Glück haben wir unsere Kontakte, über die man die
unglaublichsten Informationen bekommen kann. In Gedanken versunken
griff ich mir das Telefon und rief einen Drugstore in der East 14th
Street an. Über diesen Anschluß war mein ›Penner V-Mann‹ meist zu
erreichen. Denn wer auf der Straße lebt, hat natürlich kein
Telefon.
»Wieso unterhält das US-Wirtschaftsministerium eigentlich ein
geheimes Forschungslabor?« wollte Milo wissen, nachdem ich den
Drugstorebesitzer um einen Rückruf meines Bekannten gebeten
hatte.
»Das habe ich mir von Mr. McKee erklären lassen. Das Labor ist
nicht direkt geheim. Es weiß bloß niemand, daß es von der Regierung
finanziert wird.«
Milo grinste. »Was für ein großer Unterschied. Aber wir
sollten mal Clive Hawks Kollegen durchleuchten. Einer von denen
kann ja wohl seine Klappe nicht halten. Sonst wäre unser Schützling
nicht entführt worden.«
»Milo, wir wissen nicht hundertprozentig, ob er entführt
wurde. Vielleicht konnte er ja auch fliehen.«
»Aber wo zum Henker ist er dann jetzt?« seufzte Milo.
Das Telefon klingelte und ersparte mir eine Antwort, die ich
sowieso nicht hätte geben können.
»Hier ist Howard!« Es war mein ›Straßenkontakt‹.
»Das ging ja schnell«, meinte ich.
»Kein Problem«, lachte er. »Ich wohne zur Zeit in der Gasse
hinter dem Drugstore. In einem komfortablen Pappkarton.«
Ich verabredete mich mit ihm. Eine Stunde später saßen Milo
und ich dem schäbig gekleideten, aber cleveren Burschen in einer
Filiale von ›Dunkin Donuts‹ gegenüber. Die US-weit verbreitete
Fastfood-Kette hat sich auf die süßen Fettkringel spezialisiert und
bietet sie in allen Variationen an. Und Howard bemühte sich gerade,
das gesamte Sortiment durchzuprobieren. Auf meine Kosten
natürlich.
»Kennen Sie diesen Mann?« Ich schob ihm ein Foto von dem Toten
herüber, der Clive Hawks Anzug getragen hatte.
Howard gingen fast die Augen über, während er sich einen
ganzen Schoko-Donut auf einmal in den Mund schob.
»Natürlich«, schmatzte er mit vollem Mund. »Das ist der
Texaner.«
»Wer?« hakte ich nach.
»Der Texaner. Seinen richtigen Namen kennt niemand.
Wahrscheinlich hat er ihn selbst längst vergessen. Aber wieso
steckt der in so einem guten Anzug? Und tot scheint er auch noch zu
sein… armer alter Süffel.«
»Können Sie uns zeigen, wo der Texaner Platte gemacht
hat?«
Mit diesem Ausdruck meinte ich den festen Schlafplatz, den die
meisten Obdachlosen ungern wechseln.
»Na klar. Aber erst noch einen Donut, okay?«
Wir waren eigentlich nicht überrascht, daß uns Howard zur
Lexington Avenue führte. Dort, in einer toten Sackgasse zwischen
einem Textillager und einem Depot für leere Weinflaschen, lag eine
durchnäßte Matratze sowie einiger Krimskrams.
»Hier ist es«, sagte unser Kontaktmann. »Der Texaner liebte
diesen Platz wegen dem Weingeruch.«
Milo kniete nieder. »War das seine Alltagskleidung?«
Mit spitzen Fingern hob er einen dreckstarrenden Mantel und
eine halb zerfetzte Hose hoch. Ausgelatschte Schuhe und ein
Sweatshirt fanden sich ebenfalls.
»Alltagskleidung ist gut«, lachte Howard. »Es war seine
einzige Kleidung überhaupt.«
»Ich stelle es mir so vor«, überlegte ich laut. »Clive Hawks
kommt in diese Gasse, trifft den Texaner und tauscht mit ihm die
Kleidung.«
»Oder das Physikgenie läuft hier auf, legt einen Striptease
hin und flüchtet nackt weiter«, witzelte Milo.
Bevor ich etwas erwidern konnte, summte das Handy in meiner
Jackett-Tasche.
»Trevellian!«
Das Gespräch dauerte nur eine Minute. Aber als ich mein
Mobiltelefon ausschaltete, muß ich ausgesehen haben, als sei mir
der Geist von Abraham Lincoln erschienen.
»Was ist denn los, Alter?« drängte Milo.
»Mr. McKee war am Apparat«, entgegnete ich entgeistert. »Man
hat Clive Hawks gefunden. Er ist auf Island.«
***
Ray Mitchells Hand lag schwer auf dem Knie der attraktiven
Brünetten. Langsam schob er seine Rechte auf ihrem wohlgeformten
Oberschenkel höher. Der Rocksaum rutschte mit hoch, und dann waren
die Ränder ihrer schwarzen Strümpfe zu erblicken.
Der herrische Blick des Vorstandschefs bohrte sich in die
großen braunen Augen von Lara Ferguson. Es war, als wollte der Mann
mit dem kantigen Kinn sie hypnotisieren. Sein Ruf als Frauenheld
eilte ihm im Inno Tech Konzern und in der Geschäftswelt stets
voraus. Doch dieses Image verringerte seinen Verschleiß an
Bettgespielinnen nicht. Im Gegenteil…
Lara Ferguson arbeitete bereits ein halbes Jahr für Inno Tech.
Aber Ray Mitchell war erst vor kurzem auf sie aufmerksam geworden,
als sie ein Organisationsproblem in ihrer Abteilung schnell und
unkompliziert gelöst hatte. In solchen Fällen erfolgte eine
persönliche Belobigung durch den Oberboß, also ihn, Mitchell. Und
da war ihm auch ihre Schönheit ins Auge gefallen.
Es war ruhig auf der Vorstandsetage, obwohl mitten am
Nachmittag alle anderen Teile der Konzernzentrale wie die Tentakel
eines Kraken aktiv waren, um weitere Bucks in die Kasse von Inno
Tech zu schaufeln. Mitchell hatte seiner Sekretärin strikte
Anweisung gegeben, daß er nicht gestört werden wollte. Er hatte
sich eine Stunde in seinem Terminkalender ›freigeschaufelt‹. Und
die wollte er mit Lara Ferguson auf dem Ledersofa seines Büros
genießen. Daher war er ziemlich sauer, als plötzlich ein Mann in
einem billigen Kaufhausanzug in der Tür zum Vorzimmer stand.
Die Brünette hüpfte wie von der Tarantel gebissen von Mitchell
weg und zog hastig ihren Rocksaum herunter. Der Konzernchef federte
aus den Sitzen hoch und stürmte mit geballten Fäusten auf den
Eindringling zu.
Hinter dem Fremden tauchte plötzlich das verzweifelte Gesicht
der Sekretärin auf.
»Ich wollte ihn aufhalten, Mr. Mitchell«, jammerte sie. »Aber
er ging einfach durch…«
»Sie sind gefeuert!« schnappte der Boß. »Gehen Sie mir aus den
Augen!«
»Schlechte Nerven, Mitchell?« fragte der unbekannte Mann
scheinheilig und zündete sich mit entnervender Ruhe eine Zigarette
an.
Der Vorstandschef ging noch einige Schritte nach vorne, bis er
dicht vor dem Eindringling stand.
»Raus mit Ihnen, bevor ich mich vergesse!« brüllte Mitchell.
»Und hier drin wird nicht geraucht.«
»Hier drin wird geraucht«, erwiderte der Mann und schnippte
provozierend die Asche auf den Velours-Teppichboden. »Ich mache
nämlich, was ich will. Und nun schicken Sie Ihren Betthasen weg.
Wir haben Geschäftliches zu bereden.«
Ray Mitchell war einen Kopf größer als sein ungebetener
Besucher und ging dreimal pro Woche zum Boxtraining in einem
exklusiven Uptown-Gym, wo die Sparringspartner Banker und
Börsenmakler waren, und hohe Verwaltungsbeamte sich am Sandsack
abarbeiteten. Der Besucher wirkte schmächtig und ungesund.
Doch als die beiden Männer sich in die Augen sahen, passierte
etwas Unglaubliches. Lara Ferguson mußte miterleben, wie der große
Ray Mitchell dem Blick des Fremden auswich. Denn der Vorstandschef
war zwar Herr über Millionen Leben. Doch dieser andere Mann war ein
Meister des Todes. Man konnte in seinen Pupillen ablesen, daß er
Menschen so leicht und ohne Gewissensbisse tötete wie andere Leute
Fliegen. Ray Mitchell hatte plötzlich Angst. Und auch das war eine
unerhörte Neuigkeit. Vor allem für ihn selber.
»Gehen Sie bitte, Lara«, murmelte er und versuchte vergeblich,
seiner Stimme die gewohnte Festigkeit zu geben. »Ich rufe Sie
später an, ja?«
Beleidigt stolzierte die brünette Schönheit von dannen. Sie
konnte es kaum erwarten, im Kollegenkreis von der Demütigung des
unschlagbaren Kings Mitchell zu berichten.
»Sie müssen Mr. Cardiff sein«, sagte der Konzernchef mit
fragendem Unterton, als sich die Tür hinter Lara Ferguson
geschlossen hatte.
»Ich bin Owen Cardiff«,'nickte der Mann im Kaufhausanzug. »Und
ich mag es gar nicht, wenn ich hingehalten werde. Sie hatten mir
vier Objekte in Aussicht gestellt, die ich zu bearbeiten
habe.«
Damit meinte der professionelle Auftragskiller vier Morde.
Bluttaten, mit denen Mitchell die Entführer von Clive Hawks
beseitigen wollte. Natürlich erst, nachdem sie endlich Erfolg
gehabt hatten…
»Dabei bleibt es auch, Mr. Cardiff«, versicherte Ray Mitchell
und verachtete sich plötzlich selber, weil er vor dem Besucher
plötzlich so herumschleimte wie sonst seine Angestellten vor ihm.
Dieser Mann hatte etwas an sich, das ihm das Herz in die Hose
rutschen ließ.
»Aber wann, Mitchell, wann? Ich habe auch noch andere Arbeit
zu erledigen.«
Cardiff nahm seine Zigarettenkippe, warf sie auf den
Teppichboden und trat sie mit dem Absatz aus. Normalerweise wäre
der Konzernchef nun aus der Haut gefahren. Aber an diesem
Nachmittag war nichts normal.
»Wir müssen noch warten, Mr. Cardiff. Die - äh - Objekte
müssen noch einen Auftrag ausführen, bevor sie nutzlos geworden
sind. Ich halte Sie auf dem taufenden. Wenn Sie schon Auslagen
gehabt haben oder einen weiteren Vorschuß brauchen…« Ray Mitchell
zückte sein Scheckbuch und versuchte ein gewinnendes Lächeln, was
ihm gründlich mißlang.
»Behalten Sie Ihre Dollars, Mitchell«, höhnte Cardiff und
wandte sich zum Gehen. »Ich verrate Ihnen mein kleines Geheimnis.
Geld bedeutet mir nichts - das sehen Sie schon an meinem einfachen
Anzug.«
***
»Clive Hawks ist auf Island?« wiederholte Milo, nachdem wir
wieder an der Federal Plaza eingetroffen waren und Mr. McKee in
seinem Büro gegenübersaßen. Mein Freund wirkte so ungläubig, als
hätten der Chef und ich uns abgesprochen, um ihn zu
veräppeln.
Mr. McKee nickte. »Alles spricht dafür. Die isländische
Polizei hat über Interpol dieses Funkfoto an die Zentrale in
Washington geschickt.«
Er schob mir die Aufnahme rüber. Sie zeigte einen müden und
offenbar verwirrten Mann in einem T-Shirt. Aber es war ganz
eindeutig Clive Hawks.
»Sie sagen, alles spräche dafür, Sir. Hat sich denn Mr. Hawks
nicht mit unserer Botschaft in Verbindung gesetzt, um Ersatzpapiere
zu bekommen? Seine Brieftasche mit allen Ausweisen haben wir ja bei
dem Obdachlosen gefunden.«
Mein Einwand schien Jonathan D. McKee nicht zu überraschen.
»Das hätte wohl jeder von uns getan, wenn er im Ausland ohne
Papiere stranden würde. Aber der Fall ist noch komplizierter.
Dieser Mann, der Clive Hawks zu sein scheint, hat sein Gedächtnis
verloren.«
Milo ließ sich zurücksinken. »Diese Affäre schafft
mich!«
»Wenn es sich wirklich um den Physiker handelt, droht ihm nach
wie vor eine Entführung«, fuhr der Chef fort. »Sie beide haben ihn
drei Tage lang überwacht. Daher werden Sie ihn auch erkennen, wenn
Sie ihm gegenübertreten.«
»Sie meinen, wir sollen…« Milo ließ seinen Satz
unbeendet.
Wieder nickte der Special Agent in Charge. »Jesse und Sie
fliegen morgen nach Island. Es gibt eine direkte Verbindung vom
Jonathan F Kennedy Airport in die dortige Hauptstadt
Reykjavik.«
»Ich dachte immer, auf dieser Insel leben nur Pinguine!«
spottete Milo.
»Pinguine gibt es am Südpol, also genau am anderen Ende der
Welt«, wies ihn der Chef mit mildem Tadel zurecht. »Sie haben
natürlich auf Island keine Polizeigewalt, sondern müssen alle
Aktionen mit den dörtigen Behörden abstimmen. Ich habe bereits mit
dem isländischen Innenminister telefoniert und ihm die Lage
geschildert. Er war sehr hilfsbereit. Wenn Sie morgen nachmittag
dort eintreffen, werden Sie von einem gewissen Polizeileutnant
Sigurdarsdottir abgeholt. Er wird Ihnen bei allen Problemen
Unterstützung gewähren.«
»Das ist gut«, erwiderte ich. »Mein Gefühl sagt mir, daß die
Schwierigkeiten dieses Falles erst anfangen!«
Und damit sollte ich recht behalten.
***
An diesem Vormittag hatte es Henry Wagner übernommen, Jesse
Trevellian zu beschatten. Das Gangster-Quartett setzte seine ganze
Hoffnung in den G-man. Wenn er sie nicht zu Clive Hawks führen
konnte, würde ihnen ein entsetzlicher Tod sicher sein. Denn keiner
von ihnen glaubte daran, daß ihr Auftraggeber Ray Mitchell
vielleicht nur bluffen könnte.
Henry Wagner hatte sich eine geniale Tarnung zugelegt. Diese
Idee war natürlich weder ihm noch einem der anderen schlichten
Kumpane gekommen, sondern dem ›Professor‹.
Der Ganove verkaufte Broschüren einer Psychosekte. Jayy Melone
hatte einfach einem ›echten‹ Sektenmitglied auf der Fifth Avenue
gleich ein Dutzend der kleinformatigen Schriften über das
bevorstehende Ende der sündigen Welt abgekauft. Und mit dieser Ware
stand Henry Wagner nun schon seit acht Uhr morgens vor dem FBI
Field Office an der Federal Plaza und versuchte, ein wenig verrückt
auszusehen. Jedenfalls war sein stundenlanges Herumlungem noch
niemandem aufgefallen. Sobald ein Passant auf ihn zukam, schwenkte
er seine Heftchen. Und zu seiner großen Freude war noch niemand auf
die Idee gekommen, eins haben zu wollen. Der Gangster warf einen
Blick auf seine Armbanduhr. Es war nach zwölf. Trevellian könnte
langsam einmal Pause machen, dachte er.
Und dann geschah plötzlich alles gleichzeitig. Ein
langbärtiger Bursche mit unmodischer Brille steuerte auf ihn zu,
während Trevellian in Begleitung eines anderen G-man den
Haupteingang verließ und Richtung Norden schlenderte.
»Werden wir das Jahr 2000 noch erleben?« fragte der
Langbart.
»Woher soll ich das wissen?« erwiderte der Ganove, plötzlich
hektisch geworden. Er mußte dem Fed folgen!
Doch der andere Mann hielt ihn an der Jacke fest, als er sich
an Trevellians Fersen heften wollte.
»Warum so eilig, Bruder? Armaggeddon naht! Und der Herr hat
nur wenige unter seinen Schafen auserwählt!«
»Lassen Sie mich los!« zischte Henry Wagner, der sich herzlich
wenig für den Weltuntergang interessierte. Wenn sie Clive Hawks
nicht entführen konnten, würde er das Ende des Planeten sowieso
nicht mehr miterleben!
Die beiden G-men hatten nun schon mindestens 50 Yard
Vorsprung. Der Bärtige zerrte an Wagners Jacke.
»Das Ende ist nah! Lasset uns beten!«
Der Gangster ließ nicht nur die Broschüren, sondern auch seine
Sektentarnung fallen. Er wuchtete seine Rechte in den Magen des
Endzeit-Fans. Als dieser zusammenbrach, eilte er den Beamten
hinterher, die zum Glück nichts von dem Zwischenfall bemerkt
hatten. Er bekam gerade noch mit, wie sie in einem chinesischen
Schnellrestaurant namens ›Wong's‹ verschwanden.
Auf diesem Stück des Broadway gibt es einige öffentliche
Gebäude wie das Federal Building und die City Hall sowie jede Menge
Büro-Wolkenkratzer, das Woolworth Building beispielsweise.
Entsprechend groß ist die Zahl an typischen Mittagspause-Lokalen
wie eben dem ›Wong's‹. Dort ist es zwischen zwölf und drei Uhr
immer sehr voll. Doch Henry Wagner hatte Glück- In der nächsten
Eßnische neben dem Tisch der beiden FBI-Agenten war noch ein Platz
frei. Er quetschte sich neben einen Buchhaltertypen, der seinen
Lunch wohl in flüssiger Form zu sich nahm. Jedenfalls standen schon
drei leere Bierflaschen der chinesischen Marke ›Tsing Tao‹ vor
ihm.
Der Gangster bestellte eine Wan-Tan-Suppe und begann zu
lauschen.
»Island!« hörte er Jesse Trevellians Begleiter gerade sagen.
»Ein einsamer Felsen im Nordatlantik, dünn besiedelt, mit mehr
Schafen als Menschen. Und dort taucht Clive Hawks wieder auf? Das
packe ich nicht, Jesse!«
»Morgen um diese Zeit sitzen wir schon in der Maschine nach
Reykjavik, Milo. Ich bin mir sicher, daß wir das Rätsel vor Ort
lösen können.«
»Mir fehlt die Verbindung. Ein Mann verschwindet auf der
Lexington Avenue in New York und wächst plötzlich am Fischereihafen
in Reykjavik aus dem Boden, als wäre er von Enterprise-Scotty dahin
gebeamt worden.«
Henry Wagner verfolgte das Gespräch mit heftig klopfendem
Herzen. Der FBI wußte also, wo Clive Hawks war! Der sichere Tod
schien ihm und seinen Kumpanen nun wohl doch nicht zu drohen.
»Alleine kann Hawks es nicht geschafft haben«, sagte Jesse
Trevellian gerade. »Er muß über Helfer verfügen. Zum Beispiel hatte
er keine echten Papiere bei sich. Seine Brieftasche steckte ja im
Anzug des Toten.«
»Als die isländische Polizei ihn aufgegriffen hat, waren seine
Taschen komplett leer, Jesse. Kein Geld, kein Ausweis, noch nicht
einmal ein Taschentuch.«
Wagner hatte genug gehört. Er warf einige Münzen für die Suppe
auf den Tisch und wollte gerade verschwinden, als sich die Hand des
G-mans namens Milo auf seinen Ärmel legte: »Kann ich Sie einmal
kurz sprechen, Mister?«
***
Mir war der Mann nicht weiter aufgefallen, der hinter Milo am
nächsten Tisch im ›Wong's‹ saß. Doch als mein Freund sich umdrehte
und ihn ansprach, sah ich die helle Panik im Gesicht des Mannes.
Eine irrsinnige Angst, für die es keinen nachvollziehbaren Grund
gibt, wenn man mittags in einem Restaurant höflich angesprochen
wird.
Es paßte nur allzu gut, daß sich der Fremde sofort losriß und
zum Ausgang stürzte.
»Hinterher!« rief Milo. »Ich erkläre dir alles später.«
Wir nahmen die Beine in die Hand. Es gab nur eine Erklärung.
Der Flüchtende wußte, daß wir FBI-Agenten waren. Und er mußte einen
guten Grund haben, warum er keinen Kontakt zu unserem Verein haben
wollte.
Milo war zehn Schritte vor mir, aber ich holte auf. Kaum hatte
ich die Restauranttür aufgestoßen, sah ich den Verdächtigen auf die
Fahrbahn springen. Eine Wahnsinnstat bei dem Verkehr!
Bremsen quietschten. Der Mann hüpfte halb auf die Kühlerhaube
eines Yellow Cab, verfolgt von den gotteslästerlichen Flüchen des
Fahrers. Er stieß sich ab, geriet auf die Parallelfahrbahn.
Vollbremsungen, empörtes Hupen. Wir setzten ihm natürlich nach,
doch wir konnten es im Gegensatz zu ihm nicht einfach in Kauf
nehmen, eine Massenkarambolage zu verursachen. Milo und ich
steckten unsere FBI-Schilder an die Jacketts, damit alle
Beteiligten wußten, mit wem sie es zu tun hatten.
Nach langen Sekunden hatten wir den Broadway ebenfalls
überquert.
»Nach rechts!« rief Milo. Ich hatte die Zielperson schon aus
den Augen verloren. Der breite Bürgersteig wimmelte von Menschen.
Wir liefen noch ein Stück. Aber mir war bald klar, daß sich dieser
Bursche in Luft aufgelöst hatte - es gibt keine bessere ›Tarnkappe‹
als eine Masse von Passanten.
Milo blieb stehen und schlug mit der rechten Faust in die
geöffnete linke Handfläche.
»Ich war so nah dran!« sagte er, und zeigte mir mit Daumen und
Zeigefinger einen Abstand von vielleicht einem Millimeter. Ich
wollte auf seinen Hang zu Übertreibungen eingehen, hielt aber
diesmal lieber den Mund.
»Was wolltest du von ihm?« fragte ich statt dessen.
»Dieser Kerl hat ein wahnsinnig penetrantes Rasierwasser
aufgelegt, Jesse!«
»Na und? Das ist zwar lästig, aber dagegen gibt es im Staat
New York meines Wissens noch kein Gesetz.«
»Warte doch mal ab. Genau dasselbe Rasierwasser hatte der
Maskierte, mit dem ich bei der Entführung von Clive Hawks gekämpft
habe. Es muß sich um eine seltene Marke handeln, glücklicherweise.
Darum wollte ich, als ich bei ›Wong's‹ den Duft wiedererkannte, den
Mann eigentlich nur fragen, wo man diese parfümierte Brühe kaufen
kann. Und da hat er gleich Fersengeld gegeben.«
»Sehr verdächtig«, überlegte ich. »Vielleicht war es ja einer
der Entführer.«
»Und er war in dem China-Restaurant…«
»…um herauszufinden, wo sich Clive Hawks nun aufhält«,
knirschte ich. »Und das ist ihm ja nun wohl gelungen!«
***
Für Ray Mitchell waren 10.000 Dollar nicht mehr als ein
Trinkgeld. Darum hatte er auch keine Hemmungen, dem erfolglosen
Entführer-Quartett diese Summe zu überreichen, um auf Island nun
doch noch Clive Hawks in ihre Gewalt zu bringen.
Henry Wagner hatte von den FBI-Informationen berichtet. Daß
die Special Agents ihn beinahe geschnappt hatten, ließ er lieber
unter den Teppich fallen.
Da er Trevellian und Tucker nun bekannt war, würden Rollins,
O’Leary und Melone die Aktion ohne ihn beenden müssen. Und auch das
sagten sie ihrem gnadenlosen Auftraggeber lieber nicht. Sonst würde
er noch auf die Idee kommen, Henry Wagner gleich einen
Auftragskiller auf den Hals zu schicken…
Nachdem sich die Tür hinter dem um zehn Grands reicheren
Gangster geschlossen hatte, lehnte sich der Konzernchef in seinem
Ledersessel zurück und überlegte.
Durch Clive Hawks Erfindung würde Inno Tech unter allen
multinationalen Konzernen sofort in eine unumstrittene
Führungsposition gehen. Er, Mitchell, würde über Nacht zu einem der
mächtigsten Männer Amerikas und der Welt werden. Dafür war er
bereit, über Leichen zu gehen. Die vier Ganoven waren des Todes,
sobald sie ihren Auftrag erfolgreich ausgeführt hatten.
Doch vertrauen konnte er ihnen in jedem Fall nicht. Sie mußten
überwacht werden, während sie zum zweiten Mal die Entführung von
Hawks versuchten.
Kurz entschlossen griff Mitchell zum Telefon und wählte eine
Handynummer: »Mr. Cardiff? Hier spricht Ray Mitchell. Die Objekte
werden kurzfristig außer Landes sein. Nein, der Auftrag wird nicht
weiter verschoben. Ja, wenn Sie vielleicht persönlich… ja, auf
jeden Fall. Sobald die Objekte nicht mehr benötigt werden, können
Sie Ihren Auftrag erledigen. Ja, natürlich auch im Ausland. Das
spielt keine Rolle. Weitere Informationen folgen. Danke.
Wiedersehen!«
Der Vorstandschef legte auf und goß sich einen Whisky ein.
Dieser Cardiff war… was er sich nie eingestanden hätte. Bei
niemandem. Dieser Cardiff war eine Nummer zu groß für ihn.
***
Schon beim Einchecken am Terminal der Icelandair auf dem
Jonathan F Kennedy Airport hatte ich das Gefühl, verfolgt zu
werden. Der Flug war bis auf den letzten Platz ausgebucht. Viele
Menschen benutzen die günstigen Tickets der isländischen
Fluggesellschaft, um billig nach Europa zu kommen. Denn Reykjavik
ist nur Zwischenstop. Von dort aus geht es weiter in Richtung
London oder Amsterdam.
Für uns würde die Reise allerdings schon in der
96.000-Einwohner-Hauptstadt des kleinen Landes enden. Für uns und
für die mutmaßlichen Entführer von Clive Hawks, die ich vergeblich
unter den Mitfliegenden zu entdecken versuchte.
Es wimmelte nur so von alleinreisenden Männern. Die meisten
sehen aus wie richtige Naturburschen in grobgestrickten Pullovern
und derben Jacken. Burschen, die sonst in den Catskill-Mountains
herumkraxelten. Und sich nun einmal an einen richtigen Gletscher
wie den Vatnajökull im Süden Islands heranwagen wollten. Die
Stewardeß war strohblond und sprach perfektes Englisch, wenn auch
mit einem knorrigen Akzent. Wir gaben unsere Bordkarten ab und
nahmen im vorderen linken Drittel der Boeing 747 Platz. In unseren
Schulterholstern ruhten die Dienstrevolver der Marke Smith &
Wesson. Dank einer schriftlichen Ausnahmegenehmigung der
Präsidentin Vigdis Finnbogadottir durften wir sie auch bei diesem
Auslandseinsatz tragen. Mr. McKee hatte das arrangiert.
Nachdem wir angeschnallt waren und uns der Kapitän über
Bordlautsprecher einen guten Flug gewünscht hatte, rollte die
Maschine auf die Startbahn.
»Frag mich doch mal, was mir an diesem Fall mißfällt, Milo«,
sagte ich zu meinem Freund.
»Was mißfällt dir an diesem Fall, Jesse?«
»Der FBI läuft den Ereignissen hinterher. Erst die
Entführungsaktion, dann der tote Obdachlose, dann der geflüchtete
Rasierwasserfan. Es wird Zeit, daß wir einmal etwas tun, um die
Dinge zu bewegen.«
»Was hast du vor?«
»Du wirst schon sehen.« Mit diesen Worten winkte ich die
Stewardeß heran. Ich flüsterte ihr etwas ins Ohr und zeigte ihr
unauffällig meine FBI-Marke.
»Da muß ich erst einmal den Kapitän fragen«, meinte sie.
»Tun Sie das«, erwiderte ich.
Versonnen betrachtete ich die Wolken, während die Maschine an
Höhe gewann. Eine Viertelstunde später brachte die Blondine mir die
Passagierliste.
»Vielen Dank«, sagte ich. Dann beugten Milo und ich uns über
die Tabelle.
»Die Augen von Clive Hawks Entführern werden nun auf uns
gerichtet sein«, raunte ich meinem Freund und Kollegen zu. »Haben
wir einen Verdacht? Sie wissen es nicht. Kennen wir ihre Namen? Wer
weiß. Lassen wir sie in Reykjavik von der Polizei kassieren?
Immerhin möglich.«
»Du willst sie nervös machen?«
»Wer nervös ist, begeht Fehler. Und sie werden einen Fehler
machen, Milo.« Unsere Sitze lagen von den meisten anderen
Passagieren aus gesehen gut im Blickfeld. Es war nicht zu
übersehen, daß wir die Liste studierten.
»Vielleicht nützt uns ja diese Aufstellung wirklich etwas«,
meinte Milo. »Die Transitpassagiere nach London scheiden als
Verdächtige aus. Bleiben 64. Wir scheiden ebenfalls aus. Bleiben
62.«
»Nehmen wir mal spaßeshalber die Familien mit kleinen Kindern
raus«, ergänzte ich. »Bleiben 51.«
»Und ich sehe hier drei oder vier Old Boys, die sich wohl kaum
mit Lösegeld die Rente aufbessern wollten. Bleiben 47.«
»Immer noch viel zu viele.«
»Abwarten, welche von denen schlechte Nerven haben.« Ich stand
auf und ging Richtung Pilotenkanzel. .
»Ich möchte mit dem Kapitän sprechen«, sagte ich zu der
Stewardeß, die in der Teeküche gerade Häppchen arrangierte. Das
FBI-Abzeichen verlieh meinen Worten Nachdruck.
JCäpt'n Olafur Johannessen sah aus, als würde er nicht ein
modernes Verkehrsflugzeug, sondern ein Wikingerboot befehligen.
Sein breites Kreuz ragte weit über die Lehne seines Sitzes hinaus.
Als er sich umdrehte, blitzten mich stahlblaue Augen über einem
struppigen Vollbart freundlich an.
»Mr. Trevellian, nicht wahr?« röhrte er und quetschte meine
Rechte in seiner riesigen Pranke. »Wie können wir der
amerikanischen Bundespolizei helfen?«
»Sie haben möglicherweise einige Verbrecher an Bord, Käpt'n
Johannessön!« Und ich erzählte ihm von meinem Verdacht.
Auf seiner Stirn erschienen dicke Sorgenfalten. »Und was kann
ich hierbei tun, verdammt noch mal?«
»Alarmieren Sie die Polizei in Reykjavik über Funk. Sie sollen
uns ein Empfangskomitee bereitstellen. Mein Kollege und ich werden
versuchen, die Gangster zu enttarnen.«
»Ist das nicht gefährlich?« fragte der blasse Kopilot.
»Nicht so gefährlich, als wenn diese Burschen unerkannt
entkommen können«, sagte ich.
***
Brian O’Leary war von einer wilden Panik erfaßt.
Eingesperrtsein! Das war für ihn das Schlimmste, was es gab.
Entsetzlicher noch, als der sichere Tod, der ihm und seinen
Kumpanen durch den Auftragskiller von Ray Mitchell drohte, falls
sie versagten.
Wieso falls, schrie es in ihm. Wir sind am Ende!
Das Flugzeug der Icelandair wurde in O'Learys Fantasie zu
einem garantiert ausbruchssicheren Gefängnis. Wie sollte man von
hier aus fliehen? Was, wenn schon die Bullen an der Landebahn
warteten?
Wenn der Verbrecher noch einmal vor Gericht gestellt und
verurteilt wurde, erwartete ihn lebenslange Haft. Gemäß dem neuen
amerikanischen Justizmotto ›three strikes and you are out‹ wäre es
bei ihm bereits die dritte Haftstrafe in Zusammenhang, mit
Gewaltverbrechen. Und das bedeutete unweigerlich lebenslänglich -
egal, wie hoch das Strafmaß ausf allen würde.
Ich will nicht in den Knast! brüllte seine innere Stimme. Die
FBI-Bullen haben die Pässagierliste. Der eine ist jetzt beim
Piloten drin und alarmiert garantiert die isländischen Cops. Und
dann kriegen sie uns! Ich will nicht!
Der ›Professor‹ hatte bemerkt, daß sein Komplize kurz vor dem
Durchdrehen war. Der dritte im Bunde schien friedlich vor sich hin
zu schnarchen, nachdem er bereits kurz nach dem Start zwei Whisky
getankt hatte. Aber wenn O'Leary sich nicht zusammenriß, würde er
das ganze Unternehmen gefährden!
»Es kann nichts passieren«, flüsterte ›Professor‹ Malone dem
durchdrehenden Iren ins Ohr. »Die G-men haben keine
Anhaltspunkte.«
»Keine Anhaltspunkte!« äffte der panische Schlägertyp seinen
Sitznachbarn nach. Er war kurz davor, dem ›Professor‹ eine zu
verpassen. Das war ein Grundproblem seines Lebens. Wenn es brenzlig
wurde, schlug er zu. »Und darum alarmiert Trevellian die
isländischen Bullen, weil er keine Anhaltspunkte hat, was? Weißt
du, wo du dir deine Anhaltspunkte hinstecken kannst?« Der Professor
reagierte hierauf nicht. O'Leary war offenbar nicht mehr zugänglich
für logische Argumente. Eine Morphiumspritze wäre jetzt genau das
Richtige. Aber wer hat so etwas schon im Handgepäck?
Er beschloß, Mike Rollins zu wecken. Gemeinsam würden sie
vielleicht eher auf den Kumpel einwirken können. Aber Rollins saß
auf der anderen Seite des Ganges. Der ›Professor‹ stand auf, um zu
ihm hinüberzugehen.
»Wo willst du hin?« kreischte der Ire. »Willst dich wohl aus
dem Staub machen, was?«
»In dieser Flughöhe?« zischte Jayy Melone mit eisigem Spott.
»Hör gefälligst auf. Oder sollen Trevellian und Tucker Lunte
riechen?«
»Gibt es ein Problem?« fragte eine Stimme hinter ›Professor‹
Malone.
***
Als ich von der Pilotenkanzel an meinen Sitz zurückkehren
wollte, fielen mir die beiden streitenden Männer auf. Sollte ich
wirklich so schnell Erfolg haben mit meinem Bluff?
»Gibt es ein Problem?« Mit diesen Worten wandte ich mich an
den einen von ihnen, der gerade aufgestanden war.
»Nichts, was Sie etwas angehen würde«, antwortete der Mann
höflich, aber abweisend. Nach seiner Sprechweise zu urteilen hatte
er höhere Schulbildung genossen, während der Sitzende den
heimtückischen Ausdruck eines Schlägers aus den Slums in den Augen
hatte.
Wenn man so lange im FBI-Dienst ist wie ich, beurteilt man
Menschen instinktiv in Sekundenschnelle. Und täuscht sich dabei nur
selten.
Deshalb war ich auch nicht allzu überrascht, als der Slumtyp
ohne Vorwarnung ein Plastikmesser aus seiner Jacke zog. Und damit
nach mir stach!
»Bist du verrückt geworden?« schnauzte sein Kumpan. Für mich
war klar, daß zumindest zwei der mutmaßlichen Entführer von Clive
Hawks vor mir standen. Und einer von ihnen gleich Amok laufen
würde!
Dem ersten Messerstoß war ich ausgewichen. Doch der Kerl
schnellte aus seinem Sitz und drang auf mich ein. Einige andere
Passagiere hatten etwas von dem Kampf mitbekommen und schrien
angstvoll auf.
»FBI!« rief ich und präsentierte meine Dienstmarke. Doch der
Killer war bemerkenswert unbeeindruckt. Immerhin wußten jetzt alle
Anwesenden, daß Milo und ich zu den ›Guten‹ gehörten. Das konnte
uns nur nützen.
Der nächste Ausfall des mageren Slumfighters zerfetzte meinen
linken Jackenärmel. Etwas Haut nahm er auch mit.
Der zweite Mann schien sich in das Unvermeidliche fügen zu
wollen. Jedenfalls zog er auch ein Plastikmesser und griff mich
ebenfalls an.
»Ich komme, Jesse!« Das war Milo. Nun stand es zwei gegen
zwei. Doch die beiden Gangster hatten Messer und wir nicht. Die
Smith & Wessons konnten wir in einer Flugzeugkabine nicht
einsetzen.
»Geben Sie auf!« schrie ich. »Sie haben keine Chance!«
Außer, dachte ich, wenn sie Geiseln nehmen. Es schien, als
hätte der Magere meine Gedanken gelesen. Er wandte sich einer
schreckensbleichen alten Lady zu, die ihn mit riesigen Augen
anstarrte.
Mein linkes Bein fuhr an seiner Messerhand vorbei. Ich legte
alle Kraft in meine Schuhspitze, die seinen Magen jeden Appetit
verlieren ließ. Für den Augenblick ließ er von der Dame ab. Doch er
war ein zäher Brocken. Offenbar hatte er in tausendundeinem
Straßenkampf Einstecken gelernt.
»Komm her!« reizte ich ihn. Mit bloßen Händen erwartete ich
ihn und seine tödliche Waffe. Auch der beste Sicherheitscheck auf
Flughäfen nützt leider nichts gegen Mordinstrumente, die nicht aus
Metall sind.
Aufheulend schickte er einen gemeinen Tritt auf den Weg. Doch
ich hatte seinen Angriff vorausgeahnt und blockte ihn mit
geschlossenen Knien ab. Die Wucht seines eigenen Vorstoßes ließ
sein Standbein erzittern.
Das nutzte ich aus und sprang ihn an. Krachend fielen wir
beide zu Boden. Aus den Augenwinkeln sah ich, wie Milo mit dem
anderen Ganoven rang.
Der Magere bäumte sich auf, doch ich hatte seine Messerhand
auf den Boden genagelt. Sein Knie donnerte in meinen Rippenbogen
und raubte mir die Luft. Doch ich hielt fest.
Der andere Angreifer schien kein harter Gegner zu sein. Ich
sah dessen Plastikmesser in hohem Bogen wegfliegen. Sekunden später
hörte ich Milos Handschellen klicken.
Da legten sich Hände von hinten um meine Kehle und drückten
zu! Es mußte noch ein dritter Krimineller an Bord sein, der aus
irgendwelchen Gründen erst jetzt aktiv geworden war. Um sich aus
einem Würgegriff zu befreien, gibt es viele gute und nützliche
Tricks. Aber wenn man gleichzeitig eine Hand mit einer tödlichen
Stichwaffe festhalten muß, nützen sie einem leider alle
nichts.
»Mach ihn fertig, Mike!« geiferte der Magere. »Erwürg das
FBI-Schwein!«
Vor meinen Augen begannen bereits rote Schleier zu schweben.
Lange würde ich den Sauerstoffmangel nicht mehr aushalten können.
Doch ich konnte es nicht riskieren, den Messerstecher loszulassen
Luft! Ich brauchte Luft! Mein Griff um das Handgelenk meines
Gegners wurde schwächer.
Plötzlich wurde der Würger zurückgerissen. Seine Hände glitten
von meinem Hals. Die abgestandene Kabinenluft schmeckte mir besser
als der köstlichste Cocktail. Gierig sog ich sie in meine
Lungen.
Im nächsten Moment war Milo neben mir und entwand dem Kerl das
Plastikmesser. Mit vereinten Kräften legten wir ihm Handschellen
an, Ich drehte den Kopf. Hinter mir hockte der riesenhafte Käpt'n
Johannessen auf dem Würger, dessen Arme auf den Rücken gedreht
waren.
»Kleine Ursache, große Wirkung!« grinste ich. »Was nicht dabei
herauskommen kann, wenn man sich eine Passagierliste zu Gemüte
führt.«
»Dafür kriegst du den großen Bürokratenorden«, witzelte Milo.
Ich wußte, daß mein Freund genauso stolz und erleichtert war wie
ich. Trotz der Lebensgefahr, in der wir uns gerade befunden hatten.
Unser Gegner war nicht mehr wie ein Schwert des Unheils, das über
uns schwebte und jederzeit herabsausen konnte. Er hatte Gesichter
und Körper. Wir würden diese Messerhelden verhören können. Es gab
die Chance, das Geheimnis um Clive Hawks zu lüften!
***
Ali und Ibrahim verfügten über eine vorbildliche
Selbstbeherrschung. Kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, daß
diese beiden gutgekleideten Herren aus dem Nahen Osten sich für den
Kampf zwischen den G-men und den drei Gangstern interessieren
würden.
Sie beteiligten sich auch nicht an dem aufgeregten Geschnatter
der anderen Passagiere. Mit gleichgültigen Mienen beobachteten sie
von ihren Logenplätzen im hinteren Teil der Boeing aus, wie die
fluchenden und tobenden Entführer auf ihren Plätzen verschnürt
wurden.
»Amateure«, raunte Ali seinem Freund zu, bevor er sich die
nächste Dattel in den Mund schob.' »Amerikanische
Nichtskönner.«
Ibrahim brummte zustimmend. »Aber die G-men dürfen wir nicht
unterschätzen. Der FBI hat immerhin herausgefunden, daß Hawks auf
Island ist.«
Ali grinste. »Und dadurch hat es auch unser Freund Muratti
spitzgekriegt, der wiederum nichts besseres zu tun hatte, als es
uns sofort zu stecken.«
»Das will ich ihm auch geraten haben«, meinte Ibrahim mit
einem drohenden Unterton in der Stimme.
»Was war da gerade los?« fragte die andere Hälfte des
Dattel-Duos die vorbeieilende Stewardeß, Gleichgültigkeit
vorspielend.
»Amerikanische Bundespolizisten haben einige Verbrecher
verhaftet«, sprudelte es aus der aufgeregten Blondine hervor. »Aber
Sie brauchen sich keine Gedanken zu machen, Sir. Die Gefahr ist
vorbei!«
Ali dankte mit einem freundlichen Kopfnicken. Es entstand eine
Pause. Keiner von beiden sagte etwas. Solange, wie man braucht, um
eine Dattel zu essen. Dann murmelte Ali gedankenverloren: »Die
Gefahr fängt gerade erst an. Für den FBI…«
***
Es hatte keinen Sinn, die Gefangenen in einem vollbesetzten
Verkehrsflugzeug vor hundert neugierigen Ohren zu verhören. Die
Kollegen in Reykjavik waren verständigt und würden uns sicherlich
unterstützen. Nachdem ich noch einmal die Fesseln der Gangster
kontrolliert hatte, versuchten Milo und ich uns vor der Landung in
der isländischen Hauptstadt noch etwas zu entspannen.
Ich lehnte mich in meinem Sessel zurück und griff zu der
kleinen Broschüre der Fluggesellschaft.
»Was weißt du über Island?« fragte mich Milo.
»Eine Insel am Polarkreis, sagt mein Lexikon. Gegründet von
norwegischen Wikingern, unabhängige Republik seit 1944. Lebt
hauptsächlich vom Fischfang.«
»Dann hast du ein anderes Lexikon als ich, Jesse. In meinem
steht, daß der Nationalschnaps Brennivin auch ›Schwarzer Tod‹
genannt wird, alle Einheimischen an Geister und Feen und so ein
Zeug glauben, und daß die isländische Frauen bildhübsch sein
sollen.«
»Was hast du denn für ein Lexikon, in dem solche Sachen
drinstehen?« lachte ich.
Doch dann nahm der Landeanflug unsere Aufmerksamkeit gefangen.
Eine Felseninsel war am Horizont zu erkennen, die beim Näherkommen
schnell größer wurde. Wir sahen hohe Berge, kahle Ebenen und das
ewige Eis von Gletschern wie dem Vatnajökull und dem Myrdalsjökull.
Aus dieser Entfernung schien das Eiland völlig unbewohnt zu sein.
Doch wenig später hatte Käpt'n Johannessen unsere Maschine bis zur
Küstenlinie gelenkt und flog eine Schleife.
Unter uns lag Reykjavik, die nördlichste Hauptstadt der Welt.
Wie bunte Puppenhäuser duckten sich die eingeschossigen Häuser mit
den roten und blauen Dächern unter dem Berg Esja. Im Vergleich zu
der sie umgebenden Natur wirkte die Stadt winzig klein.
Die Boeing landete auf dem Internationalen Flughafen Kevlavik,
der einige Meilen von der Metropole entfernt liegt. Hier haben
unsere amerikanischen Truppen auch ihre Air Base, die für die
Verteidigung der ›Wikinger-Republik‹ zuständig ist. Das Land selbst
hat keine Armee.
Als das Flugzeug ausgerollt war, führten wir als erste unsere
Gefangenen die Gangway hinunter. Sie schienen sich mittlerweile in
ihr Schicksal gefügt zu haben. Doch ich rechnete nach wie vor
damit, daß sie irgendwelche Tricks versuchen würden.
»Ich bin auf diesen Leutnant Sigurdardottir gespannt«, raunte
mir Milo zu. »Bestimmt so ein Wikinger-Verschnitt wie unser Käpt'n
Johannessen…«
Auf dem Flugfeld stand ein Polizeijeep. Einige isländische
Kollegen erwarteten uns. Sie trugen blaue Uniformen mit weißen
Mützen und grüßten uns militärisch. Während wir ihnen die Gangster
übergaben und einige Worte auf Englisch mit ihnen wechselten, fiel
uns eine Eiskönigin ins Auge.
Diesen Namen gab ich ihr in Gedanken. Er paßte auf Anhieb. Die
weißblonde Frau war Mitte bis Ende Zwanzig. Ihre Gesichtszüge
wiesen jene feingeschnittene Noblesse auf, die man manchmal auf den
Fotos von europäischen Prinzessinnen sieht. Die Augen waren so grün
wie der Nordatlantik. Sie trug Blue Jeans und einen dicken Pullover
mit Runen-Motiven. Darunter war eine aufregende Figur zu erahnen.
Okay, vielleicht bin ich ja nur ein dummer Amerikaner, für den jede
Nordeuropäerin gleich eine Wikingerprinzessin ist. Aber für mich
war sie nun einmal die Eiskönigin.
Ich wechselte einen schnellen Blick mit Milo. Er war offenbar
von ihrer Erscheinung genauso beeindruckt wie ich. Dieses
Traumwesen kam auf uns zu: »Mister Trevellian? Mister Tucker?«
fragte sie in fast akzentfreiem Amerikanisch.
Wir nickten.
»Hjartanlega velkomin!« lächelte die Eiskönigin. »Herzlich
willkommen auf Island. Ich bin Leutnant Fröydi
Sigurdardottir.«
***
Wir müssen ziemlich verblüfft aus der Wäsche geguckt haben.
Jedenfalls lachte die Inselschönheit und knuffte mich
freundschaftlich in die Seite.
»Überrascht, daß ich eine Frau bin? Wenn Ihr ein bißchen
Ahnung von Island hättet, würdet Ihr das schon an meinem Namen
erkannt haben. Wir kennen keine Nachnamen wie die Amerikaner. Ich
bin die Tochter von Sigurdar, also Sigurdardottir. Wäre ich ein
Mann, müßte ich Sigurdarsson heißen.«
Es ist schon gut, daß du eine Frau bist, dachte ich.
»Und wie ordnen Sie die Telefonbücher?« frotzelte Milo.
»Unsere Telefonbücher sind nach Vornamen geordnet«, entgegnete
die Polizistin ganz ernsthaft. »Aber da ich weiß, wie schwer sich
Amerikaner mit isländischen Namen tun, schlage ich vor, daß wir uns
duzen. Ich bin Fröydi.«
»Ich bin Jesse«, sagte ich und schüttelte ihre Hand.
»Und ich bin der liebe Milo«, meinte mein Freund und
Kollege.
Die anderen Polizisten hatten unsere Gefangenen in den Jeep
verfrachtet uhd waren bereits losgefahren. Fröydi lotste uns mit
ihrem Ausweis durch den Zoll.
»Ich hoffe, ihr habt nichts geschmuggelt«, grinste sie.
»Wir sind so unschuldig wie der Schnee deiner heimatlichen
Gletscher«, flötete Milo.
»Ich wußte gar nicht, daß G-men so poetisch sein
können.«
»Du sprichst unsere Sprache erstklassig«, sagte ich.
Sie grinste ironisch. »Isländisch wird von 250.000 Menschen
auf dieser schönen Welt gesprochen. Wir müssen entweder
Fremdsprachen können oder untergehen. Außerdem habe ich vor der
Polizeiausbildung ein Jahr als Au Pair in Brooklyn gejobbt.«
»War das nicht hart?« fragte Milo.
Sie zuckte mit den Schultern. »Es war anders. Auf Island läßt
die Natur die Menschen winzig erscheinen. In New York macht die
Stadt selbst sie zu Zwergen.«