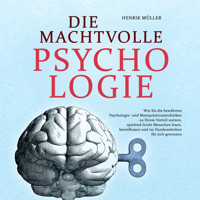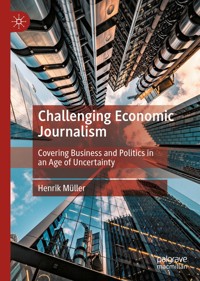14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Wie die rasante Beschleunigung der Politik unsere Gesellschaft spaltet - Warum unser politisches System in Gefahr ist und wie wir es retten können - In Zeiten von Trump, Brexit, AfD und Gelbwesten ein hochaktuelles Buch Die Welt ist aus den Fugen geraten. Innerhalb der westlichen Demokratien findet eine Polarisierung und Radikalisierung statt, die noch vor wenigen Jahren undenkbar erschien. Henrik Müller sucht in diesem Buch nach Ursachen und Folgen der globalen Verunsicherung. Anhand aktueller politischer Debatten macht er deutlich, dass Entscheidungen zunehmend öffentlich und unter großem Druck fallen. Und dass die rasante Beschleunigung politischer Prozesse eine Gefahr für Wirtschaft und Gesellschaft ist. Dabei greift er auf eigene Forschungsergebnisse zurück und bietet auch Lösungen an. Denn schließlich geht es darum, die Empörungsspirale zu durchbrechen und gleichzeitig die Freiheit des öffentlichen Wortes zu retten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.de© 2019 Henrik Müller© Piper Verlag GmbH, München 2020Illustrationen: Madlen ZiegeCovergestaltung: Büro Jorge Schmidt, MünchenCovermotiv: AnutaBerg/shutterstockSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
1 Turbodemokratismus und Unsicherheit
Zerstört der Kapitalismus die Demokratie? Oder ist es umgekehrt?
Abschalten ist keine Lösung
Diskurs als Entdeckungsverfahren
Der »Davos-Mensch« und seine Nachfahren
Von Fake News bis Safer Sex: Die Sache mit der Unsicherheit
Unsicherheit ist teuer – und messbar
Wie geht’s weiter?
2 Pessimismus und Realismus
Klimawandel: Von »Dirty Nationalists« und »Shiny Happy People«
Wirtschaftswachstum: Mehr Wohlstand ist möglich
Zuwanderung: »Cool Germany«?
Warum debattieren wir über das Falsche?
3 Identität und Narrativ
Was ist der Sinn vom Dasein?
Große Erzählungen, große Konflikte
Erzählungen über Politik und Wirtschaft
»Schrecken ohne Ende?« – ein kurzer Exkurs zum Euro-Narrativ
Der Mensch als Autor seiner selbst
Elementarteilchen auf Sendung
Fans und Fakes
Schrei nach Anerkennung
4 Bullshit und Wahrheit
Five shades of Bull
Warum gibt es immer mehr Bullshit?
Wer hat ein Interesse an der Verbreitung von Bullshit?
Bullshit Buzz
5 Herde und Wissen
Wenn Blinde anderen Blinden folgen
Wissen in Deutschland
Rationale Ignoranz
Mehr Bildung, mehr Zeit – und trotzdem keine Ahnung?
6 Gefühl und Netz
In Giftgewittern
Über die Freiheit – und ihre Grenzen
Ein Insider denkt nach
»Unempfindlich gegenüber Informationen«
Einmal Feedbackhölle – und zurück?
Hühner in grünlicher Flüssigkeit
Social Media und Journalismus – Übertragungswege
Tempo, Wut und Wahrheit
7 Lärm und Journalismus
Geld kauft Botschaften
Scouts im Info-Dschungel
Populismus und die Rolle der Medien
Aufklärung vs. Dämonisierung
Rosige Zerrbilder? Die Flüchtlingskrise in deutschen Zeitungen
Ausflüge in die Praxis
Ansager beim Bullshit Bingo? Einige vorläufige Schlussfolgerungen
8 Demokratie und Repräsentation
Vulkanier, Hobbits, Hooligans – und die »Tyrannei der öffentlichen Meinung«
Input, Output, Throughput
Brauchen wir noch Parteien?
Auf dem Weg zu einer neuen Balance?
Gesucht: eine Formel gegen die Instabilität
Neue Formen der Repräsentation, national und international
9 Abstand und Anstand
Social Media: mehr Transparenz, weniger Macht
Klassische Medien: mehr Qualität, mehr Internationalität
Soziale Normen: das UNIFEY-Prinzip
Danksagung
Literatur
Anmerkungen
1 Turbodemokratismus und Unsicherheit
Warum die westlichen Demokratien von Krisensymptomen geplagt sind
Wenn Sie an die jüngere Vergangenheit zurückdenken, welche politische Entwicklung hat Sie persönlich besonders verstört? Die Flüchtlingskrise von 2015? Die folgende Welle von Rechtspopulismus und Ausländerfeindlichkeit, vielerorts in Europa, nicht nur in Deutschland? Die Verschiebungen im deutschen Parteienspektrum und insbesondere der unaufhaltsame Niedergang der SPD? Das Gewürge um den Austritt der Briten aus der Europäischen Union? Donald Trump und das tägliche Chaos, das aus dem Weißen Haus in den Rest der Welt vordringt? Die Einmischung der russischen Regierung in westliche Wahlkämpfe und unsere Meinungsbildung? Die latent weiterschwelende Eurokrise?
Dieses Buch ist der Versuch, gedankliche Ordnung in die neue Unordnung zu bringen. Wir kommen aus einer Ära der relativen Ruhe. Die Verhältnisse waren nicht perfekt, keinesfalls, aber sie schienen doch halbwegs stabil, in Deutschland sowieso, aber auch in Europa, im Westen und im großen Rest der Welt. Umso verstörender wirken jetzt all die Umbrüche um uns herum. Wohin führt das alles? Was kommt als Nächstes? Können wir etwas dagegen tun?
Wir leben in nervösen Zeiten. Politische Blockaden und lautstarke Konfrontation, spontane Massendemonstrationen und gewalttätige Proteste, internationale Verwerfungen und innereuropäischer Streit, dazu eine wacklige wirtschaftliche Lage und ein weitreichender technologischer Wandel – der Westen gibt wahrlich kein gutes Bild ab. Tagtäglich presst der endlose Nachrichtenstrom neue Erregungswellen in unser Bewusstsein. Ein Festival der Aufregung und Selbstdarstellung, aufgeführt von Figuren, deren persönliche Stabilität und Redlichkeit, also ihre prinzipielle Eignung für öffentliche Ämter, zumindest Fragen aufwerfen. Ganze Gesellschaften durchleben inzwischen wilde Stimmungsschwankungen. So entsteht der Eindruck, die Grundlagen unseres Zusammenlebens seien ins Rutschen geraten.
Unsicherheit ist das Lebensgefühl dieser Epoche. Was eigentlich überraschend ist. Denn in vielerlei Hinsicht ist das Leben heute so risikoarm wie wohl noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Doch der Kontrast zwischen persönlichem Erleben und öffentlichem Tumult ist so groß, dass hergebrachte Gewissheiten nicht mehr zu gelten scheinen. Unübersehbar werden die westlichen Demokratien von Krisensymptomen geplagt. Ihre Fähigkeit zur Selbststeuerung – und damit ihre Zukunftsfähigkeit – ist infrage gestellt.
Längst ist die Suche nach den Schuldigen im Gange. Wer ist verantwortlich für die Verfallsprozesse? Zu den üblichen Verdächtigen gehören: die Eliten in Politik, Verwaltung und Wissenschaft, die, inkompetent oder verblendet, auf jeden Fall selbstbezogen, so sehr mit sich selbst beschäftigt sind, dass sie die große Mehrheit der einfachen Leute vergessen haben; die Topmanager in Großkonzernen und ihre gierigen Finanziers, die sich selbst die Taschen vollmachen und ansonsten um nichts und niemanden kümmern; die Populisten, die in den vergangenen Jahren in einem Land nach dem anderen mit Hass und Verschwörungstheorien die öffentliche Debatte vergiftet haben; die Journalisten, die, elitenhörig und faktenblind, Bilder einer nicht existierenden Realität zeichnen und, absichtlich oder schlicht ignorant, die Wahrheit verschweigen; soziale Medien wie Facebook, Twitter oder WhatsApp, die aus reiner Profitgier ganze Gesellschaften in Aufruhr versetzen und das Tor für Fake News und Propagandisten aus dem In- und Ausland öffnen, weshalb die Bürger nicht mehr zwischen Wahr und Falsch unterscheiden können. Die Aufzählung ließe sich fortsetzen.
Solche Schuldzuweisungen tragen nicht weit. Sie verschleiern die tiefer liegenden Ursachen eher, als dass sie sie erhellen. Die Prämisse dieses Buchs lautet: Wir sind Zeugen eines rapiden Strukturwandels der Politik. Diese Veränderungen haben diverse Gründe: ökonomische, soziale, psychologische, vor allem aber mediale. Der politische Strukturwandel lässt sich nur begreifen, wenn wir anerkennen, dass wir es mit einem Zerfall der Öffentlichkeit zu tun haben – und wenn wir versuchen, die Mechanismen offenzulegen, die Politik, Medien und Wirtschaft heute prägen.
Zerstört der Kapitalismus die Demokratie? Oder ist es umgekehrt?
Vor einigen Wochen habe ich einen Report nachgelesen, den ich Anfang 2008 mit einem Kollegen geschrieben hatte: »Zerstört der Super-Kapitalismus die Demokratie?«[1] Es war eine Titelgeschichte in der Zeitschrift Manager Magazin, bei der ich damals arbeitete. Auf dem Cover war eine Heuschrecke zu sehen, die vor einem ehrwürdigen Parlamentsgebäude lauert. Der Artikel erschien ein halbes Jahr vor dem Zusammenbruch der US-Investmentbank Lehman Brothers, die den Startpunkt zur größten Finanzkrise seit den 1930er-Jahren markierte, gefolgt von einer tiefen Rezession. Natürlich wussten wir damals nicht genau, was kommen würde. Aber dass etwas in Schieflage geraten war, das war offensichtlich. Robert Reich, Professor in Berkeley und einst Arbeitsminister unter US-Präsident Bill Clinton, hatte gerade den Begriff »Superkapitalismus« geprägt,[2] das Pendant zum deutschen »Turbokapitalismus«. Gemeint ist das Gleiche: das unbedingte Streben nach immer höheren Gewinnen und Aktienkursen, das der realen Wirtschaft allmählich die Luft abschnürte, insbesondere weil zu wenig investiert wurde und die Löhne kaum noch stiegen.
Der Turbokapitalismus, das war unser zentrales Argument, gefährde die Demokratie, weil er krisenanfällig sei und für Verunsicherung und frustrierende Verteilungsergebnisse sorge. »Stabile Volksherrschaft basiert auf prosperierender Volkswirtschaft«, schrieben wir. »Umgekehrt: Wenn große Teile der Bevölkerung das Gefühl haben, ihr Wohlstand schwinde, dann lockert sich die Verankerung demokratischer Institutionen im Volk.«
Doch als dann die Wirtschaftskrise nach dem Lehman-Crash im Herbst 2008 mit voller Wucht ausbrach, zeigte sich das demokratische System enorm widerstandsfähig. Zunächst jedenfalls. Regierungen, Parlamente und Notenbanken schalteten auf Krisenmodus und wendeten einen kompletten Systemkollaps ab. Die technokratischen Eliten zeigten, wozu sie imstande waren. Der Turbokapitalismus mochte versagen – doch die demokratischen Staaten und ihre Institutionen waren stabil und handlungsfähig genug, um die Lage im Griff zu halten. Sicher, hier und da wurden in den folgenden Jahren neue, teils linkspopulistische Parteien groß, etwa in Spanien und Griechenland. Aber insgesamt hielt das System. Immer noch stellten etablierte Parteien die Regierungen. In Deutschland blieb Angela Merkel im Amt. In den USA zog sogar erstmals ein Afroamerikaner ins Weiße Haus ein, der »Hope« und »Change« predigte. Barack Obama war die personifizierte Hoffnung auf Emanzipation und fortschreitende Demokratisierung, das Gegenteil von antidemokratischem Furor. Unsere düsteren Vorhersagen schienen sich als falsch zu erweisen.
Es dauerte einige Jahre, dann ging es Schlag auf Schlag. 2016 stimmten die Briten in einem Referendum gegen die weitere EU-Mitgliedschaft. Nach vier Jahrzehnten wollten sie als Nation »die Kontrolle zurückerlangen« – eine Entscheidung mit unüberschaubaren Risiken, ein Sprung ins Ungewisse, wider alle Vernunft. Kurz darauf wählten die Amerikaner einen Reality-TV-Star zum Präsidenten, der versprach, seine Mitbewerberin ins Gefängnis zu werfen, eine Mauer an der mexikanischen Grenze zu bauen und die Wirtschaft gegen ausländische Konkurrenten abzuschotten. Bis dahin unvorstellbar. Im Jahr darauf zerstörten in Frankreich zwei Männer und eine Frau das Parteiensystem der Fünften Republik, indem sie neuartige Bewegungen auf die Beine stellten: In der ersten Runde der Präsidentschaftswahl im Frühjahr 2017 holten die Nationalpopulistin Marine Le Pen (Front National) und der Linksdemagoge Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise) fast die Hälfte der Stimmen. Am Ende gewann der Zentrist Emmanuel Macron, auch er getragen von einer Bewegung (En Marche!); nur anderthalb Jahre später wurde er von der nächsten Bewegung eingeholt, den »Gilets jaunes« (»Gelbwesten«).
In Deutschland zog 2017 die AfD als drittstärkste Partei in den Bundestag ein, ein »gäriger Haufen«, so Parteichef Alexander Gauland, der die anderen Parteien in der Zuwanderungspolitik vor sich hertrieb. 2018 kam in Italien eine Regierung ins Amt, die von einer breiten Mehrheit aus Links- (Cinque Stelle) und Nationalpopulisten (Lega) getragen wurde und sich vor allem auf eines einigen konnte: die EU und ihre Regeln abzulehnen. Bei den Europawahlen im Frühjahr 2019 erstarkten dann die Rechtspopulisten weiter und setzten die konservativen Parteien derart unter Druck, dass das tradierte EU-Machtzentrum aus Christ- und Sozialdemokraten seine gemeinsame Mehrheit verlor – mit ungewissem Ausgang.
Diese politischen Verschiebungen mögen die Spätfolgen der schockierenden Erfahrung der großen Rezession von 2008/09 sein, als Banken gerettet und Privatleute in die Insolvenz geschickt wurden, die in den folgenden Jahren auch noch sinkende oder stagnierende Einkommen[3] und den Abbau sozialstaatlicher Leistungen hinnehmen mussten. Hinzu kam die zeitweise unkontrollierbare Flüchtlingszuwanderung des Jahres 2015, ein für viele Bürger verstörendes Ereignis. Und doch, zwischenzeitlich hatte sich noch etwas verändert: die öffentlichen Räume.
Abschalten ist keine Lösung
Die sozialen Medien à la Facebook, YouTube, Twitter & Co. haben einen wahrhaft revolutionären Wandel angestoßen. Zuvor wurde die Öffentlichkeit von Profis gesteuert: von Politikern und Journalisten, PR-Leuten und Lobbyisten, von Kunst, Kultur und Wissenschaft. Sie lieferten sich einen eingespielten Schlagabtausch. Journalisten spielten dabei eine zentrale Rolle. »Die Funktion der Massenmedien liegt (…) im Dirigieren der Selbstbeobachtung des Gesellschaftssystems«, konstatierte der Soziologe Niklas Luhmann noch Mitte der 1990er-Jahre.[4] Das hat sich geändert. Nun kann jeder mitmachen. Prinzipiell jedenfalls. Was zunächst enthusiastisch als Instrument der Demokratisierung gefeiert wurde, zeigt inzwischen seine dunklen Seiten. Die Öffentlichkeit verlagert sich in einen weitgehend unregulierten und ungeregelten Raum, wo ganz eigene Mechanismen am Werk sind. Die Brexiteers und Trump, Macron und Mélenchon wären ohne Social Media kaum erfolgreich gewesen. In Brasilien kam 2019 Jair Bolsonaro ins Präsidentenamt, ein Bewunderer der Militärdiktatur, überhaupt ein Mann von zweifelhaften Vorstellungen und Manieren, getragen von einer WhatsApp-Kampagne, die wüste Behauptungen verbreitete.
Einige Jahre zuvor war es bereits in Deutschland einer kleinen Gruppe von Aktivisten des Polit-Start-ups Campact gelungen, das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP auszuhebeln – gegen alle etablierten Interessen aus Industrielobby, Gewerkschaften und Regierungsparteien. Mit schrägen »Chlorhühnchen«-Videos auf YouTube und einem Feuerwerk an Aufrufen, Tweets und Mails gelang es ihnen, die öffentliche Meinung in bis dahin unbekannter Weise zu beeinflussen. Ein Fanal. Kurz darauf etablierte eine Truppe sächsischer Rechtsaktivisten »Pegida«, organisiert über Facebook, sodass aus einer lokalen Protestbewegung von Zuwanderungsgegnern ein Phänomen von bundesweiter Bedeutung werden konnte, das erheblichen Einfluss auf die nationale Politik und den Kurs der etablierten Parteien gewann.
Demokratie braucht Öffentlichkeit. In der Antike verstand man darunter das häufig spontane Aufeinandertreffen auf Straßen und Plätzen. Noch um die vorletzte Jahrhundertwende waren öffentliche Plätze und Bierkeller jene Orte, wo Versammlungen, Kundgebungen und Demonstrationen stattfanden (falls sie denn erlaubt waren) und sich öffentliche Meinungen bildeten. Personen trafen direkt zusammen. Man stand sich gegenüber, diskutierte, brüllte einander an. Es blieb persönlich. Man sah sich ins Gesicht. Das zügelt manchen Affekt. Die Orte der Öffentlichkeit waren kleinräumig. Erst im späten 19. Jahrhundert begann allmählich die Verlagerung der demokratischen Öffentlichkeit in den medialen Raum. In New York, London oder Paris spielten Massenblätter nun eine entscheidende Rolle bei der Meinungsbildung. Später kamen Radio und Wochenschauen hinzu – und wurden teils schamlos für Propagandazwecke genutzt, zumal in Nazideutschland. In den Nachkriegsjahrzehnten wurde das Fernsehen zum neuen einflussreichen Medium. Und so ist es bis heute: Damit Botschaften einer breiten Öffentlichkeit zugänglich sind, muss das Fernsehen sie aufgreifen. Aber die Agenda wird zunehmend außerhalb des traditionellen politmedialen Raums gesetzt, nämlich in den sozialen Medien. (Wir werden in Kapitel 6 darauf zurückkommen.)
Abschalten ist keine Lösung. Ohne Öffentlichkeit, ohne Möglichkeit zur freien Rede, ohne Austausch von Argumenten und Interessengegensätzen kann so etwas wie öffentliche Meinung gar nicht entstehen. Es ist kein Zufall, dass Staaten, die sich, wie die Türkei, Russland oder Ungarn, in Richtung Autoritarismus entwickeln, zunächst die Presse und vor allem das breitenwirksame Fernsehen unter Kontrolle bringen. Soziale Medien sind dort ebenfalls unter Druck, werden zensiert oder mit lärmender staatstragender Propaganda geflutet. Wer den Volkswillen brechen will, muss ihm zunächst seine Ausdrucksmöglichkeiten nehmen.
Wo nach wie vor Meinungsfreiheit herrscht, geraten die Verhältnisse zusehends durcheinander. Politik ist erratisch geworden. Die Polarisierung nimmt zu. Umschwünge in der öffentlichen Meinung und Kurswechsel in der offiziellen Politik können jederzeit auftreten. Auf den Turbokapitalismus als destabilisierendes Element folgt der Turbodemokratismus – der nun wiederum zum zentralen Unsicherheitsmoment für die Wirtschaft wird. Das abgewogene informierte Urteil wird abgelöst von der impulsiven Meinung. Kurzschlusspolitik verhindert vernünftige politische Entscheidungen.
Diskurs als Entdeckungsverfahren
In liberalen Gesellschaften ist der offene Diskurs das Mittel, um eine Vielzahl von Argumenten und Blickwinkeln zutage zu fördern und abzuwägen. Debatten sind ein Entdeckungsverfahren. Das sieht selten gut aus; die Ästhetik des öffentlichen Streits lässt zu wünschen übrig. Aber das ist nebensächlich. Schließlich geht es darum, die relevanten Fakten, die besten Deutungen der Wirklichkeit und die berechtigten Interessen herauszuarbeiten. Diese Suche nach der Wahrheit ist die große Stärke des westlichen Systems. Oder besser: Sie sollte es sein.
In der Formel vom »deliberativen Diskurs« hat der Philosoph Jürgen Habermas diese aufgeklärte und gezügelte Art der öffentlichen Auseinandersetzung zum Ideal erhoben.[5] Damit ist allerdings noch nicht geklärt, welche Fakten relevant sind (und welche nicht), welche Interessen berechtigt sind (und welche nicht), welche Deutungen die besten sind (und welche schlechter). Um sich dem Ideal halbwegs anzunähern, braucht es ethische und soziale Normen, Gesetze und Institutionen – Spielregeln und Schiedsrichter. In der Wissenschaft gibt es Regeln guter wissenschaftlicher Praxis, im Journalismus Institutionen der Selbstkontrolle wie den Presserat, dazu Gesetze gegen grobe Verstöße sowie, noch wichtiger, eine professionelle Ethik, die dafür sorgt, dass Regeln im Großen und Ganzen eingehalten werden. In den neuen Medienwelten fehlt all das. Sie werden gesteuert von Algorithmen, von teils selbst lernenden Systemen, die vor allem ein Ziel haben: die Aufmerksamkeit der Nutzer und damit die Erlöse zu maximieren. Dass sie nebenbei die Weltwahrnehmung der Bürger und ganzer Gesellschaften verzerren, weil sie Filterblasen[6], Echokammern[7] und Feedbackhöllen[8] ausbilden, weil sie das Extreme und das Schrille fördern und das Normale und das Abgewogene systematisch ausblenden, ist inzwischen unübersehbar, aber ein ungelöster Problemkomplex.
Wie unterscheidet man zwischen Wahrheit, Lüge, Fälschung? Die Basis jedes ernsthaften Diskurses ist der Wille, sich auszutauschen – zuhören, sich in Argumente hineindenken und sich in die Interessen anderer hineinfühlen. Eine gemeinsame Ebene herzustellen benötigt Zeit. Allmähliche Prozesse sind dabei am Werk, die »langsames Denken« erfordern, wie der Psychologe und Wirtschaftsnobelpreisträger Daniel Kahneman[9] das genannt hat: Vernunft braucht Langsamkeit. Wenn Affekte angesprochen werden, sind Menschen hingegen schnell. Wir reagieren instinktiv und gefühlsbetont – mit Angst, Aggression, Abwehr, Neugier, Zorn, Ekel. Die heutigen Diskursräume sind schnell, und die Algorithmen, die sie strukturieren, zielen mit voller Absicht auf menschliche Affekte. Kaum verwunderlich, dass der öffentliche Raum von lautstarker Aggression durchzogen ist.
Der Zerfall der Öffentlichkeit geht nicht leise und friedlich vonstatten. Es sind nicht nur gemütliche Binnendiskurse kleinerer Gruppen, die sich bei Facebook oder WhatsApp über ihre Belange verständigen und ansonsten den Rest der Gesellschaft nach seiner Fasson existieren lassen. Häufig herrscht eine dröhnende Intoleranz, die der Verständigung im Wege steht. Die Hochachtung des demokratischen Kompromisses kommt allmählich aus der Mode. Ich nenne diese Form der Auseinandersetzung postrepublikanisch. Sie verdirbt die westlichen Demokratien im Innern. Und inzwischen auch das internationale Machtgefüge.
Der »Davos-Mensch« und seine Nachfahren
Ablesen lassen sich die Verschiebungen zum Beispiel am Weltwirtschaftsforum (WEF), das alljährlich im Januar im schweizerischen Davos stattfindet. Über viele Jahre war Davos ein Treffpunkt von Ähnlichgesinnten: ein paar Hundertschaften Mächtiger und Wichtiger, die sich nebenher auch noch darum kümmern wollten, die Welt ein bisschen besser zu machen. Die Treffen stießen schon früher auf Kritik. Demonstranten liefen in großer Zahl auf: Proteste von linken Globalisierungsgegnern gehören seit vielen Jahren zu den Seitenereignissen des WEF. Auch von rechts gab es teils beißende Kritik. »Tote Seelen« seien diese Leute, denen »tiefe Gefühle von Bindung« an die Heimat fehlten. Der »Davos-Mensch« sei eine Spezies, die sich in ihren »Einstellungen und Verhaltensweisen« weit vom übrigen Volk entfernt habe, ätzte der US-Politologe Samuel Huntington. Es klang, als ob sich oben in den Schweizer Bergen einmal im Jahr ein Haufen Zombies träfe.
Es lohnt sich, Huntingtons Essay, erschienen im Jahr 2004, noch einmal zu lesen.[10] Nicht, weil alles wahr wäre, was darin stand – sondern weil sich seither eine Menge verändert hat. Inzwischen gibt es die eine globale Elite nicht mehr. Sie zerfällt in unterschiedliche Zweige, die die Lage der Welt jeweils aus ihrem ganz speziellen Blickwinkel beurteilen – der »Davos-Mensch« hat sich in verschiedene Unterarten aufgespalten. Was seine eigenen Probleme mit sich bringt.
Immerhin hatte die von Huntington heftig diffamierte Elite ein gemeinsames Weltbild. In der Ära der raschen Globalisierung der 1990er- und 2000er-Jahre folgten die Führungsfiguren aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft einer ziemlich einheitlichen Agenda: weitere Integration der Märkte, verstärkte internationale Zusammenarbeit, schlagkräftige internationale Institutionen. Es war ein großes liberalistisches Programm. Viele Schwellenländer mochten noch autoritär regiert werden, aber ihre Führer schienen nach Wegen zu suchen, wie sie ihre Gesellschaften allmählich öffnen könnten, ohne deren Stabilität zu gefährden. Die Welt wird allmählich westlich, das war lange die verbreitete Erwartung. Alles nur eine Frage der Zeit. Was nicht hieß, dass alles gut war: Zum Davos-Konsens gehörte nicht nur das Versprechen auf Wachstum und Reichtum (sowie das Zelebrieren der eigenen Wichtigkeit), sondern auch das Bewusstsein, dass es immer mehr globale Probleme gab, die man gemeinsam angehen muss – ja, die man ausschließlich gemeinsam angehen kann. Lösungen könne es nur geben, wenn sich nationale Egoismen überwinden ließen.
Der geschmähte »Kosmopolitismus« (Huntington) brachte immerhin einiges zustande. Das globale Krisenmanagement nach dem Finanzcrash von 2008 wäre ohne den Geist von Davos kaum vorstellbar gewesen, ebenso wenig das Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 – um nur zwei Beispiele zu nennen. Doch dieser Geist verflüchtigt sich. Tiefe Gräben tun sich auf – zwischen den Staaten, aber auch innerhalb von Gesellschaften. Während der postrepublikanische Turbodemokratismus die westlichen Gesellschaften schwächt, trumpfen unfreie Systeme auf. Das liberale westliche Gesellschaftsmodell ist nicht mehr das Vorbild, dem andere nacheifern.
Gegenentwürfe gibt es reichlich, von Chinas digitalem Totalitarismus über moderne Despotien wie Russland bis zu traditionellem Absolutismus am Persischen Golf; all diese Systeme sind inzwischen in großer Zahl mit Regierungsmitgliedern und Managern in Davos vertreten. Auch der offen zur Schau getragene Nationalismus von Figuren wie Donald Trump stellt das liberale Modell infrage. Bezeichnend: Beim WEF 2019 waren weder der US-Präsident noch Minister seiner Administration anwesend. Sie hatten ihren Besuch kurzfristig absagen müssen, weil sich der Präsident und der Kongress in Washington wieder mal derart ineinander verhakt hatten, dass sie keinen Staatshaushalt zustande brachten. Ein Teil der Bundesbehörden stellte seine Arbeit ein – in den USA herrschte »government shutdown«, und zwar der bis dato längste der Geschichte.
Davos 2019 war geradezu ein Sinnbild für den Zustand des Westens. Nicht nur Trump und seine Minister fehlten, auch andere westliche Regierungschefs blieben dem Treffen fern. Großbritanniens Premier Theresa May war nicht angereist, weil sie daheim in London mit dem hoffnungslos zerstrittenen Parlament über den Ausstiegsvertrag mit der EU rang und das Land im Brexit-Chaos zu versinken drohte. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte alle Hände voll mit dem Aufstand der Gelbwesten zu tun, die bereits seit Wochen französische Straßen blockierten. Vertreten wurde der Westen von innenpolitisch geschwächten Figuren: von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die angezählt war, nachdem sie ihren allmählichen Rückzug aus allen politischen Ämtern angekündigt hatte (eine Folge der quälenden Debatte über ihre Flüchtlingspolitik und der »Merkel muss weg!«-Parolen der Rechtspopulisten); von Giuseppe Conte, dem italienischen Ministerpräsidenten von Gnaden der Führer von Cinque Stelle und Lega; von Pedro Sánchez aus Spanien, einem Regierungschef ohne parlamentarische Mehrheit. Es war, insgesamt, nicht gerade eine überzeugende Demonstration von Stärke und Stabilität.
Top Act war 2019 Jair Bolsonaro, definitiv kein »Davos-Mensch«. Brasiliens Präsident hatte beim WEF seinen ersten großen Auftritt auf der Weltbühne und bemühte sich nach Kräften, moderat zu wirken. Doch bereits im Vorfeld hatte er keine Zweifel daran aufkommen lassen, wie wenig Bedeutung er dem globalen Problem Nummer eins, dem Klimawandel, beimaß, und offen angekündigt, wieder in größerem Maßstab brasilianischen Regenwald roden lassen zu wollen. Da mochte der Weltrisikobericht des WEF extreme Unwetter, Naturkatastrophen, Wassermangel, Artensterben und das Kollabieren ganzer Ökosysteme oben auf seine Warnliste setzen[11] – Bolsonaro zeigte sich wenig beeindruckt.
Zwei Jahre zuvor hatte Chinas Präsident Xi Jinping noch Kooperationswillen suggeriert. In seiner WEF-Rede von 2017 hatte er sein Land als Garanten der multilateralen Ordnung dargestellt – und sich selbst als eine Art Anti-Trump. Ein starkes Stück Propaganda von einem Regenten, der längst die Zurückhaltung seiner Vorgänger aufgegeben hat, nach außen eine aktive Großmachtpolitik betreibt und im eigenen Land den Repressionsapparat ausbauen lässt. Wenn es zuvor in China eine sachte Liberalisierung gegeben haben mochte – Xi, der wohl mächtigste Führer der chinesischen Kommunistischen Partei seit Mao, hat das Rad mit Macht zurückgedreht.
Sicher, es gibt noch die traditionellen Davos-Besucher, die auch 2019 wieder in großer Zahl anreisten, darunter die üblichen Polit-Wirtschaft-Kultur-Promis wie Al Gore, Bill Gates und Bono, die Topliga der internationalen Technokratie (darunter die Chefs von Währungsfonds, Weltbank, UNO, OECD sowie diverse EU-Kommissare) und natürlich Heerscharen von Managern internationaler Konzerne. Hinzu kommen renommierte Wissenschaftler und Aktivisten von Nichtregierungsorganisationen. Aber anders als früher verfolgen sie nicht mehr unbedingt die gleichen Ziele.
Internationale Kooperation wird unter diesen Bedingungen immer schwieriger. Ähnliche Ziele und Überzeugungen sind die Grundvoraussetzung für kollektives Handeln. Eine gemeinsame Basis an Fakten, Wissen und Werten hilft dabei, Interessengegensätze zu überwinden. Wenn aber die Weltsicht flexibel den jeweiligen Interessen angepasst wird, lassen sich mehrheitlich akzeptierte Lösungen kaum finden.
Zu tun gäbe es wahrlich genug. In vielen Bereichen vollzieht sich parallel ein tief greifender Wandel. Zum Beispiel die Demografie: Noch nie lebten so viele Menschen auf der Erde, noch nie alterte die Weltbevölkerung so rapide. Das dürfte fundamentale Auswirkungen haben – auf die Produktivität, auf Migrationsströme, auf soziale Beziehungen oder politische Präferenzen. Nur welche? Oder das globale Kräfteverhältnis: In der Vergangenheit stützte sich das internationale Staatensystem auf wenige Großmächte. Inzwischen erleben wir eine Diffusion der Macht, in der diverse Länder miteinander um Vorherrschaft ringen. Besonders augenfällig ist dies am Persischen Golf, in einer Region, die lange von den USA stabilisiert wurde, in der nun aber auch Saudi-Arabien, der Iran, Russland, die Türkei und Israel die Finger im Spiel haben. Mit welchen Institutionen und Prozessen lässt sich eine derart zerklüftete internationale Landschaft befrieden? Oder der Klimawandel: Die Erwärmung der Erdatmosphäre scheint sich zu beschleunigen, häufige extreme Unwetter und ungleichmäßige Niederschläge inklusive. Doch nicht alle leiden darunter. Russland beispielsweise kann sich Vorteile ausrechnen, wenn seine Permafrostgebiete tauen und das Eis im Nordmeer schmilzt. Andererseits sollte der globale Ausstieg aus der CO2-Wirtschaft einfacher werden, weil erneuerbare Energie dank technischen Fortschritts immer billiger wird.
Wie wirkt all das zusammen? Was wird beispielsweise aus einer demografisch schrumpfenden Nation wie Russland, wenn die Welt immer weniger Öl und Gas nachfragt und dadurch die wirtschaftlichen Grundlagen bröckeln? Gelingt es dem Land, sich neu zu erfinden? Oder wird es seine inneren Konflikte noch stärker nach außen tragen als bislang?
Aber zur objektiven globalen Unordnung kommt eben auch eine veränderte Wahrnehmung der Welt. Der Westen, das zeigt das Beispiel Davos 2019, ist in einem Zustand innerer Schwäche. Die Perzeption der Realität zerfasert. Während die objektiven Probleme großräumiger werden, werden die Kommunikationsräume kleinteiliger; informationsorientierte Massenmedien werden verdrängt von sozialen Netzwerken, von Unterhaltung und »Soft News«. In den virtuellen Echokammern kommt es zu Rückkopplungseffekten, in der Gleichgläubige sich gegenseitig immer lautstärker bestätigen. Die Sphäre der Öffentlichkeit zersplittert in – häufig instabile – Subgruppen. Und dann ist da noch die anschwellende Bilderflut aus YouTube-Videos, Netflix-Serien, Chats, Spielen, Pushmeldungen, WhatsApp-Nachrichten und vielem mehr. In der Wahrnehmung vermischt sich das Triviale mit dem Wichtigen, das Reale mit dem Fiktionalen, Bullshit mit Wahrheit (mehr dazu in Kapitel 4). Die Basis gemeinsam akzeptierter Fakten wird brüchig. Es ist längst nicht immer klar, was wirklich ist und was relevant – was also wirklich relevant ist.
Von Fake News bis Safer Sex: Die Sache mit der Unsicherheit
Unsicherheit ist nicht gut. Sie stört uns bei unseren Planungen. Sie verwirrt Individuen und ganze Gesellschaften. Sie stellt zwischenmenschliche Bindungen und soziale Normen infrage, erschwert unternehmerische Entscheidungen, untergräbt die Stabilität staatlicher Institutionen und der internationalen Ordnung und damit das Fundament von Wohlstand und Sicherheit. Die Epoche der Unsicherheit beginnt gerade erst. Dieses Buch ist der Versuch, ihren Ursachen auf den Grund zu gehen, Auswirkungen zu beschreiben und mögliche Gegenmittel zu diskutieren.
Wir haben uns daran gewöhnt, die Welt als ausrechenbar anzusehen. Oder besser: Wir haben sie uns so eingerichtet, dass sie ausrechenbar erscheint. Das ist ein gutes Gefühl. Es vermittelt Sicherheit, in mehrfachem Sinn: Unsere Umgebung wirkt verlässlich; wir selbst fühlen uns sicher, was uns wiederum Selbstsicherheit verleiht. Identität basiert auf Selbstsicherheit – auf der Gewissheit darüber, wer man ist, als Individuum, als Gesellschaft. Wer sich hingegen in einer unsicheren Umgebung bewegt, wird in seiner Identität herausgefordert.
Der Neonationalismus, inzwischen rund um den Globus im Trend, lässt sich verstehen als Versuch der kollektiven Selbstvergewisserung. Was die Sache nicht besser macht – und Gegenstrategien umso schwieriger: Demokratien lösen gesellschaftliche Konflikte üblicherweise durch den Ausgleich von Interessen, also durch ein rationales Geben und Nehmen. Bei Fragen der Identität jedoch setzt die so verstandene Vernunft mitunter aus. Es geht um Anerkennung, Respekt, Achtung, um Selbstbehauptung gegenüber anderen. Eine akzeptable Lösung für alle Beteiligten zu finden – einen vernünftigen Kompromiss, wie das in der Demokratie und im Geschäftsleben üblich ist –, geht womöglich am Bedürfnis nach Anerkennung vorbei. So kommt ein destruktives Element in die Politik, das nicht so rasch wieder verschwinden wird (dazu eingehend Kapitel 3).
Unsicherheit führt dazu, dass wir schlechter miteinander kooperieren. Kooperation bedeutet Verzicht auf egoistisches Verhalten. Egoismus zahlt sich kurzfristig aus, Kooperation nützt längerfristig. Wer schlicht nicht weiß, wie die äußeren Umstände morgen sind, wird kaum gewillt sein, Opfer zu bringen. Warum soll ich sparen, investieren, mich bilden oder in die Bildung meiner Kinder investieren, warum soll ich selbst ehrlich sein, wenn die anderen es doch offenkundig auch nicht sind? Warum soll ich mich an Gesetze halten, wenn ich mir unsicher bin, ob sie morgen noch gelten? Unsicherheit korrumpiert. Sie macht misstrauisch und egoistisch. Unter unsicheren Bedingungen ziehen sich Menschen in Kleingruppen zurück – Familien, Clans, Stämme.
Unsicherheit bedeutet, dass unser Bild von der Zukunft verschwommener wird. Klar, niemand weiß, was die Zukunft bringt. Risiken gehören zum Normalzustand entwickelter Gesellschaften. Aber Risiken sind bezifferbar. Ihre Eintrittswahrscheinlichkeit lässt sich berechnen, Prognosefehler lassen sich bestimmen. Gegen Risiken gibt es Versicherungen. Davon lebt eine ganze Branche. Unsicherheit hingegen ist etwas anderes, wie der US-Ökonom Frank Knight bereits 1921 herausgearbeitet hat.[12] Der Begriff schließt die Möglichkeit ein, dass die Zukunft ganz anders aussehen kann als die Gegenwart. Aber mit welcher Wahrscheinlichkeites zu einem Umschwung in die eine oder andere Richtung kommt, ist nicht bestimmbar. Damit kann man schlecht arbeiten.
In den 1980er-Jahren prägte der deutsche Soziologe Ulrich Beck den Begriff »Risikogesellschaft«.[13] Damit traf er einen Nerv. Dass Technologien die natürliche Umwelt gefährden können, dass Arbeitslosigkeit jeden treffen kann, dass es wieder Seuchen ohne Gegenmittel geben kann, all das war damals neu. Waldsterben und das Reaktorunglück von Tschernobyl, die Verwerfungen der heraufziehenden Globalisierung (die damals noch nicht so hieß), Aids als Rückkehr der unheilbaren ansteckenden Krankheiten – das waren große Themen der späten 1980er-Jahre. Westliche Gesellschaften reagierten darauf in typischer Manier: die neuen Unsicherheitsfaktoren verstehen lernen, Institutionen anpassen, Probleme in praktikable Pakte zerlegen. Abgaskatalysator und bleifreies Benzin gegen sauren Regen und Waldsterben, ein neues Bundesumweltministerium, um die Reaktorsicherheit in Deutschland zu verbessern, die Propagierung von kondomgeschütztem Safer Sex gegen die Ausbreitung von Aids.
Die Moderne lässt sich verstehen als Großprojekt gegen die Unsicherheit. Staatliche Institutionen, anständig organisierte Unternehmen und wohlregulierte Märkte sollten das Unwägbare einhegen und es zu Risiken abmildern, die leichter handhabbar sind. Unsicherheit resultiert aus Nichtwissen, manchmal auch aus Nichtwissenwollen. »Es dürfte die meisten Menschen überraschen«, schrieb Knight, »wenn ihnen erstmals ernsthaft klar wird, welch kleiner Teil unseres Tuns auf akkuratem und umfassendem Wissen über die Dinge, mit denen wir umgehen, beruht.«[14]
Eine Strategie gegen die Unsicherheit besteht darin, Wissen über den Zustand der Welt anzusammeln. Wissenschaft ist, so gesehen, ein Versicherungsprogramm. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts begannen Statistiker damit, Gesellschaften systematisch zu vermessen. In den vergangenen Jahrzehnten machten Prognostiker große Fortschritte dabei, die unmittelbare Zukunft vorherzusagen. Sozialstaaten wurden ausgebaut, um individuelle Lebensrisiken abzusichern. Sogar das Wetter kommt nicht mehr so überraschend über uns wie früher, denn die Prognosen sind deutlich treffsicherer geworden. Doch nun tun sich Risse auf. Das Vertrauen in staatliche Institutionen und Unternehmen erodiert. Wissenschaft gilt nicht mehr unbedingt als verlässlich. Dem Journalismus ergeht es nicht besser: Viele Bürger sagen, sie könnten nicht mehr unterscheiden zwischen realen Nachrichten und Fake News (dazu näher Kapitel 5).
Unsicherheit verunsichert. Sie frisst sich in die Köpfe, verhindert Entscheidungen, destabilisiert die Wirtschaft und verstärkt sich damit selbst. Bürger und Unternehmen halten sich zurück. Anschaffungen werden hinausgeschoben, Investitionspläne zusammengestrichen. Wenn Unsicherheit das Wohlstandsfundament bröckeln lässt und dadurch das Vertrauen in Institutionen und Unternehmen weiter schwindet, dann sind wir auf einem abschüssigen Entwicklungspfad. Freiheitliche Demokratien müssen erst noch beweisen, dass sie unter den neuen Bedingungen auch weiterhin funktionsfähig bleiben. Wir Zeitgenossen stehen vor all den unvorhersehbaren Wendungen und staunen – zumal wenn wir nicht recht begreifen, was den Zerfall der Öffentlichkeiten treibt, wenn uns, im Sinne von Knight, das »akkurate und umfassende Wissen über die Dinge« fehlt.
Die Wirtschaftskrise von 2008/09 war für sich genommen ein verunsicherndes Ereignis, weil sie offenbarte, wie wenig der Mainstream der Ökonomen über die Finanzmärkte wusste – und wie prekär es um die Stabilität und Integrität von Institutionen wie Banken und Aufsichtsbehörden bestellt war. Hinzu kamen die sozialen Folgen der tiefen Rezession. Wo die Unwägbarkeiten der Globalisierung nicht hinreichend durch sozialstaatliche Sicherungssysteme abgefedert würden, argumentiert der US-Wirtschaftshistoriker Barry Eichengreen, seien Wirtschaftskrisen imstande, die politische Ordnung zu zersetzen. Populisten und Extremisten erhielten Zulauf. Das sei eine Lehre aus den 1930er-Jahren. Dem damaligen US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt sei es mit dem Ausbau des Sozialstaats (»New Deal«) gelungen, eine Strategie gegen Unsicherheit und Verunsicherung durchzusetzen. Die Weimarer Republik hingegen sei an der Sparpolitik der letzten demokratischen Regierungen unter Reichskanzler Heinrich Brüning zugrunde gegangen und habe die Kampfbahn bereitet, auf der die Nazis wüten konnten. Heutige Regierungen hätten die Dringlichkeit zu entschlossenen Umbau- und Ausbaumaßnahmen der Sozialsysteme nicht erkannt, so Eichengreen.[15]
Da ist was dran. Aber auf Frankreich beispielsweise trifft Eichengreens Diagnose nicht zu. Präsident Macron übernahm bei seinem Amtsantritt einen sehr großen Staatsapparat. Nirgends in der Europäischen Union ist der öffentliche Sektor so groß. Die Staatsquote liegt bei 56 Prozent; fast die Hälfte der öffentlichen Ausgaben fließt in die Sozialhaushalte.[16] Die Proteste der Gelbwesten haben gezeigt: Auch ein sehr großer öffentlicher Sektor schützt nicht vor erratischem Aufbegehren. Außerdem: Rechtspopulisten durchpflügen die politische Landschaft auch in Schweden oder in Baden-Württemberg, in Gegenden also, die objektiv reich und sicher sind. Aber die subjektive Einschätzung der Lage ist nun mal etwas anderes als die Realität.
Unsicherheit ist teuer – und messbar
Verunsichert sind nicht nur die Bürger, sondern inzwischen auch die sogenannten Eliten. Ich habe das in vielen Gesprächen erlebt, die ich in den vergangenen Jahren mit Politikern, Topmanagern, Journalisten, Gewerkschaftern oder Wissenschaftlern geführt habe. Immer wieder höre ich die gleichen Fragen: Woher kommen Angst und Hass, die auch in unsere Betriebe einsickern? Warum ist die Zuwanderungsdebatte derart vergiftet? Wie sollen wir uns als Arbeitgeber zur AfD verhalten? Warum werden in den Medien stets aufgeregte Politdebatten geführt, in denen Sachargumente nicht mehr viel zählen? Was wird eigentlich aus der deutschen Politik, wenn Union und SPD zusammen keine Mehrheit mehr haben und es im Zweifel auch für große Koalitionen nicht mehr reicht? Wird dieses Land strukturell unregierbar? Ein in Berlin bestens vernetzter Banker erzählte: »Vielleicht müssen wir uns selbst bemühen, einen deutschen Macron aufzubauen, und eine neue Bewegungspartei à la En Marche! unterstützen.« Bei einer Konferenz der IG Metall im Sommer 2018 diskutierte ich mit Funktionären und Betriebsräten – über die Frage, ob sich Solidarität mit kollektiven Narrativen befördern lasse – und war mit einer Mischung aus Kampfgeist und Verunsicherung ob der absehbaren ökonomischen, technologischen, sozialen und politischen Verwerfungen konfrontiert.
Auch Journalisten suchen nach einer neuen Rolle. Sie bemühen sich um Transparenz und Redlichkeit, wissen aber gleichzeitig, dass sie den veränderten Mechanismen des Medienmarkts nicht entfliehen können (dazu eingehend Kapitel 7). Redaktionsleiter bei öffentlich-rechtlichen Sendern erzählen, wie sehr es sie quält, dass sie das jüngere Publikum kaum noch erreichen. Wissenschaftler fragen sich, warum sie mit empirisch gut abgesicherten Erkenntnissen nicht mehr durchdringen. Andere stürzen sich mit Verve in die Twitter-Gewitter und mischen möglichst bei jedem Aufregungszyklus mit.
Die ökonomischen Kosten der Unsicherheit sind potenziell groß. Aber wie groß genau sie sind, lässt sich nicht so einfach sagen. Sie sind das Resultat von Attentismus, also Abwarten und Nichthandeln, der Investoren, Konsumenten und sonstigen Akteure. 87-mal kamen die Worte »uncertain« oder »uncertainty« im Wirtschaftsbericht der OECD, der Organisation der Marktdemokratien, vom November 2018 vor.[17] Im OECD-Bericht vom Mai des gleichen Jahres waren es noch 65-mal.[18] Das 2018er Gutachten des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (»Fünf Weise«) enthielt immerhin 47 entsprechende Nennungen.[19] Unsicherheit wurde überwiegend im politischen Kontext erwähnt, insbesondere über die künftige Ausrichtung der US-Wirtschaftspolitik, zumal der Handelspolitik; über die Folgen des Brexits; über die Auswirkungen politischer Kehrtwenden auf die Finanzmärkte und auf die Stimmung bei den Unternehmen; über die Durchsetzbarkeit und Wirkung von Reformen des französischen Arbeitsmarkts. Und so weiter.
Ende der Leseprobe