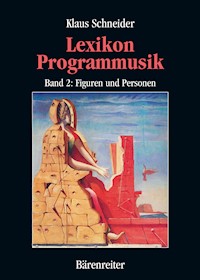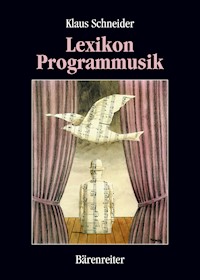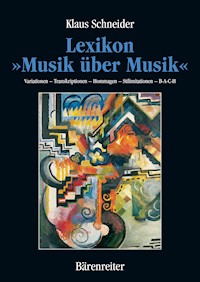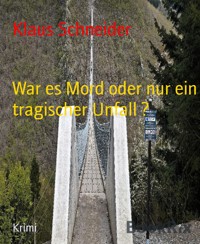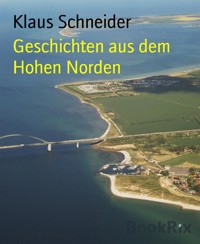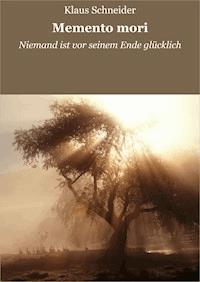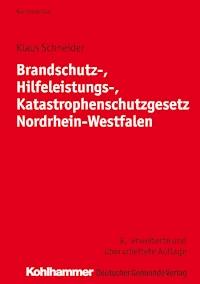Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Deutscher Gemeindeverlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Der Verordnungsgeber in Nordrhein-Westfalen hat am 26.5.2017 eine neue Verordnung über die Laufbahn in der Freiwilligen Feuerwehr als "Landesverordnung Freiwillige Feuerwehr NRW" beschlossen und verkündet. Damit tritt die bisherige "Verordnung über die Laufbahn der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr" außer Kraft. Die 4. Auflage kommentiert die neue Verordnung praxisnah und gibt Hilfestellungen bei notwendigen Personalentscheidungen in den Freiwilligen Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LandesverordnungFreiwillige FeuerwehrNordrhein-Westfalen
Kommentar für die Praxis
von
Klaus SchneiderDr. rer. sec. h. c.Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht a. D.Ehrenvorsitzender des Verbandes der Feuerwehren in NRW e.V.Hauptbrandmeister a. D. der Freiwilligen FeuerwehrLehrbeauftragter a. D. an der Bergischen Universität Wuppertal
4., überarbeitete Auflage
Deutscher Gemeindeverlag
4. Auflage
Alle Rechte vorbehalten
© Deutscher Gemeindeverlag GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-555-01989-5
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-555-01990-1
epub: ISBN 978-3-555-01991-8
mobi: ISBN 978-3-555-01992-5
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Der Verordnungsgeber in Nordrhein-Westfalen hat am 26.5.2017 eine neue Verordnung über die Laufbahn in der Freiwilligen Feuerwehr als‚Landesverordnung Freiwillige Feuerwehr NRW‘ beschlossen und verkündet. Damit tritt die bisherige ‚Verordnung über die Laufbahn der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr‘ außer Kraft.
Die 4. Auflage kommentiert die neue Verordnung praxisnah und gibt Hilfestellungen bei notwendigen Personalentscheidungen in den Freiwilligen Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen.
Dr. rer. sec. h. c. Klaus Schneider, Vorsitzender Richer am Oberlandesgericht a. D., Ehrenvorsitzender des Verbandes der Feuerwehren NRW, Hauptbrandmeister a. D. der Freiwilligen Feuerwehr, Lehrbeauftragter a. D. an der Bergischen Universität Wuppertal.
Vorwort
Durch die Verordnung über das Ehrenamt in den Freiwilligen Feuerwehren im Land Nordrhein-Westfalen (Landesverordnung Freiwillige Feuerwehr – VOFF NRW) vom 09. Mai 2017 (veröffentlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen 2017 Seite 582) ist die alte Laufbahnverordnung der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr vom 01. Februar 2002 ersatzlos aufgehoben worden.
Die Gliederung einer Freiwilligen Feuerwehr ist neu geregelt worden. Rechte und Pflichten der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen sind umfassend überarbeitet und teilweise neu gestaltet worden. Die Funktionen innerhalb einer Freiwilligen Feuerwehr sind einer neuen rechtlichen Bewertung unterzogen und das Disziplinarverfahren in mehreren Punkten geändert worden.
Das machte insgesamt eine umfassende Überarbeitung der Kommentierung erforderlich. Gleichzeitig sind in der neuen Auflage auch die einschlägigen, veröffentlichten neuen Rechts- und Verwaltungsvorschriften in die Erläuterungen der einzelnen Paragrafen aufgenommen worden. Weiterhin ist die zwischenzeitlich bekannt gewordene Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte und sonstiger Gerichte berücksichtigt worden.
Der Kommentar soll auch in dieser Auflage helfen, die in der Freiwilligen Feuerwehr notwendigen Personalentscheidungen sachgerechter, einfacher und nachvollziehbarer treffen zu können.
Für die mir bisher gegebenen Anregungen möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Für weitere Hinweise bin ich sehr aufgeschlossen.
Um die Kontinuität des Kommentars auch in Zukunft wahren zu können, hat meine Tochter, Richterin am Oberlandesgericht Andrea Berg, diese Auflage dankenswerterweise mitbearbeitet und ihre Gedanken und Stellungnahmen eingebracht.
Meinem Sohn, Brandamtmann Christian Schneider, danke ich auch jetzt wieder für die umfangreichen Schreibarbeiten und die sachdienlichen Anmerkungen. Ohne ihn wäre diese neue Kommentierung nicht möglich gewesen.
Hamm, im März 2018Dr. h.c. Klaus Schneider
Gendererklärung
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Kommentar die Sprachform des generischen Maskulinums angewendet. Es wird darauf hingewiesen, dass die ausschließliche Verwendung der männlichen Form geschlechterunabhängig zu verstehen ist.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Verordnung über das Ehrenamt in den Freiwilligen Feuerwehren im Land Nordrhein-Westfalen(Landesverordnung Freiwillige Feuerwehr – VOFF NRW) mit Erläuterungen
Teil 1:Allgemeines
§ 1Gliederung der Freiwilligen Feuerwehr
Teil 2Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr
§ 2Zuständigkeit und Grundsätze der Aufnahme
§ 3Dienst und Mitgliedschaft in einer Freiwilligen Feuerwehr außerhalb des Wohnortes
§ 4Übernahme aus anderen Feuerwehren
§ 5Mitwirkung in anderen Organisationen
§ 6Probezeit
§ 7Mitgliedsakte
Teil 3Verwendung innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr
§ 8Aufnahme in die Einsatzabteilung
§ 9Ausscheiden aus der Einsatzabteilung und Eintritt in die Ehrenabteilung
§ 10Unterstützungsabteilung
§ 11Kinder- und Jugendfeuerwehr
Teil 4Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr
§ 12Pflichten der Mitgliedschaft
§ 13Fortbildung und Personalentwicklung
§ 14Dienstgrade und Beförderungen
§ 15Beurlaubung
Teil 5Funktionen und Inkompabilitäten
§ 16Funktionen im Dienst der Freiwilligen Feuerwehr
§ 17Kommissarische Übertragung von Funktionen
§ 18Qualifikation für Führungs- und Aufsichtsfunktionen
§ 19Mehrfachfunktionen
Teil 6Disziplinarverfahren
§ 20Disziplinarbefugnis
§ 21Dienstvergehen
§ 22Disziplinarmaßnahmen
§ 23Verfahren
Teil 7Ausscheiden, Übergangs- und Schlussvorschriften
§ 24Ausscheiden aus der Freiwilligen Feuerwehr
§ 25Übergangsvorschriften
§ 26Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Anlage 1 zu § 14 VOFF Dienstgrade der Freiwilligen Feuerwehr
Anlage 2 zu § 14 VOFF Dienstgrade der Feuerwehrmusik
Anhang 1Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
Teil 1:Aufgaben und Träger
Teil 2:Organisation
Teil 3:Gesundheitswesen
Teil 4:Einrichtungen, vorbeugende und vorbereitende Maßnahmen
Teil 5:Durchführung der Abwehrmaßnahmen
Teil 6:Rechte und Pflichten der Bevölkerung
Teil 7:Kosten
Teil 8:Aufsicht
Teil 9:Übergangs- und Schlussvorschriften
Anhang 2Unfallverhütungsvorschriften
Anhang 2.1Übersicht über die von der Unfallkasse NRW für die Feuerwehr geltenden speziellen Unfallverhütungsvorschriften
Anhang 2.2Unfallverhütungsvorschrift „Feuerwehren“
Anhang 3Regelung über die Dienstgrad- und Funktionsabzeichen der Feuerwehren, des Instituts der Feuerwehr NRW und der Aufsichtsbehörden des Landes Nordrhein-Westfalen sowie über die Helmkennzeichnung für Führungskräfte der Feuerwehr
Stichwortverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Fehn/Selen, Rechtshandbuch für Feuerwehr und Rettungsdienst, 3. Auflage 2010, Verlagsgesellschaft Stumpf und Kossendey m.b.H., Edewecht/Wien
Fischer, Rechtsfragen beim Feuerwehreinsatz, 4. Auflage 2017, Die roten Hefte Nr. 68, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart
Graeger, Einsatz und Abschnittsleitung, 1. Auflage 2003, Ecomed Verlag
Müssig- Ruppel-Timm, Wer haftet, wenn etwas passiert ? 1. Auflage 2016, Ecomed-Storck GmbH, Landsberg am Lech
Sammlung gerichtlicher Entscheidungen zum Feuerschutz Rettungsdienst und Katastrophenschutz,, Aktualisierung 2017, herausgegeben vom Verband der Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen, Wuppertal
Schneider, Brandschutz-,Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen, 9. Auflage 2016, Verlag W. Kohlhammer/Deutscher Gemeindeverlag, Stuttgart
Steegmann/Kamp, Recht des Feuerschutzes und des Rettungsdienstes in Nordrhein-Westfalen, 4. Auflage (40. Aktualisierung) 2017, R. v. Decker’s Verlag, Heidelberg
Verordnung über das Ehrenamt in den Freiwilligen Feuerwehren im Land Nordrhein-Westfalen (Landesverordnung Freiwillige Feuerwehr – VOFF NRW)
vom 09. Mai 2017 (GV.NRW. 2017 S. 582)
Auf Grund des § 56 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz vom 17. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 886) wird folgende Verordnung erlassen:
Teil 1:Allgemeines
§ 1Gliederung der Freiwilligen Feuerwehr
(1)Die Freiwillige Feuerwehr gliedert1 sich in:
1. die Einsatzabteilung2 gemäß § 9 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz,
2. die Unterstützungsabteilung3 gemäß § 9 Absatz 2 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz,
3. die Ehrenabteilung4,
4. die Abteilung Feuerwehrmusik5, soweit diese gebildet wurde,
5. die Jugendfeuerwehr6 nach Maßgabe des § 13 Absatz 1 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz und
6. die Kinderfeuerwehr7 nach Maßgabe des § 13 Absatz 2 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz
(2)Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr können nach Maßgabe dieser Verordnung einer oder mehreren Abteilungen nach Absatz 1 angehören8.
1.Gliederung einer FF
1.1Vorgabe durch VOFF
1Die VOFF gibt jetzt die Gliederung einer Freiwilligen Feuerwehr vor. Aus der Aufzählung folgt, dass der Verordnungsgeber von einer Mitgliedschaft in fast allen Lebensphasen ausgeht. Insoweit wird hier das Lebensphasenmodell, das auch in § 13 Abs. 5 VOFF angesprochen wird, vorgegeben. Es soll eine Mitgliedschaft in einer Freiwilligen Feuerwehr vom Grundschulalter bis zum Tod ermöglicht werden.
1.2Abteilungen einer Freiwilligen Feuerwehr
2Eine Freiwillige Feuerwehr gliedert sich in:
– die Einsatzabteilung
siehe unten Anm. 2 zu § 1 VOFF
– die Unterstützungsabteilung
siehe unten Anm. 3 zu § 1 VOFF
– die Ehrenabteilung
siehe unten Anm. 4 zu § 1 VOFF
– die Abteilung Feuerwehrmusik
siehe unten Anm. 5 zu § 1 VOFF
– die Jugendfeuerwehr
siehe unten Anm. 6 zu § 1 VOFF
– die Kinderfeuerwehr
siehe unten Anm. 7 zu § 1 VOFF.
2.Einsatzabteilung
2.1Dienst für die Gemeinde
3Die im Einsatzdienst tätigen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr (Einsatzabteilung) sind freiwillig und ehrenamtlich im Dienst der Gemeinde tätig.
2.2Einzelregelungen
4Einzelregelungen finden sich in
– § 8 VOFF Aufnahme in die Einsatzabteilung
– § 9 VOFF Ausscheiden aus der Einsatzabteilung
– § 11 VOFF Übernahme aus der Jugendfeuerwehr.
2.3Pflicht zur Bildung
5Eine Einsatzabteilung muss gebildet werden. Dies ergibt sich aus § 3 Abs. 1 BHKG (siehe Anhang 1 – Der Lesbarkeit wegen wird der Hinweis auf die Fundstelle des BHKG im Anhang 1 dieses Kommentars in der nachfolgenden Kommentierung nicht mehr in jedem Einzelfall wiederholt).
3.Unterstützungsabteilung
3.1Kein ausschließlicher Einsatzdienst
6Einer Freiwilligen Feuerwehr können auch Personen angehören, die freiwillig und ehrenamtlich zur Erfüllung der Aufgaben der Feuerwehr auf andere Weise als durch die Mitwirkung im Einsatzdienst beitragen. Für diese Mitglieder findet § 9 Abs. 1 BHKG entsprechende Anwendung (vgl. § 9 Abs. 2 BHKG).
3.2Keine Pflicht zur Gründung
7Aus den Worten „können auch“ in § 9 Abs. 2 BHKG ergibt sich, dass eine solche Unterstützungsabteilung gegründet werden kann, aber nicht gegründet werden muss.
3.3Einzelregelungen
8Einzelregelungen finden sich in
– § 9 Abs. 3 VOFF Übertritt in die Unterstützungsabteilung,
– § 9 Abs. 4 VOFF Wechsel in die Unterstützungsabteilung,
– § 10 Abs. 1 VOFF Aufgaben der Unterstützungsabteilung.
3.4Mitgliedschaft in mehreren Abteilungen
9Wenn ein Feuerwehrangehöriger Tätigkeiten ausübt, die sowohl in der Einsatzabteilung als auch in der Unterstützungsabteilung zum Tätigkeitsbereich gehören (z. B. Maschinist eines Löschfahrzeugs und Gerätewart), ist eine Mitgliedschaft in beiden Abteilungen möglich. Die Mitgliedschaft in der Einsatzabteilung sollte Vorrang haben, da eine Unterstützungsabteilung ja zwingend nicht gegründet werden muss (siehe Anm. 3.2 zu § 1 VOFF) und weil beim Ausscheiden aus der Einsatzabteilung ein Wechsel in die Unterstützungsabteilung vorgesehen ist (vgl. § 9 Abs. 3 und § 9 Abs. 4 VOFF). Eine solche Regelung wäre sonst überflüssig.
4.Ehrenabteilung
4.1Grundsatz
10Die Ehrenabteilung findet keine ausdrückliche Erwähnung im BHKG.
In die Ehrenabteilung werden die Angehörigen aufgenommen, die keine Aufgaben mehr in der Freiwilligen Feuerwehr wahrnehmen, aber nach wie vor der Feuerwehr aufgrund ihrer langjährigen Lebensleistung weiterhin verbunden sind.
Mitglieder einer Ehrenabteilung können Feuerwehrangehörige einer Freiwilligen Feuerwehr unter anderem werden:
– beim Ausscheiden aus der Einsatzabteilung wegen Erreichens der Altersgrenze (§ 9 Abs. 1 Nr. 1, § 9 Abs. 3 VOFF), es sei denn der Leiter der Feuerwehr weist sie der Unterstützungsabteilung zu,
– beim Ausscheiden aus der Einsatzabteilung wegen fehlender Gesundheit (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, § 9 Abs. 3 VOFF), es sei denn der Leiter der Feuerwehr weist sie der Unterstützungsabteilung zu,
– beim Ausscheiden aus der Einsatzabteilung wegen persönlicher oder sonstiger Gründe (§ 9 Abs. 1 Nr. 3; § 9 Abs. 4 VOFF), soweit sie nicht nach § 2 Abs. 1 S. 2 VOFF vom Leiter der Feuerwehr einer anderen Abteilung zugewiesen werden,
– beim Ausscheiden aus der Unterstützungsabteilung aus persönlichen oder sonstigen Gründen (in der Regel auf Antrag des Betroffenen).
Ein direkter Eintritt in die Ehrenabteilung ist nicht möglich.
4.2Einzelregelungen
11Einzelregelungen finden sich in
– § 9 Abs. 3 VOFF Übertritt aus der Einsatzabteilung,
– § 9 Abs. 4 VOFF Übertritt aus der Unterstützungsabteilung.
4.3Pflicht zur Bildung
12Eine Ehrenabteilung muss in einer Freiwilligen Feuerwehr gebildet werden. Dies ergibt sich aus den Regelungen in § 9 VOFF.
5.Abteilung Feuerwehrmusik
5.1Grundsatz
13Die Abteilung Feuerwehrmusik findet keine ausdrückliche Erwähnung im BHKG.
5.2Keine Pflicht zur Einrichtung
14Sie kann, muss aber nicht eingerichtet werden (vgl. § 1 Abs. 1 Nr. 4 VOFF).
5.3Einzelregelungen
15Einzelregelungen finden sich in
– Dienstgrade der Abteilung Feuerwehrmusik ergeben sich aus der Anlage 2 zu § 14 Abs. 1 S. 2 VOFF.
– Die Dienstgradabzeichen der Abteilung Feuerwehrmusik finden sich in der Anlage 3 (Nrn. 49 bis 59) des Runderlasses des Ministeriums des Innern vom 20.7.2017 – siehe Anhang 3.
6.Jugendfeuerwehr
6.1Grundsatz
16Die Gemeinde soll nach § 13 Abs. 1 S. 1 BHKG in der Freiwilligen Feuerwehr die Bildung einer Jugendfeuerwehr fördern. Angehörige einer Jugendfeuerwehr müssen das zehnte Lebensjahr vollendet haben. Der Leiter der Feuerwehr bestellt einen Jugendfeuerwehrwart. Als Jugendfeuerwehrwart darf nur tätig werden, wer die hierfür erforderliche Eignung und Befähigung hat.
Angehörige der Jugendfeuerwehr dürfen nur an den für sie angesetzten Übungen und Ausbildungsveranstaltungen teilnehmen. Mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten dürfen sie ab dem 16. Lebensjahr auch außerhalb der Jugendfeuerwehr zu Ausbildungsveranstaltungen und im Einsatz zu Tätigkeiten außerhalb des Gefahrenbereichs herangezogen werden.
6.2Abweichung vom Gesetz
17Von der Bildung einer Jugendfeuerwehr kann nach dem Wortlaut „soll“ nur abgewichen werden, wenn ein wichtiger Grund der vorgesehenen Gründung einer Jugendfeuerwehr entgegensteht. Es darf also nur in atypischen Fällen anders verfahren werden als im Gesetz vorgeschrieben (vgl. dazu OVG NRW SgE Feu § 3 II PrüfVO NRW Nr. 1).
6.3Einzelregelungen
18Einzelregelungen finden sich in
– § 11 Abs. 1 S. 2 VOFF Aufnahmealter in die Jugendfeuerwehr,
– § 11 Abs. 2 VOFF Übernahme aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung,
– § 11 Abs. 3 VOFF sonstige Tätigkeiten bei Einsätzen,
– § 11 Abs. 4 VOFF Beachtung von § 72a SGB VIII,
– § 16 Abs. 3 VOFF Jugendfeuerwehrwart.
Die Funktionsabzeichen für die Jugendfeuerwehr finden sich in der Anlage 2 (Nrn. 40, 42 und 44) des Runderlasses des Ministeriums des Innern vom 20.7.2017 – siehe Anhang 3.
7.Kinderfeuerwehr
7.1Grundsatz
19In der Freiwilligen Feuerwehr können nach § 13 Abs. 2 S. 1 BHKG für Kinder vom vollendeten sechsten Lebensjahr bis zum vollendeten zwölften Lebensjahr Kinderfeuerwehren gebildet werden.
Der Leiter der Kinderfeuerwehr wird vom Leiter der Feuerwehr bestellt. Als Leiter einer Kinderfeuerwehr darf nur tätig werden, wer die hierfür erforderliche Eignung und Befähigung hat.
7.2Keine Pflicht zur Gründung
20Aus dem Gebrauch des Wortes „können“ in § 13 Abs. 2 S. 1 BHKG folgt, dass eine Kinderfeuerwehr gegründet werden kann, aber nicht muss. Die Gemeinde kann hier nach freiem Ermessen entscheiden.
7.3Einzelregelungen
21Einzelregelungen finden sich in
– § 11 Abs. 1 S. 1 VOFF Aufnahmealter in die Kinderfeuerwehr,
– § 11 Abs. 4 VOFF Beachtung von § 72a SGB VIII,
– § 16 Abs. 4 VOFF Kinderfeuerwehrwart.
7.4Funktionsabzeichen
22Die Funktionsabzeichen für eine Kinderfeuerwehr finden sich in der Anlage 2 (Nrn. 41, 43 und 45) des Runderlasses des Ministeriums des Innern vom 20.7.2017 – siehe Anhang 3.
8.Angehörigkeit in mehreren Abteilungen
23Die VOFF erlaubt ausdrücklich eine Mitgliedschaft in mehreren Abteilungen. So ist z. B. eine Mitwirkung in der Einsatzabteilung oder der Unterstützungsabteilung und in der Abteilung Feuerwehrmusik oder eine Tätigkeit in der Einsatz- oder Unterstützungsabteilung und (z. B. als Betreuer) in einer Kinderfeuerwehr zulässig.
Teil 2Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr
§ 2Zuständigkeit und Grundsätze der Aufnahme
(1)Die Leiterin oder der Leiter der Feuerwehr1 nimmt Bewerberinnen und Bewerber2 als Angehörige in die Freiwillige Feuerwehr auf (Mitgliedschaft)3. Sie oder er entscheidet über die Verwendung der Angehörigen innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr4, befördert5 und entlässt diese6.
(2)Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht7. Gründe für eine Ablehnung8 können fehlende Eignung9, tatsächliche Anhaltspunkte für eine fehlende Bereitschaft zur Erfüllung der Voraussetzungen des § 1210 oder ein anderer wichtiger Grund sein11.
(3)Vor der Aufnahme hat die Leiterin oder der Leiter der Feuerwehr oder eine von ihr oder ihm beauftragte Führungskraft ein Aufnahmegespräch12 mit der Bewerberin oder dem Bewerber zu führen, in dem insbesondere die Rechte und Pflichten der Mitgliedschaft zur Freiwilligen Feuerwehr gemäß der §§ 12 und 13 behandelt werden13.
0.Vorbemerkung
0.1Geltungsbereich
1Der Geltungsbereich des § 2 VOFF erstreckt sich über alle in § 1 Abs. 1 VOFF aufgeführten Abteilungen einschließlich der Jugend- und Kinderfeuerwehr. Eine Reduzierung auf die Anwendung in der Einsatzabteilung findet im § 2 VOFF nicht statt.
0.2Entscheidungsbefugnis
2Aufgrund der in der Feuerwehr bestehenden Aufgabenvielfalt sollen ehrenamtliche Angehörige im Rahmen der VOFF gezielt und individuell eingesetzt werden können. Die VOFF ermöglicht dem Leiter der Feuerwehr die hierfür erforderliche Ermessensausübung bezüglich der Aufnahme von Personen in die Freiwillige Feuerwehr. Die Kriterien sind daher individuell auf die Person und den jeweiligen Verwendungszweck in der Freiwilligen Feuerwehr zu betrachten.
1.Leiterin oder Leiter der Feuerwehr
1.1Gemeinden mit Freiwilliger Feuerwehr
3Nach § 11 Abs. 1 S. 1 BHKG ist in Gemeinden mit Freiwilliger Feuerwehr Leiter einer Feuerwehr die oder der von der Gemeinde nach Anhörung der aktiven Wehr auf Vorschlag des Kreisbrandmeisters auf die Dauer von 6 Jahren bestellte Feuerwehrangehörige. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine Freiwillige Feuerwehr mit ausschließlich ehrenamtlich Tätigen oder auch mit hauptamtlichen Kräften (vgl. dazu § 10 BHKG) handelt.
1.2Gemeinden mit Berufsfeuerwehr
4Nach § 11 Abs. 4 BHKG ist in Gemeinden mit Berufsfeuerwehr der Leiter dieser Berufsfeuerwehr für eine Freiwillige Feuerwehr, die neben der Berufsfeuerwehr besteht, der Leiter der Feuerwehr. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Berufsfeuerwehr in einer kreisfreien oder kreisangehörigen Stadt aufgestellt worden ist.
1.3Verantwortung des Leiters der Feuerwehr
5Durch die ausdrückliche Wiederholung der Zuständigkeit in § 2 Abs. 1 VOFF wird nochmals auf die organisatorische und personelle Verantwortung des Leiters der Feuerwehr hingewiesen.
Aus dieser Zuständigkeit des Leiters der Feuerwehr folgt auch heute noch, dass ehrenamtliche Feuerwehrangehörige keine Beschäftigten im Sinne des Landespersonalvertretungsgesetzes sind (vgl. dazu auch OVG NRW SgE Feu § 5 LPVG Nr. 1).
1.4Keine Regelung für Kreiseinheiten bei Nicht-Feuerwehrangehörigen
6In der VOFF findet sich keine Regelung für Kreiseinheiten nach § 4 Abs. 2 S. 3 BHKG, soweit die Mitglieder nicht Angehörige einer Freiwilligen Feuerwehr sind.
1.5Ausschließliche Zuständigkeitsregelung
7Bei der Regelung des § 2 Abs. 1 S. 1 VOFF handelt es sich ausschließlich um eine Zuständigkeitsregelung (vgl. auch OVG NRW SgE Feu § 1 I LVOFF Nr. 2).
2.Bewerber
2.1Frauen und Männer
2.1.1Feuerwehrangehörige
8Als Bewerber können Frauen und Männer in die Freiwillige Feuerwehr aufgenommen werden. Eine Benachteiligung von Frauen bei der Aufnahme in die Feuerwehr verstößt gegen Artikel 3 des Grundgesetzes und § 1 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes vom 14. August 2006 (BGBl. I 2006 Seite 1897 – in der jeweils geltenden Fassung –). Seit der Neufassung des BHKG wird nicht mehr von „Feuerwehrmännern“ gesprochen, sondern es wird das neutrale Wort „Feuerwehrangehöriger“ gebraucht.
2.1.2Gleichstellungsprinzip
9Nach dem Gleichstellungsprinzip ist jede Gemeinde verpflichtet, auch weiblichen Bewerbern die Mitarbeit in der Feuerwehr zu ermöglichen (vgl. auch Landtag NRW, Landtagsdrucksache 12/4759 vom 9.3.2000 zu Frage 3).
2.1.3Schwangerschaft
10Die Möglichkeit einer Schwangerschaft ist kein Grund, Frauen nicht aufzunehmen. Während des Dienstes in der Feuerwehr sind bei einer Schwangerschaft die Richtlinien über den Mutterschutz (vgl. Mutterschutzgesetz vom 23.5.2017 – BGBl. I 2017 Seite 1228 –) zu beachten. Vgl. auch die Mutterschutz- und Elternzeitverordnung vom 12.2.2009 – BGBl. I 2009 Seite 320 in der jeweils geltenden Fassung. Als Anhalt können auch die Mutterschutzrichtlinien der Bundeswehr (vgl. z. B. VMBl. 2001 Seite 187) dienen.
2.2Ausländische Mitbürger
11Die VOFF enthält keine Regelung bezüglich der Staatsangehörigkeit. Es bestehen daher keine Bedenken, auch ausländische Mitbürger in die Freiwillige Feuerwehr aufzunehmen. Ein ausländischer Mitbürger sollte jedoch der deutschen Sprache mächtig sein, um eine Verständigung im Gefahrenbereich gewährleisten zu können (vgl. auch Nadler in: „Feuerwehr Magazin“ Heft 5/2001 Seite 42).
2.3Einwohner/Bürger
12Die Bewerber müssen nicht mehr Gemeindebürger (Wahlberechtigte nach § 21 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW zu den Gemeindewahlen) sein. Die Verordnung schreibt auch nicht vor, dass sie Gemeindeeinwohner sein, also in der Gemeinde wohnen (§ 21 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW; so auch Fischer in „Der Feuerwehrmann“ 2002 Seite 195) müssen. Dies folgt auch aus § 3 Abs. 1 und Abs. 2 VOFF. Grundsätzlich soll zwar die Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr des Wohnortes erworben werden, in begründeten Ausnahmefällen ist aber eine Mitgliedschaft in der Feuerwehr der an die Wohngemeinde angrenzenden Gemeinde zulässig (vgl. dazu Anm. 2 bis 4 zu § 3 VOFF). Es steht in der Personalhoheit des Leiters der Feuerwehr, auch einen Bewerber aus einer anderen Gemeinde aufzunehmen (vgl. auch Fischer in „Der Feuerwehrmann“ 3/2002 Seite 54 f.). Allein das Wohnen in einer anderen Gemeinde ist auch kein wichtiger Grund im Sinne des § 2 Abs. 2 VOFF, um einen Bewerber abzulehnen.
2.4Bewerber aus Beschäftigungsort
13Nach dem neuen § 3 Abs. 3 VOFF ist es jetzt möglich, dass ein Bewerber, der in einer Gemeinde einer Beschäftigung nachgeht, dort aber nicht wohnt, neben der Wohnort- oder Nachbarortfeuerwehr auch in die Freiwillige Feuerwehr des Beschäftigungsortes aufgenommen werden kann.
Nähere Einzelheiten zur möglichen Mitgliedschaft in zwei Freiwilligen Feuerwehren vgl. in den Anm. zu § 3 VOFF.
2.5Fachberater
14In die Freiwillige Feuerwehr können nach § 10 Abs. 2 VOFF Personen mit besonderen Fähigkeiten und Kenntnissen zur Beratung und Unterstützung der Feuerwehr aufgenommen werden. Sie tragen dann die Bezeichnung „Fachberater“.
Zu näheren Einzelheiten zu diesen Fachberatern siehe die Anm. zu § 10 VOFF.
2.6Mitarbeiter des Feuerschutzes
15Aus der Regelung des § 19 VOFF folgt, dass auch folgende Mitarbeiter des Feuerschutzes grundsätzlich als Bewerber für die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr in Betracht kommen:
(1) feuerwehrtechnische Beamte von Gemeinden (z. B. Angehörige von Berufsfeuerwehren [vgl. dazu § 8 Abs. 2 BHKG]; z. B. hauptamtliche Kräfte einer Freiwilligen Feuerwehr [vgl. dazu § 10 BHKG]),
(2) Beamte der Kreise (z. B. Personal in den Kreisleitstellen nach § 28 BHKG),
(3) feuerwehrtechnische Beamte des Landes (z. B. im Institut der Feuerwehr NRW [vgl. dazu § 32 BHKG]; z. B. in der Fachaufsicht des Landes NRW (z. B. Feuerschutzdezernenten in den Bezirksregierungen [vgl. dazu § 53 BHKG]); z. B. in den Werkfeuerwehren von Landeseinrichtungen (vgl. dazu § 116 Abs. 2 LBG NRW),
(4) Mitarbeiter des Feuerschutzes in den Gemeinden (z. B. Angestellte im Feuerwehrdienst [vgl. dazu § 58 BHKG]),
(5) Mitarbeiter des Feuerschutzes in Kreisen (z. B. Angestellte in den Kreisleitstellen [vgl. dazu § 28 BHKG]),
(6) für Angehörige von Werkfeuerwehren (vgl. dazu § 16 BHKG) finden sich keine Regelungen in der VOFF. Entsprechende Regelungen werden sich aus der – nach § 56 Abs. 1 S. 3 BHKG noch zu erlassenden – Werkfeuerwehrverordnung ergeben.
2.7Bewerber bei Mitwirkung in anderen Organisationen
16Es können sich auch Personen bewerben, die in anderen Hilfsorganisationen tätig sind.
Aus der Formulierung des § 5 VOFF ergibt sich jedoch, dass die Personen zwar in der Freiwilligen Feuerwehr mitwirken können, aber dort nicht auf die Sollstärke angerechnet werden. Es handelt sich dabei um folgende Personenkreise:
(1) Helfer in der Gefahrenabwehr, wenn sie in einem besonderen öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehen;z. B.: Polizeivollzugsbeamte,
z. B.: aktive Helfer im Technischen Hilfswerk (vgl. dazu das Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk vom 22.1.1990 [BGBl. I 1990 Seite 118] in der jeweils gültigen Fassung),
z. B.: Rettungsdienstmitarbeiter, soweit sie in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zu einer Gemeinde oder einem Kreis stehen.
(2) Ehrenamtlich aktiv Mitwirkende in den privaten Hilfsorganisationen nach § 18 BHKG. Ehrenamtlich Mitwirkende können u. a. in folgenden Hilfsorganisationen tätig sein:
– ASB (Arbeiter-Samariter-Bund),
– DLRG (Deutsche Lebensrettungsgesellschaft),
– DRK (Deutsches Rotes Kreuz),
– JUH (Johanniter-Unfall-Hilfe),
– MHD (Malteser-Hilfsdienst).
(3) Ehrenamtlich aktiv Mitwirkende in Regieeinheiten nach § 19 BHKG.
Die Nichtanrechnung auf die Sollstärke der Freiwilligen Feuerwehr rechtfertigt sich aus der Tatsache, dass in einem Einsatz pro Person nur einmal aktiv geholfen werden kann.
2.8Keine sonstigen Bewerbervoraussetzungen
2.8.1Berufliche Stellung
17Für die ehrenamtliche Tätigkeit in der Freiwilligen Feuerwehr spielt es keine Rolle, welche berufliche Stellung der Feuerwehrangehörige bekleidet, ob er als Arbeiter, Angestellter, Beamter, Soldat oder Selbständiger tätig ist.
Ein Arbeitnehmer, der sich als Freiwilliger für die Feuerwehr meldet, setzt sich einem privaten Arbeitgeber gegenüber nicht dem Vorwurf aus, seinen arbeitsvertraglichen Verpflichtungen zuwiderzuhandeln (vgl. VGH Baden-Württemberg SgE Feu § 17 FwG BW Nr. 1).
2.8.2Richter
18Wegen des Prinzips der Gewaltenteilung sind Bedenken erhoben worden, ob auch Richter ehrenamtliche Feuerwehrangehörige sein können. Gegen diese ehrenamtliche Tätigkeit bestehen solange keine Bedenken, als nicht Verwaltungstätigkeit im engeren Sinn (z. B. Erlass von Verwaltungsakten) ausgeübt wird oder das Deutsche Richtergesetz insoweit geändert wird (vgl. den Antrag der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag vom 5.12.2000).
2.8.3Nebentätigkeitsgenehmigung
19Ein Beamter oder Richter benötigt in NRW keine Nebentätigkeitsgenehmigung für seine Tätigkeit in einer Freiwilligen Feuerwehr. Die Nebentätigkeitsverordnung NRW ist entsprechend geändert worden (vgl. GV. NRW. 2001 Seite 187).
Dem freiwilligen Feuerwehrdienst haftet unter keinen denkbaren Umständen der Makel einer verbotenen Nebentätigkeit an (vgl. VGH Baden-Württemberg SgE Feu § 17 FwG BW Nr. 1).
2.8.4Längerfristige Bindung
20Die VOFF sieht grundsätzlich nicht die Absicht einer langjährigen Dienstzeit als Aufnahmekriterium vor (vgl. dazu Nadler in „Feuerwehr Magazin“ Heft 5/2001 Seite 42).
2.8.5Arbeitslosigkeit
21Nach § 138 Abs. 2 SGB III schließt eine Arbeitslosigkeit eine ehrenamtliche Tätigkeit nicht aus, wenn dadurch die berufliche Eingliederung des Arbeitslosen nicht beeinträchtigt wird (vgl. auch Schneider in „Der Feuerwehrmann“ 2002 Seite 198).
3.Mitgliedschaft/Aufnahme
3.1Regelung im BHKG
22Die Bewerber werden durch den Leiter der Feuerwehr aufgenommen, befördert und entlassen; der Leiter der Feuerwehr ist zugleich Vorgesetzter.
3.2Generelle Entscheidung über Mitgliedschaft
23Die generelle Entscheidung über die Mitgliedschaft in einer Freiwilligen Feuerwehr ist zu unterscheiden von der Entscheidung des Leiters der Feuerwehr, wo der Feuerwehrangehörige konkret verwendet werden soll.
3.2.1Generelle Mitgliedschaft
24Bei der Aufnahmeentscheidung handelt es sich um die grundsätzliche Mitgliedschaft in einer Freiwilligen Feuerwehr. Diese Entscheidung betrifft also nur die generelle Mitgliedschaft in einer Freiwilligen Feuerwehr.
3.2.2Konkrete Verwendungsentscheidung
25Die generelle Aufnahmeentscheidung kann verbunden werden mit der konkreten Zuweisung in eine Abteilung in der Freiwilligen Feuerwehr. Vgl. zu dieser Verwendungsentscheidung die Anm. 4 zu § 2 VOFF.
3.3Voraussetzungen
3.3.1Materielle Voraussetzungen
26Der Bewerber muss die Altersvorschriften erfüllen. Er muss den Anforderungen, die in § 12 VOFF aufgezählt sind (vgl. dazu die Anm. zu § 12 VOFF), entsprechen. Es dürfen keine Gründe für eine Ablehnung nach § 2 Abs. 2 S. 2 VOFF vorliegen (vgl. dazu Anm. 8 zu § 2 VOFF).
Das gilt auch für eine Wiederaufnahme (vgl. auch OVG NRW SgE Feu § 1 I LVOFF Nr. 1).
Aus § 9 Abs. 1 BHKG ergibt sich darüber hinaus, dass der Bewerber bereit sein muss, freiwillig und ehrenamtlich im Dienst der Gemeinde tätig sein zu wollen.
Freiwillig bedeutet, dass der Feuerwehrangehörige freiwillig beitritt und zu jeder Zeit und ohne Angabe von Gründen seinen Austritt (vgl. dazu Anm. 3 zu § 24 VOFF) aus der Feuerwehr erklären kann.
Ehrenamtlich ist die Tätigkeit in den Freiwilligen Feuerwehren, weil dieser Tätigkeit nicht nur „die Ehre“ sondern auch ein „Amt“ eigen ist. Ein ehrenamtlich Tätiger nimmt ein Amt ehrenhalber wahr (vgl. ausdrücklich BSG SgE Feu § 9 I FSHG Nr. 21).
Das BHKG setzt voraus, dass die ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren ihren Dienst unentgeltlich leisten. Dabei ist entscheidend, dass der Feuerwehrangehörige für seine Tätigkeit im Interesse der Gemeinde und ihrer Einwohner keine Bezahlung von der Gemeinde erhält. Diesem Grundprinzip steht nicht entgegen, dass ihm Auslagenersatz, Lohn- bzw. Verdienstausfall und ggf. auch eine Aufwandsentschädigung zustehen (vgl. BVerwG SgE Feu § 9 I FSHG Nr. 25a).
3.3.2Formelle Voraussetzungen
27Die Aufnahme setzt einen Aufnahmeantrag voraus. Die Form dieses Antrages ist nicht vorgeschrieben. Der Antrag kann daher schriftlich, mündlich oder konkludent (durch schlüssiges Verhalten) erfolgen. In der Regel sollte aber ein schriftlicher Antrag vorliegen, um Klarheit über das beginnende öffentlich-rechtliche Rechtsverhältnis (vgl. dazu Anm. 3.5.2 zu § 2 VOFF) zu haben.
In dem Aufnahmeantrag sollte – unabhängig von der Regelung des § 8 Abs. 2 VOFF – der Bewerber seine Bereitschaft zur Vorlage eines Führungszeugnisses gemäß § 30 und § 30a des Bundeszentralregistergesetzes erklären, um auch für die Aufnahme in andere Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr eventuelle, einschlägige Verurteilungen, aus denen sich Ablehnungsgründe im Sinne von § 2 Abs. 2 VOFF ergeben können, abklären zu können.Bei Aufnahme von Minderjährigen und Kindern muss feststehen, wer sorgeberechtigt ist.
3.3.3Bereitschaft für alle Tätigkeiten in einer Freiwilligen Feuerwehr
28Der Bewerber muss grundsätzlich bereit sein, alle von einer Freiwilligen Feuerwehr geforderten Tätigkeiten auszuüben. Das sind u. a.:
293.3.3.1 Abwehrende Tätigkeit. Damit sind zunächst alle Tätigkeiten gemeint, die zur Erfüllung der Aufgaben der Feuerwehr nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BHKG erforderlich sind.
Nach der genannten Vorschrift handelt es sich um:
– Bekämpfung von Schadenfeuern,
– Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden.
303.3.3.2 Vorbeugende Tätigkeit. Zum Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr gehören nach § 3 Abs. 2 BHKG auch Maßnahmen zur Verhütung von Bränden.
313.3.3.2.1 Brandsicherheitswachen. Zu den Maßnahmen zur Verhütung von Bränden zählen insbesondere Brandsicherheitswachen nach § 27 BHKG bei solchen Veranstaltungen, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen gefährdet ist.
Die Übernahme von Brandsicherheitswachen ist eine Pflicht (vgl. Anm. 3.7.2 zu § 2 VOFF), die jeder Feuerwehrangehörige zu erfüllen hat.
323.3.3.2.2 Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung. In den Bereich der Maßnahmen zur Verhütung von Bränden fallen auch alle Aktivitäten nach § 3 Abs. 5 BHKG zur Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung. Darunter ist die Aufklärung der Einwohner (Kinder und Erwachsene) über
– die Verhütung von Bränden,
– den sachgerechten Umgang mit Feuer
und
– das Verhalten bei Bränden
zu verstehen.
Auch die Mitwirkung in diesem Bereich zählt zu den Pflichten eines Feuerwehrangehörigen.
333.3.3.3 Tätigkeit bei Großeinsatzlagen/Katastrophen. Nach Aufhebung des Katastrophenschutzgesetzes NRW sind die früher darin beschriebenen Aufgaben in das BHKG integriert worden. Die Feuerwehren wirken nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 BHKG auch bei der Bewältigung von Großeinsatzlagen und Katastrophen mit. Zu den Definitionen einer Großeinsatzlage und einer Katastrophe vgl. § 1 Abs. 2 Nr. 1 und 2 BHKG.
343.3.3.4 Tätigkeit im „erweiterten“ Katastrophenschutz (Zivilschutz). Die Feuerwehren wirken auch bei den Aufgaben zum Schutz der Bevölkerung vor den besonderen Gefahren und Schäden, die im Verteidigungsfall drohen, mit. § 11 Abs. 1 Zivilschutzgesetz bestimmt dazu:
„Die nach Landesrecht im Katastrophenschutz mitwirkenden Einheiten und Einrichtungen nehmen auch die Aufgaben zum Schutz der Bevölkerung vor den besonderen Gefahren und Schäden, die im Verteidigungsfall drohen, wahr. Sie werden zu diesem Zwecke ergänzend ausgestattet und ausgebildet. Das Bundesministerium des Innern legt Art und Umfang der Ergänzung im Benehmen mit der zuständigen obersten Landesbehörde fest.“
Durch die Regelungen im Zivilschutzgesetz wird auch erkennbar, dass es nicht – wie es früher einmal war – zwei Arten von Freiwilligen Feuerwehren gibt (einmal friedensmäßiger Brandschutz, andererseits Brandschutzdienst im erweiterten Katastrophenschutz). Die Doppelgleisigkeit gibt es nicht mehr. Das bedeutet:
– Mit der Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr übernimmt der Bewerber auch die Aufgabe im Zivilschutz. Eine zusätzliche Aufnahme in den erweiterten Katastrophenschutz ist nicht erforderlich.
– Wegen der Unteilbarkeit der Aufgaben der Feuerwehr kann ein Bewerber, der nur in einem Teilbereich der vorgenannten Aufgaben tätig werden will, nicht in die Freiwillige Feuerwehr aufgenommen werden.
353.3.3.5 Tätigkeit im Rettungsdienst. Nach § 23 BHKG wirken die Feuerwehren nach Maßgabe des Gesetzes über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und Krankentransport durch Unternehmer vom 24.11.1992 (GV. NRW. 1992 Seite 458 – in der jeweils geltenden Fassung) im Rettungsdienst mit.
Auch hierbei handelt es sich um einen Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr im Sinne von § 1 BHKG.
3.4Entscheidungsbefugnis
36Über die Aufnahme entscheidet nach § 11 BHKG der Leiter der Feuerwehr, in Städten mit Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr der Leiter der Berufsfeuerwehr.
Der Leiter der Feuerwehr in kreisangehörigen Gemeinden braucht für die Entscheidung über eine Aufnahme weder das Einverständnis des Trägers des Feuerschutzes (Gemeinde) noch das des Kreisbrandmeisters.
Auch ist es nicht erforderlich, sein „Benehmen“ mit der dem Kreisbrandmeister und dem Träger des Feuerschutzes herzustellen (im „Benehmen“ bedeutet, dass Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben und eine Verständigung anzustreben ist [so OVG Münster SgE Feu § 9 I FSHG Nr. 6]).
3.5Rechtsnatur der Aufnahme
3.5.1Verwaltungsakt
37Da durch die Aufnahme Rechte und Verpflichtungen begründet werden, ist von einem gleichzeitig begünstigenden und belastenden Verwaltungsakt auszugehen (zur Einordnung als Verwaltungsakt siehe VG Gelsenkirchen, Urteil vom 11. Juli 1989 – 12 K 1098/86 –).
Der Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr wird im Kern durch die Verpflichtung, aber auch die Berechtigung zur Teilnahme an Einsätzen, Übungen und Lehrgängen geprägt (vgl. OVG NRW SgE Feu § 8 LVOFF Nr. 1).
3.5.2Öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis
38Durch die Aufnahme wird ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis zwischen dem Träger des Feuerschutzes und dem Bewerber begründet (vgl. OVG Münster SgE Feu § 8 LVOFF Nr. 1; OVG Münster SgE Feu § 9 I FSHG Nr. 1; VG Düsseldorf SgE Feu § 1 LVOFF Nr. 4).
Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen einer Freiwilligen Feuerwehr haben deswegen ihrerseits eine besondere Treuepflicht gegenüber der Gemeinde.
Andererseits trifft die Gemeinde gegenüber den Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr eine öffentlich-rechtliche Fürsorgepflicht (vgl. auch LAG Hessen SgE Feu § 6 I EFortZG Nr. 2)
Die VOFF sieht keine Mitgliedschaft auf Zeit oder eine Mitgliedschaft nur für ein bestimmtes Projekt vor. Die auf Dauer begründete Mitgliedschaft kann dann nur durch einen Austritt nach § 24 Abs. 1 Nr. 3 VOFF beendet werden.
Für einen Schaden, den ein Feuerwehrangehöriger in Ausübung dieses öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses einem Dritten zufügt, haftet grundsätzlich die Gemeinde, weil die Tätigkeit der Feuerwehr dem hoheitlichen Bereich zuzuordnen ist und eine unmittelbare Haftung des Handelnden nach § 839 BGB i. V. m. Art. 34 GG entfällt. Das gilt für den gesamten Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr (vgl. LG Aachen SgE Feu § 1 I FSHG Nr. 43), also auch für den Einsatz- und Übungsdienst (vgl. OLG Düsseldorf SgE Feu § 839 BGB Nr. 47). Zum Umfang der von der Feuerwehr zu ergreifenden Rettungsmaßnahmen bei der Brandbekämpfung vgl. OLG Stuttgart SgE Feu § 222 StGB Nr. 5.
Bei der Wahrnehmung von Aufgaben des Feuerschutzes handelt es sich um Amtspflichten, die den Gemeinden und Kreisen nicht nur gegenüber der Allgemeinheit, sondern auch gegenüber dem durch einen Verstoß gegen diese Pflichten gefährdeten Bürger obliegen (vgl. OLG Hamm SgE Feu § 839 BGB Nr. 25). Ein Grund dafür, dass in einem solchen Fall die Gemeinden die ihnen übertragenen Aufgaben allein im öffentlichen Interesse wahrnehmen, ist weder dem Wortlaut noch dem Sinn der gesetzlichen Regelung zu entnehmen (vgl. OLG Hamm SgE Feu § 4 FSHG Nr. 6). Zu Amtspflichten gegenüber Dritten vgl. auch BGH SgE Feu § 839 BGB Nr. 37.
3.5.3Verpflichtung nach Wehrpflichtgesetz
39Die Aufnahme ist zu unterscheiden von der Verpflichtung nach dem derzeit ausgesetzten § 13a Wehrpflichtgesetz (früher § 8 Abs. 2 KatSG Bund), die zu einer Wehrdienstausnahme führt. Die Freistellung vom Wehrdienst setzt vielmehr eine tatsächliche Mitwirkung in der Feuerwehr voraus, die nur nach Aufnahme in einer Feuerwehr möglich ist.
3.6Aufnahme-Bescheid
40Wird dem Antrag auf Aufnahme stattgegeben (zur Ablehnung der Aufnahme vgl. unten Anm. 8 bis 11 zu § 2 VOFF), so sollte ein mit Datum versehener Bescheid erteilt werden, damit der Beginn des oben genannten öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnisses genau fixiert wird. Dies ist z. B. für die Dienstzeitberechnung zur Verleihung des Feuerwehr-Ehrenzeichens des Landes von ausschlaggebender Bedeutung.
Die Aufnahme in den freiwilligen Feuerwehrdienst setzt – anders als im Beamtenrecht – nicht die Aushändigung einer formellen Urkunde voraus.
3.7Rechtsfolgen der Aufnahme
41Durch die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr erhält der Feuerwehrangehörige Rechte und Ansprüche (vgl. dazu Anm. 3.7.1). Andererseits werden ihm aber auch Pflichten (vgl. dazu Anm. 3.7.2) auferlegt.
Mit der Aufnahme beginnt die Probezeit nach § 6 VOFF.
3.7.1Rechte und Ansprüche
42Rechte und Ansprüche eines Feuerwehrangehörigen sind einmal im BHKG, dann im Sozialgesetzbuch Teil VII – Unfallversicherung – und der daraus abgeleiteten Unfallverhütungsvorschrift Feuerwehr (siehe Anhang 2.2) – sowie in anderen rechtlichen Vorschriften verankert.
Hier sollen nur die Wichtigsten – ggf. mit Hinweisen auf andere umfassende Kommentierungen – aufgezählt werden:
– das Nachteilsverbot im Arbeits- oder Dienstverhältnis (vgl. dazu Schneider, BHKG § 20 Anm. 5),
– das Entfallen der Pflicht zur Arbeits- oder Dienstleistung (vgl. dazu Schneider, BHKG § 20 Anm. 6),
– der Anspruch auf Lohnfortzahlung (vgl. dazu Schneider, BHKG § 21 Anm. 1),
– der Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalles für Selbständige (vgl. dazu Schneider, BHKG § 21 Anm. 9 bis 15),
– der Anspruch auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall (vgl. dazu Schneider, BHKG § 21 Anm. 4),
– der Anspruch auf Auslagenersatz (vgl. dazu Schneider, BHKG § 22 Anm. 2),
– der Anspruch auf Zahlung einer Aufwandsentschädigung (vgl. dazu Schneider, BHKG § 22 Anm. 4),
– der Anspruch auf Ersatz von Schäden (vgl. dazu Schneider, BHKG § 22 Anm. 5),
– der Unfallversicherungsschutz:
Mit der Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr wird der Feuerwehrangehörige gleichzeitig automatisch bei der Unfallkasse NRW gegen Unfallschäden aus dem Feuerwehrdienst versichert.
Voraussetzungen für ein Eintreten der Unfallkasse NRW sind:
– versicherte Person (vgl. dazu Schneider, BHKG § 22 Anm. 6.2),
– versicherte Tätigkeit (vgl. dazu Schneider, BHKG § 22 Anm. 6.3 und 6.4),
– Unfallereignis aufgrund der versicherten Tätigkeit (vgl. dazu Schneider, BHKG § 22 Anm. 6.5),
– Körperschäden als Folge des Unfallereignisses (vgl. dazu Schneider, BHKG § 22 Anm. 6.5).
Liegt ein versicherungspflichtiger Unfall vor, so werden Regelleistungen und Mehrleistungen, auf die ein gesetzlicher Anspruch besteht, gewährt (vgl. dazu Schneider, BHKG § 22 Anm. 6.6).
– der Anspruch auf persönliche Schutzausrüstung
Nach § 12 Abs. 1 der Unfallverhütungsvorschrift Feuerwehren (siehe Anhang 2.2) gehört zur persönlichen Schutzausrüstung zwingend:
1. Feuerwehrschutzanzug,
2. Feuerwehrhelm mit Nackenschutz,
3. Feuerwehrschutzhandschuhe,
4. Feuerwehrschutzschuhwerk.
Zu § 12 Abs. 1 Nr. 1 UVV
Feuerwehrschutzanzug: Feuerwehrschutzanzüge müssen den „Feuerwehrschutzkleidungs-Herstellungsrichtlinien“ des Innenministeriums des betreffenden Bundeslandes entsprechen.
Zu § 12 Abs. 1 Nr. 2 UVV
Feuerwehrhelm mit Nackenschutz: Feuerwehrhelme müssen der DIN EN 433 „Feuerwehrhelme; Anforderungen; Prüfung“ entsprechen. Gehört ein Gesichtsschutz nicht zum Feuerwehrhelm, ist dieser als Zusatzausrüstung bereitzustellen.
Zu § 12 Abs. 1 Nr. 3 UVV
Feuerwehrschutzhandschuhe: Feuerwehrschutzhandschuhe müssen den Anforderungen der DIN EN 659 entsprechen.
Zu § 12 Abs. 1 Nr. 4 UVV
Feuerwehrschutzschuhwerk: Feuerwehrschutzschuhwerk muss den Anforderungen gemäß DIN EN 345 Teil 2 (Feuerwehrsicherheitsschuhe) entsprechen.
Bei besonderen Gefahren müssen nach § 12 Abs. 2 Unfallverhütungsvorschrift Feuerwehren spezielle persönliche Schutzausrüstungen vorhanden sein, die in Art und Anzahl auf diese Gefahren abgestimmt sind.
Spezielle persönliche Schutzausrüstungen sind insbesondere:
– Feuerwehrschutzkleidung gegen erhöhte thermische Einwirkung,
– Feuerwehr-Haltegurt entsprechend DIN 14 926 „Feuerwehr-Haltegurt mit Zweidornschnalle für den Selbstrettungseinsatz – Anforderungen, Prüfung“,
– Sonderschutzkleidung wie z. B. Chemikalienschutzanzug, Hitzeschutzkleidung, Kontaminationsschutzkleidung,
– Atemschutzgerät entsprechend der Anerkennung nach landesrechtlichen Bestimmungen (aus hygienischen Gründen ist es angezeigt – wenn möglich –, jedem Feuerwehrangehörigen, der nach G 26 untersucht ist, einen eigenen Atemanschluss [Maske] zur Verfügung zu stellen),
– Feuerschutzhaube entsprechend DIN EN 13 911 „Schutzkleidung für die Feuerwehr – Anforderungen und Prüfverfahren für Feuerschutzhauben für die Feuerwehr“,
– Augen- und Gesichtsschutz entsprechend DGUV-Regel „Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz; DGUV-Regel 112 – 192“,
– Feuerwehrleine gemäß DIN 14 920 „Feuerwehrleine – Anforderungen, Prüfung, Behandlung“,
– Auftriebsmittel wie Rettungskragen und Schwimmwesten entsprechend DIN EN 399 „Rettungskragen und Schwimmhilfen“,
– Tauchausrüstung entsprechend der Anerkennung nach landesrechtlichen Bestimmungen,
– Gehörschutzmittel entsprechend DIN EN 352 Teil 1 „Gehörschützer; Sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfung“.
Für Angehörige der Jugendfeuerwehr sind vorzuhalten:
– ein Anzug nach landesrechtlichen Regelungen,
– ein Schutzhelm entsprechend DIN EN 397 „Industrieschutzhelme“ (vergleiche auch DGUV-Regel „Benutzung von Kopfschutz“ DGUV-Regel 112 – 193),
– Sicherheitsschuhe entsprechend DIN EN 345 Teil 1 bis DIN EN 345 Teil 2 sowie
– Schutzhandschuhe.
– Ehrung
(1) staatliche Ehrungen
Verdienste im Feuerwehrwesen können bundesseitig durch Verleihung der verschiedenen Stufen des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland gewürdigt werden.
Landesseitig ist von folgender Regelung auszugehen:
Durch Gesetz vom 2.2.2016 (GV. NRW. 2016 S. 90), hat das Land ein Feuerwehr-Ehrenzeichen gestiftet. Dieses wird in drei Stufen verliehen. Angehörige der freiwilligen Feuerwehren sowie der Berufs- und Werkfeuerwehren sowie Bedienstete, die einer Laufbahn des feuerwehrtechnischen Dienstes angehören, können mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber, Gold oder Gold mit Goldkranz ausgezeichnet werden, wenn sie mindestens 25, 35 oder 50 Jahre lang aktiv in einer Feuerwehr pflichttreu ihren Dienst getan haben.
Für besonders mutiges und entschlossenes Verhalten im Einsatz unter erheblicher Gefahr für das eigene Leben oder die körperliche Unversehrtheit können Feuerwehrangehörige mit dem Feuerwehr- und Katastrophenschutz-Ehrenzeichen ausgezeichnet werden. Zur Anerkennung und Würdigung von Verdiensten auf dem Gebiet des Brandschutzes oder des Katastrophenschutzes ist ein Brand- und Katastrophenschutz-Verdienst- Ehrenzeichen gestiftet worden. Es kann in Silber für herausragende Verdienste im Brand- oder Katastrophenschutz oder in Gold für überragende Verdienste durch Tätigkeiten, die zu einer wesentlichen Verbesserung des Brand- und Katastrophenschutzes beigetragen haben, verliehen werden. Zur Anerkennung und Würdigung der Teilnahme an einem besonderen Einsatz ist eine Feuerwehr- und Katastrophenschutz-Einsatzmedaille gestiftet worden.
Die jeweilige Auszeichnung wird in der Regel durch den Dienstherrn ausgehändigt.
(2) verbandliche Ehrungen
Für die 10-, 40-, 50-, 60-, 70-, 75- und 80-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr hat der VdF NRW eine besondere Ehrung vorgesehen.
Eine Würdigung besonderer Verdienste um den VdF NRW kann durch die Verleihung von mehreren Stufen des Feuerschutzehrenkreuzes erfolgen.
Verdienste in der Jugendfeuerwehr können durch Ehrungen auf Bundes- und Landesebene von den Feuerwehrverbänden gewürdigt werden.
Hiervon zu unterscheiden ist die Verleihung des vom Bundespräsidenten gestifteten und vom Präsidenten des Deutschen Feuerwehrverbandes zu vergebenden Feuerwehrehrenkreuzes in Bronze, Silber oder Gold.
Antragsteller hierfür sind die Kreis- bzw. Stadtfeuerwehrverbände. Die Auszeichnung wird von den Vertretern der Feuerwehrverbände ausgehändigt.
– Der strafrechtliche Schutzanspruch:
Der Schutz der § 113 StGB (Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte), § 114 StGB (Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte), § 115 Absatz 3 StGB (Behinderung oder tätlicher Angriff auf Hilfeleistende) und § 323c StGB (Behinderung von hilfeleistenden Personen) gilt auch für Feuerwehrangehörige.
– Der polizeiliche Schutzanspruch:
Die Polizei ist verpflichtet, allen Angehörigen der Feuerwehren auf Ersuchen persönlichen Schutz zu gewähren, falls dies mit Rücksicht auf geleisteten oder zu erwartenden Widerstand erforderlich ist.
– Der psychologische Schutzanspruch:
Jeder Feuerwehrangehörige hat gegenüber seinem Dienstherrn auch einen Anspruch auf Unterstützung bei der Bewältigung von psychischen Belastungen aus dem Feuerwehreinsatz (vgl. dazu u. a. Happersberger in vfdb-Zeitschrift Heft 3/2001 Seite 111 ff.; Schneider, BHKG § 3 Anm. 3.1.9).
3.7.2Pflichten
43Mit der Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr treffen den Feuerwehrangehörigen auch einige Pflichten. Nachfolgend werden einige Pflichten aufgeführt, die der Feuerwehr-angehörige nach Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr zu erfüllen hat. Vergleiche auch die Anm. zu §§ 12 und 13 VOFF. Die nachfolgende Aufzählung ist nur beispielhaft:
– Unverzügliche Teilnahme an Einsätzen,
– Übernahme von Brandsicherheitswachen,
– Übernahme von Aufgaben in der Brandschutzerziehung und –aufklärung,
– Regelmäßige und pünktliche Teilnahme an Ausbildungsveranstaltungen (Dienstabende, Übungen),
– Teilnahme an sonstigen Veranstaltungen auf Anforderung des Leiters der Feuerwehr,
– Teilnahme an sonstigen dienstlichen Veranstaltungen,
– Bereitschaft zur Aus- und Fortbildung (auch Lehrgänge),
– Beachtung aller Unfallverhütungsvorschriften der Unfallkasse NRW (siehe u. a. dazu Anhang 2),
– Tragen der Dienstkleidung,
– Gehorsam gegenüber Vorgesetzten (vgl. dazu auch Anm. 4.2.1 und 4.2.3 zu § 12 VOFF),
– Verschwiegenheitspflicht (vgl. dazu auch Anm. 6 zu § 12 VOFF),
– Pflege der persönlichen Ausrüstung, der Fahrzeuge, sonstiger Geräte (z. B. von überlassenen Funkmeldeempfängern) und Gerätehäuser,
– Kameradschaftliches Verhalten zu allen übrigen Feuerwehrangehörigen (vgl. dazu auch Anm. 4.2.4 zu § 12 VOFF),
– Beachtung von Weisungen und Anordnungen (z. B. Feuerwehrdienstvorschriften [FwDV], Gefahrenerlasse).
Feuerwehrdienstvorschriften sind allgemeine Weisungen im Sinne des § 54 Abs. 3 BHKG.
Bisher sind folgende FwDV erlassen worden:
1 = Grundtätigkeiten (Stand September 2006)
2 = Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren (Stand Januar 2012)
3 = Einheiten im Löscheinsatz (Stand Februar 2008)
7 = Atemschutz (Stand Mai 2006)
8 = Tauchen (Stand August 2004)
10 = Die tragbaren Leitern (Stand 1996)
100 = Führung und Leitung im Einsatz-Führungssystem (Stand 1999)
500 = Einheiten im ABC-Einsatz (Stand Januar 2012)
Die DV 800 „Fernmeldeeinsatz“ ist durch Ziffer 3.4.4 der FwDV 100 ebenfalls für den Feuerwehrbereich verbindlich. Sie soll demnächst in NRW als FwDV/DV 800 gesondert eingeführt werden.
Die Dienstvorschrift für den Fernmeldebetriebsdienst mit Ergänzungen für den Katastrophenschutz PDV/DV 810 bleibt als PDV/DV 810.3 voll gültig (siehe Steegmann Anhang 667). Vgl. auch BOS-Funkrichtlinie vom 12.9.2006 (MBl. NRW. 2007 Seite 3).
Durch Anlage 6 der FwDV 100 sind die Grundzüge der DV 102 „Taktische Zeichen“ ebenfalls für NRW eingeführt.
Folgende Gefahrenerlasse des Innenministeriums sind, auch wenn sie teilweise formell nicht mehr gelten, inhaltlich zu beachten:
vom 10.4.1990:
Brandeinsätze, bei denen mit der Möglichkeit der Entstehung von Dioxinen und Furanen zu rechnen ist
vom 30.1.1981:
Maßnahmen beim Austreten von Mineralölen und sonstigen wassergefährdenden Stoffen – Öl- und Giftalarmrichtlinien – (siehe Steegmann Anhang 20)
vom 17.12.1986:
Gefahrinformationen in den Bereichen Wasser und Abfall (MBl. NRW. 1986 S. 150)
vom 24.7.1962:
Unfälle und Brände von Tankwagen, Kesselwagen und Tankschiffen (siehe Steegmann Anhang 23)
vom 25.7.1979:
Einsätze an elektrisch betriebenen Strecken der Bundesbahn (siehe Steegmann Anhang 10)
vom 6.9.1991:
Einsatz der Feuerwehr und des Rettungsdienstes bei Abstürzen/Notlandungen von Militärflugzeugen (siehe Steegmann Anhang 635)
vom 4.1.1988:
Zusammenarbeit der Forstbehörden mit den Feuerwehren und Katastrophenschutzbehörden (siehe Steegmann Anhang 631)
vom 20.3.2017:
Gefahrenabwehr in der Umgebung von Anlagen zur Lagerung brennbarer Gase
vom 19.3.1987:
Flüssiggas-Sicherheitsdienst
vom 15.12.1998:
Acetylenflaschen-Explosionen (Steegmann Anhang 6)
vom 31.5.2001:
Empfehlungen für den Einsatz der Feuerwehren bei Gefahren durch Chlorgas (MBl. NRW. 2001 Seite 903)
Darüber hinaus sind alle Weisungen der Aufsichtsbehörden nach § 54 BHKG zu beachten. Dabei macht es keinen Unterschied, ob es sich um Weisungen zur gesetzmäßigen oder Weisungen zur zweckmäßigen Erfüllung der Aufgaben handelt.
Zu den Pflichten der Feuerwehrangehörigen gehört es auch, den Anordnungen des Leiters der Feuerwehr, die er als Vorgesetzter (vgl. dazu § 9 Abs. 1 S. 2 BHKG) erlässt, Folge zu leisten. Weiterhin sind sie verpflichtet, ihre Vorgesetzten zu beraten und zu unterstützen.
Pflicht der Vorgesetzten ist es, ihre Dienstaufsicht wahrzunehmen. Sie müssen sich deswegen über das Verhalten ihrer Feuerwehrangehörigen unterrichten.
Die Vorgesetzten sind darüber hinaus im Umgang mit den Feuerwehrangehörigen zu einem korrekten, achtungswürdigen und vertrauenswürdigen Auftreten verpflichtet.
Andererseits müssen sie nach pflichtgemäßem Ermessen die notwendigen Entscheidungen und Maßnahmen treffen (vgl. dazu auch BVerwG NJW 2001 Seite 2343).
Vorsätzliche Verstöße gegen Dienstvorschriften und vorsätzliches Nichtbeachten von Anordnungen sowie Nachlässigkeit im Dienst können gemäß § 21 Abs. 1 VOFF als Dienstvergehen geahndet werden. Zu weiteren Einzelheiten vgl. die Anm. zu § 21 VOFF.
3.8Übernahme
44Von der Aufnahme in den Dienst der Freiwilligen Feuerwehr ist begrifflich
– die Übernahme aus der Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst der Freiwilligen Feuerwehr nach § 11 Abs. 2 VOFF
und
– die Übernahme aus anderen Freiwilligen Feuerwehren nach § 4 Abs. 1 VOFF zu unterscheiden.
Beide Übernahmen setzen nämlich voraus, dass bereits eine Mitgliedschaft in einer Freiwilligen Feuerwehr vorliegt.
Zu den Voraussetzungen und rechtlichen Folgen der genannten Übernahmen vergleiche die Anm. zu § 4 Abs. 1 und § 11 Abs. 2 VOFF.
4.Verwendungsentscheidung
4.1Allgemeine Verwendungsentscheidung
45, 46Nach § 2 Abs. 1 S. 2 VOFF entscheidet der Leiter der Feuerwehr über die Verwendung der Angehörigen innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr.
Zuweisungsvorschriften befinden sich
– für Angehörige der Kinderfeuerwehr in § 13 Abs. 2 BHKG und in § 11 Abs. 1 Nr. 1 VOFF,
– für Angehörige der Jugendfeuerwehr in § 13 Abs. 1 BHKG und in § 11 Abs. 2 Nr. 2 VOFF,
– für Angehörige der Einsatzabteilung in § 9 Abs. 1 BHKG und in § 8 VOFF,
– für Angehörige der Unterstützungsabteilung in § 9 Abs. 2 BHKG und in § 10 VOFF,
– für Fachberater in § 10 Abs. 2 VOFF.
4.2„Reaktivierung“ ausgeschiedener Feuerwehrangehöriger
47Die Norm gilt auch für nach altem Recht aus der Einsatzabteilung bereits ausgeschiedene Feuerwehrangehörige. Die Initiative für die „Reaktivierung“ muss hier allerdings vom Feuerwehrangehörigen ausgehen. Eine automatische „Reaktivierung“ sieht die VOFF nicht vor.
Die Wiederverwendung in der Einsatzabteilung erfolgt nach einer Einzelfallentscheidung des Leiters der Feuerwehr und bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen.
5.Beförderung
5.1Regelung im BHKG
48Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr werden nach § 9 Abs. 1 S. 2 BHKG durch den Leiter der Feuerwehr befördert; der Leiter der Feuerwehr ist zugleich Vorgesetzter.
5.2Regelung in VOFF
5.2.1Grundsatz
49§ 2 Abs. 1 S. 2 VOFF wiederholt insoweit nur die Regelung des BHKG in seinem § 9 Abs. 2 S. 1.
Die Beförderung kann sich nur auf die ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr beziehen.
Für Beförderungen von Beamten und Angestellten im feuerwehrtechnischen Dienst ist nicht der Leiter der Feuerwehr sondern der öffentlich-rechtliche Dienstherr zuständig.
5.2.2Einzelheiten
50Die VOFF widmet den Beförderungen einen eigenen Paragrafen und zwei Anlagen. Zu weiteren Einzelheiten siehe deshalb die Anm. zu § 14 VOFF.
6.Entlassung
6.1Regelung im BHKG
51Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr werden nach § 9 Abs. 1 S. 2 BHKG durch den Leiter der Feuerwehr entlassen; der Leiter der Feuerwehr ist zugleich Vorgesetzter.
6.2Regelung in VOFF
6.2.1Grundsatz
52Der Text der VOFF wiederholt insoweit nur die Regelung des § 9 Abs. 1 BHKG.
Die Entlassung kann sich nur auf ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr beziehen.
Für Entlassungen von Beamten und Angestellten im feuerwehrtechnischen Dienst ist nicht der Leiter der Feuerwehr, sondern der öffentlich-rechtliche Dienstherr zuständig.
6.2.2Entlassungsgründe
53Eine Entlassung hat der Leiter der Feuerwehr auszusprechen, wenn
– der ehrenamtliche Feuerwehrangehörige diese beantragt.
Man spricht dann von einem Austritt.
– der ehrenamtliche Feuerwehrangehörige schwere Dienstvergehen im Sinne von § 21 Abs. 2 VOFF begangen hat.
Man spricht dann von einem Ausschluss.
– Das Nicht-Bestehender Probezeit führt nach § 6 Abs. 2 VOFF ebenfalls zur Entlassung.
6.2.3Einzelheiten
54Zum Austritt vergleiche die Anm. 3 zu § 24 VOFF.
Zum Ausschluss vergleiche die Anm. 4 zu § 24 VOFF.
Zum Nicht-Bestehen der Probezeit vergleiche die Anm. 8 zu § 6 VOFF.
7.Kein Anspruch auf Aufnahme
55Nach § 2 Abs. 2 S. 1 VOFF besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr (a. A. VG Düsseldorf SgE Feu § 1 LVOFF Nr. 1).
8.Ablehnungsgründe
8.1Grundsatz
56Die Ablehnung von Bewerbern ist nur rechtmäßig, wenn nachvollziehbare und berechtigte Gründe vorliegen. Das Grundgesetz verlangt, dass jeder nach Maßgabe von Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung zumindest einen Rechtsanspruch auf eine sogenannte ermessensfehlerfreie Entscheidung über einen Antrag auf Aufnahme in eine Freiwillige Feuerwehr besitzt (vgl. auch Müssig, a.a.O, Seite 85).
Liegt aber kein Ablehnungsgrund vor, so reduziert sich die Ermessensentscheidung in der Regel auf Null.
8.2Ablehnungsgründe
57§ 2 Abs. 2 S. 2 VOFF zählt folgende Ablehnungsgründe auf:
– fehlende Eignung (vgl. dazu Anm. 9 zu § 2 VOFF),
– tatsächliche Anhaltspunkte für eine fehlende Bereitschaft zur Erfüllung der Voraussetzungen nach § 12 VOFF (vgl. dazu Anm. 10 zu § 2 VOFF),
– anderer wichtiger Grund (vgl. dazu Anm. 11 zu § 2 VOFF).
8.3Ablehnung der Aufnahme ohne Entscheidungsspielraum
58Der Leiter der Feuerwehr ist, wenn einer der in § 2 Abs. 2 S. 1 VOFF genannten Ablehnungsgründe vorliegt, zur Ablehnung der Aufnahme sachlich befugt und verpflichtet, ohne dass ihm ein Entscheidungsspielraum eingeräumt ist (vgl. OVG NRW SgE Feu § 1 IV LVO FF Nr. 3).
8.4Verwaltungsakt
59Die Ablehnung eines Bewerbers ist ein Verwaltungsakt. Dagegen kann – ohne die Durchführung eines vorherigen Widerspruchverfahrens (vgl. dazu § 110 Justizgesetz NRW vom 26.1.2010 – in der jeweils geltenden Fassung –) Klage vor dem Verwaltungsgericht erhoben werden. Die Klage muss sich gegen die Gemeinde (Oberbürgermeister/Bürgermeister) richten (vgl. OVG NRW SgE Feu § 78 I VwGO Nr. 1).
8.5Folgen bei Nichtvorliegen der Aufnahme-Voraussetzungen
60Wird eine Person in den Feuerwehrdienst aufgenommen, obwohl die Voraussetzungen einer Aufnahme nicht vorliegen, so kommt nur ein Widerruf oder eine Rücknahme des Aufnahmebescheids in Betracht. Ein Ausschluss ist dann nicht möglich (vgl. AG Ansbach SgE Feu Art. 6 IV Bay. FwG Nr. 1).
9.Fehlende Eignung
9.1Geltung für alle Abteilungen der Feuerwehr
61Eine fehlende Eignung muss bezogen auf die einzelnen Abteilungen der Feuerwehr (siehe § 1 VOFF) festgestellt werden.
9.2Geistige Eignung
62Da im Feuerwehrdienst schnelle Entscheidungen in kritischen Situationen gefordert werden, von denen der Schutz von Menschenleben und von erheblichen Sachwerten abhängig ist, ist von den ehrenamtlichen Angehörigen eine geistige Wendigkeit zu erwarten.
Die Aufgabe der Feuerwehren, oftmals in Extremsituationen unter innerer eigener und äußerer Stressbelastung Entscheidungen von großer, ausschlaggebender Bedeutung treffen zu müssen, erfordert von allen ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen eine große psychische Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit.
Trotz der Freiwilligkeit ergibt sich für die Angehörigen einer Freiwilligen Feuerwehr aufgrund der besonderen Eigenart der Tätigkeit und den damit typischerweise verbundenen Gefahrensituationen auch eine Verpflichtung zum Einsatz des eigenen Lebens (vgl. LSG Niedersachsen SgE Feu § 9 I FSHG Nr. 20). Die geistige Verarbeitung dieser Verpflichtung und die daraus zu fordernde innere Bereitschaft zu dem Feuerwehrdienst erfordert darüber hinaus eine besondere geistige Aufgeschlossenheit.
Die Freiwilligkeit schließt auch ein, dass man sich der Erfüllung von freiwillig übernommenen Pflichten (z. B.: Pflicht zum Gehorsam, Pflicht zur Befolgung von Anordnungen im gesamten Feuerwehrdienst) unterwirft. Auch dies bedarf einer geistigen, inneren Bereitschaft, die von den Vorgesetzten ständig zu hinterfragen ist.
Zur geistigen Eignung muss bei freiwillig tätigen Feuerwehrangehörigen noch die charakterliche Zuverlässigkeit hinzutreten. Diese umfasst zum einen die – innere – Bereitschaft, zusammen mit gleichgesinnten Kameradinnen und Kameraden gegebenenfalls Leben und Gesundheit zu opfern, um andere Menschen zu retten. Weiterhin muss die Bereitschaft hinzukommen, in kritischen Situationen für sich selbst und die betroffenen Personen Verantwortung zu übernehmen. Schließlich ist dringend erforderlich, dass die genannte Tätigkeit in der Feuerwehr von uneigennütziger Kameradschaft getragen wird. Diese Pflicht zur uneigennützigen Kameradschaft findet auch ihre rechtliche Begründung in § 21 Abs. 2 Nr. 3 VOFF, der vorsätzliche Straftaten (welche Straftaten hiermit gemeint sind vgl. Anm. 10 zu § 21 VOFF) gegen andere Feuerwehrangehörige als besonders schwere Dienstvergehen ansieht. Wer in der vorgesehenen Weise gegen Kameraden handelt, besitzt nicht die für den Feuerwehrdienst erforderliche charakterliche Zuverlässigkeit.
Aus § 21 Abs. 2 Nr. 2 VOFF ist zu folgern, dass der Bewerber für den aktiven Feuerwehrdienst auch über eine besondere Vertrauenswürdigkeit verfügen muss.