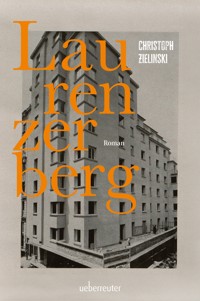
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Ueberreuter Verlag GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Roman von Christoph Zielinski erzählt die eindringlich die Geschichte von Emigranten, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem kommunistischen Polen fliehen und in Wien in eine für sie fremde, feindselige Welt gelangen. Am Beispiel von Wacek und seiner Frau Ophelia, genannt Fela, wird der innere Konflikt zwischen der Sehnsucht nach der alten Heimat und der Hoffnung auf ein besseres Leben in der neuen Welt spürbar. Ein eindrucksvoller Roman über Migration, Einsamkeit und die Suche nach einem Platz in einer fremden Welt. »Als Nachfahre von Menschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus einem diktatorischen Regime in ein für sie fremdes Land emigriert oder geflohen sind, war es mir ein Anliegen, mich in einem Roman mit ihrem Schicksal auseinanderzusetzen.« (Christoph Zielinski)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Danke, dass Sie sich für unser Buch entschieden haben!
Sie wollen mehr über uns & unsere Bücher erfahren, überunser Programm auf em Laufenden bleiben sowie über Neuigkeiten und Gewinnspiele informiert werden?
Folgen Sie
auch auf Social Media
& abonnieren Sie unseren Newsletter
Über das Buch
Wacek und seine Frau Ophelia, jüdische Emigranten, die aus dem kommunistischen Polen geflohen sind, beginnen im Österreich der 1960er-Jahre zusammen mit ihrem kleinen Sohn ein neues Leben. Zwischen Alltag, Kaffeehausbesuchen und Ausflügen auf den Semmering bleibt die Fremdheit in ihnen allgegenwärtig.
In einer Gesellschaft, die ihre Vergangenheit nicht überwunden hat, kämpfen sie um Heimat und gegen das Gefühl der Verlorenheit.
Ein eindrucksvoller Roman über Migration, Einsamkeit und die Suche nach einem Platz in einer fremden Welt.
„Als Nachfahre von Menschen, die nach dem ZweitenWeltkrieg aus einem diktatorischen Regime in ein fürsie fremdes Land emigriert oder geflohen sind, war esmir ein Anliegen, mich in einem Roman mit ihremSchicksal auseinanderzusetzen.“
Christoph Zielinski
Obwohl sich die in dem vorliegenden Text geschilderten Geschehnisse so oder so ähnlich zugetragen haben mögen, sind Ähnlichkeiten der dargestellten Personen mit lebenden oder verstorbenen Menschen rein zufällig und lagen nicht in der Absicht des Autors.
Inhalt
Vorwort
1. Laurenzerberg
2. Rosenberg und das Gefängnis
3. Rosenberg entschließt sich zur Weiterreise
4. Rosenberg sucht die amerikanische Botschaft auf und will seinen Namen ändern
5. Die Fahrt auf den Semmering ins Südbahnhotel
6. Mittagessen mit Bierwärmer
7. Der Professor und das Bridgespiel
8. Am Abend des Jom Kippur Kaffee mit großem Schlagobersgupf
9. Rückkehr
10. Eine Karte von Rosenberg, der jetzt Rose heißt
11. Schoschana im Hotel Wandl und in der Telefonzelle am Fleischmarkt
12. Der Besuch beim Professor
13. Die Fahrt im schwarzen Opel Kapitän
14. Allerheiligen und Allerseelen
15. Die Adoption
16. Wacek und Fela spazieren durch den Prater
17. Im Café Gerstner
18. Der Film im Fernsehen und die Schüsse
19. Der Reisepass
20. Das Paket
21. Susi und Szymons Nebenbuhler
22. Hochzeitsvorbereitungen
23. Rosalia fährt von Krakau nach Wien
24. Eine Karte aus Tel Aviv
25. Essen am Sonntag im Restaurant „zur Linde“
26. Die Hochzeit
27. Beim Herzspezialisten
28. Nach dem Krieg
29. Rosalia fährt nach Krakau zurück
30. Die Reisenden
31. Der Akzent des Kindes und die Ankunft Titos
32. Die Verehrer
33. Die verstummende Stimme im Radio
34. Anruf von Rosenberg (jetzt Rose)
35. Die Sesselbezüge
36. Richard kommt von der Schule nach Hause und trifft einen Freund aus dem 2. Bezirk
37. Wieder im Hotel Wandl
38. Kauf einer Uhr der Marke Doxa bei Herrn Edelstein
39. Die Fahrt mit der Rettung
40. Abendessen in der Roten Bar
41. Das Attentat
42. Das verlorene Kind
43. Das Plakat
44. Filip schreibt einen Brief aus Tel Aviv an Richard
45. Wieder im Café Gerstner, diesmal zwei Frauen
46. Wacek und Fred gehen in der Prater Hauptallee spazieren
Nachwort
Vorwort
Der vorliegende Roman schildert die Schicksale von jüdischen Emigranten aus Polen nach Österreich in den 1960er-Jahren. Obwohl die Schicksale aufgrund einer gemeinsamen Geschichte miteinander verflochten sind, so ist doch jeder allein in seinem Versuch, in einem Land, das den Nationalsozialismus noch nicht überwunden hat, Fuß zu fassen, während die alte Heimat immer fremder wird.
Die Personen, die im Roman vorkommen, sind dem Autor alle begegnet, wenn auch nicht in ihrer singulären Identität, sondern als mehrere Charaktere, die im Buch zusammenfließen. Daraus ist die Bemühung entstanden, unter dem Eindruck der Erlebnisse des relativ kurz zurückliegenden Kriegs das Verlorensein in einer neuen Welt in Relation zum Verlust der alten zu setzen.
1. Laurenzerberg
„Komm sofort“, sagte seine Cousine Ada am Telefon, „es ist etwas Fürchterliches passiert!“
Auf Nachfrage: „Blut im Stuhl, die ganze Klomuschel ist voll damit“, sagte Ada, und dass Wacek sofort, „Ja, sofort!“ kommen müsse.
Wacek lief also so schnell er konnte, und das rasche Gehen ließ ihn in dem dicken, aus Polen mitgebrachten Mantel schwitzen, denn mit Krebs – Ada nannte ihn immer „jene Krankheit“ – war nicht zu spaßen. Manchmal ging Wacek rasch, dann lief er wieder. Auch wenn er sich der Gefühle gegenüber seiner Cousine immer unsicher gewesen war, aber es gehörte sich jetzt, dass er sich beeilte.
Im Laufen in Richtung des Laurenzerbergs dachte er daran, dass sein Vater, den sie im Juli 1941 in einem Ort unweit von Lemberg erschlagen hatten, zwei Brüder gehabt hätte und Ada die Tochter des ältesten Bruders war, was den Altersunterschied zwischen ihr und Wacek, der der Sohn des jüngsten Bruders war, erklärte.
Dann dachte er daran, dass er ihretwegen nach Wien gekommen wäre, denn in der Welt gab es eben nur sie, die viel ältere Cousine, auch wenn er sie damals kaum gekannt hatte. Blut wäre eben „dicker als Wasser“, hatte er zu seiner Frau Ophelia, die alle Fela nannten, gesagt, als sie in Krakau an die Ausreise dachten und daran, den alle unterdrückenden Kommunisten zu entgehen.
„Jetzt oder nie“, hatte Wacek gesagt, denn man müsste die Zeiten des „Tauwetters“, das Chruschtschow nach der Entlarvung von Stalin und seiner grauenhaften Taten in der UdSSR und allen ihren Satellitenstaaten ausgerufen hatte, nützen, um auszureisen, was bis dahin nicht möglich gewesen war.
„Nicht zu fliehen, sondern auszureisen – das ist schließlich ein Unterschied“, sagte Wacek zu Fela und sie schwieg, weil sie sich vor dem fremden Land mehr fürchtete als vor den polnischen Kommunisten, die sie nicht mochte, ja verabscheute, und sich dennoch an sie gewöhnt hatte.
In diesen Gedanken lief Wacek über die immer städtischer werdende Praterstraße, am Kino vorbei, wo der Film „Ewig rauschen die Wälder“ auf einem dunkelgrünen Plakat mit viel Wald im Hintergrund angepriesen wurde, vorbei am Spielwarengeschäft und über den Donaukanal, über den Schwedenplatz und schließlich den Laurenzerberg hinauf, der sich etwas hinanzog und nicht umsonst das Wort „Berg“ in der Adresse trug.
An der Nummer drei und etwa in der Mitte zwischen Schwedenplatz und Fleischmarkt blieb Wacek stehen, lief vor Anstrengung und wegen des zu dicken Mantels schwitzend den schmalen Gang des Mietshauses in den ersten Stock hinauf, wo Ada seit dem Telefonat an der offenen Tür gewartet hatte.
„Ein großes Unglück“, sagte Ada, führte ihn zur Toilette: „Ich werde dir zeigen, was geschehen ist“, und sagte: „Ich werde jetzt wohl sterben. Nicht sehr jung, aber jung“, denn es wäre nach ihrem Gefühl für sie noch nicht an der Zeit zu sterben.
Sie führte ihn zur Muschel, wo ihr Stuhl in einer roten dünnen Flüssigkeit schwamm, und zeigte darauf: „Bitte …“ Und: „Ein großes Unglück. Alles voller Blut.“
Sie lief ins Wohnzimmer, wo sie sich an den Tisch auf einen der mit blauem Samt bezogenen hohen Sessel setzte, ihr Gesicht in ihre Hände stützte und weinte und schrie, dass sie noch nicht sterben wolle, aber jetzt wohl würde sterben müssen.
Ada sagte, als Wacek ins Zimmer trat und sie ihn aus verweinten Augen ansah: „Was hilft das Wollen, wenn es sein muss, und es so geschrieben steht.“ Und dann: „Es steht eben so geschrieben. Geschrieben“, und dann weinte sie weiter.
Wacek setzte sich zu ihr, meinte, dass er kein Arzt wäre, aber Blut sähe wohl anders aus, viel dicker, viel dunkler, aber dass man ja niemals die Wahrheit wüsste. Nicht, bevor sie nicht durch Untersuchungen und Beweise erhärtet worden wäre. Er wiederholte es, um sie und sich selbst zu beruhigen, und sagte, dass man niemals etwas wirklich wissen würde.
Er versuchte, sich selbst zu überzeugen, dass das Offensichtliche nicht offensichtlich wäre, weil er von Ada und ihrem Mann Szymon abhängig war, nachdem er seit der Emigration in Szymons Firma arbeitete und nicht sicher sein konnte, wie Szymon mit ihm, der er der Cousin Adas war, nach ihrem Tod, der jetzt derart unerwartet möglich erschien, verfahren würde.
„Ein großes Unglück“, sagte Ada und ging zum Telefon, das gerade läutete, und rief hinein: „Ein großes Unglück, ein Unglück!“, während Wacek noch an ihren Stuhl und die ihn umgebende rote Flüssigkeit dachte, und Ada ihrer Freundin Mia, die am Telefon war, das ganze Unglück beschrieb und am Schluss sagte, dass sie jetzt sicher sterben werde müssen, denn offenbar stünde es so geschrieben. „Bald, wohl sehr bald, werde ich sterben müssen, denn man kennt die Verläufe ja bei ‚jener Krankheit.‘“
Dann legte Ada den Telefonhörer auf, setzte sich, fing wieder an zu weinen, und weinte und weinte und ließ sich weder von Wacek, der sich in der großen und beinahe luxuriösen Wohnung fremd fühlte und deshalb kleinlaut war, noch von der Haushälterin Julyi, die wegen des lauten Schluchzens herbeigeeilt war, beruhigen.
Langsam, nur ganz langsam, hörte Ada zu weinen auf, während Wacek, neben ihr sitzend, ihre linke Hand, und Julyi im Stehen – denn sie hätte sich nie erlaubt, am Esstisch der Herrschaften zu sitzen – ihre rechte Hand hielt.
Nach einer Weile sagte Ada: „Was soll man jetzt tun? Wohin und zu wem gehen?“ und Wacek empfahl einen sehr erfahrenen Spezialisten, denn jemand anderer könnte es in dieser schwierigen Situation nicht sein.
Julyi ging wieder in die Küche, räumte den kleinen Balkon, der in den Hinterhof ging, zusammen, wo wegen des nur kleinen, in der Küche stehenden Eiskastens, zu dem Ada „Frigidaire“ sagte, Speisen und Flaschen aufgehoben wurden, und lärmte dabei laut, als mit plötzlichem und krachendem Geklirr ein großes Stück Glas zu Boden fiel und zerbrach. Julyi erschrak nicht nur wegen des lauten Geräuschs, sondern auch, weil sie noch nie etwas in der Wohnung kaputt gemacht hatte, kam aber bald ins Esszimmer gelaufen, um sich bei Ada zu entschuldigen.
Ada sah sie aus den noch immer verweinten Augen an, sprang auf und ihre dunkelbraun gefärbten Haare, die am Scheitel grauen Nachwuchs sehen ließen, wippten auf dem vor Erregung zitternden Kopf.
Ada wollte wegen des Schadens zu schimpfen beginnen, aber Julyi mit ihren rötlichen, in kleine Wellen gelegten, schütteren Haaren, zwischen denen die weiße Kopfhaut sichtbar war, in ihrer weißen geplätteten Schürze, die sich über den Oberkörper zog und deren obere Bänder nach hinten gebunden am Rücken in einen undefinierbaren Knoten mündeten, der täglich anders aussah, ihren hochgeschnürten braunen Schuhen, an denen ihre missgebildeten Zehen große Wülste bildeten, sah so verzagt drein, dass Adas Wut nicht oder nur langsam über sie kommen konnte, und sie mit bebender Stimme, die nur mühsam ihre Aufregung verbarg, sagte: „Julyi, was ist geschehen? Was hast du kaputt gemacht? Was ist zerbrochen?“
„Es war das Glas mit den Roten Rüben“, sagte Julyi mit ihrem ungarischen Akzent, „mit den Rüben vom Essen zu Mittag von gestern. Es ist mir aus der Hand gefallen, weil es noch vom roten und etwas süßen Saft der Rüben glitschig war. Anderes Mal war nicht mehr viel an Rüben drin.“
„Das Glas mit den Roten Rüben von gestern?“, fragte Ada.
„Ja, die Roten Rüben“, sagte Julyi, „nicht mehr viele gewesen, alle gestern aufgegessen. Anderes Mal: Um das Glas ist es auch nicht schade, war alt und oben ausgebrochen. Ich werde alles schön wegputzen. Wird kein Spur bleiben.“
„Ihr habt gestern Rote Rüben gegessen?“, fragte Wacek.
„Ja“, sagte Ada, „zu Mittag, denn Szymon kommt ja immer zu Mittag von der Firma nach Hause. Ist ja nicht weit. Da will er immer ein Mittagessen haben und nachher legt er sich schlafen.“
„Dann waren es vielleicht die Roten Rüben mit ihrer roten Farbe, die den Stuhl so verfärbt haben?“, fragte Wacek und schwitzte immer mehr, weil ihn das Thema und seine weinende Cousine in der für ihn fremden, überladenen Wohnung immer mehr anstrengten.
Da sprang Ada vom Sessel auf, umarmte den verschwitzten Mann von hinten und sagte: „Gerettet, für dieses Mal gerettet! Ja, es müssen die Roten Rüben gewesen sein.“
Und dann: „Ja, es waren die Roten Rüben“, tanzte durchs Zimmer, „die Roten Rüben waren es, die Roten Rüben, und ‚jene Krankheit‘ kann warten.“ Und dann: „Es steht nämlich gar nichts geschrieben, nicht für dieses Mal.“
Ada lachte, lief zum Telefon, rief Mia an, rief ins Telefon: „Es waren die Roten Rüben!“ Und: „Nichts steht geschrieben, nicht für dieses Mal, es waren die Roten Rüben“, und legte den Telefonhörer auf.
Dann ging Ada auf den kleinen Balkon hinaus und sagte zu Julyi: „Und dass ja keine Spur zurückbleibt – wie sieht das sonst aus ...? Wir sind ja keine armen Leute“, und Julyi nickte.
2. Rosenberg und das Gefängnis
„Fünf Jahre Gefängnis haben sie mir gegeben, weil ich versucht hätte, Litauen von der Sowjetunion abzutrennen“, sagte Rosenberg mit heiserer Stimme, als er im Café Dogenhof mit Wacek an einem der Marmortische, wie sie in vielen Wiener Kaffeehäusern standen, saß.
„Das war damals und nach dem Krieg, als ich mit deiner schönen Schwester dieses eigentümliche Verhältnis hatte, das mich bis heute verfolgt, wenn ich an sie denke, und erst recht verfolgt hat, als ich im Gefängnis war und wusste, dass sie sich mit diesen Typen trifft, die mit am Schwarzmarkt gekauften Schnürlsamthosen und der im Mundwinkel angeklebten Zigarette auf Humphrey Bogart machten“, sagte Rosenberg, „und jetzt ist sie mit diesem unbegabten Schönling Andrzej verheiratet, dem ich damals das Theaterspielen beigebracht habe, der aber bis heute den Text, den er aufzusagen hat, nicht versteht. Aber immerhin haben wir zwei damals und jetzt einander wiedergefunden“, sagte Rosenberg zu Wacek, stand auf und küsste ihn auf den Kopf.
Rosenberg setzte sich wieder hin, stützte den linken Arm auf den Marmortisch, legte sein Gesicht und sein vorstehendes Kinn, über dem sich eine auffällig große, seine gesamte Gestalt dominierende Knollennase befand, in die linke Hand und sah sich um: Im Café Dogenhof befanden sich Bilder und Fresken von Venedig und man konnte darauf immer mehr Details entdecken, wenn man nur lange genug hinsah.
Das Café hatte eine für die Praterstraße ungewöhnliche Fassade, die ein venezianisches Haus nachahmte, und lag in der Nähe von Waceks kleiner, dunkler Wohnung, wo er seit seiner Emigration aus Polen im Jahr 1958 mit seiner Frau und dem kleinen Kind schon zwei Jahre lang beengt wohnte. Und so hatte sich Wacek mit Rosenberg im Café Dogenhof verabredet, als er über das große schwarze Telefon, das an der Wand hing, angerufen hatte.
Wacek war erstaunt und fragte, woher Rosenberg die Nummer hätte, auch wenn er sich natürlich sehr über seinen Anruf freuen würde, aber eigentümlich wäre es ja doch, dass er die Nummer hätte. Rosenberg sagte, dass es ganz einfach gewesen wäre, die Telefonnummer zu bekommen, denn er hätte von Waceks Schwester, von der er sich vor seiner Abfahrt verabschiedet hatte, gewusst, dass Wacek jetzt in Wien wäre, und das Postamt hätte ja alle Telefonnummern und würde sie auch weitergeben, wenn man mit Namen danach fragte. Es wäre hier eben nicht so wie in Polen, wo alles kontrolliert werden würde. Und so schlug Wacek vor, dass sie sich in einer Stunde – es war ein Samstag am Nachmittag – im Café Dogenhof treffen könnten.
An anderen Tischen saßen Frauen mit toupierten blonden Haaren, die in die Höhe ragten, und ab und zu kam ein Mann mit geölter, nach hinten gekämmter Frisur, einer dünnen Krawatte und spitzen Schuhen herein, näherte sich einem der Tische, sprach mit einer der Frauen, die dann meist aufstand und mit dem Mann das Café verließ.
„Gerade ich soll das gewesen sein“, so Rosenberg weiter, „wo ich Litauen gar nicht kenne. Aber so sind sie“, sagte er, bestellte einen Cognac und fragte Wacek, ob er auch einen wolle, doch Wacek verneinte. „Ab 1945 waren Stalin und dieses Schwein Rokossowski 1, dieser Agent Stalins, den er zum Verteidigungsminister machen ließ, Polens wahre Herrscher, aber nicht dieser flexible Cyrankiewicz 2, der sich als Ministerpräsident als unser Mann ausgab, aber gar nicht unserer, sondern ihrer war und bis heute ist, und weiter die Befehle von den Kommunisten bekommt, die wiederum aus Moskau kommen. Bis heute. Ein Verräter ist er, sonst gar nichts“, sagte Rosenberg. „Die Russen haben mir fünf Jahre gegeben“, sagte er, „der Richter war zwar Pole, aber die, die ihm befahlen, saßen in Moskau und er war ihr Helfershelfer“, sagte Rosenberg, und dann: „Sie wollten an mir ein Exempel gegen die Intelligenzija statuieren“, und trank den Cognac zur Hälfte aus.
„Recht haben sie gehabt, denn nach dem Urteil gegen mich kehrte Ruhe ein und keiner traute sich, etwas gegen die Partei zu sagen. Nicht am Theater, nicht in der Literatur und schon gar nicht in den Zeitungen. Alle haben sich gefürchtet, weil sie an Rosenberg und seine fünf Jahre dachten“, sagte er, „obwohl ich gar nicht so heiße, aber sie dachten an Rosenberg und das ist doch komisch, wenn sie an jemanden dachten, dessen Namen ich trage, aber nicht er bin“, und trank den Rest des Cognacs aus.
„Du kennst den ‚Pan Tadeusz‘ des großen Mickiewicz 3 im Detail?“, fragte Rosenberg Wacek, der antwortete, dass er ihn natürlich kennen würde, ganze Passagen würde er aus dem Stück deklamieren, denn wer in Krakau würde dieses grandios gewichtige Stück nicht kennen?
„Komisch“, sagte Wacek, „hier kennt Mickiewicz niemand, dabei war er so wichtig für uns, und nicht nur für uns, für die ganze Region. Hier kennt ihn keiner, und vom ‚Pan Tadeusz‘ hat überhaupt noch nie jemand gehört. Komische Welt“, sagte er, „zwischen der Gottähnlichkeit und der Bedeutungslosigkeit liegen nur 500 Kilometer.“
„Oder ein paar Jahre“, sagte Rosenberg, lachte und deutete dem Kellner, dass er noch einen Cognac haben wollte, während Wacek mit einer Geste verneinte.
Rosenberg nach einer Pause: „Jedenfalls habe ich den ‚Pan Tadeusz‘ am Słowacki Theater inszeniert. Was soll ich dir sagen, was du nicht selbst weißt? Während der Proben sind fremde Männer in den Zuschauerraum gekommen, haben zugehört, sind dann wieder hinausgegangen und haben dabei die Türen zum Zuschauerraum laut zugeschlagen.
Da habe ich mir schon gedacht, dass der ‚Sicherheit‘ meine Inszenierung des Stücks nicht gefallen würde, aber wer könnte schon die Aufführung eines Stücks des großen Mickiewicz verbieten? – Das hätte einen Aufstand gegeben, gerade in Krakau, wo sein Denkmal am Hauptplatz steht.“
„Hingegen“, sagte Rosenberg, „haben sie sich für die Inszenierung beim Regisseur revanchieren können. Du kennst ja die alte Masche: ein mieser Typ, Konterrevolutionär, Teil der Intelligenzija, jüdischer Name, ein Kosmopolit – die Zeitungen waren voll davon, selbst der Dziennik Polski und der Przekrój schrieben darüber. Die Karikaturen im Przekrój sind ja häufig treffend, für das Regime gerade noch akzeptabel, aber bei meiner Verurteilung haben sie mitgetan.“
„Das Schlimmste für mich aber“, so Rosenberg weiter, „war, dass der Schauspieler, der den gewaltigen Anfangstext ‚Litwo, ojczyzno moja‘, der – wie du natürlich weißt – ein Loblied auf die Schönheit Litauens ist, und das Land, das damals gerade Teil der Sowjetunion geworden war, hymnisch als Heimat beschreibt, schlecht, ganz schlecht, sprach, weil er aus Angst, etwas zu rezitieren, was der Partei nicht passen würde, um seine Karriere bangte.
Fast flüsterte er den gewaltigen Text und dennoch erhob sich das Publikum am Schluss von den Sitzen und applaudierte über Minuten und stampfte mit den Füßen und da wusste ich, dass ich dran sein würde. Konterrevolutionäres Verhalten – klare Sache.“
Und dann sagte er noch: „Dieser Schauspieler war eben jener Schönling Andrzej, mit dem deine Schwester jetzt verheiratet ist. Hat mich mit ihm betrogen, aber als ich aus dem Gefängnis rauskam und sie schon mit ihm verheiratet war, ihn mit mir“, und lachte.
Rosenberg trank wieder ein halbes Glas Cognac aus und erzählte weiter: „Vor Gericht fragte mich der Richter, warum ich bei der Regie gesagt hätte, dass manche Textpassagen traurig und sentimental, andere voll des Gottesglaubens und wieder andere tapfer und kampfbereit vorgetragen werden sollten, wo ich wissen müsste, dass jeder Kampf gegen das Bruderland UdSSR ein Akt gegen Polen selbst und letztlich Hochverrat sei.“ Und: „Der Staatsanwalt sagte dann, dass ich im Text die Passage über die schwarze Częstochower Mutter Gottes drin gelassen hätte, um meine jüdischen Wurzeln zu vertuschen, um mich bei der Kirche, die gerade wieder ihr konterrevolutionäres Haupt erheben würde, als Jude einzuschmeicheln; aber so leicht würden sie mir das alles nicht machen, denn sie würden alles wissen.“
Rosenberg trank den Cognac aus und erzählte weiter: „Völlig entlarvend wäre es, sagte der Staatsanwalt, und klar ersichtlich, was ich damit hätte sagen wollen, wenn es im Text hieße, dass die ausgedrückte Hoffnung, zu den goldenen Getreidefeldern Litauens zurückkehren zu können, sich erfüllen würde. Nirgendwo würde meine konterrevolutionäre Einstellung besser zum Vorschein kommen und ich in eben konterrevolutionärer Absicht Litauen von der Sowjetunion abtrennen wollen. Ich wäre eben Teil der zionistischen, antikommunistischen Weltverschwörung.“
Dafür gab’s dann fünf Jahre in einer Einzelzelle.
Rosenberg schaute in die Runde und auf die anderen Tische, schwieg, legte sein großes Gesicht wieder in seine linke Hand und sagte nach einer Pause: „Jetzt heißt das Ganze ‚Tauwetter‘ und der Parteiapparatschik Chruschtschow, der immer mit dabei war, ist plötzlich ein Guter, und aufgrund dieser Güte bin ich jetzt hier, bevor sie ihm wieder vergeht.“
Anmerkungen:
1Konstantin Konstantinowitsch Rokossowski (* 21. Dezember 1896 in Warschau, † 3. August 1968 in Moskau) war während des Zweiten Weltkriegs Marschall sowie Held der Sowjetunion und wurde nach Kriegsende auf Wunsch Stalins vom polnischen Präsidenten Bierut zum Verteidigungsminister der Volksrepublik Polen und Marschall von Polen ernannt.
Erst 1956 wurde er in der Phase der Entstalinisierung durch Chruschtschow nach Moskau zurückbeordert.
2Józef Cyrankiewicz (* 23. April 1911 im österr.-ungar. Galizien, Polen, † 20. Jänner 1989 in Warschau), während der deutschen Besatzung Polens in den KZs Auschwitz und Mauthausen inhaftiert, anfangs Mitglied der Polnischen Sozialistischen Partei, danach der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei, die 1948 aus der Sozialistischen Partei und der Arbeiterpartei hervorging. 1947 bis 1952 und 1954 bis 1970 Ministerpräsident Polens.
Cyrankiewicz galt als Befürworteter der Unterwerfung der in Polen vorherrschenden Strukturen unter die Anliegen der Kommunistischen Partei.
3Adam Mickiewicz (* 24. Dezember 1798 im Russischen Kaiserreich, † 28. November 1855 in Konstantinopel) war ein polnischer Nationaldichter der Romantik.





























