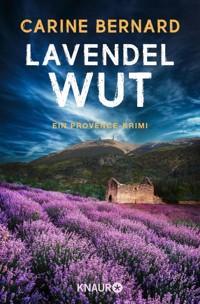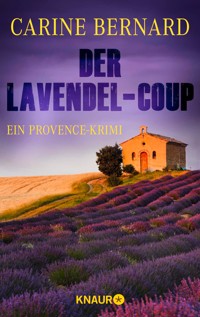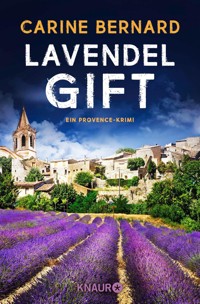
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Lavendel-Morde
- Sprache: Deutsch
Lavendel-Duft, französische Küche und ein hinterhältiger Mord: Willkommen in der Provence! Der zweite Provence-Krimi in der Reihe »Die Lavendel-Morde« von Carine Bernard begleitet Polizei-Schülerin Lilou Braque, die gerade ihr letztes Praktikum für die Ausbildung zur Commissaire in einem kleinen Städtchen in der Provence absolviert, bei ihrem ersten Mordfall. Cosy Crime mit viel französischem Flair: Die perfekte Urlaubslektüre Lilou ist schockiert: Gleich die erste Mord-Ermittlung in ihrer Karriere betrifft sie auch persönlich. Ihr Nachbar Frédéric Benoit wurde eiskalt ermordet. Aber wer würde dem hilflosen alten Mann, für den Lilou oft gekocht hat, etwas antun? Steckt hinter dem Familien-Kochbuch, das Frédéric ihr kurz vor seinem Tod anvertraut hat, vielleicht mehr als eine Sammlung köstlicher Koch-Rezepte? Lilous Verdacht stößt bei ihrem Vorgesetzten Commissaire Demoireau auf wenig Zustimmung, deshalb verfolgt sie mit Schwung und einer gehörigen Portion Intuition ihre eigenen Spuren. In Simon, dem charmanten Großneffen des Ermordeten, findet sie unvermutet Unterstützung. Doch kann sie ihm wirklich vertrauen? Dem Mörder jedenfalls geht es um weitaus mehr als alte Koch-Rezepte ... Der Urlaubs-Krimi »Lavendel-Gift« überzeugt mit einer jungen weiblichen Ermittlerin, alten Bekannten aus dem Krimi »Lavendel-Tod« und jeder Menge provenzalischer Atmosphäre und Kulinarik. Die Autorin Carine Bernard hat ein Faible für Frankreich und besonders für die Provence und erkundet Land und Leute am liebsten entlang kleiner Nebenstraßen mit dem Campingbus. Die Krimi-Reihe »Die Lavendel-Morde« ist eine wunderbare Mischung aus Urlaubsfeeling und spannendem Krimi – nach Art der Provence. Die Provence-Krimis von Carine Bernard sind in folgender Reihenfolge erschienen: - Lavendel-Tod - Lavendel-Gift - Lavendel-Fluch - Lavendel-Grab - Lavendel-Zorn - Lavendel-Sturm - Lavendel-Wut
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 356
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Carine Bernard
Lavendel-Gift
Ein Provence-Krimi
Knaur e-books
Über dieses Buch
Der zweite Provence-Krimi in der Reihe Die Lavendel-Morde von Carine Bernard begleitet Polizei-Schülerin Lilou Braque, die gerade ihr letztes Praktikum für die Ausbildung zur Commissaire in einem kleinen Städtchen in der Provence absolviert, bei ihrem ersten Mordfall.
Lilou ist schockiert: Gleich die erste Mord-Ermittlung in ihrer Karriere betrifft sie persönlich. Ihr Nachbar Frédéric Benoit wurde eiskalt ermordet. Aber wer würde dem hilflosen alten Mann, für den Lilou oft gekocht hat, etwas antun? Steckt hinter dem Familienkochbuch, das Frédéric ihr kurz vor seinem Tod anvertraut hat, vielleicht mehr als eine Sammlung köstlicher Rezepte?
Lilous Verdacht stößt bei ihrem Vorgesetzten Commissaire Demoireau auf wenig Zustimmung, deshalb verfolgt sie mit Schwung und einer gehörigen Portion Intuition ihre eigenen Spuren. In Simon, dem charmanten Großneffen des Ermordeten, findet sie unvermutet Unterstützung. Doch kann sie ihm wirklich vertrauen? Dem Mörder jedenfalls geht es um weitaus mehr als alte Kochrezepte …
Inhaltsübersicht
Kapitel 1
Weich wie Watte füllte das fedrige Weiß sein Gesichtsfeld, drang in seine Nase, seinen Mund, sein Leben, nahm ihm die Luft zum Atmen. Er öffnete den Mund, doch der Schrei erstarb, erstickt in Daunen, so weich, so warm, so überall. Er warf den Kopf zurück, wollte kämpfen und sich wehren, doch das Kissen war unerbittlich. Er schmeckte Salz und Blut, tat einen verzweifelten Atemzug, sein Herz hämmerte und zersprang, und das Letzte, was ihm blieb, war die seifige Süße von Lavendel.
Lilou klappte das Buch zu. Der alte Mann schreckte hoch, geweckt vom leisen Knall der Seiten. Durch Brillengläser, dick wie Glasbausteine, blinzelte er sie an.
»Mademoiselle Braque, Sie lesen fast so gut vor, wie Sie kochen«, krächzte er. Er nahm die Brille ab und wischte sich mit zittrigen Fingern über die Augen. Altersfeuchte glänzte in tiefen Krähenfüßen.
Lilou bezweifelte, dass er viel von der Geschichte mitbekommen hatte. Vermutlich war es besser, wenn sie das letzte Kapitel beim nächsten Mal noch einmal von vorn begann. Sie legte den Thriller, aus dem sie vorgelesen hatte, auf den Tisch, nahm die leere Suppenschale, stand auf und ging zur Tür.
»Ich komme dann morgen Abend wieder, Monsieur Benoit, okay?«
»Mais oui, aber gerne!«
Der alte Mann hob den Kopf und runzelte die Stirn. Einen Moment lang sah er sie verwirrt an, als ob er sich plötzlich nicht mehr an sie erinnerte, dann fiel sein Blick auf die bunte Steingutschüssel in ihrer Hand.
»Warten Sie, Mademoiselle, ich habe noch etwas für Sie.« Er raffte die Decke zusammen, die über seinen dürren Beinen lag. Die Luft im Zimmer war stickig und warm. Trotz der geöffneten Fenster war von der lauen Abendluft nichts zu spüren.
Lilou blieb in der Tür stehen, die Hand auf der Klinke, und sah zu, wie er den Rollstuhl im Zickzack durch das Zimmer bewegte. Sie wusste, er wollte keine Hilfe. Er rollte zu seinem Schreibtisch hinüber und umrundete ihn mit der Hand an der Tischkante.
»Venez, Mademoiselle, kommen Sie her, ich will Ihnen etwas geben!«
Lilou stieß sich vom Türrahmen ab und durchquerte das große Zimmer. Alter Eichenboden, matt glänzend vom jahrzehntelangen Polieren, knarrte unter den Gummisohlen ihrer Sneakers. Vor dem Schreibtisch lag ein kleiner bunter Teppich, dem sie auswich, einfach weil Monsieur Benoit das auch immer tat.
Der alte Mann zerrte an der Schreibtischschublade, doch nur der Rollstuhl bewegte sich. Lilou langte an ihm vorbei, rüttelte an der widerspenstigen Schublade und zog sie auf. Sie sah einige Briefe, Papiere, lose Zettel, einen Einsatz mit Stiften.
Frédéric Benoit schob sie mit plötzlicher Kraft zur Seite und griff tief in das Schubfach hinein. Er tastete nach etwas, das offenbar ganz hinten lag, und endlich zog er einen flachen Gegenstand hervor, der sich, bei Licht betrachtet, als ein Buch entpuppte, eingebunden in dickes dunkelrotes Papier. Er hielt es ihr hin.
»Sie kochen doch so gern«, sagte er. »Vielleicht haben Sie ja Lust, es sich einmal anzusehen.«
Lilou nahm das Buch entgegen und wog es in der Hand. Das Papier des Umschlags knisterte, ein schwacher Duft nach Kräutern ging von ihm aus. Sie schlug den Band wahllos in der Mitte auf, ihr Blick fiel auf eng beschriebene Seiten, Listen, Skizzen, Anweisungen in einer sauberen kleinen Schrift. Sie hatte Mühe, die Worte zu entziffern.
»Ein Kochbuch?«, fragte sie überrascht.
Der alte Mann wackelte mit dem Kopf. »Das ist das Journal d’Armand«, sagte er, als ob das alles erklärte. »Das Buch enthält sozusagen das Erbe meiner Familie.«
»Aber so etwas dürfen Sie doch nicht aus der Hand geben«, protestierte Lilou und legte es zurück auf den Schreibtisch.
»Warum denn nicht?« Benoit blinzelte ihr zu. »Vielleicht überlegen Sie sich das mit der Polizei ja noch einmal.«
Lilou runzelte die Stirn, der alte Mann bemerkte es. »Sie sind doch ein hübsches Mädchen«, brummte er. »Sie sollten kein flic werden. Machen Sie sich und andere glücklich, bleiben Sie lieber beim Kochen!«
Genervt verdrehte Lilou die Augen. Sie war schon lange kein »Mädchen« mehr, sie war 26 und hatte sich nach ihrem Master in Ernährungswissenschaften für die Ausbildung zur Commissaire bei der Police nationale entschieden. Doch seit sie das dem alten Mann erzählt hatte, durfte sie sich ständig seine überholten Ratschläge anhören. Es fehlte nur noch, dass er ihr vorschlug, sie solle sich besser einen Mann suchen, den sie bekochen konnte, und ein paar Kinder in die Welt setzen.
Dabei mochte sie ihn wirklich. Frédéric Benoit war der Eigentümer des Hauses, in dem sie für die Dauer ihres Praktikums in Carpentras ein Zimmer gemietet hatte. Claire, eine Freundin ihrer Tante, wohnte mit ihrem Mann ebenfalls hier und hatte ihr das winzige Einzimmerappartement unter dem Dach vermittelt.
Sie richtete sich zu ihrer vollen Größe von 1,62 Metern auf. »Ich kann auch als Polizistin noch kochen«, gab sie zurück. Sie bemühte sich gar nicht, ihre Verärgerung zu verbergen.
Er drückte ihr das Buch wieder in die Hände. »Wissen Sie, meine Familie besaß hier im Haus ein Restaurant. Mein Bruder sollte es übernehmen, aber nach dem Tod meiner Mutter wanderte er nach Kanada aus. Und nun gibt es niemanden mehr, der nach diesen Rezepten kocht.« Der alte Mann sah sie bittend an. »Sie würden mir eine große Freude machen, wenn Sie mir hin und wieder etwas daraus kochten.«
Lilou seufzte innerlich. Aus reiner Freundlichkeit hatte sie begonnen, ihren Vermieter abends zu besuchen, ihm etwas vorzulesen und ihm manchmal eine Kleinigkeit zum Abendessen zu bringen. Eine dauerhafte Verpflichtung hatte sie damit eigentlich nicht eingehen wollen, aber sie brachte es nicht übers Herz, ihm seine Bitte abzuschlagen.
Sie betrachtete das Buch und strich mit den Fingern über den roten Umschlag. Dann blickte sie auf. »Wenn das so ist, nehme ich es gern.«
»Magnifique.« Frédéric Benoit zwinkerte ihr vertraulich zu. »Aber erzählen Sie es nicht meinem petit neveu«, sagte er. »Nicolas ist kein Koch, er hat gar kein Interesse an unserer Familientradition.«
Lilou hatte Nicolas Dompierre, den »kleinen Neffen«, bereits kennengelernt. Er wohnte ebenfalls im Haus und kümmerte sich liebevoll um seinen Onkel, half ihm morgens aus dem Bett und bereitete das Frühstück für ihn zu. Aber es gab auch immer wieder Streit, der unüberhörbar durch die schlecht schließenden Türen drang. Dompierre war der Ansicht, sein Onkel wäre in einem Pflegeheim besser aufgehoben, doch der starrsinnige Alte sah das anders. Zwar saß er im Rollstuhl, doch er war überzeugt, noch immer gut zurechtzukommen. Niemand dürfe ihm vorschreiben, was er zu tun habe, und Nicolas solle bloß nicht glauben, er könne sein Erbe vorzeitig antreten, so der alte Mann. Lilou hatte nie den Eindruck gehabt, dass es Dompierre um Geld ging, und im Grunde gab sie ihm sogar recht, was die Versorgung des alten Mannes betraf. Aber das war nicht ihre Sache.
»In Ordnung«, sagte sie deshalb nur.
Benoit saß zusammengesunken in seinem Rollstuhl, seine knotigen Finger kneteten die Decke, die trotz der Wärme im Zimmer auf seinen Schenkeln lag. »Bien, très bien«, murmelte er. »Sehr gut.«
Lilou wandte sich ab und hörte, wie der Rollstuhl sich in Bewegung setzte. »Brauchen Sie noch etwas?«, fragte sie, als sie die Tür erreichte.
»Ich komme zurecht«, erwiderte er, und wie um es zu beweisen, stemmte er sich aus dem Rollstuhl. Trotz seiner offensichtlichen Schwäche erhob er sich und hielt ihr die Tür auf.
Sie quittierte die Geste mit einem Nicken und drehte sich noch einmal zu ihm um. »Danke für das Buch.«
»Ich habe zu danken.« Er hielt sich am Türrahmen fest. »Geben Sie gut darauf acht!«
»Das werde ich«, antwortete sie und ging zur Treppe, die hinauf zu ihrer Wohnung führte. Sie hörte, wie sich die Tür hinter ihr schloss und Monsieur Benoit den Schlüssel zwei Mal drehte.
Langsam stieg Lilou die Treppe hoch. Im Treppenhaus war es dämmrig, das Licht funktionierte wieder einmal nicht. Nur der Schein einer Straßenlaterne fiel durch ein schmales Fenster auf den Treppenabsatz. Durch den Spalt unter der Tür zu Claires Wohnung im zweiten Stock drang Licht, und sie hörte Stimmen. Alfonse, ihr Mann, war offenbar zu Hause. Hinter der Tür von Nicolas Dompierre, der gegenüber wohnte, war alles dunkel.
Die Treppe zu den beiden Dachzimmern, von denen sie das rechte bewohnte, war schmal und steil und stockfinster, hier gab es kein Fenster. Lilou ließ die Finger über den Handlauf gleiten, bis er zu Ende war, und tastete nach ihrer Tür. Im Dunkeln angelte sie den Schlüssel aus der Tasche ihrer Jeans und balancierte mit der Linken die Suppentasse und das Buch, das ihr Monsieur Benoit gegeben hatte, während sie aufschloss. Sie schob die Tür hinter sich ins Schloss und drehte den Schlüssel zweimal um, ehe sie auf den Lichtschalter drückte.
Die Deckenlampe flackerte kurz, bevor sie sich doch entschied, ihre Arbeit zu tun, und Lilou seufzte dankbar. Das Haus war alt, und die Stromleitungen im Dachgeschoss waren viel zu lange nicht erneuert worden. Schon einmal hatte sie plötzlich im Dunkeln gesessen und musste dann mit der Taschenlampe die drei Stockwerke hinunter und in den Keller, wo sich der Sicherungskasten befand, sonst hätte sie den Abend im Schein einer Kerze verbringen müssen. Das war zwar romantisch, aber nicht hilfreich, wenn man Gesetzestexte und juristische Fachartikel studieren musste.
Sie legte das Journal d’Armand auf einen kleinen Tisch vor der hoffnungslos überdimensionierten Küchenzeile, die die komplette Wand neben der Tür einnahm, und stellte die Suppenschüssel zu dem leeren Topf in die Spüle. Sie besaß nur den einen Topf und eine alte gusseiserne Pfanne, die sie beide an ihrem ersten Tag am Markt erstanden hatte. Wenn sie morgen Abend wieder kochen wollte, sollte sie besser heute noch abspülen.
Im Zimmer war es warm, noch wärmer als in der Wohnung des alten Mannes. Die Dachziegel hatten die Hitze des Tages gespeichert und heizten den Dachboden auf, der sich genau über ihr befand. Lilou zog die Sneakers aus, streifte die Jeans ab und warf sie auf die Couch. Nur in Slip und T-Shirt öffnete sie die hohen Fensterflügel und stieß die Fensterläden auf. Sie trat an die Brüstung und sog tief die Abendluft ein. Es roch nach warmem Stein.
Sie warf einen Blick zu dem winzigen Balkon im obersten Stockwerk des gegenüberliegenden Hauses. Manchmal stand dort ein kräftig gebauter bärtiger Mann und rauchte. Sein Oberkörper war über und über tätowiert, aber er schien okay zu sein, denn immer, wenn er sie sah, grüßte er freundlich. Heute jedoch war der Balkon leer.
Ein Moped knatterte unter ihr durch die Gasse, und die bunten Gemälde des jährlichen Open-Air-Kunstfestivals, die wie Wäschestücke an Leinen über der Straße hingen, bewegten sich ganz leicht im Luftzug. Das Haus von Monsieur Benoit befand sich an der Place de l’Horloge, einem winzigen Platz mit einem Uhrturm, dem er seinen Namen verdankte, mitten in der Altstadt von Carpentras, wo sich fünf Gassen trafen und die Fußgängerzone begann. Von hier waren es nur ein paar Schritte zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt, zur Place d’Inguimbert und zur Cathédrale Saint Siffrein, zum Hôtel de Ville oder zur Porte d’Orange. Und in nur fünf Minuten war man am Hôtel de Police, wo Lilou ihr letztes, zweimonatiges Praktikum vor dem Ende ihrer Ausbildung zur Commissaire ableistete.
Die Straßengeräusche bildeten einen beständigen Klangteppich, der einschläfernd wirkte wie das Murmeln eines Baches. Lilous Gedanken wanderten zurück zu dem Moment vor zwei Wochen, als sie sich von Pasquale verabschiedet hatte. Pasquale du Mournier, reicher Industriellensohn, Schwarm aller Frauen der Schule, und – wie sie dachte – ihr petit ami. Gemeinsam hatten sie sich um Praktikumsplätze bei der Pariser Polizeipräfektur beworben, er im Generalsekretariat, sie bei der Police judiciaire, der Kriminalpolizei.
Erneut fühlte sie die bittere Enttäuschung. Bei Pasquale hatte es geklappt, er würde wohl in zwei Monaten direkt als Sous-Directeur in der Polizeiverwaltung anfangen, während ihre Zukunft offenbar in einem kleinen Kommissariat in einer unbedeutenden Kleinstadt lag, dessen Leitung sie irgendwann übernehmen sollte. Und als ob das nicht reichte, hatte ihr Pasquale zum Abschied den Laufpass gegeben: Eine Fernbeziehung komme für ihn nicht infrage, aber er wünsche ihr alles Gute. Er hatte sich mit zwei Wangenküssen verabschiedet, war in sein Auto gestiegen und davongefahren, als ob es das letzte gemeinsame Jahr nicht gegeben hätte.
Lilou schrak aus ihren Gedanken auf, als plötzlich laute Stimmen erklangen. Eine Gruppe junger Männer zog lärmend unter ihr vorbei, mit schwarzen Haaren und dunklen Gesichtern. Ein Pfiff erklang. Sie sah ihnen hinterher, bis sie hinter einer Straßenecke verschwanden, dann trat sie ins Zimmer zurück.
Es war fast Mitternacht, als Lilou die Schlafcouch aufklappte und sich für die Nacht fertig machte. Sie löschte das Deckenlicht und machte es sich im Schein der Stehlampe gemütlich, das Journal d’Armand auf dem Schoß und ein Glas Wasser auf dem niedrigen Tisch neben sich.
Sie schlug das Buch irgendwo in der Mitte auf und berührte mit den Fingerspitzen die Seite. Das Papier war seidig glatt, die enge Schrift in schwarzer Tinte gestochen scharf. Die Buchstaben erschienen auf den ersten Blick wie eine Abfolge von runden Kringeln, unterbrochen von nur wenigen Spitzen und Punkten, kaum zu entziffern. Sie blätterte weiter und erkannte eine Überschrift, Ratatouille stand da und war doppelt unterstrichen. Darunter die Liste der Zutaten, die sie nur lesen konnte, weil sie wusste, woraus das provenzalische Nationalgericht bestand: Zwiebeln, Auberginen, Zucchini, rote und gelbe Paprika, Tomaten und Knoblauch, Thymian, Rosmarin und Lavendel.
Der Lavendel war eine Überraschung. Lilou liebte den Duft der violetten Blüten und legte immer einen Lavendelzweig zwischen ihre Wäsche, aber zum Kochen hatte sie ihn noch nie verwendet. Sie steckte die Nase in das Buch und glaubte wieder, den schwachen Duft von Kräutern zu wahrzunehmen.
Neugierig blätterte sie weiter. Langsam gewöhnte sie sich an die eigenwillige Schrift. Das kleine a unterschied sich kaum vom kleinen o, und das n sah aus wie ein u, das r glich dem s und das e einem i, aber mit jeder Seite, die sie aufschlug, konnte sie mehr erraten.
Alle klassischen südfranzösischen Rezepte schienen in dem Buch versammelt: Salade niçoise, Pissaladière und Rouille. Sie zählte vier Varianten einer Bouillabaisse, der berühmten Fischsuppe aus Marseille, drei verschiedene Arten, eine Aïoli zuzubereiten, fünf Rezepte für Soupe au Pistou und dreizehn unterschiedliche Tapenaden, würzige Olivenpasten, die man mit Weißbrot als Vorspeise reichte.
Dieser Armand, nach dem das Journal benannt war, schien ihre Freude an vielfältigen Aromen zu teilen. Beim Durchblättern stieß sie immer wieder auf Kräuter und Gewürze, die sie noch nie zum Kochen verwendet hatte: allen voran Lavendel, den sie wegen seines seifigen Geruchs für zu bitter gehalten hätte, und Piment d’Espelette, ein Pulver aus einer besonders milden Chilischote, Safranfäden, auf dem Markt kaum zu bezahlen, Fenchelsamen, Veilchenblüten, Piniennadeln, rosaroter Pfeffer und noch vieles mehr.
Ob der alte Mann ahnte, welch eine Freude er ihr damit bereitete? Lilou liebte Kochbücher, und schon seit frühester Kindheit war sie fasziniert von allem gewesen, was mit der Verarbeitung von Lebensmitteln zu tun hatte. Doch das Studium der Ernährungswissenschaften war ihr viel zu trocken gewesen, und mit dem Masterdiplom in der Tasche hatte sie keine Arbeit gefunden, die ihr auch nur im Mindesten zugesagt hätte. Deshalb besann sie sich auf ihren zweiten großen Traum, verstaute ihre Sammlung von Kochbüchern auf dem Dachboden ihrer Eltern und meldete sich kurz entschlossen zur Aufnahmeprüfung an der Polizeischule in Lyon an. Zum Entsetzen ihrer Familie bestand sie mit Bravour, und im Verlauf der zweijährigen Ausbildung zur Commissaire der Police nationale wuchs ihre Gewissheit, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.
Das Lesen machte sie hungrig, deshalb klappte sie rasch das Buch zu, trank ihr Wasser aus und löschte das Licht. Dann zog sie das Laken, das sie wegen der Hitze anstatt einer Decke verwendete, bis unters Kinn und schloss die Augen.
Der nächste Morgen brachte eine Überraschung: Commissaire Demoireau, der Lilous Praktikum anleitete, nahm sie mit ins Bürgermeisteramt, in die Mairie, zu einer Besprechung mit dem Leiter der Police municipale. So etwas hatte er bisher noch nie getan. Aber sie wagte nicht, das als gutes Zeichen zu werten, denn bis jetzt hatte sie nicht das Gefühl, dass der Commissaire sie wirklich als künftige Kollegin betrachtete. Echte Polizeiarbeit schien er ihr nicht zuzutrauen; er behandelte sie, als ob sie sich hier während ihres Praktikums nur die Zeit vertrieb.
Doch was sich im Vorfeld spannend angehört hatte, erwies sich als ebenso langatmige wie langweilige Veranstaltung. Nicht zum ersten Mal verfluchte Lilou die Verantwortlichen in der Polizeischule, die sie für ihren letzten Ausbildungsabschnitt auf einen drögen administrativen Posten abgeschoben hatten. Wie sollte sie hier ihre Fähigkeiten als Ermittlerin unter Beweis stellen? Sie kritzelte auf einem Block herum und versuchte, wenigstens nach außen hin den Eindruck gespannten Interesses zu erwecken. Im letzten Moment unterdrückte sie ein Gähnen und räusperte sich, um das verräterische Schnaufen zu übertönen.
»Möchten Sie etwas sagen, Mademoiselle Braque?«, fragte Lamberton, der Chef der Police municipale, höflich.
Lilou schüttelte den Kopf und malte schnell ein paar weitere Kringel auf das Papier. »Nein, Monsieur, fahren Sie bitte fort.«
Lamberton holte tief Luft und wandte sich wieder Commissaire Demoireau zu. Seit einer halben Stunde referierte er über Videokameras, und Lilou wusste noch immer nicht, warum er all das dem Dienststellenleiter der Police nationale erzählte. Vielleicht hätte sie doch besser zuhören sollen. Aber als er sich minutiös und minutenlang über technische Details wie Frequenz, Reichweite, Erfassungswinkel und Betriebsdauer ausließ, hatte ihr Gehirn abgeschaltet. So wie die siebenunddreißig Überwachungskameras, die an strategischen Stellen in Carpentras verteilt waren und in der letzten Nacht alle gleichzeitig den Geist aufgegeben hatten.
Inzwischen funktionierten sie wohl wieder, aber der Chef der Police municipale hatte große Sorge, dass so etwas noch einmal vorkommen könnte. Dann wären seine Leute blind und taub, lamentierte er, und das ginge ja gar nicht.
Yves Lamberton war ein großer dünner Mann mit dünnem Haar und dünner Stimme, die immer ein wenig quengelig klang. Wenn man Commissaire Demoireau Glauben schenken durfte, war er sehr tüchtig, und die gute Zusammenarbeit zwischen der Police nationale und den Beamten der städtischen Polizei, die direkt dem Bürgermeisteramt unterstand, in erster Linie ihm zu verdanken.
Im Gegensatz zu Demoireau behandelte Lamberton sie mit ausgesuchter Höflichkeit, wie einen geschätzten Gast, was dazu führte, dass Lilou sich von ihm noch weniger ernst genommen fühlte als vom Rest ihrer Kollegen. Sie seufzte.
Demoireau warf ihr einen strengen Blick unter buschigen Brauen zu. Lilou setzte sich gerade hin und konzentrierte sich wieder auf Lambertons Worte.
»Die Kameraanlage ist inzwischen über zehn Jahre alt«, erklärte er gerade. »Wir haben sie zwar beständig mit neuen Kameras erweitert, aber die Technik ist uralt. Die Funkreichweite ist zu gering und extrem fehleranfällig. Heute macht man so etwas mit WLAN und Solarzellen.«
Der Commissaire nickte. »Das weiß ich«, sagte er. »Aber das ist Sache der Stadt, das müssen Sie mit der Bürgermeisterin besprechen, nicht mit mir.«
Lamberton schnaubte. »Das habe ich bereits getan«, schimpfte er. »Aber la Maire sagt, die Stadt hat kein Geld. Die Kosten für eine neue Anlage seien im Budget nicht vorgesehen. Wenn wir sie jetzt sofort ersetzen wollten, hätten wir nur noch zwölf Kameras, mehr ist nicht drin.«
»Hm«, machte Demoireau. »Sie wissen doch, dass das Budget der Police nationale nicht für städtische Belange zur Verfügung steht.«
»Aber die Überwachungsanlage kommt doch auch Ihren Leuten zugute!« Lambertons Stimme nahm einen weinerlichen Tonfall an.
»Das mag schon sein«, antwortete Demoireau und verschränkte die Arme vor der Brust. Lilou sah, dass er sich beherrschen musste, nicht die Geduld zu verlieren. »Aber Sie wissen genau, dass mir da die Hände gebunden sind.«
»Vielleicht könnten Sie mit Madame Adelphe sprechen?« Lamberton klang jetzt bittend. »Auf Sie hört sie eher als auf mich.«
»Warum wohl«, dachte Lilou bei sich. Die Bürgermeisterin konnte Lambertons Gejammer wahrscheinlich auch nicht mehr ertragen.
»Madame Adelphe kann auch kein Geld lockermachen, wo keines ist«, gab Demoireau zurück. »Die hellere Beleuchtung sensibler Bereiche der Stadt hat einen großen Batzen Geld gekostet, das wissen Sie genau.«
Lamberton nickte traurig. »Als wir das beantragt haben, wusste ich ja noch nicht, dass die Kameraanlage …«
Lilou reichte es. Sie blickte auf und hob den Kugelschreiber. »Warum lassen Sie nicht die neue Anlage mit den zwölf Kameras installieren und ordern die fehlenden Kameras im nächsten Jahr nach?«
Lamberton sah sie mit offenem Mund an. »Aber … aber das …« Er schüttelte den Kopf. »Das geht doch nicht, dann haben wir doch zu wenig Kameras!«
»Wenn die alten nicht mehr funktionieren, haben Sie noch weniger«, gab Lilou lakonisch zurück.
»Sie hat recht, Lamberton«, pflichtete Demoireau ihr bei. »Lieber weniger Kameras, die dafür zuverlässig laufen, als eine Anlage, die die halbe Zeit nicht auf Sendung ist.«
»Aber wie soll ich dann die Stadt überwachen? Meine Gardiens können nicht überall zugleich sein!«
»Ich kann Ihnen nur anbieten, dass meine Leute verstärkt die Plätze kontrollieren, an denen es keine Kameras gibt«, schlug Demoireau vor. »Zumindest bis die neuen Kameras da sind.«
»Sie können die alten Kameras doch so lange hängen lassen«, schlug Lilou vor. »Als Präventionsmaßnahme müssen sie ja nicht in Betrieb sein.«
Lamberton schnappte nach Luft. »Das ist …«
»Hab dich nicht so, Yves«, erklang eine weibliche Stimme von der Tür.
Lilou wandte sich um. Im Türrahmen stand eine kleine Frau mit so tiefschwarzem Haar, dass es nur gefärbt sein konnte. Sie trug es hochgesteckt und war in ein schickes Kostüm mit taillierter Jacke gekleidet, das ihrer pummeligen Figur schmeichelte.
Das runde Gesicht der Bürgermeisterin verzog sich zu einem strahlenden Lächeln. »Georges, ich wusste nicht, dass du hier bist.«
Demoireau und Lamberton hatten sich erhoben, und Lilou folgte eilig ihrem Beispiel.
»Madame«, murmelte Lamberton.
»Bonjour, Francine«, sagte der Commissaire und erwiderte ihre Wangenküsse.
Die Bürgermeisterin nickte Lilou zu. »Wir haben doch jahrelang mit Kamera-Attrappen gearbeitet«, sagte sie. »Habt ihr das schon vergessen?«
Demoireau schüttelte den Kopf. »Nein, natürlich nicht.«
»Aber ist das denn noch zeitgemäß?«
»Haben wir eine andere Wahl?«
Madame Adelphe stützte die Hände auf die Tischplatte. »Ich habe gehört, was Mademoiselle la Commissaire vorgeschlagen hat. Ich halte das für einen vernünftigen und vor allem gangbaren Weg.«
»Dann soll es so sein.« Demoireau nickte Lamberton zu, der resigniert den Kopf einzog. »Gibt es sonst noch etwas?«
Der Chef der Police municipale schüttelte den Kopf. »Nein. Den Rest haben die Kollegen schon heute Morgen besprochen.«
»War etwas Besonderes?« Demoireau hob die Brauen.
»Nur wieder ein Einbruch«, erwiderte der Stadtpolizist. »Diesmal hat es Grailloux erwischt, den immobilier in der Rue des Marins. Bargeld, Schmuck, Bilder, ein Flachbildschirm, ein Laptop und ein paar Skulpturen. Das alte Muster, und wieder keine Anhaltspunkte.«
Lilou horchte auf. Seit sie hier war, hatten ihre Kollegen fast täglich mit Wohnungseinbrüchen zu tun gehabt. Eine Bande von jungen Männern aus dem Maghreb hatte sich offenbar auf leer stehende Wohnungen spezialisiert. Sie brachen überall ein, wo sie leichte Beute witterten, und nahmen alles mit, was nicht niet- und nagelfest war. Dabei gingen sie so geschickt vor, dass es der Polizei bisher nicht gelungen war, sie in flagranti zu erwischen – wurde der Einbruch dann entdeckt, waren die Diebe längst über alle Berge.
»Ich wäre euch beiden wirklich dankbar, wenn ihr die Sache in den Griff bekommen würdet«, sagte Madame Adelphe. Ihre Stimme war jetzt kalt wie Stahl und genauso hart. »Irgendwann erwischen sie die Ferienwohnung eines Touristen, und dann habe ich den Fremdenverkehrsverband auch noch am Hals.«
»Wir tun unser Bestes«, murmelte Lamberton und schielte zur Tür.
»Irgendwann kriegen wir sie«, bekräftigte Demoireau. »Irgendwann werden sie einen Fehler machen.«
»Traurig, wenn ihr drauf warten müsst, dass die Einbrecher etwas falsch machen«, gab die Bürgermeisterin spitz zurück. »Ich hätte gehofft, ihr zeigt in dieser Sache ein wenig mehr Esprit.«
Sie wirbelte auf ihren hohen Absätzen herum und marschierte hocherhobenen Hauptes hinaus. Die beiden Männer starrten ihr hinterher, und Lilou unterdrückte ein Schmunzeln.
»Diese Frau«, stöhnte Lamberton.
»Sie hat leicht reden!« Demoireau erhob sich und strich durch seine kurzen eisengrauen Haare. Dann reichte er Lamberton die Hand.
»Wir müssen jetzt wirklich los«, sagte er. »Au revoir, Lamberton.«
Lambertons dünne Finger verschwanden in Demoireaus schwieligen Pranken, und Lilou rechnete fast damit, dass sie wie dürre Zweige zerbrechen würden. Aber nichts passierte. Lamberton streckte ihr ebenfalls die Hand hin, die sie kurz ergriff und gleich wieder losließ. Seine Finger waren eiskalt.
Sie wandte sich ab und folgte Demoireau nach draußen.
Auf dem Rückweg zur Wache war Lilou schweigsam. Ob Commissaire Demoireau ihr ihre Einmischung verübelte? Seine Miene verriet nichts. Er steuerte den großen Peugeot unerbittlich über die Ringstraße von Carpentras, verzog keine Miene, als ihn ein Kleinwagen mit deutschem Kennzeichen schnitt, und bremste nur, wenn ihn eine rote Ampel dazu zwang.
Wie schon oft empfand Lilou ihren Status als Praktikantin zur Commissaire als Widerspruch in sich. Das letzte Praktikum ihrer Ausbildung sollte sie eigentlich auf die leitende Funktion vorbereiten, die sie in einigen Monaten übernehmen würde. Doch die Dienststelle unter der Leitung von Commissaire Demoireau war von eingefahrenen Hierarchien geprägt; die Männer hatten das Sagen, und Valérie Cravasse, die einzige Polizistin mit dem Rang eines Lieutenants, gab sich burschikoser als ihre männlichen Kollegen.
Sie seufzte und beschloss, den Stier bei den Hörnern zu packen. »War das vorhin in Ordnung, dass ich mich eingemischt habe?«, fragte sie.
»Hm«, machte Demoireau und wandte sich ihr zu. »Ihr Vorschlag war schon richtig, Mademoiselle«, fuhr er fort. »Aber einem Mann wie Lamberton sollten Sie das nicht so ins Gesicht sagen.«
»Aber wieso denn nicht? Er hat doch nur gejammert.«
»Das hat etwas mit Höflichkeit zu tun«, gab er zurück. »Sie als junges Mädchen …«
»Ich bin eine künftige Commissaire«, unterbrach ihn Lilou. »Ich darf doch wohl mit den Kollegen auf Augenhöhe sprechen?«
»Hm, hm.« Die Ampel sprang auf Grün, Demoireau legte den Gang ein und gab Gas.
Lilou stieß geräuschvoll die Luft aus. »Wie soll ich denn lernen, die Aufgaben einer Commissaire wahrzunehmen, wenn ich immer die Klappe halten soll?«
Demoireau hielt die Augen fest auf die Straße gerichtet. »Haben Sie Geduld. Wir sind hier in der Provence, wie Ihnen vielleicht aufgefallen ist. Da ticken die Uhren anders als in Paris.«
»Das ist mir nicht entgangen.« Lilou verschränkte die Arme vor der Brust. »Trotzdem. Ich werde in einigen Monaten selbst Commissaire sein, auch wenn ich dann immer noch ein junges Mädchen bin.«
Demoireau fuhr auf den Parkplatz der Polizeidienststelle und stellte den Wagen auf dem für ihn reservierten Platz ab.
»Sie müssen selbst einen Mittelweg finden, Mademoiselle Braque«, sagte er und stieg aus. »Ich kann Ihnen da nicht helfen.«
Er warf die Autotür ins Schloss, und Lilou beeilte sich, aus dem Wagen zu kommen. Der Commissaire strebte bereits mit eiligen Schritten auf das Gebäude zu. Sie sah ihm hinterher und wusste nicht, ob sie wütend oder belustigt sein sollte.
An ihrer letzten Praktikumsstelle bei der Police judiciaire hatte eine Frau die Leitung innegehabt. Madame la Commissaire hatte das Kunststück beherrscht, ihre Truppe von Kriminalpolizisten mit starker Hand zu führen und dabei den einzelnen Beamten genügend Freiraum für eigenverantwortliches Handeln zu lassen. Das Praktikum unter ihrer Führung hatte Lilou genau gezeigt, was und wie sie später einmal werden wollte. Doch hier, unter den erzkonservativen Bauern der Vaucluse und in einer Dienststelle, die ganz und gar nicht dem entsprach, was sie sich als berufliches Ziel vorgestellt hatte, begann sie zum ersten Mal, an ihrer Entscheidung, Commissaire werden zu wollen, zu zweifeln.
»Kommen Sie, wo bleiben Sie denn«, rief Demoireau und winkte sie heran. Er stand im Eingang und hielt ihr die Tür auf. Sie schüttelte die trüben Gedanken ab und eilte zu ihm.
Wenig später saß Lilou an ihrem Schreibtisch im Büro von Commandant Didier Pouffin, dem stellvertretenden Leiter der Dienststelle. Angestrengt versuchte sie, die Schrift von Cropardin zu entziffern, einem der älteren Gardiens, der sich beständig weigerte, seine Protokolle am Computer zu tippen. Das war für ihn Teufelszeug, und da es in der Dienststelle keine Schreibmaschine mehr gab, mussten andere Beamte das Abtippen für ihn übernehmen. Und weil Lilou ja schließlich alle Aufgaben innerhalb der Polizeistation kennenlernen sollte, hatte man kurzerhand ihr die ungeliebte Arbeit zugewiesen. Sie atmete tief durch und bezwang ihren Ärger. Sie würde die Aufgabe erledigen. Aber wenn das, was sie da in den PC tippte, hanebüchener Unsinn war, lag es nicht an ihr. Dann war es in erster Linie Cropardins Schuld, der sich ja immerhin um eine leserliche Handschrift hätte bemühen können.
Als sie fertig war, sah sie aus dem Fenster. Zwischen den silbergrünen Blättern der Platanen blitzte ein azurblauer Himmel, und sie war froh über die Klimaanlage, obwohl sie das surrende Geräusch nervte, das zusammen mit einem metallischen Geruch mehr kühl als kalt aus den Lüftungsschlitzen drang.
Pouff war schon gegangen, und natürlich hatte der Commandant sie nicht aufgefordert, ihn zu begleiten. Das tat er nur auf ausdrückliche Anordnung von Demoireau, und der würde seiner kleinen Praktikantin heute tunlichst aus dem Weg gehen. Er mochte es gar nicht, wenn sie ihn zwang, Stellung zu beziehen, oder ihn gar darauf hinwies, dass sie bald selbst eine Commissaire sein würde, genau wie er.
Sie lehnte sich in ihrem Stuhl zurück, legte die Füße auf die Tischplatte und schloss die Augen. Was Pasquale wohl gerade machte? Bestimmt saß er in einem perfekt ausgestatteten Büro mit funktionierender Klimaanlage und wurde in die Abläufe der Polizeiverwaltung eingeweiht, ganz wie er es sich immer erträumt hatte. Sie dagegen durfte sich mit langweiliger Büroarbeit herumschlagen, anstatt ein Team von Ermittlern der Police judiciaire bei ihrer Arbeit zu begleiten.
Das leise Quietschen der Türklinke schreckte Lilou auf, und rasch nahm sie die Füße vom Tisch. Sie bewegte die Maus, und als Pouff hinter sie trat, war wieder die Eingabemaske für die Protokolle zu sehen.
»Bist du fertig?«, fragte er.
Sie hatte ihm nie das Du angeboten, aber sie nahm es hin. Die Kollegen waren hier alle per Du; Demoireau war der Einzige, der alle siezte. Auch ihr gegenüber hielt er eisern am »Sie« fest, obwohl er sie vor zwei Jahren noch geduzt hatte, als sie ihm in Tante Margots Café seinen Kaffee servierte. Was Commandant Pouffin anging, vermied sie es tunlichst, ihn direkt anzusprechen – sie wollte lieber nicht wissen, wie er reagierte, wenn sie ihn Pouff nannte, so wie ihre Kollegen.
»Ja«, sagte sie. »Gerade fertig geworden.« Sie schob ihm Cropardins handgeschriebenen Ergüsse hin. »Gar nicht so einfach zu entziffern.«
»Auch das musst du lernen«, sagte Pouffin. Er nahm die Blätter und warf ihr einen abschätzigen Blick zu. »Ich werde es morgen kontrollieren.«
Lilou verzog das Gesicht. Das fehlte ihr noch, dass sie das Ganze morgen noch einmal machen durfte. »Bitte lass etwas geschehen, damit das nicht passiert«, dachte sie. »Irgendetwas, bitte!«
Es war nach 17.00 Uhr, als Lilou das Polizeigebäude verließ. Sie wandte sich nach links in die Rue Watton, eine kleine Gasse, die den Namen »Straße« gar nicht verdiente. Die Häuser standen so eng, dass sie das Gefühl hatte, wenn sie beide Arme ausstreckte, die Wände zu beiden Seiten berühren zu können. Sie drückte sich in einen Hauseingang, um einen staubigen Pick-up vorbeizulassen, und war froh, als sie die Fußgängerzone erreichte. Hier waren die Straßen breiter, und es gab keine Autos, die die Gassen von Carpentras mit einer Rennstrecke verwechselten.
Im Carrefour an der Rue de la République kaufte sie Milch, gemahlenen Kaffee, Eier und ein Baguette, beim algerischen Gemüsehändler ein paar Häuser weiter erstand sie Zwiebeln, eine Zucchini sowie eine rote und eine gelbe Paprika. Er verkaufte auch Gewürze, und in Erinnerung an die Rezepte von Armand Benoit legte sie auch noch eine duftende Packung Lavendelblüten sowie ein kleines Glas Piment d’Espelette in ihre Einkaufstüte.
Die Sonne war inzwischen hinter den Dächern der Altstadt verschwunden, und die Schatten waren so lang, dass kaum noch ein Sonnenstrahl das helle Pflaster erreichte. Lilou hatte es nicht eilig, ihre von der Sonne aufgeheizte Bleibe zu erreichen, deshalb bummelte sie in gemütlichem Tempo in Richtung Place de l’Horloge, blieb immer wieder an Schaufenstern stehen, leistete sich noch zwei Kugeln Eis – Salzkaramell und Pistazie – und genoss die letzten Sonnenstrahlen auf den Treppenstufen vor der Kathedrale Saint Siffrein.
Erst gegen sechs machte sie sich langsam auf den Heimweg. Sie sperrte das Haustor auf; wie immer hakte der Schlüssel ein wenig, und sie musste an dem schmalen Türflügel rütteln, bis das Schloss nachgab. Die staubigen, zugeklebten Scheiben des ungenutzten Ladenlokals im Erdgeschoss wirkten wie ein Fremdkörper in dieser geschäftstüchtigen Umgebung, in der es kaum Leerstand gab. Dank der vielen Touristen in der Altstadt von Carpentras schien hier jedes Geschäft zur Goldgrube zu werden, die Mietpreise waren exorbitant, und Lilou verstand nicht, warum sich der alte Mann weigerte, das Lokal zu vermieten. Aber er hatte seinen eigenen Kopf, und je mehr sein Neffe ihn drängte, desto sturer lehnte er eine Vermietung ab. Letzte Woche erst hatte Lilou einen lautstarken Streit mitbekommen, der durch die geöffneten Fenster bis zu ihr nach oben zu hören gewesen war: »Ich will keinen Zigarettengestank und keine laute Musik bis spät in die Nacht«, hatte der alte Mann mit erstaunlich kräftiger Stimme geschrien. »Du musst schon warten, bis ich tot bin, bevor du mein Haus an den Nächstbesten verschacherst!«
Lilou hatte leise das Fenster geschlossen und sich ihre eigenen Gedanken dazu gemacht. Sie konnte die Haltung des alten Mannes, der einfach seine Ruhe haben wollte, sogar nachvollziehen. Andererseits verstand sie auch Nicolas Dompierre, der die Pflege seines Onkels lieber in professionelle Hände geben wollte. Hände, die jedoch auch bezahlt werden wollten. Noch funktionierte es weitgehend ohne fremde Hilfe. Nicolas kam jeden Morgen und half seinem Onkel, bereitete ihm das Frühstück zu und machte ihn für den Tag fertig. Mittags brachte jemand vom Sozialdienst der Stadt das Mittagessen, Claire ging für ihn einkaufen, und abends versorgte er sich selbst. Aber dass das nicht mehr lange funktionieren würde, war auch Lilou klar geworden, als der alte Mann sie kurzerhand für den Abenddienst eingespannt hatte.
Sie beeilte sich und lief die Treppe hoch. Sie hatte zu lange getrödelt, die Milch musste schleunigst in den Kühlschrank. Während sie noch die Lebensmittel einräumte, überlegte sie bereits, was sie heute kochen sollte. Beim Einkaufen hatte sie sich vom Angebot des Gemüsehändlers leiten lassen, doch nun musste sie entscheiden, was sie damit anfangen wollte. Ihr Blick fiel auf das Journal d’Armand, das noch immer auf dem Couchtisch lag. Warum eigentlich nicht?
Sie setzte sich mit dem Buch an den Küchentisch und blätterte langsam durch die Seiten. Bei einem Rezept für Piperade blieb ihr Blick an den Zutaten hängen. Zwiebeln und Paprika, dazu ein Ei, das passte doch perfekt zu ihren Einkäufen! Das Wasser lief ihr im Mund zusammen.
Während sie eine große Zwiebel schälte und in kleine Würfel schnitt, erhitzte sie Olivenöl in der Pfanne. Ein Löffel brauner Zucker sorgte zusammen mit der Zwiebel für einen intensiven Duft nach Karamell und überzog die bunten Paprikastreifen und den gehackten Knoblauch mit goldenem Glanz. Lilou goss einen Schuss Weißwein dazu, es zischte, und der Dampf nahm ihr für einen Augenblick die Sicht. Zwei Esslöffel Tomatenmark, Salz, Pfeffer und eine Messerspitze Piment d’Espelette sowie eine Prise Lavendel sah das Rezept noch vor, und Lilou schnupperte beglückt, als ein aromatischer Duft aufstieg. Während das Gemüse köchelte, schnitt sie das Baguette in längliche Scheiben. Zehn Minuten später reduzierte sie die Hitze, kippte zwei verquirlte Eier in die Gemüsemasse, rührte kräftig um und ließ sie in der Pfanne stocken.
Dieser Armand wusste wirklich, wie man kochte. Die Kombination der sommerlichen Gewürze mit den Farben der Occitanie war ein Genuss für alle Sinne. Sie aß die fertige Piperade direkt aus der Pfanne, nutzte die Brotschnitten als Löffel und tunkte damit die Soße auf. Schließlich zwang sie sich zum Aufhören und häufte den Rest der Piperade auf die letzten drei Brotscheiben, die sie auf einem Teller anrichtete.
Der kleine Tisch neben Monsieur Benoits Wohnungstür, auf dem der Sozialdienst immer sein Mittagessen abstellte, war leer. Alles war still. Das war unüblich, normalerweise lief das Radio, wenn er alleine war. Ein mulmiges Gefühl beschlich sie, sie stellte den Teller ab und berührte den Türknauf. Die Tür schwang ohne Widerstand nach innen auf, Licht fiel auf den Türrahmen, und jetzt erst bemerkte sie das zersplitterte Holz um das Schloss herum.
»Monsieur Benoit?«, rief sie, plötzlich ernsthaft besorgt. »Ist alles in Ordnung?«
Keine Antwort.
Sie schob die Tür ganz auf und trat in den Flur. Die Deckenlampe brannte, alle Türen standen offen, es war brütend warm. Sie hielt den Atem an und eilte ins Wohnzimmer. Im Türrahmen blieb sie abrupt stehen. Es sah aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen.
Die Schubladen in dem Wandverbau aus dunklem Holz waren herausgerissen, die Schranktüren geöffnet. Auf dem Boden türmten sich aufgeschlagen und geknickt die Bücher aus den Regalen, der kleine Teppich vor dem Schreibtisch lag mit der Oberseite nach unten. Ein Blick durch die offen stehende Tür in die Küche verriet ihr, dass es dort nicht besser aussah: Zerbrochenes Geschirr, Töpfe, Lebensmittel, alles war auf dem Fußboden verteilt. Aber wo war Monsieur Benoit?
Auf leisen Sohlen ging sie zurück in den Flur und betrat das Schlafzimmer. Das Bild hier glich dem im Wohnzimmer, die Schränke waren offen, die Kleidung lag in einem unordentlichen Haufen auf dem Boden. Mitten im Zimmer, neben dem hohen Pflegebett, stand mit dem Rücken zu ihr der Rollstuhl. Die Fenster waren geschlossen, auch hier herrschte drückende Hitze.
»Monsieur Benoit?«, wiederholte sie, obwohl sie schon ahnte, dass sie keine Antwort bekommen würde. Lilou trat näher und umrundete den Rollstuhl.
Kapitel 2
Beinahe hätte man glauben können, Frédéric Benoit schliefe nur. Das Kinn war ihm auf die Brust gesunken, die Augen waren geschlossen, doch sein Gesicht war weiß wie Wachs, die Lippen bläulich, und nichts rührte sich an ihm.
Lilou legte dennoch zwei Finger an seinen Hals. Die faltige Haut war erstaunlich warm, als hätte er gerade noch geatmet, doch unter ihren Fingerspitzen regte sich kein Puls. Sie zog die Hand zurück und wischte sie an ihrer Hose ab, als ob die Berührung des Toten etwas auf ihrer Haut hinterlassen hätte. Einen Moment lang starrte sie Monsieur Benoit ins Gesicht. Er sah irgendwie friedlich aus, als wäre er einfach im Schlaf gestorben, doch das Durcheinander in den Zimmern strafte diesen Eindruck Lügen. Und seine Hände, die wie Klauen die Armlehnen des Rollstuhls umklammerten, vermittelten ebenfalls ein anderes Bild.
Wie betäubt zog Lilou sich aus dem Raum zurück. Erst im Flur holte sie ihr Mobiltelefon aus der Tasche und rief zuerst Demoireau, dann den Wachdienst in der Dienststelle an. Anschließend ging sie hinunter, um auf die Kollegen zu warten.
Der Streifenwagen war als Erstes da, ein Peugeot 308, der mit Blaulicht aus der Fußgängerzone kam und vor dem Haus hielt. Drei Kollegen stiegen aus. Jamal Emetoit, der große algerischstämmige Capitaine, nickte ihr zu und bedeutete ihr, vorauszugehen. Cropardin, dessen Berichte sie heute noch getippt hatte, und Valérie Cravasse folgten ihnen.
Oben angelangt, wies Emetoit Cropardin an, vor der Tür zu warten. In diesem Moment kam Claire die Treppe herunter und blieb mit weit aufgerissenen Augen stehen.
»Was ist denn passiert?«, fragte sie und sah erschrocken zu Lilou.
»Monsieur Benoit ist …«, begann sie.
»Bitte gehen Sie wieder nach oben«, fiel ihr Emetoit ins Wort. »Wir kommen später zu Ihnen.«
Seine hochgewachsene Gestalt und seine feste Stimme schienen Claire zu beeindrucken, denn sie drehte sich widerspruchslos um und stieg die Treppe hinauf. Lilou hätte ihr gern alles erklärt, aber Emetoit winkte sie zu sich. Sie sah Claire noch einen kurzen Moment hinterher, dann straffte sie die Schultern und folgte Emetoit und Cravasse in die Wohnung.
»Hast du etwas angefasst?«, fragte Emetoit. Er sprach mit leichtem Akzent, die kehligen Laute waren typisch für nicht in Frankreich geborene Algerier.
Lilou schüttelte den Kopf. »Er ist da drin«, sagte sie und deutete auf das Schlafzimmer. »Ich habe nur nach seinem Puls gefühlt«, fügte sie nach kurzem Zögern hinzu.
Emetoit nickte und betrat das Schlafzimmer, während Valérie Cravasse mit gezogener Waffe das Wohnzimmer sicherte. Als Lilou das sah, ärgerte sie sich über sich selbst. Auf die Idee, dass die Einbrecher noch da sein könnten, war sie vorhin gar nicht gekommen. Eine Nachlässigkeit, die sie leicht das Leben hätte kosten können.
Als sie Cravasse ins Wohnzimmer folgte, hörte sie unten Autotüren schlagen. Durchs Fenster verfolgte sie, wie drei Beamte der Spurensicherung aus dem blauen Bus der Police scientifique sprangen, der vor dem Haus gehalten hatte. Sie schleppten große Koffer mit sich, und kurz darauf hörte Lilou sie auf der Treppe miteinander sprechen.
Carpentras besaß eine eigene kleine Abteilung für Kriminaltechnik, die mit vier Beamten besetzt war: junge Männer, die Zivil trugen, keiner älter als 35, mit langen Haaren und Bärten in unterschiedlichen Wachstumsphasen. Auf der Wache blieben sie meist für sich in ihrem Kellerraum. Lilou hatte noch nicht mit ihnen zu tun gehabt; sie wusste nur, dass der mit der Brille mit Vornamen Guillaume hieß und Computerexperte war.
Die Männer stellten ihre Koffer im Flur vor Benoits Wohnung ab und stiegen in weiße Ganzkörperanzüge. Einer von den dreien sah sie und Valérie Cravasse im Wohnzimmer stehen und warf ihnen einen missbilligenden Blick zu.
»Ihr vernichtet da gerade Spuren, das wisst ihr, oder?«, rief er.
Emetoit kam aus dem Schlafzimmer. »Wenn du eine ungesicherte Wohnung durchsuchen willst, Karimi, dann nur zu.«
Der Angesprochene verzog das Gesicht. »Schon gut, Jamal«, sagte er. »Ich habe nur die Frauen da drin gesehen.«
Cravasse baute sich vor ihm auf, der Kriminaltechniker war einen halben Kopf kleiner als sie. »Falsche Antwort, Ebrahim«, sagte sie kalt und steckte die Waffe zurück ins Holster.
Karimi hob in gespielter Angst die Hände. »Schon gut, Valérie, ich habe es nicht so gemeint.« Dabei zwinkerte er ihr zu. »Ich bin natürlich froh, wenn du mich beschützt.«
Cravasse lachte nicht. »Hier ist niemand«, sagte sie zu Emetoit und ging hinaus zu Cropardin. Lilou war am Fenster stehen geblieben.
»Du gehst bitte auch raus«, sagte Ebrahim Karimi, der offenbar der Leiter des Trupps war. »Wir müssen hier arbeiten.«
»Aber ich …«
»Tout de suite.«
Der Tonfall des Mannes ließ keinen Widerspruch zu, und unwillig fügte sich Lilou. Sie hätte den Kollegen von der Spurensicherung gern bei der Arbeit zugesehen. Als ihm vorgesetzte Commissaire hätte sie auch darauf bestehen können. Aber im Moment war sie nur Praktikantin und hatte, so wie es aussah, überhaupt nichts zu sagen.