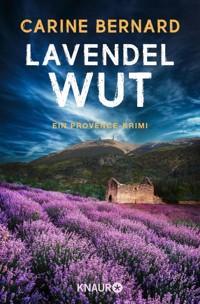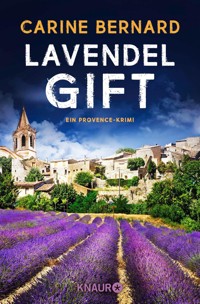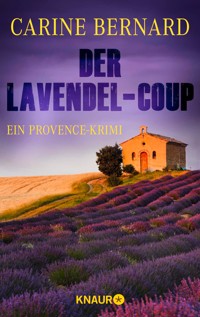4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Molly Preston ermittelt
- Sprache: Deutsch
Der neue Kriminalfall von Carine Bernards EU-Ermittlerin Molly Preston - Cosy Crime auf Mallorca! Molly verbringt mit ihrem Freud Charles einige Urlaubstage auf Mallorca. Bei einem Ausflug zur Dracheninsel Sa Dragonera lernt sie einen deutschen Auswanderer kennen, aus dessen Umfeld bald darauf ein junges Mädchen verschwindet. Molly wäre nicht Molly, würde sie nicht sofort ihre Hilfe bei der Suche anbieten. Dabei kommt sie einem rumänischen Rauschgiftsyndikat auf die Spur, was nicht nur sie, sondern auch Charles in Lebensgefahr bringt ... Ob in der sonnigen Provence, im grünen Yorkshire oder im kaiserlichen Wien – Molly Preston löst ihre Fälle mit Intelligenz, Charme sowie den Mitteln modernster Technik und entführt den Leser ganz nebenbei zu den schönsten Plätzen Europas. Neben Mallorce hat sie auch schon in England, der Provence und in Wien ermittelt. Die Cosy-Krimis um Molly Preston von Carine Bernard sind eine wunderbar stimmige Urlaubslektüre und in folgender Reihenfolge erschienen: - Der Lavendel-Coup (Provence) - Das Schaf-Komplott (England) - Die Schnitzel-Jagd (Wien) - Der Drachen-Klau (Mallorca)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 305
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Carine Bernard
Der Drachen-Klau
Ein Mallorca-Krimi
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Der neue Kriminalfall von Carine Bernards EU-Ermittlerin Molly Preston – diesmal auf Mallorca!
Molly verbringt mit ihrem Freund Charles einige Urlaubstage auf Mallorca. Bei einem Ausflug zur Dracheninsel Sa Dragonera lernt sie einen deutschen Auswanderer kennen, aus dessen Umfeld bald darauf ein junges Mädchen verschwindet. Molly wäre nicht Molly, würde sie nicht sofort ihre Hilfe bei der Suche anbieten. Dabei kommt sie einem rumänischen Rauschgiftsyndikat auf die Spur, was nicht nur sie, sondern auch Charles in Lebensgefahr bringt …
Carine Bernard entführt die Leser zu den schönsten Plätzen Europas.
Ebenfalls in der Reihe »Molly Preston ermittelt« sind erschienen: »Der Lavendel-Coup«, »Das Schaf-Komplott« und »Die Schnitzel-Jagd«.
Inhaltsübersicht
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
Rezept für Paella
Danksagung
KAPITEL 1
Molly Preston zog sich über den letzten Felsvorsprung nach oben und schlug dabei mehrere Drachen in die Flucht, die sich auf dem warmen Stein gesonnt hatten. Trockene Schuppen scharrten über den Boden, als die Tiere in schmalen Ritzen im Fels verschwanden. Dracheneidechsen! Sie sahen wirklich ein wenig wie kleine Drachen aus, und dass sie nur auf Sa Dragonera, der Dracheninsel, vorkamen, war sicher kein Zufall.
Molly stand auf und blickte sich um. Laut der Beschreibung des Geocaches sollte sie hier einen Hinweis finden, der sie zur nächsten Station führen würde. Doch da war nichts. Die Felsklippe war vollkommen kahl, und in den engen Spalten im Gestein versteckten sich nur die Eidechsen.
Molly hielt ihr erhitztes Gesicht in den lauen Wind und genoss für einen Augenblick die Illusion von Kühle. Wenigstens hatte sie von hier oben eine großartige Aussicht auf die wild zerklüftete Südwestküste Mallorcas, die sich gegenüber der kleinen Insel erstreckte. Wie Kulissen in einem Theater reihten sich die vorspringenden Felsen hintereinander auf und nahmen mit der Entfernung immer mehr die Farbe des Wassers an, das sie verband.
Ohne rechte Hoffnung auf einen Fund durchstöberte Molly die größeren Felsspalten, doch vergeblich. An der letzten Station hatte die Aufgabe gelautet, Buchstaben auf einem Schild zu zählen, und mithilfe dieser Zahl hatte sie die Position der nächsten Station berechnet. Die Koordinaten wiesen nach rechts in die Hügel, was Molly überraschte, denn immerhin befand sie sich in einem Naturschutzgebiet. Aber Geocaches führten nun einmal gern zu abgelegenen Stellen, die sonst niemand kannte, das machte einen der Reize dieses Hobbys aus. Sie hatte deshalb nur kurz gezögert, bevor sie vom Hauptweg abbog. Der anfangs noch deutlich ausgetretene Pfad verlief sich bald zu einer kaum sichtbaren Spur und endete oben auf der Felskuppe, auf der sie nun stand.
Sie seufzte und wandte sich ab. Der schmale Sims, der sie die letzten Meter hier heraufgeführt hatte, endete ein Stück unterhalb des Gipfels. Sie ließ sich vorsichtig hinunter, erschreckte eine weitere Eidechse und war froh, als sie den felsigen Pfad erreichte. Er war so schmal, dass ihre Schultern die Felswand neben ihr streiften, und das lose Gestein unter ihren Füßen erschwerte das Fortkommen. Prompt löste sich ein großer Stein unter ihrem Schuh. Sie stolperte und wäre fast gefallen, während der Brocken polternd über die steile Kante zu ihrer Linken hinunterhüpfte.
»Mierda!«
Der Ruf war nicht laut gewesen, aber Molly hatte ihn deutlich gehört. Sie verharrte mitten im Schritt und lauschte. Nichts, nur das Rascheln einer Eidechse im dürren Gestrüpp war zu vernehmen. Sie ließ sich auf die Knie fallen, um über die Kante zu blicken, und eine weitere Dracheneidechse huschte zwischen ihren Beinen davon. Ein zerzauster Olivenbaum, der sich unter ihr in die Felsen krallte, versperrte Molly die Sicht. Angestrengt spähte sie durch die Zweige, um einen Blick auf den Talgrund zu erhaschen, der vielleicht zehn Meter tiefer lag.
Sie kratzte die wenigen Brocken Spanisch zusammen, die sie beherrschte.
»Todo bien?« Ist alles in Ordnung?
Keine Antwort. Nicht einmal das Zwitschern von Vögeln war hier oben zu hören. Die Südhänge der Insel gehörten den Eidechsen; die Vögel brüteten auf der anderen Seite, in der steilen Felswand auf der Nordwestseite, die von Mallorca aus nicht zu sehen war.
Eigentlich gab es für Molly keinen Grund, noch länger zu zögern. Sie musste hinunter, musste nachsehen, was der losgetretene Stein angerichtet hatte. Doch das war leichter gedacht als getan. Die schmale Kante, auf der sie sich befand, bot keine Möglichkeit des Abstiegs. Sie führte am Fels entlang nach unten und verbreiterte sich irgendwann wieder zu so etwas Ähnlichem wie einem Trampelpfad, der ungefähr zweihundert Meter weiter in den Hauptweg der Insel mündete. Gar nicht ausgeschlossen, dass er von Geocachern ausgetreten worden war, die sich so wie sie an der vorherigen Station verrechnet hatten.
Molly kehrte um und eilte wieder hoch, zurück zu dem Felsen, von dem sie gerade gekommen war. Auf der anderen Seite lagen weitere Felsblöcke, übereinandergetürmt wie von einem Riesen verstreute Bauklötze, und dort suchte sie sich kletternd und rutschend ihren Weg nach unten. Die letzten Meter legte sie auf dem Hosenboden zurück und war froh über die Entscheidung, heute Morgen trotz der zu erwartenden Hitze feste Jeans angezogen zu haben. Ein stacheliger dunkelgrüner Busch bremste ihre Rutschpartie und hüllte sie in eine Wolke aus Rosmarinduft. Trotz ihrer Eile hielt Molly einen Augenblick inne, schloss die Augen und atmete tief und genussvoll ein. Die Nadeln des Strauchs waren kürzer und dichter, als sie es von den Gewürztöpfen in deutschen Supermärkten kannte, und rochen intensiv nach Süden, Sonne und Mittelmeer. Endlich war sie unten angelangt und bahnte sich rasch ihren Weg durch die dicht stehenden Pflanzen.
Erstaunlich grün war es in diesem Talgrund. Nicht nur Rosmarin und die dürren, namenlosen Gewächse, denen man ihre Widerstandskraft ansah, gediehen hier, sondern auch üppige Stauden mit sattgrünen gefiederten Blättern, und der Boden war bedeckt mit weißen Blüten. An einer Stelle versank ihr Fuß sogar in feuchter schwarzer Erde – irgendwo musste hier eine Quelle sein.
Sie orientierte sich an der Klippe, die immer noch rechts von ihr aufragte, und musterte mit zusammengekniffenen Augen den Fels. Ja, da oben war die Kante zu sehen, das musste die Stelle sein, wo sie den Stein losgetreten hatte. Sie umrundete eine weitere buschige Pflanze, die sich ihr ausladend in den Weg stellte. Der Bewuchs war hier so dicht, dass sie Gefahr lief, in zwei Meter Abstand an jemandem vorbeizulaufen, der auf dem Boden lag, ohne ihn zu sehen.
Da! Ein Stück vor ihr leuchtete etwas Blaues durch die Büsche. Sie pflügte sich die letzten Meter durch das Dickicht, ohne Rücksicht auf Zweige und Blätter zu nehmen. Eine weitere Wolke von Rosmarinduft stieg auf, gepaart mit anderen Gerüchen, holzig, würzig und ein wenig nach Heu. Doch jetzt ließ sie sich nicht mehr aufhalten, denn da vorne lag ein Mann, halb auf dem Rücken, den Arm wie schützend vor dem Gesicht, in einem verwaschenen blauen T-Shirt. Als Molly näher kam, bemerkte sie ein schmales Rinnsal aus Blut. Es lief über seine Wange und bildete auf dem T-Shirt einen leuchtend roten, feuchten Fleck, der langsam größer wurde.
Das Herz klopfte ihr bis zum Hals, und sie ging neben dem Mann in die Hocke. Als Erstes prüfte sie den Puls an seiner Halsschlagader. Zu ihrer Erleichterung fühlte sie sofort ein kräftiges, gleichmäßiges Pochen unter ihren Fingern. Sie wartete einige Sekunden, bis sie sicher war, dass es nicht ihr eigener Herzschlag war, den sie spürte. Der Mann lag halb auf einem großen braungrünen Rucksack, der wohl seinen Sturz gedämpft hatte. Sie befreite seinen Arm aus dem Gurt und zog den Mann in eine stabile Seitenlage, das obere Bein angewinkelt, den Kopf auf den unteren Arm gebettet. Vorsichtig fädelte sie den Schulterriemen der anderen Seite aus der Schnalle, zog ihn unter dem Mann hervor und schob den Rucksack zur Seite. Er war erstaunlich schwer. Sie hob ihn an und hörte metallisches Klirren.
Das Geräusch schien den Mann geweckt zu haben, denn er schlug die Augen auf. Sie waren vergissmeinnichtblau und starrten sie verständnislos an.
»Está bien«, murmelte Molly beruhigend und verfluchte ihre fehlenden Sprachkenntnisse. Sie beherrschte neben Deutsch auch Englisch, Französisch und Japanisch wie ihre Muttersprache, doch das hatte sie den verschiedenen Nationalitäten ihrer Großeltern zu verdanken und nicht ihrem Talent für Fremdsprachen.
»Qué …?«, krächzte der Mann. »Qué ha pasadó?«
»Un accidente«, erwiderte Molly und hoffte, dass das Wort im Spanischen das Gleiche bedeutete wie im Französischen: ein Unfall.
Der Mann versuchte sich aufzurichten und griff sich stöhnend an den Kopf. Er starrte auf seine blutigen Finger, verdrehte die Augen und verlor erneut das Bewusstsein.
Molly musterte ihn unschlüssig. Sie hatte nichts dabei, um die Wunde richtig zu versorgen. Nur eine Packung Taschentücher fand sich in ihrer Umhängetasche, in die sie heute Morgen noch zwei Äpfel und eine inzwischen halb leere Wasserflasche gepackt hatte. Kurz entschlossen wandte sie sich dem Rucksack des Mannes zu. In einer der unzähligen Außentaschen hoffte sie, Verbandsmaterial oder zumindest eine Packung mit Heftpflastern zu finden.
Sie fühlte sich wie ein Eindringling, während sie den Rucksack durchsuchte. In den beiden Seitentaschen steckten Wasserflaschen, eine war fast leer. Im Vorderfach fand sie ein gut bestücktes Schweizer Messer, eine Pflanzenschere und eine leere Plastiktüte, in dem kleinen Fach darunter eine Spule Bindfaden, eine Rolle Draht und mehrere Klipse, wie sie zum Hochbinden von Pflanzen verwendet werden. Sie öffnete die obere Klappe des Rucksacks, zog die Kordel des Hauptfachs auf und blickte auf Rosmarinzweige und einen offenen Leinenbeutel mit weiteren Blättern und Blüten. Ein durchdringender Geruch erfüllte die Luft, und sie runzelte die Stirn. Im Naturschutzgebiet war das Sammeln von Pflanzen doch strengstens verboten? Doch das erklärte wenigstens, warum er hier abseits der Wege unterwegs war. Im Deckel des Hauptfachs befand sich ein weiterer Reißverschluss, und hier wurde sie fündig: Eine Rolle Leukoplast fiel ihr entgegen.
Sie befeuchtete ein Taschentuch mit Wasser aus einer der Flaschen und tupfte dem Mann das Blut von der Wange. Es sickerte noch immer aus der kleinen Risswunde, die der Stein hinterlassen hatte. Darunter bildete sich bereits eine deutlich sichtbare Beule. Molly fuhr fort, sein Gesicht zu reinigen. Zum Schluss wusch sie die Wunde selbst mit reichlich Wasser aus, und der Mann zuckte trotz seiner Bewusstlosigkeit zusammen. Das letzte Taschentuch faltete sie zu einem festen Kissen, riss drei Pflasterstreifen ab und versorgte den Riss mit einem provisorischen Druckverband, der die Blutung stillen sollte.
Nachdem sie das letzte Pflaster angebracht und den Sitz des Verbandes geprüft hatte, kam sie endlich dazu, den Mann zu betrachten, der vor ihr auf dem steinigen Boden lag. Er war nicht mehr jung, Anfang sechzig vielleicht. Sein schütteres Haar war eisengrau, und unzählige Fältchen durchzogen sein gebräuntes Gesicht, zu dem die hellblauen Augen gar nicht passen wollten. Das Kinn bedeckten Bartstoppeln, kein gepflegter Dreitagebart, sondern Zeichen einer schlampigen Rasur. Insgesamt erinnerte er Molly an einen alternden Hollywood-Schauspieler, doch sie kam nicht auf den Namen.
Unschlüssig sah sie auf die Uhr. Die letzte Fähre zurück zum Hafen von Sant Elm ging um 15.00 Uhr, und es war bereits kurz vor zwei. Doch den Mann hier allein zurückzulassen kam natürlich nicht infrage. Ob die Nationalpark-Ranger sie suchen würden, wenn sie zur Abfahrt des Bootes nicht an der Anlegestelle war? Immerhin wurden alle Besucher gezählt und registriert, die auf die Insel kamen, und es war streng verboten, hier zu übernachten. Wer die Insel besuchte, musste am selben Tag auch wieder zurück.
Der Mann bewegte sich. Langsam öffnete er die Augen und blinzelte ins helle Licht der Nachmittagssonne, während er mit der Hand über den Boden tastete. Er setzte sich auf und schwankte ein wenig. Molly griff zu, um ihn zu stützen.
Er wich ängstlich vor ihr zurück, sah sich hektisch um und hob abwehrend die Hände.
»No, por favor, no!«, rief er und versuchte aufzustehen. Seine Stimme klang rau, Angst schwang darin mit, doch dann klärte sich sein Blick, und bei Mollys Anblick schien er sich zu entspannen.
»Sprechen Sie Deutsch? Do you speak english?«, fragte Molly und bemühte sich um einen beruhigenden Klang. »Haben Sie keine Angst, ich tue Ihnen nichts.«
Er sah sich nochmals um und antwortete zögernd: »Ja, ich spreche Deutsch.« Vorsichtig befühlte er den Verband an seinem Kopf. »Warst du das?«
»Ja. Ich habe Sie verbunden«, erwiderte sie. »Ich fürchte, ich bin auch schuld an Ihrem Unfall«, gab sie zu.
»Wie meinst du das?« Sein Deutsch war eindeutig gefärbt, Molly tippte auf Ruhrgebiet.
»Ich war da oben«, sagte sie und wies mit der Hand auf die Felswand über ihnen. »Ein Stein hat sich gelöst und …«
»… und hat mich ausgeknockt«, beendete der Mann ihren Satz. Er lachte trocken auf. »Was tust du hier, abseits der Wege?«
»Das Gleiche könnte ich Sie auch fragen«, gab Molly zurück. Sie mochte sein vertrauliches Du nicht und betonte das Sie, wodurch der Satz unfreundlicher klang als gewollt.
Der Mann runzelte die Stirn und machte Anstalten, sich zu erheben.
»Warten Sie, ich helfe Ihnen«, bot Molly an und reichte ihm den Arm. Er ignorierte sie, doch als er stand, knickten seine Knie ein, und er griff haltsuchend nach ihrer Schulter.
Sein Blick fiel auf die geöffnete Klappe des Hauptfachs. »Hast du meinen Rucksack durchsucht?«, fragte er misstrauisch.
»Ich habe nach Verbandszeug gesucht, um Ihre Wunde zu versorgen«, rechtfertigte sie sich. »Was Sie hier tun, interessiert mich herzlich wenig.«
Die Stimmung war auf einmal frostig, und Molly befreite ihre Schulter aus seinem Griff. Mit einem Blick auf sein blasses Gesicht zog sie ihr Handy aus der Tasche.
»Sie haben wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung«, sagte sie. »Ich rufe jetzt Hilfe, denn so schaffen Sie es nie zurück.«
»Lass das«, brummte der Mann unwirsch und griff nach ihrem Telefon. »Ich brauche keine Hilfe.«
Molly trat einen Schritt zurück und brachte ihr Handy aus seiner Reichweite. »Aber Sie müssen …«
»Nichts muss ich. Ich will keine Hilfe. Ich schaffe das schon.«
Er machte ein paar Schritte und verlor erneut das Gleichgewicht. Molly konnte ihn gerade noch auffangen und taumelte unter seinem Gewicht.
»Das ist doch Unsinn! Sie sehen doch selbst, dass das nicht geht«, beschwor sie ihn.
Er schaute sie aus seinen blauen Augen an, und Molly fiel auf, dass die Augäpfel gerötet und die Bindehäute entzündet waren. Aber wenigstens waren die Pupillen gleich groß und verengten sich, als ihm die Sonne in die Augen schien. Ein gutes Zeichen.
»Ich habe keine Krankenversicherung«, murmelte er und sah sie dabei nicht an. »Wenn du jetzt den Rettungsdienst anrufst, muss ich das aus eigener Tasche bezahlen, und das kann ich mir einfach nicht leisten. Deshalb werde ich das alleine schaffen. Ich muss es schaffen«, betonte er.
Keine Krankenversicherung? Dass so etwas in Europa noch möglich war, hätte Molly nicht gedacht. Das änderte natürlich alles und bürdete ihr die Verantwortung für ihn auf. Schließlich hatte sie ihn in diese Lage gebracht.
»In Ordnung«, sagte sie. »Aber ich helfe Ihnen.« Das war das Mindeste, was sie für ihn tun konnte.
Er blickte sie zweifelnd an. »Wie willst du kleines Persönchen mir helfen? Willst du mich tragen?«
Er lachte trocken auf, bückte sich nach einer braunen Schirmkappe, die unter ihm gelegen hatte, und setzte sie auf. Dann griff er nach seinem Rucksack.
»Was hast du damit gemacht?«, fragte er und hielt den gelösten Schulterriemen in die Höhe.
»Ich musste Sie doch aus dem Rucksack befreien.« Sie nahm ihm den Gurt aus der Hand und zog ihn wieder durch die Schnalle. »Ich nehme den Rucksack. Sie werden genug damit zu tun haben, sich auf den Beinen zu halten.«
Der Mann brummte etwas, das als Zustimmung durchgehen konnte, und wandte sich zum Gehen. Mit vorsichtigen Schritten suchte er sich seinen Weg zwischen den Büschen und Sträuchern. Die größeren umrundete er, als würde er vermeiden wollen, die Blätter zu berühren. Molly folgte ihm, den großen Rucksack auf dem Rücken und ihren kleinen Beutel in der Hand.
Es gab hier keinen Weg. Das halbhohe Strauchwerk bildete ein wahres Labyrinth schmaler Trampelpfade, die der Mann vor ihr wie seine Westentasche zu kennen schien. Der Boden war trocken und steinig, und auch die Vegetation änderte sich. Zum Ausgang des Tals hin nahmen struppige, dürre Sträucher zu, gelb blühender Ginster und knorrige Olivenbäume krallten sich in den Boden. Schon konnte Molly den gepflasterten Hauptweg ein Stück voraus erkennen, der von der Anlegestelle zum Leuchtturm Far de Llebeig führte. Kein Mensch war weit und breit zu sehen, die letzten Wanderer hatten sich bestimmt schon an der Ranger-Station versammelt. Molly erkannte in der Ferne das kleine Fährboot auf dem Wasser, das sich schnell dem natürlichen Hafen näherte. Die Zeit wurde knapp, selbst ohne ihren verletzten Begleiter würde sie es kaum noch schaffen.
Am Weg angekommen, wandte sich der Mann zu ihrer Überraschung nach rechts, weg vom ungefähr fünfhundert Meter entfernten Anleger.
»Wo wollen Sie hin? Die Anlegestelle ist doch da drüben?«, fragte sie und blieb stehen.
»Ich habe mein eigenes Boot hier«, antwortete er kurz angebunden und deutete mit der Hand vage in Richtung Süden. »Es liegt da unten in einer Bucht.«
»Aber ich muss zur Fähre, man wird mich sonst vermissen!«
Der Mann sah auf die Uhr. »Die erwischst du sowieso nicht mehr.« Er überlegte kurz und zog ein altmodisches Klapphandy aus der Tasche. »Ich kläre das.«
Er tippte eine Nummer in die Tasten und sprach schnell einige Worte auf Spanisch.
»Soy Gabriel«, verstand sie. Ich bin’s, Gabriel. Dem Rest konnte sie nicht folgen.
»Ich kenne den Ranger«, erklärte der Mann – Gabriel –, nachdem er das Gespräch beendet hatte. »Ich habe ihm gesagt, dass du bei mir bist.«
Molly hob die Augenbrauen und sagte nichts. Gabriel drehte ihr den Rücken zu und schritt jetzt schneller aus, sodass ihr nichts anderes übrig blieb, als ihm zu folgen. Vielleicht zweihundert Meter weiter bog er nach links auf einen kleinen Pfad ab, den Molly niemals wahrgenommen hätte, so unauffällig schlängelte er sich zwischen den Felsen nach unten. Das letzte Stück war steil, und staunend blickte sie in das glasklare Wasser einer kleinen Bucht, in der sich der Meeresgrund in wunderschönen Blautönen abzeichnete. Erst als sie ganz unten war, kam ein blaues Boot mit Außenbordmotor in Sicht, das bis zuletzt hinter einem Felsvorsprung verborgen gewesen war.
Gabriel war die Anstrengung jetzt deutlich anzumerken. Sein Gesicht war schweißüberströmt, und er keuchte laut und deutlich.
»Geht es Ihnen gut?«, fragte Molly besorgt.
Er nickte knapp. »Wir haben es ja fast geschafft«, gab er zurück. »Kannst du das Tau einholen?« Er deutete auf eine Spalte zwischen den Steinen, in der ein Seil mit einem dicken Knoten am Ende lag. Molly zog das Boot heran und hielt es fest, während er hineinkletterte. Es war winzig, eigentlich nur ein Ruderboot, das mithilfe des im Heck eingehängten Motors angetrieben und gesteuert wurde. Sie reichte ihm den Rucksack, bevor sie selbst über die niedrige Bordwand auf die schwankenden Bretter stieg und auf der Bank im Heck Platz nahm. Gabriel saß auf dem Boden, gegen die Seitenwand gelehnt, und war offenbar am Ende seiner Kräfte.
»Ich hoffe, du kannst mit so einem Boot umgehen«, murmelte er und schloss die Augen.
Molly reichte ihm die Wasserflasche. »Hier, trinken Sie etwas.«
Drei Züge am Anlasser brauchte sie, bis der Motor ansprang, aber schließlich tuckerte das Bötchen aus der Bucht aufs offene Meer hinaus. Molly blickte zurück und musste den Kopf in den Nacken legen, denn die Schulter des »Drachens«, den die Insel Sa Dragonera bildete, ragte hoch über ihr auf. Sie wandte sich wieder um. Der Hafen von Sant Elm schien keinen Meter näher gekommen zu sein. Gabriels kleines Motorboot war natürlich nicht so schnell wie die Fähre, die die Touristen mehrmals am Tag auf die Dracheninsel transportierte. Sie würden wohl einiges länger als die zwanzig Minuten benötigen, die ihre Hinfahrt gedauert hatte.
»Wie heißt du?« Das Sitzen schien Gabriel gutzutun, er sah jetzt nicht mehr so blass aus wie noch vor einigen Minuten.
»Ich bin Molly Preston«, stellte sie sich vor. »Und Sie sind Gabriel?«, fragte sie.
Er nickte. »Gabriel Foster. Und du musst mich nicht siezen. Mich duzen hier alle«, brummte er und blinzelte ihr zu. »Machst du hier Urlaub? Wo wohnst du?«
»Ja, Urlaub. Ich wohne in Andratx.«
»Ganz allein?« Gabriel musterte sie aus zusammengekniffenen Augen, ließ seinen Blick über den zerzausten Pferdeschwanz, ihre verschwitzte Bluse, die staubigen Jeans und die Wanderstiefel schweifen. »Ein Mädchen wie du macht doch nicht allein Urlaub!«
Molly antwortete nicht gleich. Eine kleine Wolke verdunkelte die Sonne und warf einen Augenblick lang ihren Schatten auf das Boot. Sie räusperte sich.
»Nein, mein Freund ist auch hier«, sagte sie schließlich. »Aber er muss arbeiten.«
»Arbeiten, so, so. Was arbeitet er denn?«
»Er ist Schriftsteller. Er schreibt gerade an einem Krimi, der auf Mallorca spielt.«
»Na hoffentlich hat er trotzdem genug Zeit für dich.«
Molly wollte nicken, aber dann entschied sie sich anders. Falls Gabriel es sonderbar fand, dass sie allein unterwegs war, während Charles arbeitete, so ließ er es sich nicht anmerken. Immerhin, denn sie selbst fand es – nun, zumindest ungewöhnlich. Nicht, dass sie nicht gern für sich war, und sie konnte sich auch hervorragend allein beschäftigen. Doch der gemeinsame Urlaub mit ihrem Freund, den sie ohnehin viel zu selten sah, war schon lange geplant gewesen. Dass sie jetzt wieder einmal hinter einem seiner Projekte zurückstehen musste, wurmte sie. Charles’ Verlag hatte den Veröffentlichungstermin für seinen neuen Roman kurzerhand um drei Monate vorverlegt. Deshalb musste er jetzt schreiben und recherchieren und in Gedanken einen komplizierten Kriminalfall entwickeln – für Urlaub blieb da so gut wie keine Zeit.
»Aber ich arbeite nicht vierundzwanzig Stunden am Tag und auch nicht sieben Tage die Woche«, hatte er noch am Telefon zu ihr gesagt. »Es ist wunderschön hier, und ich würde mich wirklich freuen, wenn du kommst.«
Freunde hatten Charles ihr Stadthaus in Andratx zur Verfügung gestellt, ein schmales, hohes Gebäude im Zentrum der kleinen Stadt, das unter Denkmalschutz stand. Es hatte zwei Gästezimmer, einen beeindruckenden Weinkeller und eine herrliche Dachterrasse, auf der Charles tagsüber an seinem Buch schrieb, wenn er nicht gerade unterwegs war und in staubigen Archiven und Bibliotheken irgendwelche Dinge recherchierte.
»Ein Mädchen wie du findet hier sonst sicher schnell einen anderen.« Gabriel hatte sie nicht aus den Augen gelassen und zwinkerte ihr jetzt anzüglich zu.
Ganz unrecht hatte er natürlich nicht. Molly wusste selbst, dass ihre dunkelblauen Augen in Verbindung mit dem leicht asiatischen Schnitt ihres Gesichts und dem glänzenden schwarzen Haar die Aufmerksamkeit der Männer auf sich zogen, wenn sie es darauf anlegte.
»Nein danke, kein Interesse.« Molly verpackte die Zurückweisung mit einem verschmitzten Lächeln. »Und wenn doch, brauche ich ja nur an den Ballermann zu gehen.«
»Was willst du denn am Ballermann? Hier ist es doch viel schöner!« Gabriel wandte sich um, streckte seinen Arm aus und umfasste mit einer Bewegung das vor ihnen liegende Panorama.
Damit hatte er allerdings recht, der Anblick des südwestlichen Teils von Mallorca war atemberaubend. Inzwischen waren sie nahe an die Küste herangekommen, und Molly konzentrierte sich wieder darauf, das Boot zu steuern. Geschickt lenkte sie es zwischen den anderen Booten hindurch, Fischerboote, Segelschiffe und sogar eine kleine Jacht, die in der Bucht von Sant Elm vor Anker lagen. Gabriel dirigierte sie in den kleinen Hafen, vorbei an dem betonierten Pier, an dem das Fährboot anlegte, zu einer von zwei Rampen, die vom Strand ins Wasser führten. Das Boot stieß gegen die Mauer, eine Möwe kreischte beleidigt und gab ihren Platz auf einem der Poller auf. Gabriel kam schwankend auf die Beine, griff nach dem Poller und kletterte seitlich aus dem Boot. Molly reichte ihm die Leine hoch, stellte den Motor ab und kippte ihn nach vorne, sodass der Propeller aus dem Wasser ragte. Gabriel hielt die Bordwand fest, und sie stieg ebenfalls aus. Gemeinsam zogen sie das Boot über die Rampe zu seinem Liegeplatz am Fuß einer Felswand, wo schon mindestens zwanzig weitere baugleiche Boote in bunten Farben lagen.
Diese letzte Anstrengung war fast zu viel für Gabriel gewesen. Sein Gesicht war wieder blass geworden, und Schweißtropfen standen auf seiner Stirn.
»Und jetzt?«, fragte Molly. »Wo müssen Sie – musst du hin?«
»Ich wohne da oben.« Mit der Hand deutete er die Straße hoch. »Ein Stück außerhalb von Sant Elm.«
Sie sah sich um. »Hast du ein Auto?«
»Ja, der Pick-up dort drüben. Es geht gleich wieder.« Er stützte sich an der Felswand ab und rang nach Luft.
»In dem Zustand darfst du nicht Auto fahren. Nicht hier in den Bergen.« Molly blickte ihn besorgt an. »Kann ich dich nicht fahren? Wie weit ist es denn?«
»Nicht weit. Vielleicht eineinhalb Kilometer von hier.«
»Dann fahre ich dich. Keine Widerrede. Ich kann nachher zurücklaufen«, sagte sie bestimmt. Falls Gabriel tatsächlich eine Gehirnerschütterung hatte, war damit nicht zu spaßen.
Zu ihrem Erstaunen nickte er zustimmend. Offenbar machte ihm die Verletzung doch mehr zu schaffen, als er zugeben wollte.
Molly ließ sich von ihm die Autoschlüssel geben und holte den Wagen, einen riesigen, staubigen Pick-up, der innen jedoch erstaunlich sauber war. Vorsichtig steuerte sie ihn die steile Straße zum Kai hinunter. Danach holte sie den Bootsmotor und den Rucksack aus dem Boot und verstaute beides auf der Ladefläche.
Gabriel hatte in der Zwischenzeit auf dem Beifahrersitz Platz genommen und schien ganz froh zu sein, sich um nichts kümmern zu müssen. Molly legte den Rückwärtsgang ein und setzte den Wagen zurück, bis sie wenden konnte. Die engen Gassen rund um den Ortskern von Sant Elm waren mit dem langen Radstand eine Herausforderung, aber sie meisterte auch diese. Am Ortseingang atmete sie auf und bog in die Hauptstraße ein.
»Und jetzt?«, fragte sie.
»Nach rechts«, erwiderte Gabriel und deutete in Richtung Andratx.
Gabriels Zuhause erwies sich als eine Finca, die an der Hauptstraße nach Andratx lag. Von der Straße bis zum Haus, dessen Silhouette Molly zwischen den Bäumen ausmachen konnte, erstreckte sich ein Feld mit niedrigen dunkelgrünen Sträuchern. Sie bog in die Einfahrt ein und folgte einer geschotterten Straße, die auf die fensterlose Rückseite eines kleinen zweigeschossigen Gebäudes aus gelbbraunem Stein zuführte und sich dahinter zu einem sandigen Platz verbreiterte. Gabriel deutete auf einen riesigen Olivenbaum, ein uraltes Exemplar, und Molly parkte den Pick-up in seinem Schatten.
Das Wohnhaus war alt und im typischen mallorquinischen Stil erbaut. Nur der hintere Teil des Gebäudes, den sie von der Straße aus gesehen hatte, besaß ein Obergeschoss. Das schräge Dach überragte die untere Etage und beschattete eine kleine Dachterrasse, um die sich eine blühende Bougainvillea rankte. Hinter dem Olivenbaum erstreckte sich ein langer flacher Ziegelbau mit Wellblechdach. Ein kleiner Traktor, ein hoher Wassertank und unterschiedlichste Gerätschaften zeugten davon, dass diese Finca mehr war als der Wohnsitz eines deutschen Auswanderers: Hier wurde landwirtschaftlich gearbeitet.
Molly stieg aus und sah sich um. Jetzt erst erkannte sie die Pflanzen, die in dichten, unregelmäßigen Reihen die gesamte Fläche bis zur Straße bedeckten.
»Du pflanzt hier Rosmarin an?«, wunderte sie sich. Schließlich wuchs Rosmarin auf Mallorca wild an jeder Straßenecke.
Gabriel warf die Autotür ins Schloss und nickte. »Ich stelle daraus ein besonderes ätherisches Öl her«, erklärte er. »Bei meinen eigenen Pflanzen weiß ich, dass sie keine Rückstände von Pflanzenschutzmitteln enthalten und auch sonst kein Gift drin ist.«
»Und das da hinten ist deine Fabrik?«, fragte sie und deutete auf das lang gestreckte Gebäude im Hintergrund.
»Genau. Der Trockenraum, die Destille und die Abfüllanlage.«
Molly war beeindruckt. »Wofür verwendet man denn das Öl?«, erkundigte sie sich. »Zum Kochen?«
»Aber nein!« Gabriel grinste. Er schien sich über ihre Unwissenheit köstlich zu amüsieren. »Ätherisches Rosmarinöl benötigt man für Kosmetika und in der Naturheilkunde. Ich liefere es an eine Freundin, und die macht daraus Seife, Massageöl und solche Sachen, die sie auf den lokalen Märkten verkauft. Einen Teil fülle ich hier direkt in Kapseln ab, zur inneren Anwendung. Wir nennen es Aceite de drago, Drachenöl, weil die Pflanzen von Sa Dragonera stammen.«
»Und deshalb warst du …« Jetzt ging Molly ein Licht auf.
»Richtig. Deshalb war ich auf der Insel. Ich habe Stecklinge für meine Plantage geschnitten.«
»Ist das nicht verboten? Die Insel ist doch als Naturschutzgebiet ausgewiesen!«
Gabriel seufzte. »Ja, du hast recht«, gab er zu. »Deshalb bin ich auch so erschrocken, als du mich da erwischt hast. Aber weißt du«, er sah sie aus seinen blauen Augen treuherzig an, »der Rosmarin von Sa Dragonera ist etwas ganz Besonderes. Von der chemischen Zusammensetzung ähnelt er mehr dem Rosmarin, der in Nordafrika wächst. Damit hat er eine andere Wirkung als der normale spanische Rosmarin. Von Zeit zu Zeit hole ich mir Stecklinge von der Insel und kultiviere sie hier auf meiner Finca. Ich mache es sehr vorsichtig und beschneide nur die kräftigsten Pflanzen. Ich füge der Natur damit kaum einen Schaden zu.«
Molly hob die Schultern. Im Grunde ging sie das nichts an, und seine Straftat war harmlos im Vergleich zu den Verbrechen, mit denen sie es sonst zu tun hatte. Sie arbeitete als Ermittlerin für eine geheime EU-Abteilung, die sich mit der Aufklärung von Wirtschaftskriminalität befasste, und hatte schon einige zwielichtige Wirtschaftsspione und skrupellose Finanzjongleure hinter Gitter gebracht.
»Wie geht es deinem Kopf?«, fragte sie, während sie seinen Rucksack von der Ladefläche hob.
»Wird schon«, brummte er zur Antwort. Offenbar hatte er den Anlass ihrer Bekanntschaft zwischenzeitlich schon vergessen und wurde nun schmerzhaft daran erinnert.
»Du solltest dich hinlegen und ausruhen. Und falls dir übel wird oder es morgen nicht besser ist, dann …«
»Ja, ja«, unterbrach er sie brüsk. »Ich weiß schon, was ich tue.«
Er schulterte seinen Rucksack und stapfte auf den Ziegelbau zu.
»Dann gehe ich jetzt«, rief Molly ihm hinterher, doch Gabriel drehte sich nicht mehr um.
Molly zuckte mit den Achseln und wandte sich zum Gehen, da erklang das Geräusch eines Motorrads von der Straße her. Es kam rasch näher, und im nächsten Augenblick knatterte eine staubige Geländemaschine die Schotterstraße hoch. Eine Wolke dunkler Locken umflatterte den Kopf der schmalen Gestalt, die darauf saß. Sekunden später brachte das Mädchen die hochbeinige Kawasaki schlitternd zum Stehen.
»Hola, Gabriel!«, rief sie und stieg ab. Während sie die Maschine auf den Seitenständer stellte, musterte sie Molly misstrauisch aus zusammengekniffenen Augen. Sie trug weder Helm noch Motorradkleidung.
»Hola, Mattea!« Gabriel winkte ihr zu und kam wieder heran. Den Rucksack hatte er offenbar an der Fabrikhalle gelassen, denn seine Hände waren leer. Herzlich schüttelte er Mattea die Hand.
Das Mädchen sah aus wie gerade sechzehn geworden, obwohl sie wahrscheinlich älter sein musste, um so eine Maschine fahren zu dürfen. Andererseits erweckte sie nicht den Eindruck, als würde sie viel darum geben, was erlaubt war und was nicht. Sie trug ein auffälliges pinkfarbenes Top, das ein bunter Paradiesvogel zierte, und kurz abgeschnittene Jeans. Aus den ausgefransten Säumen ragten schlanke, tief gebräunte Beine, und die Füße steckten in rosaroten Sneakers. Der Fahrtwind hatte die Haare zerzaust, das hübsche Gesicht mit dem spitzen Kinn war staubbedeckt. Ihre schwarzen Augen glänzten, aber ihr grimmiger Gesichtsausdruck zerstörte den Eindruck von Lieblichkeit, der das Mädchen ansonsten umgab.
Mattea warf Molly erneut einen bösen Blick zu und packte Gabriel am Arm. Sie redete auf ihn ein, und ihr Spanisch klang wie eine Maschinengewehrsalve, während sie ihn von Molly wegzog. Er befreite seinen Arm und sah über die Schulter zu Molly; anscheinend fragte er sich, warum sie noch immer hier herumstand. Es war mehr als deutlich, dass ihre Anwesenheit nicht mehr erwünscht war.
»Auf Wiedersehen«, rief sie so freundlich wie möglich und beeilte sich, die Finca hinter sich zu lassen. Im Gehen warf sie einen Blick auf die Uhr. Es war inzwischen nach fünf, Charles wunderte sich bestimmt schon, wo sie blieb. Wie auf Kommando brummte ihr Handy, eine WhatsApp-Nachricht von Charles.
»Wo steckst du? Ich bin fertig für heute.«
»Ich auch«, schrieb sie zurück und wandte sich an der Hauptstraße nach links auf Sant Elm zu.
Der Asphalt der Straße strahlte die Hitze des Tages ab. Die Straße war stark befahren, und die Autofahrer nahmen auf die einsame Wanderin nicht viel Rücksicht. Mehrmals musste Molly in den Straßengraben ausweichen oder sich an die steinige Böschung drücken, weil die Autos mit nur wenigen Zentimetern Abstand an ihr vorbeibrausten. Ein glutäugiger Schönling in einem offenen Cabriolet, der ebenfalls nach Sant Elm unterwegs war, verlangsamte seine Fahrt, und sie dachte schon, er wolle sie mitnehmen. Doch dann sah er ihr verschwitztes Gesicht, hupte kurz und drückte das Gaspedal durch. Fast im Laufschritt legte sie die letzten zweihundert Meter zurück. Nur weg von dieser Straße.
Erleichtert ließ sie sich auf den Sitz des kleinen Mietwagens fallen, den sie auf dem Parkplatz am Rand von Sant Elm abgestellt hatte. In ihrer Wasserflasche war nur noch ein Rest Wasser, den sie austrank, bevor sie den Motor startete und zurück nach Andratx fuhr.
Die Straße war eng und kurvig, und Molly fiel auf, dass die entgegenkommenden Fahrzeuge genauso wenig Rücksicht auf sie und ihr Auto nahmen wie zuvor auf die einsame Fußgängerin. Ein Wagen mit spanischem Kennzeichen überholte sie mit halsbrecherischer Geschwindigkeit an einer unübersichtlichen Kurve und musste scharf bremsen, als ihm ein Lastwagen entgegenkam. Endlich weitete sich das Tal. Die Häuser an den umliegenden Hängen wurden immer größer, bis nur noch Villen mit türkisblauen Swimmingpools die Landschaft sprenkelten. Sie passierte die Stadtgrenze von Andratx und bog ab zur Stadtmitte.
Charles drückte ihr ein Glas gekühlten Rosé in die Hand, bevor er ihr zur Begrüßung einen Kuss auf die Wange gab.
»Du willst sicher duschen, bevor wir essen«, sagte er und zwinkerte ihr zu.
»Du meinst, so schmutzige Gesellschaft möchtest du beim Essen nicht haben?«, gab sie zurück, aber sie lachte dabei, denn sie sehnte sich selbst nach einer Dusche.
In ein leichtes Wickelkleid aus Seide gehüllt, stieg sie anschließend die steile Treppe zum Obergeschoss hinauf und trat auf die Dachterrasse. Charles hatte in einem Buch gelesen, nun hob er den Kopf und sprang sofort auf. Lächelnd kam er ihr entgegen und schloss sie in die Arme.
»Hmm, du riechst gut«, sagte er.
»Ich habe die Seife benutzt, die im Bad lag«, erwiderte sie.
»Ah. Die habe ich auf dem Markt gekauft. Drachenölseife, mit Rosmarin von der Dracheninsel, wie mir die Verkäuferin erklärt hat.«
»Nein, wirklich?« Molly lachte. »Ich habe heute den Mann kennengelernt, der das Rosmarinöl dafür herstellt«, erzählte sie.
Charles runzelte die Stirn. »War der auch auf Sa Dragonera?«, fragte er.
»Ja, sozusagen. Ich meine, also …« Molly holte tief Luft. »Ich bin auf der Suche nach einer Station des Geocaches vom Weg abgekommen und habe dabei einen Stein losgetreten, der ihn getroffen hat. Ich musste ihn verarzten und habe ihm anschließend geholfen, nach Hause zu kommen.«
Charles grinste schief. »Hat dein Helfersyndrom also wieder zugeschlagen?«
»Ich habe doch kein Helfersyndrom«, widersprach Molly empört. »Ich war schließlich schuld daran, dass er verletzt wurde. Da ist es doch klar, dass ich ihm helfen musste.«
Molly runzelte die Stirn. Sie und ein Helfersyndrom? Das war ja lächerlich!
»Wieso konntest du nicht einfach die Notrufnummer wählen und es den Profis überlassen?«
»Er hat gesagt, er habe keine Krankenversicherung und könne so einen Einsatz gar nicht bezahlen«, rechtfertigte sie sich. »Außerdem bin ich selbst Profi.«
»Ja, natürlich bist du das«, murmelte Charles.
Molly machte sich los und trat an die Brüstung der Terrasse. Die abendliche Brise streichelte ihr Haar, das noch feucht von der Dusche war. Sie atmete tief durch. Hoch am Himmel blinkten bereits die ersten Sterne.
»Entschuldige bitte.« Charles war hinter sie getreten. »Ich wollte dir keinen Vorwurf machen.«
Molly drehte sich um und sah zu ihm hoch. »Es ist schon gut. Vielleicht hast du ja recht.«
»Selbst wenn, ich möchte dich gar nicht anders haben«, flüsterte er und küsste sie auf den Mund. Molly schlang die Arme um seinen Nacken und erwiderte den Kuss. Lange standen sie so da, aber irgendwann lösten sie sich voneinander, und Charles zog sie mit sich zum Tisch.
»Hast du keinen Hunger?«
»Doch, sehr großen Hunger sogar«, antwortete sie.
»Heute gibt es Tapas«, erklärte er feierlich. »Ich war extra auf dem Markt und habe frische Sachen eingekauft.«
»Das sieht ja wundervoll aus!« Molly musterte voller Freude die Leckereien, die Charles aufgetischt hatte, während ihr das Wasser im Mund zusammenlief. Da waren Schüsseln mit schwarzen und grünen Oliven, Teller mit kleinen Fleischbällchen, gegrillte Paprikaschoten, geröstetes Brot, dunkelroter Schinken, Spießchen mit Fleisch, hellrote Wurst, gebratene Garnelen, gewürztes Schweinemett, marinierter Fisch und eine Schale voll Aioli, cremig weiß wie Schlagsahne.
Charles schenkte ihr Wein nach und wartete, bis sie Platz genommen hatte, bevor er sich ebenfalls setzte. »Weißt du, woher die Tapas ihren Ursprung haben?«
Molly schüttelte den Kopf.
»Tapa bedeutet so viel wie Deckel. Früher wurden in den Kneipen kleine Teller oder Schüsseln auf die Gläser gestellt, um das Bier und den Wein vor den Fliegen zu schützen. Damit der Deckel auch bei Wind hielt, legte man eine Olive darauf. Mit der Zeit wurden diese Abdeckungen Teil des Service, und man gestaltete den Inhalt immer aufwendiger. Deshalb bekommt man Tapas auch meist nur in den Bars und Bodegas.«
»Ah. Das ist eine schöne Geschichte.« Molly war voll der Bewunderung. Beim Anblick der Speisen begann ihr Magen zu knurren.