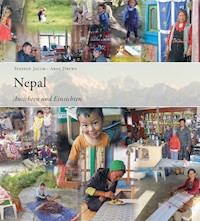19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Was ist aus den jüdischen Deutschen geworden, die zwar den Holocaust überlebten, aber von den Nazis aus ihrer Heimat vertrieben wurden oder sich verstecken mussten? Wie und wo haben sie überlebt? Unter welchen Bedingungen gelang es ihnen, die ja unsere ehemaligen Nachbarn oder vielleicht sogar Freunde waren, in anderen Teilen der Welt oder, nach dem Krieg, wieder in Deutschland sesshaft zu werden? Steffen Jacob, Sohn jüdisch-kommunistischer Eltern aus der ehemaligen DDR, hat über einen Zeitraum von 7 Jahren die (auffindbaren und gesprächsbereiten) Verwandten in acht Ländern auf vier Kontinenten aufgesucht und ihre Lebensgeschichten aufgenommen. Besonders interessierte ihn, wie die Menschen, nachdem die Frage des Überlebens nicht mehr akut war, ihr Leben nun gestalteten. Die familiäre Nähe öffnet dabei Fenster in Lebensräume, die sonst in Biografien meistens verborgen bleiben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1746
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Steffen Jacob
Leben danach
Alle Rechte vorbehalten
© für alle Texte und Fotos:
Steffen Jacob
„Leben danach“
entstand auf der Basis von Interviews,
die der Autor zwischen 1994 und 1997 mit Verwandten führte,
die vor 1933 in Deutschland geboren wurden.
Günther (Alfredo) Fuchs wurde von Monica Heller interviewt.
Die englischen Texte wurden von Carolyn Gammon bearbeitet,
die deutschen von Gudrun Moises und Steffen Jacob.
Grafik der Stammbäume: Elke Rohleder
Satz & Layout: Hans-Günter Goldbeck-Löwe
1. Auflage: Edition Goldbeck-Löwe, 2004
Diese Ausgabe: © 2022
ISBN Softcover: 978-3-347-77861-0
ISBN Hardcover: 978-3-347-77862-7
ISBN E-Book: 978-3-347-77863-4
Druck und Distribution im Auftrag :
tredition GmbH, An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt.
Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich.
Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig.
Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH,
Abteilung „Impressumservice“, An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Deutschland.
LEBENDANACH
LEBENSGESCHICHTENZWEIER JÜDISCHER FAMILIENAUS DEUTSCHLAND
AUFGEZEICHNET VON
STEFFEN JACOB
Gewidmet Berthold Feit, der nicht mein Onkel werden konnte
Inhaltsverzeichnis
Dank
Steffen Jacob (geb. 1952 in Berlin, lebt auch noch dort): Meine Geschichte mit den Geschichten
Henny und Norbert Jacob (geb. 1922 in Berlin bzw. Darmstadt, leben in Berlin): Unsere Gedanken und Gefühle waren nach vorne gerichtet
Die Familie Felder/Weitmann aus Galizien (mütterliche Seite)
Chaya Avi-Shaul (geb. 1922 in Düsseldorf, gest. 2001 in Be‘eri, Israel): Den Glauben an Gott habe ich gewechselt in den Glauben an Menschen
Josef Billig (geb. 1926 in Berlin, lebt in New York, USA und Herzeliya, Israel): Ich wollte vorwärtskommen
Baruch Billig (geb. 1929 in Berlin, gest. 1996 in New York, USA): Ich war ein full-time soldier (teilweise englisch)
Kurt Mendel (geb. 1903 in Hamburg, gest. 1997 in Ra‘anana, Israel): Das war eine große Arbeit, die ich da gemacht hab
Malka (geb. 1922 in Berlin, gest. 2000 in Kfar Bialik) und Moshe Birnbaum (geb. 1915 in Berlin, gest. 2001 in Kfar Bialik, Israel): Die Arbeit macht einen Mann und eine Frau zu harten, festen Leuten
Die Familie Fuchs aus Baden (väterliche Seite)
Herbert Kaufmann (geb. 1924 in Frankfurt a. M., lebt in Ammelsdorf/D): Wir sind unterwegs.
John Burne (geb. 1929 in Koblenz, lebt in Cheltenham, Großbrittanien): It's not a question of deciding that you want to do something -you want God to show you (englisch)
Anita Heller (geb. 1926 in Karlsruhe, lebt in Montreal, Kanada): I'm only proud of something that I have accomplished (englisch)
Natalie Fochs-Isaacs (geb. 1929 in Berlin, lebt in Montreal, Kanada): Ich bin auch ein Berliner
Anna Fuchs-Marx (geb. 1901 in Bruchsal, gest. 2003 in London, GB): Was sind Sachen? Nichts.
Renate Griffiths (geb. 1929 in Bruchsal, lebt in Vancouver, Kanada: If it's in you it comes out (englisch)
Elizabeth Foulkes (geb. 1918 in Karlsruhe, lebt in London, GB): I wanted to try and make an new life (teilweise englisch)
Lisa Ward (geb. 1927 in Frankfurt a. M., lebt in London, GB): I do feel my total lack of roots (englisch)
Vera Mayer (geb.1931 in Frankfurt a. M., gest. 2003 in Mexiko-City): Ich wurde hingeworfen, hergeworfen, und die äußeren Umstände haben so viel Einfluß gehabt
Ernest Foulkes (geb. 1924 in Karlsruhe, lebt in Cincinnati, USA: in Kiesel bin ich geworden, aber nicht Einstein. (teilweise englisch)
Jutta und Hans Grünthal (geb. 1913 in Würzburg bzw. 1915 in Breslau, leben in Haifa, Israel): Wir haben ein sehr schweres Leben gelebt.
Suse Schweitzer (geb. 1920 in Graudenz, lebt in Hadera, Israel): Aber es hat uns das Leben gekostet, auf das wir eigentlich vorbereitet waren
Suzanne (Suzie) Schrag (geb. 1910 in Straßburg, lebt in New York, USA): Ich hab‘ meine Tage ausgenützt
Eva Menkin (geb. 1923 in Berlin, lebt in Santa Barbara, USA): I coped by attaching myself to strangers (teilweise englisch)
Geoffrey Fuchs (geb. 1926 in Karlsruhe, lebt bei Philadelphia, USA): When your children ask you: “Where do I com from?"How much do you tell them (englisch)
Gabrielle Fuchs (geb. 1931 in Karlsruhe, lebt in Benicia, USA): If you could change your own history … (englisch)
Gerda Rypins (geb. 1931 in Karlsruhe, lebt in Berkeley, USA): If only ourparents would have told us… (englisch)
Günther (Alfredo) Fuchs (geb. 1921 in Karlsruhe, lebt in Sao Paulo, Brasilien): Unless we take some initiative, nothing will happen (englisch)
Renate Wyman (geb. 1918 in Stuttgart, lebt in London, GB): Das war nicht immer leicht, aber irgendwie haben wir es hinbekommen
Anhang
Stammbaum der Familie Felder Weitmann
Stammbaum der Familie Fuchs
Glossar
Dank
Wenn ich auf die zehn Jahre zurückblicke, die ich mit den Lebensgeschichten verbracht habe, bin ich beeindruckt, wie viele Menschen an diesem nun endlich vorliegenden Buch einen Anteil haben.
Zuerst möchte ich meine Eltern erwähnen, die mich während der ganzen Zeit in jeder Hinsicht unterstützt haben. Mit ihnen fing alles an - sie hatten teil an der Entstehung des Projektes, waren die ersten, die ihre Lebensgeschichte erzählten, waren die ersten Leser, und jederzeit konnte ich auf ihre Anteilnahme und Unterstützung bauen.
In diesem Atemzug sind alle Verwandten zu nennen, deren Lebensgeschichten hier versammelt sind. Es ist ein Teil ihrer Seele, den sie mir anvertraut haben, und ich hoffe, dass ich mich ihres Vertrauens würdig erwiesen habe und sie sich mit mir über das hier vorliegende Ergebnis freuen. Leider sind einige ihnen - Kurt Mendel, Baruch Billig, Malka Birnbaum, Chaya Avi-Shaul, Anna Fuchs-Marx und Vera Mayer - nicht mehr am Leben. Es sei an dieser Stelle ihrer gedacht. Bei allen Verwandten war ich zu Gast und möchte mich bei ihnen und ihren Partnerinnen bzw. Partnern für die erwiesene Gastfreundschaft und Kooperation bedanken. Jeder meiner Aufenthalte ist mir noch in guter, lebendiger Erinnerung. Wichtig zu erwähnen ist auch, dass diese Gastfreundschaft und die eine oder andere finanzielle Zuwendung mir überhaupt die mit dem Projekt verbundenen Reisen ermöglichten.
Bedanken möchte ich mich auch für Unterstützung von Verwandten, die nicht zu dem Kreis der Interviewten gehören. Elisabeth Laufer-Fuchs (Liekje) gab - unbeabsichtigt - die Initialzündung, indem sie mir Geschichten der Fuchs-Familie erzählte. Auch eine spätere Spende von ihr war wichtig für den Fortgang der Arbeit. Michael Billig ermöglichte mir den Einstieg in Amerika und stellte sich als office während meiner ersten Nordamerika- Reise zur Verfügung. Während dieser Tour lernte ich Monica Heller kennen, die mir seither durch Tipps und Kontakte in vielerlei Hinsicht hilfreich gewesen ist. Inzwischen gehört sie auch hier, in Deutschland, zur Familie. Während einer Dienstreise machte sie in Brasilien Günther (Alfredo) Fuchs ausfindig und interviewte ihn. Dadurch war es möglich, auch seine Geschichte noch ins Buch aufzunehmen.
Rosemary Somers gab hilfreiche Ergänzungen den Stammbaum betreffend und Unterstützung beim Interview mit ihrer Mutter Anna (Annele) Fuchs-Marx; an der Bearbeitung ihres Textes hat meine Schwester Ruth mit ihren Englisch-Kenntnissen einen großen Anteil. Jonathan und Cindy Bernd stellten mir ihre Wohnung während meines ersten Londoner Aufenthalts zur Verfügung. Mein Sohn Robert und meine damalige Lebensgefährtin Margrit Aßmann waren mir wichtige Partner bei der Überarbeitung der Einleitung; Jan Nadolny half bei Computerproblemen.
Dass aus Idee und Geschichten schließlich doch ein Buch wurde - dafür bin ich vielen Freunden und Kollegen zu Dank verpflichtet, die sich über den professionellen Rahmen hinaus sehr stark persönlich engagiert haben.
Ganz am Anfang, als ich nur mit meiner Idee und meinem guten Willen dastand, halfen mir meine Freunde Pauline Paul und Prof. Wolfgang Frindte, indem sie mit mir zusammen verschiedene Anträge an Stiftungen formulierten. Die erhoffte finanzielle Unterstützung blieb zwar aus, aber Ziele und Gedanken wurden klarer, und ich bekam eine erste Lektion in professioneller Textarbeit. Auch späterhin war mir bei verschiedenen Anlässen beider Hilfe wertvoll.
Aus der gesprochenen Erzählung einen lesbaren Text zu machen, der jedoch den Charakter des mündlich Erzählten beibehalten soll – diese Arbeit oblag bei den deutsch gesprochenen Texten Gudrun Moises und bei den englisch gesprochenen Carolyn Gammon. Ihrem Enthusiasmus, ihrem Einfühlungsvermögen und ihrem professionellen Können ist es zu verdanken, dass die Texte in dieser Qualität vorliegen.
Bedanken möchte ich mich bei meinem Lehrer und Kollegen Sebastian Elsaesser. Das Interview, das er mit mir im Januar 1998 über mich und das Projekt führte, war die Grundlage für den Text meiner Einleitung „Meine Geschichte mit den Geschichten“. Irgendwann kommt der Schritt an die Öffentlichkeit. Reinhard Weidauer und Jürgen Rennert vom Kunstdienst der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg gaben mir den erforderlichen Impuls und ermöglichten und moderierten die erste Lesung in ihren Räumen. Anwesend war auch Frau Ilse Rohnacher, deren Vater ein enger Kollege meines Großvaters am Stadttheater in Heidelberg war. Ihrer Initiative und dem Einsatz ihrer Nichte, Frau Barbara Kofler, verdanke ich eine Spende in Form eines Druckkosten-Zuschusses durch den Karlsruher Stadtrat für Kultur, Herrn Dr. Heck.
Eine zweite Lesung fand in Hildesheim statt, die von Roswitha Marzahn initiiert wurde. Bei ihr möchte ich mich auch für ihre Spende bedanken.
In Elke Rohleder fand ich eine Grafikerin, die sich mit Interesse und Gründlichkeit der - damals für sie neuen - Aufgabe annahm, die Genogramme und Stammbäume zu zeichnen und - obwohl der kalkulierte zeitliche und finanzielle Rahmen längst überschritten war - bereitwillig und akribisch die immer wieder von Neuem anfallendenden Korrekturen und Ergänzungen einarbeitete.
Frau Prof. Renate Doering hat mich in vielfältiger und kreativer Weise moralisch und finanziell unterstützt. Sie vertraute auch weiterhin auf das Gelingen der Veröffentlichung, als sich die damaligen Versprechen als nicht realisierbar erwiesen. In diesem Zusammenhang danke ich auch der Deutschen Union von Soroptimist International und der Union deutscher Zonta Clubs.
Es dauerte mehrere Jahre, bis ich endlich mit Hans-Günter Goldbeck-Löwe einen Verleger fand, der es mit großem persönlichen Einsatz ermöglichte, dieses Buch trotz seines Umfangs und sehr begrenzter finanzieller Mittel in ansprechender Qualität bei Wahrung der Authentizität des Erzählten zu produzieren.
Für Rat und Tat bedanke ich mich weiterhin bei Yitzchak Zieman, Dr. Hermann Simon, Prof. Wolfgang Benz, Petra Krösche, Rachel Stillmann, Dr. Sonja Tichy, Dagmar Füner, Dr. Arnim Krüger, Dr. Ingrid Miethe, Annette Rickert und Andrée Fischer-Marum.
Berlin, im September 2003
Meine Geschichte mit den Geschichten
Anstöße und Hintergründe
Wie kommen wir zu dem, was wir sind und was wir tun?
Im März 1990 war ich mit meinem Vater in Israel - zum ersten Mal - und wir landeten bei seiner Schwester Suse. Gleichzeitig traf auch ein Vetter Charly aus Antwerpen ein; er hatte eine Urne bei sich mit der Asche von einem „Uncle Joe“ aus Köln, dessen letzter Wunsch es gewesen war, im Heiligen Land begraben zu werden. Der Wunsch wurde erfüllt, und es gab ein großes Familienfest im Haus meiner Cousine Orna in Zichron Ya´akov auf dem Carmel. Das Haus war voll, alles Familie - und wir gehörten dazu! Es war fast ein Schock, so etwas hatte ich bis dahin nie erlebt.
Eigentlich wollte ich ja auch nur mal, wie so viele meiner Kollegen und Freunde, in den Westen reisen, und das ging nun einmal nur über Verwandte. In der Bundesrepublik hatten wir keine, aber in Israel. Meine Eltern waren bereits 1985, nachdem sie Rentner geworden waren, dort gewesen – Rentner durften ja ins westliche Ausland fahren. Sie hatten von der DDR ganze 15 DM als Reisegeld bekommen, waren also finanziell völlig von den Verwandten abhängig, denn unsere DDR-Mark konnte man ja nicht in Devisen tauschen. Von dieser Abhängigkeit war ihre Reise überschattet, und sie wollten eigentlich nicht noch einmal fahren. Als ich ihnen nun Anfang 1988 von meinem Vorhaben erzählte, meinte mein Vater: „Na ja, wenn der Steffen fährt, dann würd´ ich auch nochmal mitkommen.“ Wir haben dann fast zwei Jahre mit den Behörden gekämpft, bis Vater schließlich eine Eingabe an Honecker schrieb, in der er darauf hinwies, dass unsere Verwandten ja schließlich nicht von ungefähr in Israel leben. Es war demütigend. Als die Reiseerlaubnis dann endlich eintraf, war sie nicht mehr notwendig - die Wende war in vollem Gange.
Kurz nach unserer Ankunft in Israel landeten wir also auf dieser Familienfeier; irgend jemand erzählte etwas Privates, dann sah er uns, stutzte und sagte nach einem Moment Bedenken: „Na, Ihr seid ja Familie, Ihr gehört ja dazu.“ Schlagartig wurde mir bewußt, was mir bisher entgangen war. Von dieser Vielfalt von Ereignissen, die man in einer großen Familie miterlebt - da werden Menschen geboren und sterben, einer wird Pilot, einer wird Akademiker, einer wird Bauer, es gibt Hochzeiten, Scheidungen, Krankheiten - von diesem Reichtum an Lebenserfahrung, den man einfach dadurch mitbekommt, dass irgendwo in der Familie irgendwann etwas passiert, war ich, waren wir ziemlich abgeschnitten. Zum Beispiel erlebte ich erst 1993, im Alter von 41 Jahren, wie das ist, wenn ein naher Mensch stirbt. Es war meine Großtante Cilly, die jüngste Tante meiner Mutter; die beiden hatten zusammen mit dem kleinen Hans in der Illegalität überlebt1. Ich habe also in Israel begonnen, anders über Familie zu denken. Den entscheidenden Anstoß erhielt ich dann in der Schweiz durch eine Großcousine meines Vaters: Elisabeth Laufer-Fuchs, genannt Liekje. Sie hatte sich nach über vierzig Jahren wieder bei ihm gemeldet. Der Anlaß war, dass einer ihrer Söhne sich mit Genealogie beschäftigte und interessiert war an dem Stammbaum, den meine Tante Jutta erstellt hatte. Es entwickelte sich ein Briefwechsel – nachdem sie sich zuletzt 1946 gesehen hatten, als mein Vater als britischer Soldat in Holland war. Als ich 1993 ich in der Schweiz war, besuchte ich bei dieser Gelegenheit Liekje in Lausanne. Vom ersten Moment unserer Begegnung an überschüttete sie mich mit Geschichten aus einer Familie Fuchs, von der ich bis dahin kaum eine Vorstellung hatte - Geschichten von Fanny Fuchs, der „Stammutter“ und ihren 12 Kindern, einem großen Holzhandel in Karlsruhe, von Männern, die nach Amerika gegangen und dort verschollen sind, von anderen die hinterhergingen, um sie zu suchen, sie zwar nicht fanden, aber ein Unternehmen dort gründeten usw. usf.. Auch mein Großvater, der „Schauspieler“ kam vor. Mir schwirrte der Kopf, und ich dachte nur: Was passiert mit diesen ganzen Geschichten?
Wieder zu Hause wollte ich meinen Vater überzeugen, eine Art Kartei über die Verwandten anzulegen und die Geschichten, die er von ihnen kennt, nach und nach dort einzuschreiben. Aber mein Vater ließ sich nicht überreden, und ich mußte einsehen, dass ich mich selbst darum kümmern muß. Von nun an fuhr ich fast anderthalb Jahre lang an den Wochenenden mit einem Aufnahmegerät zu meinen Eltern, und sie erzählten mir ihre Lebensgeschichte und auch einiges von dem, was sie von anderen Familienmitgliedern wissen. Das war der eigentliche Beginn des Projektes.
Als mir klar wurde, wie beide sich ganz bewußt dafür entschieden hatten, in Ostdeutschland zu leben - sie hätten ja durchaus auch andere Optionen gehabt - kam der Gedanke, auch die anderen Verwandten ihrer Genera-tion, die ebenfalls aus Deutschland stammten, zu interviewen. Ich wollte nachvollziehen, wie diese zu ihren Entscheidungen gekommen waren. Offenbar gab es nach der Phase, in der es darum ging, jeden sich bietenden Strohhalm zu ergreifen, um zu überleben, eine Zeit, in der man seinen Lebensweg wieder in stärkerem Maße selbst bestimmen konnte. Wie verlief dieser Prozeß bei ihnen, die doch dem gleichen sozialen Milieu und derselben Familienkultur entstammen wie meine Eltern? Das ist die Kernfrage, der ich in den Interviews nachgehe.
Wenn ich darüber nachdenke, wie ich zu diesem Vorhaben kam (oder es zu mir), halte ich noch zwei weitere Aspekte für wesentlich. Der erste ist meine Verbindung zum Judentum.
Irgendwann in der Mitte der 80er Jahre war ich mit Christa, meiner damaligen Frau, im Kino. Wir sahen den Film „Der Garten der Finzi Contini“, die Geschichte einer jungen Jüdin, die dank reicher Freunde unter eigentlich relativ komfortablen Umständen die Judenverfolgung übersteht, bis sie dann aber doch gefaßt wird. An dieser Stelle kamen mir plötzlich die Tränen. Das war schon ein starkes Signal: Offenbar berühren mich manche Geschichten besonders. 1988 war der 50. Jahrestag des Novemberpogroms, der sogenannten Kristallnacht. Es gab viele Veröffentlichungen und Veranstaltungen, und auch hier hatte ich - bei aller Distanz zu der offenkundigen Absicht von Honecker, sich mittels der Juden in Amerika hoffähig zu machen - das Gefühl einer besonderen Verbindung.
Im Sommer 1990 nahm ich im Odenwald-Institut an einem Seminar über die Verbesserung zwischenmenschlicher Beziehungen teil. Es war die Zeit, als die Grenzen schon offen waren, es aber noch die DDR gab. Geleitet wurde das Seminar von Yitzchak Zieman, einem alten Juden aus New York, mit dem ich seitdem tief verbunden bin. In ihm habe ich zum ersten Mal die ostjüdische Lebendigkeit verspürt, die ich bis dahin nur kannte als etwas, das mit der Shoah untergegangen war und von dem noch verwilderte Friedhöfe, alte Fotos vom Leben im Stetl, Folklore, wie der „Fiedler auf dem Dach“, jiddische Lieder (die wir zu Hause oft hörten) oder Literatur (die ich zeitweise sehr intensiv gelesen habe) übrig geblieben sind - eher Märchen aus vergangener Zeit, mit viel Wehmut … Hier aber war nun Yitzchak: ein lebendiger Mensch mit stiller, kraftvoller Ausstrahlung, Humor und Güte - auch gegenüber sich selbst - mit Liedern (die ich zum Teil kannte, aber kaum mitsingen konnte) und einer Lebenserfahrung, die ich damals nur erahnen konnte. Nachdem der Kurs zuende war, blieb ich noch einen Tag in Heidelberg, um dort auf den Kindheitsspuren meines Vaters zu wandeln. Den ganzen Tag habe ich geheult. Es war, als wenn eine verschüttete Quelle angefangen hatte zu sprudeln …
Ich bin froh, dass ich meine Eltern zu Lebzeiten fragen konnte und sie mir so offen und ehrlich geantwortet haben. Es ist gut für mich, nachvollziehen zu können, woher ich komme, wohin ich gehöre oder hineingeraten bin, und es ist gut für meine Eltern, dass sie dadurch auch die Gelegenheit bekommen zu einer Art Vermächtnis. Hier komme ich zum zweiten Aspekt: meinem deutschen Hintergrund. Denn nicht zu vergessen: Entstanden ist ja diese Idee in bzw. kurz nach der Wendezeit! Meine Eltern stehen - oder standen, inzwischen liegt das ja auch schon ein paar Jahre zurück - vor dem Scherbenhaufen ihres Lebenswerkes. Ihre Lebensgeschichte könnte zukünftigen Generationen mit größerer historischer Distanz, als wir sie haben, eine exemplarische Antwort geben, wenn sie vielleicht Fragen wie diese stellen: Da gab´s doch mal so einen interessanten Versuch hier in Deutschland, einen sogenannten Arbeiter-und Bauern-Staat - was waren das eigentlich für Menschen, die sich getraut haben, diese grandiose Utopie in Angriff zu nehmen? Immerhin ist da zeitweilig etwas Beachtliches aus den Ruinen auferstanden. Und wie konnte es dann aber geschehen, dass dieselben Menschen, die diesen Staat wie ihr Kind aufgezogen hatten, ihn dann so verkommen ließen?
Auch für mich war die DDR Heimat, sie war mein sozialer und kultureller Bezugsrahmen. Mein Engagement, meine Vorbehalte und Veränderungswünsche, meine Kritik - alles bezog sich im Besonderen auf die DDR und allgemein auf den Sozialismus. Natürlich wußte ich, dass die Welt größer ist, doch mein konkretes Leben und Denken spielte sich innerhalb der DDR-Grenzen ab. Wirklich stolz auf mein Land war ich allerdings nur einige Monate lang - in jener Zeit der Wende, des Ausbruchs aus dem miefigen Honecker-Sozialismus und des vermeintlichen Aufbruchs in eine Zeit, in der „… die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller …“2 sein würde. Dann fiel die Mauer, und es öffneten sich nicht nur beengende Grenzen, sondern zugleich brachen auch gesellschaftlichen Denk- und Lebensbezüge weg. Das mir vertraute Land gab es schlicht nicht mehr. Lange, viel zu lange hatte es sich seine Identität als „real existierender Sozialismus“ vorgegaukelt und sich dann einfach aufgegeben. Mit dem neuen, „vereinigten“ Deutschland, in das ich geraten war, konnte ich mich nicht identifizieren und wollte es auch nicht, die Bundesrepublik war nie das Land meiner Träume gewesen. Im Laufe der Zeit sind mir jedoch, vor allem durch berufliche Kontakte, deutsche Menschen und Gegenden auch außerhalb der alten DDR-Grenzen nahegekommen, und ich begann mich langsam für das neue Land, die Bundesrepublik Deutschland, zu öffnen.
Auch die Verwandten mußten sich – ungleich drastischer als ich – mit dem Verlust dessen, was sie als Heimat empfunden hatten, abfinden. Nicht sentimentale Heimatgefühle (wie Ernest es ausdrückt: „Yearn3 for the Schwarzwald “), nicht der nostalgische Rückblick, sondern der Schritt in das ungewisse Irgendwo bot ihnen die Chance zu überleben und am neuen Ort wieder Fuß zu fassen.
Ich denke, ich habe hier in Deutschland - und das ist auch ein wesentliches Moment meiner Verbundenheit mit diesem Land - etwas zu tun: In meiner Familie spürte ich die unerzählten Geschichten, und ich spüre sie auch in diesem Land. Vielleicht sind die Lebensgeschichten für nichtjüdische Deutsche manchmal noch schwerer zu erzählen als für uns Juden, weil sie oft mit Schuld verbunden sind. Trotzdem: Wenn die unerzählten Geschichten weiter verschwiegen werden, bleiben sie als weiße Flecken - oder schwarze Löcher - in der Geschichte des Landes und der Familien, die in ihm wohnen. Alles Mögliche kann in die Zeiträume hinein projeziert werden, und daraus kann alles Mögliche entstehen. Wie können sich nach all dem, was in der Mitte des 20. Jahrhunderts geschehen ist, an dessen Ende wieder junge Menschen in Deutschland mit den Nazis identifizieren?
Ich bin überzeugt, dass nur über die ehrliche Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte Schuld aus der Vergangenheit in Verantwortung für die Gegenwart und Zukunft transformiert werden kann. Einzelne Menschen können sich vielleicht dieser schmerzhaften Auseinandersetzung entziehen, jedoch werden diese Schuldgefühle dann unbewußt weitergegeben; sie werden von anderen Familienmitgliedern, oft der nächsten oder übernächsten Generation, übernommen4, und diese haben es natürlich schwer, sich damit auseinanderzusetzen, wenn sie auf eine „Mauer des Schweigens“ stoßen.
In diesem Sinne hoffe ich, dass durch die Veröffentlichung der Lebensgeschichten meiner Verwandten Menschen angeregt und ermutigt werden, ihren eigenen und den Lebensgeschichten in ihrer Familie nachzuspüren, sich zu ihnen zu bekennen und sie zu erzählen.
Das Projekt
Das ganze Vorhaben wäre undenkbar ohne die Prozesse, die bald den passenden Namen „Wende“ bekamen. Mit dem Jahr 1989 begann auch in meinem persönlichen Leben eine Phase der Öffnung - Grenzen, Weltanschauungen, Herkunft und Familie. Mit Hilfe des Stammbaums meiner Tante entdeckte ich familiäre Linien, die über den ganzen Globus führen - nach Israel, in die USA, nach Holland und in die Schweiz, aber auch nach England, Frankreich, Kanada, Mexiko, Brasilien, Australien, Neuseeland, Südafrika und sogar nach Taiwan! Mein Blick auf die Welt veränderte sich, und nachdem ich den Entschluß gefaßt hatte, die Lebensgeschichten all dieser Verwandten zusammenzutragen, kam ich mir vor, wie vermutlich Kolumbus vor seinem Aufbruch nach „Indien“: Ich war überzeugt, dass sich die Reise lohnen wird und dass ich ausreichend dafür gerüstet bin, mich auf den Weg zu machen - auch wenn ich noch unklar darüber war, wie dieser Weg im Weiteren aussieht. So bin ich dann losgesegelt, und Wasser und Wind haben mich bisher ganz gut getragen. Nie war klar, wie ich zum Ziel komme, aber es waren immer genug Ressourcen da, um den nächsten Schritt gehen zu können.
Mit den Interviews will ich nachvollziehen, wie sich das Leben der Person gestaltet hat, welcher Art von Logik es folgt, welche inneren Faktoren und welche äußeren Faktoren es beeinflußt haben, welches die „sensiblen Phasen“ waren, in denen Weichen gestellt wurden. Methaphorisch gesprochen strebte ich an, mit der Person in den Fluß ihres Lebens zu kommen, und beim Mitschwimmen die Strömung zu erfassen.
Für einige war es ein Vergnügen zu erzählen, für andere war es sehr schwer. Selbstverständlich habe ich ihre Grenzen respektiert; ich habe nachgefragt, aber nicht „gebohrt“. Gefragt habe ich besonders nach Übergängen, nach ersten Eindrücken, oder auch Abschieden - zum Beispiel bei John und Renate G. nach dem Abschied von den Eltern, als sie mit dem Kindertransport nach England gekommen sind. Sie haben ja nicht gewußt, ob sie ihre Eltern jemals wiedersehen. Als Kinder so einen endgültigen Abschied zu erleben! Und weiter: Wie war es dann für sie, so allein in dem Zug ins Unbekannte? Und die Ankunft in dem fremden Land? - Es war für sie oft nicht leicht, darüber zu erzählen. Früher Erlebtes wird lebendig, und der Schmerz ist wieder zu spüren. Die erneute Arbeit der Bewältigung dieses Geschehens ist der Preis, den meine Gesprächspartnerinnen und -partner auf sich genommen haben, um zuerst mir und durch mich den Leserinnen und Lesern dieses Buches die Einsicht von innen in den Gang ihres Lebens zu gewähren.
Wenn wir dann in der Gegenwart angekommen waren, stellte ich abschließend drei Fragen: „Was bedeutet es für Dich, Jude bzw. Jüdin zu sein?“, „Wenn Du an Deutschland denkst, welches Gefühl hast Du dabei?“ und „Gibt es so etwas wie eine Grunderfahrung in Deinem Leben oder eine Botschaft, die Du weitergeben möchtest?“ - Durch diese Fragen wollte ich existentielle Faktoren, die allen gemeinsam sind, auf den Punkt bringen, auch. Zum Teil werden sie natürlich schon im Lauf der Geschichte angesprochen, aber ich wollte das gerne nochmal ausdrücklich wissen. Warum?
Erstens, Deutschland ist das Land, in dem die von mir interviewten Verwandten geboren wurden und das ihnen - bis es sie verstoßen hat - Heimat war, und es ist das Land, aus dem ich komme und in dem ich lebe. Theoretisch hätte jedes andere Familienmitglied meiner Generation diese Arbeit auch in Angriff nehmen können, aber es fiel mir zu; ich bin derjenige, der von hier aus versucht hat, Fäden wieder neu aufzunehmen … Das alles ist schon recht merkwürdig - zumal, wenn man außerdem noch bedenkt, dass es in der Geschichte der Fuchs-Familie zweimal vorgekommen ist, dass Söhne aus Deutschland aufbrachen, um ihre in Amerika verschwundenen Väter zu suchen … Zweitens, ihr Jüdischsein war die Ursache dafür, dass diese Menschen dort sind, wo sie jetzt sind. Ich bin, wie Herbert, der Meinung, dass die meisten von ihnen noch in Deutschland wären, hätte man sie „normale“ Deutsche sein lassen, wenn sie nicht durch die nationalsozialistische Gesetzgebung und Politik als Juden definiert und diffamiert und in ihrer Existenz bedroht worden wären. Nur wenige gingen freiwillig als Zionisten wie Kurt oder Moshe, die meisten hatten sich einigermaßen bis sehr gut etabliert und hätten keinen Grund gehabt, Deutschland zu verlassen. Gerade für die Verwandtschaft meines Vaters spielte ihr Judentum ja scheinbar kaum noch eine Rolle; sie waren völlig „assimiliert“, bevor sie dann von außen, durch die Nazis, darauf gestoßen wurden, dass sie Juden sind, egal, wie sie selbst sich ihre Identität konstruiert hatten. Deswegen war es für mich wichtig zu wissen, wie sie jetzt dazu stehen.
Drittens, die Frage nach der Grunderfahrung oder Botschaft ist einerseits eine gute Frage, um das Interview zu beenden: In einer prägnanten Form - in a nutshell5, wie Geoffrey vielleicht sagen würde - wird ein Bogen geschlossen von der Vergangenheit in die Zukunft. Jedoch vor allem hat mich interessiert, ob man am Ende eines langen, bewegten Leben, auf das ja alle interviewten Personen zurückblicken können, so etwas herauskristallisieren kann. Ich war oft erstaunt und sehr bewegt von den Antworten, nicht nur von ihrem Inhalt, sondern auch ihrer sprachlichen Form. Suse zum Beispiel zitiert einen Spruch: „Üb´ immer Treu und Redlichkeit …“. Eingerahmt, in Sütterlinschrift oder als moralisches Willkommen über Haustüren finde ich einen solchen Spruch meistens trivial - du hast das schon zigmal gehört, sagst: „Ach, ja …“ und nickst bedeutungsvoll gelangweilt. Aber wenn du siehst, welches Leben dahinter steht, bekommt diese Zeile ein ganz anderes Gewicht - Dabei ist jede dieser Botschaften anders, eben persönlich. Manche scheuen sich auch, sie sagen: Wir haben keine Botschaft, oder: Wir sind einfache Leute, es ist nicht an uns, Botschaften zu verkünden. Implizit kommt aber immer etwas rüber.
Der Schlüssel zu einem Leben ist für mich eine Idee, was es sein könnte, das dieses Leben treibt. Und die habe ich, glaube ich, bei allen bekommen. Es ist ein intuitiver Prozess: Du hörst oder liest einen Satz oder auch nur einen Nebensatz und merkst: Das ist es! Dieser Satz könnte als Überschrift über dem ganzen Leben stehen.
Ich bin froh, dass ich die Voraussicht hatte, zwei Phasen einzuplanen: erstens das Interview und zweitens die persönliche Besprechung des Textes in einer zweiten Begegnung. Im Vorfeld verspürte ich eine unbestimmte Angst, witterte eine Gefahr, die mir aber nicht klar war. Mit Hilfe einer befreundeten Kollegin kam ich darauf, dass es die Gefahr ist, bestohlen bzw., was mich betrifft, zum Dieb zu werden. - Es gibt Völker, die glauben, dass schon, wenn man fotografiert wird, einem - zumindest, wenn dies ungefragt geschieht - ein Teil seiner Seele genommen wird. Ein ähnliches Gefühl kenne ich selbst, und auch aus dem Familien- und Freundeskreis hatte ich schon so etwas gehört: Eine Person wurde interviewt, und nachdem die InterviewerInnen ihre „Daten“ hatten, ließen sie nichts mehr von sich hören oder sehen. Dass es den Interviewten hinterher manchmal ziemlich schlecht ging, haben sie wahrscheinlich gar nicht bemerkt.
So ein Interview kann auch eine Art Verführungssituation sein: Dass die Personen einverstanden sind, sich interviewen zu lassen, ist nur die eine Seite, die formelle. Dadurch, dass du zuhörst, dich um Verständnis bemühst (für viele Menschen ein ganz seltenes Erlebnis!) und sich andererseits die interviewte Person darum bemüht, verstanden zu werden, entsteht Empathie6, ein eigenartiger, besonderer Raum des Verstehens, in dem einige doch mehr erzählen, als sie ursprünglich wollten. Oder sie erzählen anders, oder sie gehen hinein in die Zustände von damals - sind vielleicht wieder das Mädchen von sechs, sieben Jahren, das nichts von dem ganzen Chaos versteht, das um sie herum passiert … Aber hinterher, nach dem Interview, bin ich weg, und dann tut es ihnen vielleicht leid, so viel von sich gezeigt zu haben, oder sie schämen sich, oder es wird noch viel mehr in ihrem Innern lebendig. Wir haben zwar einen Kontrakt miteinander, sind uns beide bewußt, dass wir eventuell schlafende Dämonen wecken - die Verantwortung ist also geteilt - aber sie sind es, die sich hinterher wieder „einholen“, ihren Alltag weiter bewältigen müssen. Ich bin mir bewußt, dass die Verwandten mir ein Teil ihrer Seele anvertraut haben. Durch das Buch wird der Kreis einerseits wieder geschlossen, andererseits öffnet er sich in die Öffentlichkeit.
Über sieben Jahren bestimmte diese Arbeit mein Leben. Ich war besessen von der Idee, und sie ließ mich nicht los, bis sie nunmehr erfüllt ist.
Auch ein Gefühl von Vaterschaft (oder Mutterschaft) schwingt mit: Mein Kind ist in die Welt gekommen, und ich fühlte mich für sein Wachsen und Gedeihen verantwortlich. Manches kann man nur selber tun, oder es wird nicht getan. Jetzt kann ich es loslassen. Vor allem aber fühle ich mich bei diesem Vorhaben als Vermittler, als Medium, durch das diese Lebensgeschichten erhalten werden, Sprache bekommen und eine Form, in der sie aufgehoben werden können. Als zum Beispiel Natalie mir ihre Geschichte erzählte, sah ich wie in einem Film, wie das kleine Mädchen von 1933 lebendig wurde: Hier in Berlin, im schönen und reichen Ortsteil Nikolassee, wo sie wohnt, ist sie mit einemmal Jüdin und ausgeschlossen. Dabei weiß sie von zu Hause her gar nicht, wer oder was Juden eigentlich sind. Der Führer kommt zu ihrer Schule, und sie möchte gern dabeisein, möchte dazugehören - sie ist ja schließlich auch gegen diese schlimmen Juden mit den dicken Taschen und dem verschlagenen Blick, nicht wahr? Aber sie darf nicht mit den anderen den Führer begrüßen, ihre Schwester darf nicht Klassenerste sein, obwohl sie die besten Zensuren hat, und das kann sie einfach nicht verstehen: Was machen sie denn falsch? - Ja, dieses kleine Mädchen von sechs, sieben Jahren hatte mich ergriffen, und ich fühlte die Verpflichtung, ihm Stimme zu geben. Ähnlich ging es mir bei vielen meiner Interviewpartnerinnen und –partner.
Einige Verwandten wollten ihre Lebensgeschichte nicht erzählen. Auch dadurch sind sie mir nah gekommen; ihre Gründe kann ich nachvollziehen und respektiere die von ihnen gesetzte Grenze.
Die Familien
Fanny Fuchs
Ich bin weit in die Geschichte und das System beider Familien vorgedrungen. Wenn ich versuche, die Familienkulturen zu beschreiben, fällt mir das bei der väterlichen Verwandtschaft väterlicherseits viel leichter als bei der mütterlichen. Die Familie Fuchs scheint mir als Familie greifbarer, homogener als die Familie Felder/ Weitmann. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass sie durch ihre Lebensumstände, vor allem das Geschäft „H.-Fuchs-Söhne“ in Karlsruhe mit Filialen in Straßburg und Stuttgart bis zur Nazizeit enger miteinander verbunden waren, auch wenn bereits die Enkel von Hirsch und Fanny Fuchs zum größten Teil nicht mehr im Geschäft, sondern in verschiedenen anderen Berufen arbeiteten. Nicht zu unterschätzen ist die starke Hand, mit der Matriarchin Fanny bis in diese Generation hinein straff die Zügel hielt. Mindestens einmal im Jahr, zu Neujahr, kam die gesamte Familie in Karlsruhe zusammen. Offenbar wurde Wert auf ein Familienbewußtsein nach innen und ein Ansehen nach außen gelegt, was durch entsprechende Ansprüche, aber auch interessierten Austausch und gegenseitige Unterstützung reproduziert wurde. Nach dem Krieg, als die Familie über die halbe Welt zerstreut war, gab es Versuche, diese Kultur wieder zu beleben - das markanteste Beispiel dafür ist die Herausgabe eines „Familienbulletins“ (1953) durch Albrecht Fuchs (Albert Foulkes) in Australien) und Siegmund Heinz Fuchs (Foulkes) und seine spätere Frau Elizabeth Marx in London. Im Anschluß erschienen noch drei Nummern der „Fuchs Family Letters“ (1953 - 56) in bescheidenerem Umfang. Dieses Vorhaben ließ sich allerdings nicht fortführen - die Glieder der Familie hatten sich wohl doch inzwischen zu weit voneinander entfernt. Aber immer wieder gibt es einzelne, die versuchen, Verbindungen nicht abreißen zu lassen - sei es über die Erarbeitung von Stammbäumen, die Pflege von bestehenden oder das Knüpfen neuer Kontakte. Auch mein Projekt läßt sich hier einreihen.
Hirsch Fuchs
Die Stellung unserer Familie Jacob innerhalb dieser großen Sippe ist etwas besonders. Wir sind die Nachkommen der einzigen Tochter unter den insgesamt zwölf erwachsen gewordenen Kindern von Hirsch und Fanny Fuchs. Jenny, meine Urgroßmutter, hatte vier Kinder. Bei der Geburt des vierten ist sie gestorben, wenige Monate später starb auch das Kind. Ihr Mann, Gustav Jacob, ist während ihrer Schwangerschaft nach Amerika gegangen - oder geschickt worden von Jennys Brüdern und/oder seiner Schwiegermutter. Die Gründe kennen wir nicht. Wie dem auch sei, ich stelle es mir ziemlich schwer vor, als Ehemann der einzigen Schwester zu bestehen. Meine Phantasie: Elf Brüder, alle höchst distinguierte, erfolgreiche Herren, wachen mit Argusaugen, wie es ihrer Schwester geht! Da mußt du mindestens so gut sein wie sie … Die drei Kinder - Johanna, Alfred und mein Großvater Walter - wurden nach dem Tod der Mutter nicht zusammen gelassen, sondern einzeln in andere Familien weggegeben, teilweise zu fremden Leuten, wenn auch die Füchse Verbindung zu ihnen gehalten haben. Insofern sind wir eher am Rand des Systems als in der Mitte. Hinzu kommt, dass mein Vater der einzige ist, der, sobald es möglich war, wieder nach Deutschland zurückgekehrt ist. Zwar lebt auch Herbert wieder in Deutschland, aber er ist erst 1975 und unter ganz anderen Umständen hierher gekommen.
Was fiel mir nun auf bei der Begegnung mit dieser Verwandtschaft, die mir bis dahin so gut wie unbekannt war? In fast jedem Haushalt befindet sich ein Fuchs-Symbol - sei es ein Türschild bei Geoffrey in Philadelphia, eine Sitzbank bei Suse in Hadera oder Kaffeelöffel bei Gerda in Berkeley. Gern und oft werden auch Geschichten aus dem „Familienkulturerbe“ erzählt - am häufigsten die von Hermann, der am Jom Kippur das Gebot des Fastens brach und dafür von Fanny nach Amerika „verbannt“ wurde. 8
Sie haben sich durch das Schicksal nicht unterkriegen lassen. In Deutschland ging es ihnen ziemlich gut - bis auf die Familie meines Großvaters gehörten sie dem gehobenen Mittelstand an - und einige haben dann ihren gesamten Besitz verloren, kamen mit nichts nach England, Kanada, USA oder Israel. Aber sie haben sich behauptet! Sie haben ihre Würde bewahrt, ihren Stil und ihre Bildung weder verleugnet noch darüber gejammert, wenn sie nun nicht mehr „standesgemäß“, sondern zum Beispiel als Bienenzüchter und Postbote wie mein Großvater Walter Jacob, Hutmacherin wie Annele oder Verkäufer wie uncle Frederic, der Vater von Renate W., ihren Lebensunterhalt auf ganz andere Art verdienen und ihr Leben viel einfacher führen mußten. Die meisten, nicht alle, haben es geschafft, sich und ihre Kinder in den neuen Verhältnissen gut zu etablieren.
Eine andere Gemeinsamkeit der Füchse ist ihre Wertschätzung des Lernens. Fast alle haben studiert, teilweise unter sehr schwierigen Bedingungen. Manche sind stolz auf ihre akademischen Grade, aber niemand protzt damit. Es scheint selbstverständlich, akademischer Grad oder nicht, in seinem Beruf hochqualifiziert zu sein und den Kindern die bestmögliche Bildung angedeihen zu lassen. Lernen und Bildung sind offenbar Werte, die über die Generationen weitergegeben werden.
Henny Felder
Bei mir stellte sich ein Gefühl von Stolz ein, zu einer so kultivierten, gebildeten und liberalen Familie zu gehören. So breit auch das Spektrum der Weltanschauungen ist - keiner ist Fundamentalist oder Dogmatiker. Zum Beispiel fand es niemand absurd oder komisch oder verabscheuenswürdig, dass mein Vater Kommunist geworden ist. Das wird als eine von vielen möglichen Lebensweisen gesehen, durchaus verständlich und kein Grund, ihm den Respekt zu verweigern.
Die Seite meiner Mutter, die Familie Felder/Weitmann, hingegen erscheint mir in ihren Konturen viel unschärfer. Schon von meinen Urgroßeltern ist kaum etwas überliefert. Es gibt ein Bild meiner Urgroßmutter Henny, nach der meine Mutter und ihre Cousine Chaya genannt wurden. Augenscheinlich war sie eine schöne Frau und offenbar auch sehr tatkräftig. Sie brachte neun Kinder zur. Welt und durch den ersten Weltkrieg - bis auf die Jüngste, Ziphora, die an Diphterie starb. Aber schon über ihre Lebensumstände in Galizien gibt es mehr Vermutungen als Fakten9. Eigentlich beginnt die nachvollziehbare Geschichte dieser Familie erst mit ihrer Übersiedlung nach Deutschland in der Zeit des ersten Weltkriegs. Für die relativ kurze Zeit bis zur Machtergreifung der Nazis läßt sich durchaus eine Familienkultur rekonstruieren. Es gab einen „starken Mann“, Chaim, der einzige Bruder unter den neun Geschwistern, und nach dem Tod von Malka der Älteste von ihnen. Er war zu Vermögen gekommen - wie, ist nicht bekannt - hielt sich offenbar in den alltäglichen Familienangelegenheien ziemlich im Hintergrund, trat aber immer dann hilfreich in Erscheinung, wenn es um existentielle Fragen ging: Er managte die Übersiedlung der Schwestern nach Berlin und wohl auch die eine oder andere Heirat, nahm Malka10 in einer für sie und ihre Familie schwierigen Zeit bei sich auf und schaffte es irgendwie, seine Schwester Fanny frei zu bekommen, nachdem sie 1933 als Kommunistin verhaftet worden war11. Nur er selbst konnte sich nicht mehr retten. 1938 flüchtete er mit seiner Familie in die Tschechoslowakei, saß dort aber bald in einer Falle - einzig der Weg nach Polen war noch offen. Wahrscheinlich sind Chaim und seine Frau Esther in Kraków, Esthers Heimatstadt, den Nazis zum Opfer gefallen. Ihre beiden Söhne Mendel und Baruch konnten sie noch nach Frankreich ausfliegen lassen, von wo aus diese in die USA gingen. Beide wollten ihre Geschichte nicht erzählen …
Bis auf Chaim aber prägen Frauen die Kultur der Familie Felder/Weitmann stärker als die Männer. Vielleicht ist es kein Zufall, dass zwar ein Bild meiner Urgroßmutter Henny erhalten ist, aber keins von ihrem Mann. War Chaim der „starke Mann im Hintergrund“, so war meine Großmutter Sara wohl das inoffizielle Zentrum der Familie, bei ihr traf man sich. Cilly, die jüngste der Geschwister, war die Erste, die aus dem zwar nicht mehr streng religiösen, aber doch noch von ostjüdischer Tradition geprägten Milieu heraustrat, indem sie einen nichtjüdischen deutschen Kommunisten heiratete. Sie „infizierte“ ihre Schwestern mit dem „kommunistischen Virus“12. Jede der Schwestern war offenbar eine starke Persönlichkeit mit einem ausgeprägten Willen. (Man könnte auch eigensinnig sagen.) Einige Familien waren mehr oder weniger vermögend, wie die Felders (Chaim) oder die Billigs, andere, wie die Familie meiner Mutter, waren eher arm.
Bei der Familie Felder/Weitmann ereignete sich der Umbruch fast eine Generation früher als in der Fuchs-Familie: Bereits die Generation meiner Großeltern mußte in jugendlichem, teilweise noch im Kindesalter, ihre angestammte Heimat, Galizien, verlassen. In Deutschland konnten sie zwar ihren Zusammenhalt bewahren, jedoch nahmen die sozialen, politischen und kulturellen Unterschiede zwischen ihnen zu; zentrifugale Kräfte machten sich deutlich bemerkbar, und nach dem durch die Nazis verursachten Auseinanderbrechen der Sippe entfernten sich die Wege der einzelnen Familien weit voneinander. Es gab dann nur noch vereinzelte Verbindungen zwischen ihnen.
So erkläre ich mir, dass ich nicht, wie bei der Fuchs-Familie, eine bestimmte Familienkultur oder bestimmte Werte beschreiben kann, die ich mehr oder weniger bei allen interviewten Personen wiedergefunden habe. Vielleicht sind sie von ihrer Mentalität her etwas spontaner und weniger intellektuell als die Füchse. Niemand hat zum Beispiel einen Stammbaum angelegt. Chaya und meine Mutter einerseits und Malka andererseits waren zwar überzeugt davon, dass sie Cousinen zweiten Grades sind, aber den genauen Zusammenhang zwischen ihnen kannten sie nicht und zerbrachen sich darüber auch nicht den Kopf (wenn sie nicht gerade von mir ausgefragt wurden). Das heißt nicht, dass sie weniger verbunden miteinander gewesen wären - Struktur und Schriftliches haben eben hier nur nicht den Stellenwert wie bei der Fuchs-Familie. Die meisten von ihnen konnten sich mit einem warmen Gefühl noch an meine Großmutter und meine Mutter erinnern. Damit hören aber die Gemeinsamkeiten schon auf. Die Unterschiede zwischen ihnen sind in jeder Hinsicht größer.
Auf unerklärliche Art ist Galizien lebendiger in mir als Karlsruhe, und bis vor kurzem spürte ich noch einen Hauch davon in den Ruinen des Scheunenviertels, in dessen unmittelbarer Nähe ich fast zwanzig Jahre lebte und das jetzt eine „Szenegegend“ geworden ist, in der alle möglichen Winde wehen, dieser Hauch aber nun endgültig verweht ist.
Ich suchte meine Vorfahren auf in diesem weitverzweigten Netz, sprach mit den lebenden, aber auch die verstorbenen und umgebrachten tauchten auf. Nicht nur räumlich Entferntes wird nah, auch Vergangenes wird präsent. Sehr nahe fühle ich mich dem Bruder meiner Mutter, Berthold Feit. Ihm, der nicht mein Onkel werden konnte, ist das Buch gewidmet. Er hatte die Schule abbrechen und als Hilfskraft in einem jüdischen Krankenhaus arbeiten müssen. Im Alter von 15 Jahren wurde er mit seiner Mutter, meiner Großmutter Sara Feit, im Zuge der sogenannten Fabrikaktion13 aus ihrer Wohnung abgeholt und von der Sammelstelle in der Großen Hamburger Straße nach Auschwitz transportiert. Es gibt so wenig über ihn, ein paar Bilder von ziemlich schlechter Qualität, und kaum jemand außer meiner Mutter kann sich an ihn genauer erinnern. Nach Berthold mußte ich immer extra fragen. Wie auch nach meinem Großvater, Iro Feit. Er war wegen seiner Tätigkeit als Hausierer oder fliegender Händler oft nicht zu Hause, und die Ehe war auch nicht besonders gut. „Ach ja, ´n ganz Netter,“ oder „ziemlich dick,“ - das ist schon fast alles, was von ihm überliefert wird. Meine Mutter hat natürlich mehr Erinnerungen, aber auch sie weiß kaum etwas über seine Herkunft. Er kam von Polen nach Berlin, ging 1938 verzweifelt in seine Heimatstadt zurück und verschwand in Rußland …
Noch andere Gestalten tauchen auf, schemenhaft, über die wenig erzählt wird - Johanna zum Beispiel, die Älteste von den drei Kindern meiner väterlichen Urgroßeltern Jenny und Gustav. Sie wurde mit ihrer Tochter Ellen 1943 nach Auschwitz deportiert. Das steht mit einem Fragezeichen in Klammern im Stammbaum von Jutta. In dem Familiensystem hat ihr Verschwinden offenbar keine Erschütterung hervorgerufen, während der Tod von anderen viel stärker empfunden wurde. - Manche verschwinden ganz unbemerkt … Ich spüre das wie einen leisen Schmerz in meinem Inneren.
Auch sie, die Umgebrachten, Verstorbenen, Vergessenen haben ihren Platz in dem Buch; sie sind im Stammbaum extra gekennzeichnet, - ein Grabstein aus Papier.
Natürlich hat mein Vorhaben auch Auswirkungen auf die Lebenden. Durch meine Reisen sind einige neue Verbindungen entstanden und einige alte wiederbelebt worden. Im Laufe der Interviews veränderte sich auch die Beziehung zu meinen Eltern: Ich glaube, alle Kinder haben eine Phase, in der sie mit ihren Eltern hadern. Ich habe mit ihnen innerlich Frieden gemacht, schon lange vor den Interviews; es gehörte wohl zu meinem Erwachsenwerden beim Weg auf die Vierzig. Sie haben mir viel Liebe gegeben, und das ist wohl letztlich das Entscheidende. Dadurch wurde ich frei, neugierig auf sie zu werden. Hinter Vater und Mutter entdeckte ich Henny und Norbert Jacob …
Anmerkungen:
1 siehe Henny Jacob
2 bekanntes und seinerzeit beliebtes Zitat aus dem Manifest der Kommunistischen Partei von Karl Marx und Friedrich Engels, London, 1848
3 lt. Wörterbuch: Sehnsucht haben, schmachten
4 vgl. z. B. Gunthard Weber (Hrsg.): Zweierlei Glück. Die systemische Psychotherapie Bert Hellingers; Heidelberg (Auer), 1998
5 lt. Wörterbuch: in aller Kürze
6 Ausführlich auseinandergesetzt mit dem Konstrukt der Empathie hat sich meine Kollegin Martina Emme in ihrem Buch „Der Versuch, den Feind zu verstehen“ Ein pädagogischer Beitrag zur moralisch-politischen Dimension von Empathie und Dialog, Frankfurt/M. (IKO), 1996
8 wird von Suzanne Schrag erzählt
9 siehe Einleitung zum 2. Teil „Die Familie Felder/Weitmann
10 Malka Birnbaum
11 siehe Chaya Avi Shaul
12 siehe Henny Jacob und Chaya Avi Shaul
13 Am 27. Februar 1943 wurden die Berliner Juden, die bei Siemens, AEG oder in anderen Wirtschaftsunternehmen Zwangsar beit leisten mußten, von ihren Arbeitsplätzen weggeholt und nach Auschwitz deportiert. (siehe Henny Jacob)
Henny und Norbert Jacob
Unsere Gedanken und Gefühle waren nach vorne gerichtet
Berlin und Bergfelde, April 1994 – Juni 1995
Henny, geb. Feit
Ich war damals nicht wenig mutig
Die Familie meiner Mutter kam aus Polen, aus Galizien. Sie lebte unter anderem in Zernica, da wurde auch meine Mutter geboren, und in Baligrod, das ist der Geburtsort ihrer Schwester Cilly. Einige Geschwister hatten den Nachnamen Weitmann, andere hießen Felder. Die unterschiedlichen Nachnamen kamen zustande, weil es damals unter den Ostjuden nicht üblich war, standesamtlich zu heiraten. Aber dann kam ein Prikas1 oder ein Gesetz, nach dem diese Amtshandlung nachzuholen war. Die Kinder aus der Vorprikaszeit hatten dadurch also einen anderen Nachnamen als diejenigen, die später zur Welt kamen. Meine Mutter beispielsweise ist eine geborene Felder, während Cilly und Senta, die jüngsten Schwestern den Familiennamen Weitmann haben. Meine Cousins in Amerika, die Söhne von Chaim, dem einzigen Bruder meiner Mutter, heißen auch Felder - Mendel Felder und Baruch Felder.
Die Geburtstage meiner Mutter und ihrer Geschwister sind nicht sehr exakt aufgezeichnet. Familien, die weitab vom nächsten größeren Ort wohnten, meldeten ihre Kinder en bloc beim Standesamt an. Oft waren die genauen Geburtstage nicht mehr bekannt, und man erinnerte sich nur, daß der eine um Pessach2, der andere um Chanukka3 herum zur Welt kam - und verpaßte ihnen dann ein Geburtsdatum, das etwa in dieser Zeit war. Meiner Tante Cilly hatte man das Datum 20. November gegeben, und sie meinte oft scherzhaft, daß sie ja vielleicht jünger sei. Sie war mit dem Datum auch nicht so recht einverstanden, weil es in dieser Zeit immer regnete und trübe war.
Um den 1. Weltkrieg herum ist Chaim als erster nach Deutschland gekommen. Die Gründe dafür und die näheren Umstände kenne ich nicht. Er hat sich Stück für Stück etabliert und ist ein bißchen wohlhabend geworden. Die Schwester Fanny war bei ihm; sie hatte als Kind mal einen Unfall und hinkte seitdem. Chaim hoffte, in Berlin eine Klinik für sie zu finden, aber die Ärzte konnten ihr nicht helfen.
Der Vater meiner Mutter hieß Baruch. Nach ihm wurden zwei Enkel benannt: Baruch Felder und Baruch Billig. Übrigens heißen meine Cousine Henny-Chaya4 und ich nach der Mutter meiner Mutter, Henny. Es war in jüdischen Familien üblich, Kindern Namen der verstorbenen Großeltern zu geben. Mein Name ist also keine HenrietteVerkürzung. Mein Name war immer Henny; er ist heute selten. Manche finden ihn ganz hübsch und wollen ihn wieder einführen. Wer ihn kennt, erinnert sich meistens an die Schauspielerin Henny Porten. Aber das nur nebenbei.
Ich habe meine Großeltern nie kennengelernt, nicht von der mütterlichen Seite und nicht von der väterlichen. Meine Mutter schilderte ihren Vater als einen sehr frommen Juden, der, wie es üblich war in diesen Familien, nur gelernt hat. Er soll ein sehr hübscher Mann gewesen sein, dunkel und mit Bart. Die Mutter meiner Mutter hat hart gearbeitet. Ob sie Besitz hatten oder nicht, das weiß ich nicht. Ich glaube, auch die Geschwister sind sich in dieser Sache nicht einig gewesen: Senta erzählte, sie stamme aus einer Gutsbesitzerfamilie. Darüber hat sich Cilly halb krank gelacht und gesagt: „Die hat aber aufgeschnitten, das stimmt nicht.“ Was stimmt, weiß ich nicht, ich kenne es nur aus Erzählungen. Fakt ist, daß man von allen Geschwistern gehört hat: Der Vater hat gelernt und die Mutter gearbeitet.
Meine Großmutter hatte wohl ursprünglich elf Kinder - jedenfalls wurde immer von elf gesprochen - aber ich kenne nicht die Namen von allen. Die jüngste Tochter starb an Diphtherie auf der Flucht während des ersten Weltkriegs. Wo der Vater da war, weiß ich nicht. Meine Mutter erzählte immer, daß diese Schwester sehr an ihr gehangen habe und sie deshalb bis zum Schluß bei ihr war. Das hat sie nie vergessen, es war sehr schlimm für sie …
Die Geschwister waren immer zwei Jahre auseinander; sie hießen Chaim, Rosa5, Sara, das war meine Mutter, dann kam Pilla6 - die soll ich als Kind so getauft haben, richtig hieß sie Sprinze. Das war die Schwimmerin der Familie, und sie ist mit mir manchmal - ich saß auf ihrem Rücken - übern Grunewaldsee geschwommen. Ah, die Pilla war toll! Sie ist übrigens so wie sie gelebt hat auch gestorben: im Meer ertrunken; sie ging in Israel jeden Tag schwimmen - sie wohnte mit ihrer Familie in der Nähe des Meeres - und starb an einem Herzanfall im Wasser.
Nach Pilla kam Fanny, die dann in Frankreich gelebt hat und auch dort gestorben ist, dann Senta7 und später Cilly. Die Älteste hieß Malka, sie ist bei einem Autounfall gestorben.
Die Geschwister zogen so nach und nach nach Berlin, nicht alle zur gleichen Zeit. Chaim unterstützte sie anfangs ein bissel - bis sie auf eigenen Beinen stehen konnten. Fünf von den Schwestern wohnten in Berlin-Mitte in der Rückerstraße 5, das war ein Eckhaus. Ob Chaim das organisiert hat oder Fanny, das weiß ich nicht - jedenfalls die Geschwister untereinander haben das organisiert und wohnten da zusammen. Später haben meine Eltern, mein Bruder und ich da gewohnt. Und aus dieser Zeit stammt auch meine verdammte Abneigung gegen diese ganze Gegend.
Im Krieg ist viel kaputtgegangen auf dieser Seite, es blieb nicht allzuviel erhalten und dieses Haus auch nicht. Es hatte einen großen Hauseingang von der einen Seite und von der anderen einen kleineren. In der Linienstraße gab es ein Lebensmittelgeschäft, in dem wir meistens eingekauft haben. Wir wohnten in einer dieser traditionellen Wohnungen hinten auf dem Hof, parterre, die Toilette war außerhalb der Wohnung. Es gab keinen Korridor, du kamst sofort rein in ein großes Berliner Zimmer, und von dort ging die Küche ab.
Als Kind dort zu wohnen, war sehr bedrückend. Es trieb sich allerhand Gesindel herum, Exibitionisten und ähnliche Typen, die versteckten sich oft in den Hausfluren und Kellereingängen. Es kam soweit, daß ich mich fast nicht mehr traute in ein Haus zu gehen, wenn ein Kerl in der Nähe war … Und ich hatte große Angst vor einem Kindermörder, der sich damals in ganz Deutschland herumgetrieben haben soll; die Erwachsenen hatten sich über den unterhalten, und ich hatte davon natürlich etwas aufgeschnappt. Aus meinem Bett konnte ich aus dem Fenster zum Hof sehen, und ich sah immer nur Dunkel … Seitdem habe ich zwei Vorurteile: Das eine ist dagegen, parterre zu wohnen, und das andere gegen Katzen, da sie ständig vor unsere Wohnungstür pinkelten. Bis heute - es wird mir keiner verübeln - habe ich eine Aversion gegen Katzen, weil ich immer noch diesen Geruch in der Nase habe!
Meine Mutter wurde so etwas wie der Mittelpunkt für die Familie. Sie konnte gut kochen, backen konnte sie auch, nur Rosa konnte es noch besser.
Wann meine Mutter meinen Vater geheiratet hat, weiß ich nicht. Chaim wird dafür gesorgt haben, daß seine Schwester durch eine Ehe abgesichert ist und einen Heiratsvermittler eingeschaltet haben. Das war damals so üblich. Bei Rosa hatte er seine Hand ja auch im Spiel, bloß bei ihr verlief die Ehe anders.
Von meinem Vater und seiner Familie kann ich wenig erzählen. Von denen weiß ich so gut wie nichts. Seine Verwandten waren in Dukla, Polen, in seinem Geburtsort, und dort ging er 1938 wieder hin. Da lebten noch seine Eltern, das weiß ich - aber wieviel Geschwister er hatte, das weiß ich nicht …
Die Familie meiner Mutter spielte eine viel größere Rolle in meinem Leben, fast all ihre Geschwister lebten ja hier in Berlin. Das war schon ein Unterschied. Aber ich hab meinen Vater mindestens genauso gern gehabt wie meine Mutter und auch beide gleichermaßen geschätzt.
Wir lebten in sehr ärmlichen Verhältnissen. Meine Eltern kamen finanziell gerade so über die Runden. Beiden hast du immer angemerkt, daß es eine Ehe war, wie ich sie mir nie gewünscht hätte. Sie haben sich nicht verstanden, waren völlig anderen Charakters; jeder für sich war´n Prachtkerl, bloß beide zusammen konnten sie nicht …
Mein Vater, der übrigens mit Vornamen Iro hieß, war für mein Empfinden ein sehr begabter Mensch - Rechnen und all sowas war seine Sache, aber er hatte nie etwas gelernt, hatte keinen festen Beruf. Also hat er mal dieses gemacht, mal jenes, und ist als Hausierer gegangen … Mein Vater war gutmütig, aber manchmal so jähzornig.
Ich kann mich an verschiedene Situationen aus dieser Zeit noch sehr gut erinnern. Vordringlich waren immer die Geldsorgen in unserer Familie. Mein Vater konnte meiner Mutter nur ein geringes Wirtschaftsgeld geben - nicht aus Geiz, sondern weil er nicht mehr hatte - so um die fünf Mark. Das mußte dann reichen. Oft konnte sie damit nicht einmal „den Gasometer füttern“; wenn die Mutter kochen wollte, mußte sie immer erst einen Groschen in den Gasometer reinschmeißen, sonst funktionierte der Gasherd nicht. Und wenn sie den Groschen nicht hatte, hatten wir eben kein Gas und kein warmes Essen … 1928/29 gab es einen harten, bitterkalten Winter. Was wir da froren! Wir konnten uns nie Kohlen auf Vorrat anlegen, und in der Kohlenhandlung schräg gegenüber in der Linienstraße gab es in diesem Winter natürlich auch keinen Vorrat an Heizmaterial. Wenn wir das Geld für einen kleinen Sack zusammen hatten, bekamen wir oft zu hören: „Heute ham wa keene Kohlen, Sie müssen warten. Vielleicht kommse morgen oder übermorgen.“ So hast du jeden Tag um deine Kohlen gebangt.
Auch in der Schule gab es manchmal nichts für die Heizung, und es war dann darin so kalt, daß der Unterricht ausfiel. An manchen Tagen schaffte ich den Weg dorthin vor lauter Kälte nicht, ich mußte umkehren.
Mein Vater war nie besonders religiös. Aber die Tradition wurde bei uns gehalten, die Feiertage, jedoch sie waren für mich ein Greuel, weil sich die Eltern da nie verstanden haben; ich war immer so neidisch auf die anderen Familien, die gingen zusammen spazieren und waren fröhlich. Bei uns gab es zwischen den beiden spätestens Krach vor den Feiertagen, zwischendurch auch, und dann ging´s immer laut zu, sogar am Shabat.
Mutter war ein ganz prima Typ, aber sehr nachtragend. Wenn es zum Streit kam oder nur ein lautes Wort fiel, ging sie ins andere Zimmer und hat den Vater strikt übersehen. Das konnte sie sehr lange aushalten … Und ihn hat das immer sehr gewurmt, denn er war zwar schnell jähzornig, aber er vertrug sich auch schnell wieder mit dir.
Obwohl der Vater nicht religiös war, ging er doch meistens noch in die kleinen Betstuben in der Grenadierstraße, der jetzigen Almstadtstraße, und später öfter mal in die Heidereutergasse. Meine Mutter ist nie mitgegangen, aber sie war auch konservativ und hat aus Gewohnheit kosher gehalten. Das wurde später im Krieg für uns sehr schlimm; wir bekamen nur noch ein paar Lebensmittelmarken von den Nazis, und es gab doch keine jüdischen kosheren Geschäfte mehr. Da mußte ich in die Fleischerläden reingehen und auf Marken ein bissel Fleisch holen - sie hatte einen Ekel davor gehabt! Aber sie hat’s dann genommen, obwohl es nicht kosher war, hat sich überwunden. Schweinefleisch aber durfte es nicht sein, es mußte vom Rind sein …
Noch´ne hübsche Sache: Der Feiertag Sukkoth, das Laubhüttenfest8, wurde immer bei uns gefeiert. Wir wohnten ja in einer jüdischen Gegend, und nicht jedes Haus konnte es sich leisten,´ne Laubhütte zu bauen. Also spielte sich das auf unserem Hof ab: Es wurden schnell´ne Holzhütte und ein paar Bänke und ein langer Tisch zusammengekloppt, und dann haben die Männer acht Tage lang da drin gegessen; die Frauen durften ihnen das Essen hinbringen, aber nicht mit ihnen dort sitzen!
Von der Rückerstraße zogen wir, das Jahr weiß ich nicht mehr so genau, in die Linienstraße, ich glaube - aber ich gebe nicht meinen Kopf zum Pfand dafür - das war die Nummer 218. Das Haus steht heute noch, Ecke Gormannstraße, gegenüber dem Garnisonsfriedhof, ein Eckhaus. Der Eingang war in der Linienstraße. Da wohnten wir schon viel besser, ziemlich weit oben. Viele Leute konnten sich damals keine größeren Wohnungen leisten, und darum lebten oft mehrere Familien in einer. Wir auch. Wir waren zu viert - inzwischen war auch mein Bruder Berthold geboren - und wir hatten zwei Zimmer, eine Küche und ein Bad, was wir vorher nicht kannten, und auch einen Balkon - es war schon ein Fortschritt! Am anderen Ende des langen Flures wohnte eine andere Familie; vielleicht waren es auch zwei Familien, das weiß ich nicht mehr so genau. Mit denen mußte man sich also sehr wohl verstehen. Wir verstanden uns auch gut mit ihnen, es gab keine Streitereien. Auf der gegenüberliegenden Seite der Straße wohnte eine Familie mit mehreren Kindern; der Vater war ein verhältnismäßig kleiner Mann, der immer die rote Fahne draußen zu hängen hatte - du nahmst also an, daß der ein Kommunist ist. Und einer der ersten, die um diese Zeit die Nazifahne raushängten, war der! Konform damit ging dann auch die SA-Uniform. Die meisten, die so schnell umschwenkten, zeigten sich ja sehr bald in SA-Uniformen. Sie bekamen dann ihre Sturmund Schlägerlokale und trafen sich dort immer. Sie waren ein Horror für uns. Dann kam auch die Angst, über die Straße zu gehen - auch im Scheunenviertel, jedenfalls in unserer Gegend. Die vielen orthodoxen Juden waren in unserer Ecke weniger zu sehen. Die wohnten mehr in dem Viertel Grenadierstraße, Dragonerstraße, Hirtenstraße; an schwarze Kluft und lange Bärte habe ich aus unserer Straße nicht so viel Erinnerung, obwohl auch dort verhältnismäßig viel Juden wohnten.
von Henny für Chaya ins Poesiealbum
Kurz nach der Machtergreifung durch die Nazis ging die Ausreisewelle los. In der Schule und überall hörtest du: „Ach, meine Eltern sagen, es wird schon nicht so schlimm werden, es wird nicht so lange dauern.“ Andere wiederum machten, daß sie schnell davon kamen - es lichtete sich schon. Natürlich, die Geld hatten, konnten am ehesten ausreisen und Visen bekommen. Das war eine große Dramatik: Wie kommst du raus, wenn du kein Geld hast … Ich war ein Kind damals, ich wollte natürlich weg, meine Mutter nur bedingt. Sie gehörte zu denen, die sich nicht ganz klar waren, aber sie neigte schon dazu, auch auszureisen.
Ihre Schwestern Cilly und Fanny waren in der KPD, die beiden kamen oft zu uns, und meine Mutter war sehr stark beeinflußt von ihnen. Sie war interessiert an Politik und las intensiv Zeitung; ich werde nie vergessen, in welcher Haltung sie die gelesen hat: Sie kniete auf einem Stuhl vor dem Tisch und war ganz aufmerksam dabei.
Mein Vater hat auch nach Möglichkeiten gesucht auszuwandern. Wir hatten ja nie Geld, und meine Eltern hatten nur die polnische Staatsbürgerschaft und eine deutsche Aufenthaltserlaubnis, die immer wieder verlängert werden mußte - da kam oft die Frage auf: Wollen wir nicht nach Polen? Es war noch lange vor dem Krieg. Aber meine Mutter hat immer gesagt: „Ich komm nicht mit, probier es, aber nach Polen wirst du mich nicht kriegen. Lebendig kriegst du mich nicht nach Polen.“ - Sie hat kaum über ihre Jugend in Polen gesprochen, ich habe nur in Erinnerung, daß sie diesen Antisemitismus dort nie verwinden konnte, der war in ihrem Kopf fest verankert. Wie heute Norberts Schwester Suse9 und meine Cousins Barry Felder und Jossi Billig10 auch sagen: „Ich betrete keinen deutschen Boden mehr.“
´38, nur Monate vor der Kristallnacht, als es gar nicht mehr weiterging, als wir keine anderen Auswanderungsmöglichkeiten hatten, ist der Vater zu seinen Eltern nach Dukla, seinem Geburtsort, gegangen in der Hoffnung, daß er dort was aufbauen kann, wovon man leben kann. Das hat sich leider als Trugschluß erwiesen, es ist völlig anders gekommen.