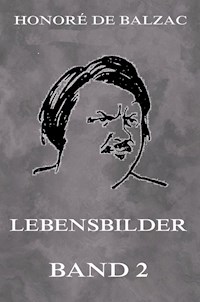
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eines der ersten in Deutschland veröffentlichten Werke Honoré Balzacs. Dies ist Band 2 von 2 mit Kurzgeschichten aus dem Pariser Leben des 19. Jahrhunderts.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lebensbilder, Band 2
Honoré de Balzac
Inhalt:
Honoré de Balzac – Biografie und Bibliografie
Lebensbilder, Band 2
Vorrede des Verfassers
Bemerkung des Übersetzers
Erstes Bild - Die Blutrache
Zweites Bild - Der Geizhals
Drittes Bild - Der Ball im Freien
Dritter Teil
Erstes Bild - Die tugendhafte Frau
Zweites Bild - Der Diamantring
Drittes Bild - Glanz und Elend
Anhang
Das Abenteuer
Lebensbilder, Band 2, Honoré de Balzac
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849605865
www.jazzybee-verlag.de
Honoré de Balzac – Biografie und Bibliografie
Franz. Romandichter, geb. 20. Mai 1799 in Tours, gest. 18. Aug. 1850 in Paris, übernahm, da seine ersten Romane, die er unter verschiedenen Pseudonymen veröffentlichte (30 Bde.), durchaus nicht beachtet wurden, eine Buchdruckerei, die er aber infolge schlechter Geschäfte bald wieder aufgeben mußte, kehrte dann zur Literatur zurück und schwang sich mit dem Roman »Le dernier Chouan, ou la Bretagne en 1800« (1829, 4 Bde.), den er unter seinem eignen Namen erscheinen ließ, mit einemmal zur Berühmtheit des Tages empor. Von nun an erschienen Schlag auf Schlag eine Unmasse von Romanen, in denen er die allmählich entstandene Idee, alle Seiten des menschlichen Lebens darzustellen, zu verwirklichen suchte.Bis zu einem gewissen Grad ist ihm dies gelungen; in der »Comédie humaine«, wie er selbst die Gesamtheit seiner Schriften bezeichnete, vereinigte er: »Scènes de la vie privée« (im ganzen 27 Werke); »Scènes de la vie de province« (»Eugénie Grandet« etc.); »Scènes de la vie parisienne« (»La dernière incarnation de Vautrin«, »Le père Goriot«, »Grandeur et décadence de César Birotteau«, »La cousine Bette«); »Scènes de la vie politique«; »Scènes de la vie militaire«; »Scènes de la vie de campagne«; »Etudes philosophiques« (»La peau de chagrin«, »Louis Lambert«); »Études analytiques« (»La physiologie du mariage«).Dazu kommen noch einige Dramen, die aber keinen Beifall fanden, und einige Komödien, von denen »Mercadet, ou le faiseur« (1851) sehr gefiel. Sein letztes Werk, der Roman »Les parents pauvres«, ist auch wohl sein reifstes. Balzacs Romane zeigen eine vorzügliche Schilderung des bürgerlichen Lebens, dem er den Glanz des Reichtums und die eleganten Formen und hochtönenden Namen der Aristokratie andichtet, ohne daß darum seine Personen in Manier und Gesittung ihre Parvenunatur verleugnen. Deshalb fällt auch Balzacs Erfolg mit dem Bürgerkönigtum zusammen. Mit der Julirevolution ging sein Stern auf, in der Februarrevolution, die den vierten Stand zur Herrschaft brachte, erblich er. Eine andre, wesentliche Stütze seines Ruhmes hatte er in der Frauenwelt gefunden, deren Herz er gewann durch »La femme de trente ans« (1831). Seinen Erfolg in Frankreich übertraf bei weitem der in Europa; überall wurde B. gelesen, man kopierte das Leben seiner Helden und Heldinnen und möblierte sich á la B. In seinen »Contes drolatiques« (30 Erzählungen im Stile Rabelais'), der »Physiologie du mariage« etc. ist er dem nacktesten Realismus verfallen, und mit Recht nennen ihn die Zola und Genossen ihren Herrn und Meister. Wenige Schriftsteller haben es verstanden, so treu die Sitten der Zeit und des Landes zu schildern, so tief in die Herzen der Menschen einzudringen und das Beobachtete zu einem lebendigen, überraschend wahren Bilde zu vereinigen. Aber seine Schilderungen sind jedes idealen Elements bar, die letzten Gründe menschlicher Handlungen führt er auf die Geldsucht und den gemeinsten Egoismus zurück, besonders seine Schilderungen des weiblichen Herzens sind oft von empörendem Naturalismus. Dazu kommen häufig große Flüchtigkeit in der Anordnung des Stoffes, Geschmacklosigkeit im Ausdruck und viele Mängel im Stil. Balzacs Werke erscheinen in einzelnen Ausgaben noch jedes Jahr und sind auch mehrmals gesammelt worden, z. B. 1856–59, 45 Bde., 1869–75, 25 Bde. (der letzte enthält Balzacs Briefwechsel von 1819–50), 1899 ff. (noch im Erscheinen); eine Ergänzung bilden die »Histoire des œuvres de H. de B.« von Lovenjoul (1879, 2.Aufl. 1886) und dessen »Études balzaciennes« (1895). Vgl. Laura Surville (Balzacs Schwester), B., sa vie et ses œuvres (1858); Th. Gautier, Honoré de B. (1859); de Lamartine, B. et ses œuvres (1866); Champfleury, Documents pour servir à la biographie de B. (1876); E. Zola, Über B. (in »Nord und Süd«, April 1880); H. Favre, La Franceen éveil. B. et le temps présent (1887); Gabr. Ferry (Bellemarre d. jüng.), B. et ses amies (1888); Barrière, L'œuvre de B. (1890); Lemer, B., sa vie, son œuvre (1892); Wormeley, Life of B. (Boston 1892); Lie, Honoré de B. (Kopenh. 1893); Cerfberr und Christophe, Répertoire de la Comédie humaine de B. (1893); Flat, Essais sur B. (1893–95, 2 Bde.); Biré, Honoré de B. (1897).Balzacs Büste ist im Foyer des Théâtre-Français aufgestellt; ein Denkmal (von Fournier) ist ihm in Tours errichtet.
Lebensbilder, Band 2
Vorrede des Verfassers
Es gibt ohne Zweifel Mütter, denen eine vorurteilsfreie Erziehung keinen der weiblichen Reize geraubt: deren gründliche Geistesbildung sich von aller Pedanterie frei erhielt; – werden diese die Lehren, die ich hier gegeben, ihren Töchtern vorlegen? – Der Autor wagt, dies zu hoffen.
Der unparteiische Leser wird ihm daraus keinen Vorwurf machen, daß er das Familienleben, welches man heutzutage den Blicken der Welt so sehr als möglich zu entziehen strebt, in wahrhaften Gemälden aufgedeckt hat. Er hat die gefährlichen Stellen des Lebenspfades mit Merkzeichen ausgestattet, wie die Schiffer der Loire die Sandbänke bezeichnen, um den Augen des Unerfahrenen eine sichtliche Warnung zu geben.
Soll er auch in den Salons um Vergebung nachsuchen? – In diesem Werke gibt er der Welt wieder, was ihm die Welt gegeben. Wird man es ihm dort verübeln, daß er die Ereignisse, die einer Heirat vorangehen oder nachfolgen, treu geschildert, und sollte deshalb sein Buch jungen Frauenzimmern entzogen werden, die auf demselben Schauplatz einst sich zeigen müssen?
Der Autor sieht nicht ein, weshalb eine Mutter den nötigen Unterricht ihrer Tochter um ein oder zwei Jahre vorenthalten soll, warum sie sie nicht beizeiten auf die Stürme vorbereiten wird, denen sie sich aussetzen muß.
Dieses Werk soll eigentlich die dummen Bücher verdrängen, welche abgeschmackte Schriftsteller bisher den Frauen darbrachten. Möge der Autor den Bedürfnissen der Zeit und dem Zweck seines Unternehmens nachgekommen sein, – er selbst darf sich dies Zeugnis nicht geben. Vielleicht wird man ihm das Beiwort anhängen, das er seinen Vorgängern gab, allein er weiß, in der Literatur heißt nicht gefallen, nicht existieren. Das Publikum hat das Recht, den Künstlern zu sagen: – Vae victis! –
Schließlich erlaubt er sich noch die Bemerkung, man könnte ihm vorwerfen, sich oft auf Einzelheiten mehr als gebührend eingelassen zu haben. Es wird leicht sein, ihm Geschwätzigkeit nachzuweisen. Seine Bilder haben oft die Fehler niederländischer Schule ohne ihre Vorzüge; aber er will dieses Buch unschuldigern, unverdorbenern, weniger unterrichteten und daher auch nachsichtsvollern, Lesern widmen, als die eigentlichen Kritiker sind, deren Kompetenz er sich entzieht.
Bemerkung des Übersetzers
Der Übersetzer hält es hier für seine Pflicht, die Tenzdenz, von welcher der Verfasser spricht, näher zu bezeichnen. Ein jedes der folgenden Bilder hat nicht einen poetischen, sondern einen praktischen Zweck, wie schon gesagt worden. Der Verfasser stellt also die Lösung des Lebensrätsels nicht in Zweifel, sondern ohne schwierige Dialektik, mit großer Sicherheit und Behaglichkeit sagt er: der Zweck des Lebens sei Famillenglück. – Der Ausspruch hat viel für und wider sich. – Dem Übersetzer liegt die Pflicht nicht ob, dies zu entscheiden. Die meisten der folgenden Erzählungen führen dies Thema nur negativ durch, das heißt: sie schildern Ehen, welche gewisser Ursachen halber nicht glücklich ausfallen konnten. Nur ein glückliches Paar erscheint in einer der sechs Novellen; ich überlasse es dem Leser, dies herauszufinden, und hat er es gefunden, so muß er eingestehen, unter solchen Umständen, bei solchen Charakteren und in solchen Umgebungen läßt sich allerdings das Familienglück nicht leugnen – und der Verfasser hat also seine Aufgabe gelöst.
Die letzten Bemerkungen der Vorrede, anlangend die Geschwätzigkeit und das Verweilen bei Nebenumständen, schienen dem Übersetzer indessen doch bedenklich, er hat sich einige Abkürzungen erlaubt, wo der Verfasser allzuweit von dem Faden der Erzählung abschweifte.
Erstes Bild - Die Blutrache
1.
Am einem Septembertage des Jahres 1800 langte ein Fremder, begleitet von seiner Gattin und seiner kleinen Tochter, vor den Tuilerien zu Paris an, blieb eine Weile vor den Trümmern eines erst kürzlich zerstörten Hauses stehen, schlang die Arme ineinander und senkte das Haupt.
Wenn er hin und wieder es erhob, geschah es, um den Palast des Konsuls in Augenschein zu nehmen, oder um seine Gattin zu betrachten, welche ermüdet auf einen Stein sich niedergelassen, das kleine Mädchen zu sich gezogen hatte, und während sie voll mütterlicher Zärtlichkeit das rabenschwarze Haar desselben streichelte, dennoch ihren Begleiter nicht aus den Augen ließ und jeden seiner Blicke erwiderte. Es war nicht zu verkennen, wie nahe sich beide gingen und ein und dieselben Gefühle ihre Blicke und Bewegungen beherrschten. Gemeinschaftliches Mißgeschick ist ein enges Band. Es waren Eheleute und die Kleine das letzte Pfand eines vergangenen Glückes.
Der Unbekannte hatte kräftige Gesichtszüge, dickes, schwarzes Haar, das schon an einigen Stellen zu greisen begann, seine edlen Züge entstellte aber eine abstoßende Härte. Er war groß, kräftig, obgleich älter als sechzig Jahre. Seine abgetragenen Kleider verrieten einen Fremden von weither.
Seine Gattin zählte mindestens fünfzig Jahre, ihre ehemals schöne Gestalt war welk, und tiefe Trauer schien ihr inzuwohnen; wenn aber ihr Gatte sie anblickte, zwang sie sich zu einem Lächeln und einer stillen Fassung. Das Kind, trotz der Müdigkeit des zarten, sonnegebräunten Antlitzes, blieb bei der Mutter stehen. Es hatte den italischen Anstand, große, schwarze Augen unter gebogenen Brauen, natürliche Würde mit kindlichem Liebreiz.
Mehr als einem Vorübergehenden fiel die südliche Gruppe auf, die keinen Hehl aus ihrer Verzweiflung zu machen schien und stumm und einfach sie ausdrückte. So oft aber der Unbekannte wahrnahm, daß er der Gegenstand müßiger Neugier sei, verscheuchte ein wilder Blick den dreisten Beobachter wie den teilnehmendsten Menschenfreund, und die Gaffer beschleunigten ihre Schritte, als habe ihr Fußtritt eine Schlange berührt.
Mit einem Male fuhr der Fremde mit der Hand über die Stirne, als wolle er die Gedanken, die in den tiefen Furchen derselben sich gelagert hatten, durch einen kühnen Entschluß verscheuchen. Noch einmal blickte er Weib und Kind an, zog ein langes Messer aus seinem Busen, reichte es seiner Gattin und sagte auf italienisch: «Laß sehen, ob die Bonapartes unsrer noch gedenken.«
Ruhig und festen Schrittes ging er auf die Pforten des Palastes zu.
Die Schildwacht hielt ihn natürlicherweise an und setzte beim ersten Ungehorsam das Bajonett auf seine Brust. Zufällig aber kam der Korporal herzu, um die Schildwacht abzulösen, der dem Unbekannten mit französischer Artigkeit riet, sich an den wachthabenden Offizier zu wenden, und den Ort, wo er zu finden sei, bezeichnete.
Der Fremde traf den wachthabenden Kapitän, und seine ersten Worte waren: »Melden Sie Bonaparte, Bartholomeo di Piombo wolle mit ihm reden.«
Der Kapitän entgegnete, der Zutritt zum ersten Konsul werde nur nach einem schriftlichen Gesuch gestattet. Aber der Fremde blieb bei seinem: Bartholomeo di Piombo wolle Bonaparte sprechen, und jener mußte sich auf seine vorgeschriebene Ordre berufen und das Gesuch rund abschlagen. Bartholomeo faltete die Brauen, ein dunkler Blick schien den Offizier für alle Folgen verantwortlich zu machen. Er schwieg, verschränkte die Arme und stellte sich mitten in die Pforte, die den Tuilerien-Garten mit dem Palaste verbindet.
Kühnen ist das Glück hold, oder wer etwas kräftig will, beschwört seine Umstände oder weicht nicht eher, bis sie sich günstig gestalten. Bartholomeo hatte sich eben auf einem Eckstein vor dem Portal niedergelassen, als ein Wagen vorfuhr, aus welchem Lucian Bonaparte, Minister des Innern, stieg.
»Lucian!« rief Bartholomeo in korsischer Mundart, »ich bin sehr erfreut, dich zu sehen.« Lucian blieb stehen, sah den Fremden an, dieser sagte ihm einige Worte ins Ohr, worauf Lucian mit dem Kopfe nickte und den Fremden ihm folgen hieß.
Er führte ihn ins Zimmer des ersten Konsuls, Murat, Lannes und Rapp waren bei Bonaparte. Als Lucian mit seinem zweideutigen Begleiter eintrat, schwiegen alle mitten in der Rede. Lucian aber nahm Napoleon bei der Hand, zog ihn in die Brüstung eines Fensters, sagte ihm einige Worte leise, worauf der Konsul ein Zeichen mit der Hand gab, dem Murat und Lannes gehorchten und sich entfernten. Rapp aber stellte sich, als habe er nichts gesehen, und blieb. Bonaparte mußte ihm noch einmal ausdrücklich befehlen, daß er hinausgehen solle; der Adjutant verließ das Kabinett, ging aber im Vorzimmer mit starken Schritten auf und nieder. Bonaparte eilte ihm zornig nach und fragte: »Willst du mich heute nicht verstehen? Ich will allein sein mit meinem Landsmann.«
»Mit dem Korsen?« fragte der Adjutant mißtrauisch. »Ich traue keinem Korsen.«
Der Konsul lächelte und stieß seinen treuen Diener sanft bei der Schulter zur Tür hinaus.
Bonaparte kehrte zurück.
»Wie kommst du hierher, mein armer Bartholomeo?« fragte er.
»Wenn du ein Korse bist,« versetzte Bartholomeo dreist, »so gib mir Schutz und Zuflucht.«
»Welch Mißgeschick macht dich flüchtig? – Vor einem halben Jahre warst du der Reichste, Angesehenste –«
»Ich habe alle Portas umgebracht,« versetzte der Korse. Der erste Konsul trat oder flog zwei Schritte zurück.
»Verrat mich nur!« rief Bartholomeo mit wilden, leuchtenden Augen. »Es leben noch vier Piombos in Korsika.«
Lucian faßte Bartholomeo beim Arm und fragte: »Willst du meinem Bruder hier drohen?«
Bonaparte verwies ihn zum Schweigen und fragte Piombo: »Warum hast du die Portas umgebracht?«
Die Augen des Korsen leuchteten wie Blitze. »Wir hatten uns vertragen,« sprach er, »die Piombos und Portas. Die Barbatonis hatten uns versöhnt. Wir tranken mitsammen, um unsern Haß im Wein zu ersäufen. Hierauf ging ich, weil ich in Bastia ein Geschäft hatte. Die Portas bleiben bei mir, stecken mein Haus in Brand, brachten meinen Sohn Gregorio um, und wenn mein Weib und meine Tochter entkamen, so geschah's, weil sie morgens zur Kommunion waren und die heilige Jungfrau sie schützte. – Ich kehre heim – finde kein Haus – in Schutt und Asche suche ich mein Obdach.«
Von Erinnerungen überwältigt, hielt er inne.
»Da« – fuhr er fort – »da stoß ich auf einen Leichnam. Es war mein Gregorio, ich erkannte ihn im Mondschein. Das sind die Portas gewesen! rief ich und ging zur Stelle in die Gebirge!
Dort sammle ich Leute um mich, denen ich Dienste geleistet – verstehst du Bonaparte, denen ich Dienste geleistet, und wir zogen nach den Weingärten der Portas. Um neun Uhr morgens waren wir dort, um zehn standen sie alle vor Gott. – – Giacomo behauptet, Elisa Banni habe den kleinen Luigi Porta gerettet. Es ist nicht wahr! Ich selbst habe ihn ans Bett gebunden und das Haus gleich darauf in Brand gesteckt.«
Mit neugierigen Blicken, jedoch ohne Erstaunen, maß Bonaparte den Erzähler.
»Wie viele waren's ihrer?« fragte Lucian.
»Sieben in allem!« versetzte Piombo. – »Zuzeiten waren's eure Verfolger,« fügte er nachdrücklich hinzu. Wie er aber sah, daß diese Worte nicht den mindesten Zorn in beiden Brüdern erregten, rief er wie in Verzweiflung:
»Was? seid Ihr Korsen? – Es gab eine Zeit, wo ich euch schützte. Ohne mich«, sprach er keck auf Bonaparte deutend, »wäre deine Mutter lebend nicht nach Marseille gekommen.«
Bonaparte stand gedankenvoll, den Arm auf den Rand des Kamins gestützt.
»Ich kann dich nicht schützen.« sprach er endlich. »Ich bin Haupt der Republik und muß die Gesetze halten.«
»O Gott! o Gott,« rief Bartholomeo.
»Allein ein Auge kann ich zudrücken, diese Blutrache«, sprach er, »stoß ich um, es koste, was es wolle.«
Er schwieg, und Lucian winkte dem Piombo, der schon wieder unwillig den Kopf zu schütteln anfing, jetzt ruhig zu sein.
»Bleib hier!« nahm Bonaparte endlich das Wort, »so will ich um das Geschehene mich nicht kümmern. Ich will dein Eigentum verkaufen lassen und später auch für dich sorgen. Vergiß aber nicht, wo du bist; du bist hier in Paris, wo keine Blutrache gilt. Wag' es nur, mit dem Dolche zu spielen, und du bist ohne Gnade verloren. Hier schützt das Gesetz alle Bürger, und keiner darf sein Recht sich selber nehmen.«
»Wohlan!« sprach Bartholomeo. »es heiße jetzt mit uns, auf Leben und Tod. Verfüge über alle Piombos.« – Seine Stirn erheiterte sich nach diesen Worten, und ruhig sah er sich im Zimmer um. »Ihr habt's gut hier,« sprach er wohlgefällig, »ein schönes Haus.«
»Es hängt von dir ab,« versetzte Bonaparte (er dutzte ihn als seinen Landsmann) »eben solchen Palast zu bewohnen. – Bei allem habe ich mitunter einen Freund nötig, dem ich gänzlich trauen kann.«
Da brach ein Freudenschrei aus Piombos gepreßter Brust. »Ja! Du bist doch ein Korse,« rief er und reichte seine Hand dem ersten Konsul hin.
Bonaparte lächelte, betrachtete schweigend seinen Landsmann, der ihm die Luft seines Vaterlandes wiederbrachte, der Insel, die ihn bei seiner Rückkehr aus Ägypten so enthusiastisch empfangen, der Insel, die er im Leben nicht wiedersehen sollte, dann gab er seinem Bruder ein Zeichen, und dieser führte Bartholomeo di Piombo hinaus.
Draußen fragte Lucian nach den Umständen seines ehemaligen Beschützers; dieser deutete mit einer zärtlich-wehmütigen Gebärde auf ein Fenster und zeigte Weib und Kind, müde auf den Trümmern sitzend. – »Wir kommen heut zu Fuß von Fontaineblau und haben keinen Heller.«
Lucian händigte ihm seine Börse ein, beschied ihn auf den andern Tag zu sich und versprach ihm, daß für seine Existenz gesorgt werden solle, denn der Wert seiner Güter in Korsika reichte nicht hin, daß er in Paris mit Anstand davon leben konnte.
Voll Freude und hoffnungsreich kehrte Bartholomeo zu seiner Familie zurück. Die Flüchtlinge erhielten am selben Abend noch eine Stätte, Brot und den Schutz des ersten Konsuls.
2.
Der erste, der in Paris ein Maler-Atelier für Damen eröffnete, war ein gewisser Herr Servin, ein Künstler von Ruf, der streng auf Sitte hielt, ganz seiner Kunst lebte und aus Zuneigung die Tochter eines Generals ohne Vermögen geheiratet hatte. – Es lag in seinem Plane, nur Schülerinnen aus den reichsten und geachtetesten Häusern anzunehmen, um jeder möglichen Nachrede auszuweichen. Sogar den Malerinnen von Profession, oder denen, die sich dazu bildeten, weigerte er den Zutritt. Diese Sorgfalt, wie auch die ganze Lebensweise des Künstlers, erwarben ihm ein unbedingtes Zutrauen, und wenn anfänglich die Mütter selbst ihre Töchter nach dem Atelier begleiteten, bald hielten sie sich der Wachsamkeit überhoben, in der festen Ueberzeugung, ihre Kinder dort in gesitteter und wohlerzogener Gesellschaft zu wissen. –
Bald hatte Servins Atelier ebensoviel Ruf wie Leroys Moden oder Chevets Pasteten usw. Wollte eine junge, vornehme Dame zeichnen oder malen lernen, so hieß es: gehen Sie zu Herrn Servin, und nahm eine Unterricht bei ihm, so wußte man, daß sie über alle Bilder des Museums ein Urteil hatte, daß sie ein Porträt zeichnen, ein Ölbild kopieren und ein Genrestück anfertigen konnte. – Servin genügte allen Kunstbedürfnissen der guten Gesellschaft, obschon er selbst ganz der freie Künstler blieb. Das Atelier nahm den ganzen Giebel eines Hauses ein. Eine innere Treppe führte zu dem Künstlerinnen-Harem, welcher den Eintretenden, der, nachdem er so viel Stufen erstiegen, vielleicht aufs Dach zu gelangen erwartete, mit seiner Größe überraschte. Hohe Fenster erhellten überflüssig den ganzen Raum, und mittels grüner Vorhänge konnten die Malerinnen beliebig jedes Licht sich schaffen. Auf die dunkelgrau angestrichenen Mauern waren Karikaturen, Köpfe, Gestalten aller Art mit der Messerspitze schraffiert, zum Beweis, daß vornehme, junge Damen ebensoviel Unnützes im Kopfe hegen als Männer irgend. Die langen Röhren eines kleinen Ofens in der Mitte beschrieben ein fürchterliches Zickzack, bevor sie den höchsten Winkel des Daches erreichten. Eine Wand, die ringsum lief, stützte die schönsten Gips-Modelle, aufgestellt in wilder Verworrenheit; einige weiß, andere halb gereinigt, die meisten mit einem gelblichen Staub überzogen; darüber offenbarte hin und wieder das Haupt der Niobe, an einem Nagel hängend, seinen steinernen Schmerz, oder eine Venus lächelte holdselig; oder gar ein Arm streckte frech sich aus und breitete die Hand zum unverschämten Betteln hin; anatomische Glieder schienen wie aus Gräbern gestohlen; Gemälde, Zeichnungen, Mannekins, Rahmen ohne Leinewand, Leinewand ohne Rahmen vollendeten den bunten Anblick, das prächtige Elend, den zerlumpten Reichtum, das prangende Chaos, die Mischung roher Stoffe, die des Künstlers zu harren scheinen, der etwas aus ihnen bilde. – So sieht's in einer Werkstatt aus, in manchem Künstlerkopf nicht besser.
Hell schien die Julisonne, und zwei mutwillige Strahlen, durch zwei unverhängte Fenster dringend, durchflimmten die ganze Tiefe der Galerie mit durchsichtigem Gold und blitzenden Staubkörnchen. Die Staffeleien erhoben ihre spitzen Häupter wie Schiffe im Hafen. Die Malerinnen saßen davor, mit jugenlichen Gesichtern, heiterem Anstand und doch ganz verschieden die eine von der andern, und verschiedener noch eine jede durch ihren Putz. – Die starken Schatten der grünen Vorhänge bildeten seltsame Lichteffekte, wundersame Massen von Helldunkel. Das Atelier selbst war würdig, Bild eines Ateliers zu sein.
Wenn auch Rang und Glücksgüter nicht in eine Künstlerwerkstatt gehören, dennoch verrieten zwei Gruppen hier zweierlei Gesellschaft.
Sitzend oder stehend, von ihren Farbenkästchen umgeben, die Pinsel rührend oder die zierliche Palette bereitend oder malend, lachend, schwatzend, singend, kurz, dem natürlichen Behagen überlassen, offenbarte die eine Gruppe ein Schauspiel, das Männern unbekannt bleibt, gelingt es ihnen nicht, es zu belauschen. Es war die Klasse der Reichen, aber Unadligen, Bankiers-, Notaren- und Beamten-Töchter; die andere Klasse, stiller und einförmiger, war die der Adligen. Ihr Wesen war voll Würde, ihr Benehmen gemessen, man erriet leicht, daß sie der Welt angehörbar, wo der Anstand die Charaktere modelt, wo es zu scheinen gilt und nicht zu sein, wo man für Geselligkeit und nicht für Einsamkeit erzogen wird, wo Äußerlichkeiten das innere Leben ersticken.
Es war Mittag und Herr Servin noch nicht angelangt. Man wußte, daß er in einem andern Atelier an einem Bilde für die Ausstellung arbeitete und erwartete ihn nicht mehr. – Da erhob sich Fräulein Monsaurin, eine junge Marquise, die vornehmste der adligen Klasse, sagte etwas leise zu ihrer Nachbarin, diese teilte es einer anderen mit, und plötzlich herrschte tiefe Stille unter dem Adel.
Darüber wunderte sich die demokratische Partei und schwieg ebenfalls, bis das Geheimnis endlich an den Tag kam.
Die Monsaurin erhob sich, nahm eine Staffelei, die ihr zur Rechten stand, und stellte sie weit weg von der adligen Gruppe, nahe bei einem Verschlag, der das Atelier von einer Dachkammer trennte. Die Mittelmauer bildete hier in einem sehr tiefen Winkel ein finsteres, unregelmäßiges Gemach, wohin zerbrochene Gipsbilder oder Gemälde, die Herr Servin mißbilligte, geworfen wurden; wo man im Sommer den Ofen ließ und im Winter Holz bewahrte.
Die Tat der Monsaurin erregte allgemeinen Unwillen, allein die vornehme Dame kümmerte sich nicht darum, wälzte den Kasten mit Malereigerät ebenfalls der Staffelei nach und trug zuletzt den Bock und ein Gemälde von Rubens hin, mit dessen Kopie die also verbannte Abwesende beschäftigt war. – Kleine Umstände entscheiden oft über ein ganzes Menschenleben, die gegenwärtige Tat der Monsaurin veranlaßte die ganze traurige Geschichte, wie sie hier wahrhaft berichtet werden soll.
Die linke Seite unterließ nicht, ihren Unwillen über diese Tat auszusprechen.
»Was die Piombo wohl sagen wird?« begann Fanny Planta.
Eine andere von derselben Seite sprach: »Sie ist eine Korsin und wird nichts sagen, aber nach fünfzig Jahren gedenkt sie der Beleidigung wie heut. – Ich möchte nichts mit ihr zu tun haben.«
»Es ist unrecht!« sprach eine dritte. »Ginevra ist seit kurzem sehr betrübt, ihr Vater ist um seinen Abschied eingekommen, des Unglücks sollte man schonen. – War sie nicht stets zuvorkommend gegen alle diese Fräuleins? Hat sie jemals irgendwen auch mit einem Worte nur beleidigt? Sie hat jedes politische Gespräch vermieden, nur um keinem Ärgernis zu geben.«
»Sie soll bei mir sitzen,« rief Fanny Planta und erhob sich – doch plötzlich blieb sie gedankenvoll stehen. – »Mit der Piombo«, fuhr sie fort, »ist nicht zu spaßen. Wer weiß, wie sie meine Artigkeit aufnimmt.«
»Sie kommt,« sprach eine schmachtende junge Dame mit dunklen Augen. – Wirklich schwebte etwas die Treppe hinauf. »Sie kommt, sie kommt!« ertönte es von Mund zu Mund, und die tiefste Stille trat wiederum ein.
Es muß zur Erklärung des Ostrazismus der Monsaurin gesagt werden, daß dieser Auftritt im Juli des Jahres 1815 stattfand, wo die zweite Rückkehr der Bourbonen manches enge Band, das der ersten Restauration widerstanden, gelöst hatte. Ginevra, die Tochter des Baron Piombo, verehrte Napoleon bis zur Anbetung und hielt ihren Kummer über seine Gefangenschaft keineswegs geheim. Die anderen adligen Schülerinnen gehörten dagegen der streng royalistischen Partei an und waren schon längst entschlossen, sich von der Bonapartianerin zu entfernen, doch hatte es noch keine gewagt, ihre Gesinnung zu verraten, bis heut, wo die Monsaurin den ersten entscheidenden Schritt tat.
Ein süßes Schweigen feierte also den Eintritt der hohen Jungfrau, die unbefangen sich nahte und, durch ihre Gefährten schreitend, mit Anstand grüßend fragte: »Weshalb sind Sie so stille heute, meine Damen?«
Ohne die Antwort abzuwarten, ging sie auf ein kleines Mädchen mit blonden Haaren zu, welches fern von allen anderen saß, denn es war die Ärmste, aber auch die Bescheidenste und Fleißigste. Sie prüfte ihre Arbeit und sprach: »Du machst Fortschritte, liebe Laura, deine Inkarnation ist noch etwas zu rosig, aber der Kopf ist gut gezeichnet.«
Dankbar blickte Laura auf sie, und die Italienerin ging weiter, blickte nachlässig auf die Zeichnungen und Bilder der übrigen Malerinnen, grüßte eine jede und schien der Neugier, mit der man sie betrachtete, so wenig zu achten wie eine Königin, von ihrem Hofstaat umgeben.
Sie setzte sich endlich vor ihre Staffelei, bereitete ihre Pinsel, öffnete die Farbenschachteln, zog die Ärmel an, band ihre Schürze vor, doch ihre Gedanken, wie es schien, waren ganz wo anders.
»Merkt sie denn nichts?« fragte die Planta.
Ginevra richtete den Blick nach der Stelle hin, welche sie sonst innezuhaben pflegte, dann wandte sie sich wieder zu ihrer Arbeit zurück.
»Sie ist nicht böse,« sprach die Planta, »denn ihre Mienen haben sich nicht einmal verändert.«
Ginevra schien nichts zu hören, langsam schritt sie längs der Wand, die das finstere Gemach bildete, blieb träumerisch und gedankenvoll stehen und schien das Licht zu prüfen, das durch die großen Fenster fiel. Sie bestieg einen Stuhl, um den Vorhang viel höher aufzuziehen, und gewahrte in dieser Höhe, ungefähr einen Fuß über ihrem Haupte, eine Spalte in jener Wand; ihre Freude darüber ließ sich nicht verkennen. – Sie ging auf ihren Platz zurück, ordnete ihr Bild, stellte sich wie unzufrieden mit dem Lichte, holte einen Tisch herbei, stellte einen Stuhl darauf, bestieg diese Höhe und konnte nunmehr durch die Spalte blicken. Das Gemach war erhellt, und was sie sah, erschütterte sie heftig.
»Sie fallen, gnädiges Fräulein,« rief die besorgte Laura.
Alle Mädchen sahen die Verwegene wanken, aber die Furcht, ihre Gefährtinnen könnten ihr zu Hilfe eilen, lieh ihr Mut; mit unglaublicher Geschicklichkeit schwang sie sich ins Gleichgewicht zurück, und sich lächelnd zu Laura wendend, sprach sie: »Liebes Kind, dies Gerüst steht fester als ein Thron.«
Hierauf zog sie den Vorhang ganz in die Höhe, schob dann Tisch und Stuhl weit weg und schien mit der Stellung ihrer Staffelei nicht eher zufrieden, als bis sie sich dem Verschlusse gänzlich genaht hatte. – Hierauf ergriff sie Pinsel und Palette, aber sie malte nicht, sondern lauschte. – Bald vernahm sie dasselbe Geräusch, das vor einigen Tagen ihre Aufmerksamkeit im höchsten Grade erregt, viel deutlicher: die tiefen, gleichförmigen Atemzüge eines Schafenden. Sie hatte jenseits der Wand den kaiserlichen Adler auf einer geächteten Uniform und beim schwachen Tagesschein, der durch eine Luke fiel, einen Offizier, auf einem Feldbette schlafend, erblickt. Sie erriet alles, fühlte, welch schwerer Verantwortlichkeit sie sich unterzogen, und beschloß, alles anzuwenden, damit nicht eine ihrer Gefährtinnen dieselbe Entdeckung mache und der arme Geächtete der Verschwiegenheit und Willkür einer Leichtsinnigen preisgegeben würde.
Ginevra also war ihrerseits mit der ihr zugefügten Kränkung wohl zufrieden, aber ihren Mitschülerinnen blieb sie ein Rätsel. Niemand hatte es der Korsin, trotz aller guten Eigenschaften, die man an ihr wahrnahm, zugetraut, daß sie eine Beleidigung vergeben würde. Zum ersten Male war ihr jetzt eine Kränkung widerfahren, aber sie schien nicht einmal darauf zu achten. Demoiselle Planta wollte endlich in Ginevras Benehmen eine über alles Lob erhabene Seelengröße entdecken, und ihr Anhang schonte keine Worte, um die aristokratische Partei ihres rangsüchtigen Benehmens halber zu demütigen. Er hatte auch bereits seinen Zweck vollkommen erreicht, als Madame Servin eintrat und sprach: «Meine Damen, ich muß meinen Mann heut entschuldigen, er kann nicht kommen.« Sie begrüßte hierauf noch eine jede Schülerin insbesondere, empfing und erteilte Liebkosungen und Schmeicheleien in Gebärden, Worten, Mienen und Umarmungen, wie dies Art der Weiber ist. Hierauf ging sie zu Ginevra, die vergeblich sich bemühte, ihre Unruhe zu verbergen. Ein Gruß reichte zwischen ihnen aus. Ginevra malte, die Servin sah zu. Die Atemzüge hinter der leichten Wand wurden immer hörbarer, der Schlafende regte sich sogar, das Bette knisterte. Ginevra sah mit einem bedeutenden Blick auf die Servin, welche aber entgegnete:
»Ich wüßte wahrlich Ihre Kopie vom Original nicht zu unterscheiden, wenn ich Sie nicht daran arbeiten sähe.«
»Sollte Servin sie nicht in dies Geheimnis geweiht haben?« dachte Ginevra und begann eine vaterländische Kanzonette, damit das Geräusch des Schlafenden nicht gehört würde.
Madame Servin ging wieder, und die Malerinnen bereiteten sich ebenfalls, das Atelier zu verlassen. Nur Ginevra ließ sich nicht stören und tat, als sei sie willens, noch lange zu arbeiten, aber mit stets unruhigeren Blicken verfolgte sie eine jede bis zur Tür. Die Monsaurin beobachtete sie genau und geriet auf die Vermutung eines Geheimnisses. Sie ging ebenfalls, vergaß aber absichtlich ihren Arbeitsbeutel. Ginevra hatte in aller Eile wieder ihr Gerüst erbaut, um ihre Beobachtungen durch die Spalte fortzusetzen, als die Monsaurin ganz leise wieder eintrat, so daß jene nichts merkte. Die Monsaurin hustete endlich. Ginevra erschrak, errötete über und über und beeilte sich, eines Vorwandes halber, den Fenstervorhang gänzlich niederzulassen, aber schon war ihre Feindin wieder verschwunden. Unwillig verließ sie das Gerüst, ordnete alles wieder und ging. Sie hatte noch einmal den schönen Schläfer belauscht. – Wer mochte er sein? – So jung und schon geächtet. – Hat die Monsaurin mich belauscht? – Hat meine ungezähmte Neugier den Ärmsten verraten? Diese Gedanken beunruhigten sie an diesem und an dem folgenden Tage und blieben die einzigen, deren sie fähig war.
Am dritten Tage konnte sie endlich das Atelier wieder besuchen, aber so sehr sie sich auch beeilt hatte, die erste zu sein, die Monsaurin, um ihr den Rang abzugewinnen, war hingefahren. Beide Mädchen beobachteten sich schweigend, ohne einander zu erraten. Die Monsaurin hatte ebenfalls durch die Spalte geguckt, den Kopf des schlafenden Jünglings gesehen, aber ein günstiger Zufall wollte, daß der Adler und die Uniform der Lauscherin nicht sichtbar wurden, und sie erschöpfte sich über das Gesehene in fruchtlosen Vermutungen.
Die übrigen Damen fanden sich ebenfalls nach und nach ein, zuletzt erschien auch Herr Servin.
»Mademoiselle!« fragte er Ginevra sogleich, »warum sitzen Sie dort? Sie haben kein gutes Licht!« – Er begab sich hierauf zu Laura und korrigierte ihre Arbeit. »Wahrhaftig,« sprach er, »Sie haben Anlagen und können noch einmal eine zweite Ginevra werden.« – Er ging von einer Staffelei zur andern, erteilte Lob und Tadel, besserte und scherzte, doch so, daß man mehr seinen Scherz, als seine Vorwürfe zu vermeiden, Ursache fand.
Während der Zeit entwarf Ginevra auf einem Blättchen Papier den Kopf des Schläfers und führte ihn in Sepia aus. Seine Züge hatten sich ihr tief eingeprägt, ihr Wohlwollen lieh denselben eine eigne Vollkommenheit und Idealität. In unglaublich kurzer Zeit entstand ein kleines Meisterstück, in welchem Lust und Liebe den genialsten Eingebungen der Begeisterung gleichgekommen war. Ginevra halte vollendet, ohne aufzusehen, und hatte daher auch die feindselige Lorgnette der Monsaurin nicht gemieden, welche in der bedeutenden Entfernung den schönen Schläfer nur allzugut wiedererkannte.
»Sind Sie immer noch hier?« fragte Servin, da er endlich auch zu Ginevra trat.
Ginevra stellte sich vor ihre Staffelei, legte das getuschte Bild auf das Ölgemälde und sprach: »Sehen Sie, Herr Servin, Ginevra hat besseres Licht, als Sie denken.« Servin stand betroffen vor dem enthüllten Geheimnis und überrascht vor dem Kunstwerke; aber der Kunsteifer gewann bald die Oberhand, und er rief aus: »Ja, mein Fräulein, wie Sie auch dahintergekommen sein mögen, das ist ein Meisterstück.« Bei diesen Worten erhoben sich alle Damen und drängten sich um die Staffelei. Ginevra aber hatte die Zeichnung rasch entfernt und verbarg sie in ein Portefeuille, während Servin, um seine Übereilung gutzumachen, die Schönheiten der Kopie Ginevras den jungen Damen anpries. Nur die Monsaurin ließ sich nicht täuschen, und um Ginevra es fühlen zu lassen, langte sie nach dem Portefeuille, das diese aber zu sich nahm und vor sich hinlegte.
»An die Arbeit, meine Damen,« sprach Servin, »um es eben so weit zu bringen, dürfen Sie nicht Moden und Bälle stets im Munde führen, sondern müssen sich hübsch wacker dran halten.«
Man gehorchte ihm, er aber blieb bei Ginevra, die ihm leise sagte:
»Besser ist's, ich habe diese Entdeckung gemacht als irgendeine andere dieser Damen.
Der Maler erwiderte: »Ja! denn Ihnen darf ich trauen.«
»Wer ist's?« fragte Ginevra dreist.
»Ein treuer Freund Labedoyères. Er und der unglückliche Obrist haben das meiste zur Vereinigung des 7ten Regiments mit den Grenadieren von Elba getan; er focht auch zu Waterloo als Eskadrons-Chef in der Garde.«
»Warum ist seine Uniform mit den kaiserlichen Adlern nicht verbrannt? warum hat er keine bürgerliche Kleidung?« fuhr sie lebhaft fort.
»Er erhält sie heut!«
»Sie hatten das Atelier für diese kurze Zeit schließen sollen. Sehen Sie nur, wie die Monsaurin herlorgnettiert.«
»Er wird abreisen.«
»Wohin, um Gottes willen?« rief Ginevra. – «Verbergen Sie ihn doch nur in der ersten Schreckenszeit. Nur in Paris ist ein Geächteter sicher. – Ist es Ihr Freund?«
»Nur seines Unglücks halber. Mein Schwiegervater rettete ihn glücklich aus den Händen derer, die Labedoyère gefangen nahmen, der Rasende wollte seinen Verteidiger spielen.«
»Nennen Sie das rasend?« fragte Ginevra stolz und bitter.
Der Maler schwieg eine Weile, dann fuhr er fort: »Man beobachtet meinen Schwiegervater zu scharf, bei sich konnte er ihn nicht verborgen halten, vorige Woche nachts führte er ihn zu mir, und in diesem Winkel glaubte ich ihn am sichersten im ganzen Hause aufgehoben.«
»Ich kann Ihnen nützlich sein,« versetzte Ginevra leise, »bauen Sie auf mich.«
»Wir reden nachdem mehr davon,« erwiderte der Maler und ging, damit ihr Gespräch nicht noch auffallender werde, als es schon zu sein schien.
Für heute blieb er im Atelier. Die Stunde, die die Sitzung endete, hatte längst geschlagen. Die Schülerinnen gingen eine nach der andern.
»Fräulein Monsaurin! Ihren Strickbeutel!« rief Servin der letzten zu. – Die Monsaurin schien betroffen, war aber doch nicht willens, ihre Neugier und Rachepläne aufzugeben. Mit vielem Geräusch ging sie die Treppe hinunter, um leise wieder hinaufzuschleichen und durchs Schlüsselloch zu gucken.
Sobald der Maler und Ginevra sich allein glaubten, pochte ersterer auf gewisse Weise an den Verschluß, und die inneren Riegel schoben sich im Roste kreischend zurück, die Klappen schlugen auseinander, und ein hoher, schlanker Jüngling bückte sich, um durch die enge Öffnung herauszusteigen: er trug die kaiserliche Uniform und den rechten Arm in der Binde. Als er außer dem Maler noch die Anwesenheit einer unbekannten dritten Person gewahrte, stieß er einen Schrei aus und wollte sich wieder verbergen.
Der Schrei hatte die glückliche Folge, daß die Lauscherin am Schlüsselloch den Mut verlor. Sie hatte den Jüngling bereits gesehen, jetzt seine Stimme gehört; die Adler waren ihr zum Glücke wieder nicht zu Gesichte gekommen, und sie entfernte sich, mit ihrer Ausbeute zufrieden.
»Mein Herr!« sprach der Maler, »dies ist die Tochter des Barons von Piombo, des treuesten Anhängers Bonapartes. Fürchten Sie nichts, denn sie hat sich erboten, Ihnen nützlich zu sein.«
Der junge Krieger blickte die hohe Jungfrau an und schien vollkommen Vertrauen zu ihr zu fassen.
»Sie sind verwundet?« fragte Ginevra.
»Leicht nur, mein Fräulein!«
»Unglücklicher! Wie kommen Sie in diese Lage?«
«Mein Fräulein! der Kaiser war mein Vater, – Labedoyère mein Freund; jener ist gefangen, dieser wird morgen erschossen. Jetzt bin ich eine Waise, allein, vielleicht schon entdeckt und morgen verurteilt; es gilt mir gleich. Meine letzte Barschaft habe ich zu Labedoyères Freiheit vergeblich geopfert, ich habe nichts mehr, ich weiß nicht, weshalb ich mich verberge, mir ist der Tod erwünscht, ich will sterben und sinne nur darauf, wie ich mein Leben am vorteilhaftesten verkaufe. Zwei für dies eine wäre schon ein annehmbarer Spottpreis. Wo nicht gar ein Dolchstoß, wert der Unsterblichkeit.«
Der wilde und plötzliche Anfall von Verzweiflung erschreckte den Maler. Doch Ginevra blieb gefaßt und sprach tröstend, wie edle Weiber in solcher Lage am besten vermögen, wo ihre Erscheinung etwas Himmlisches hat:
»Erlauben Sie mlr, mein Herr, für Sie zu sorgen. Mein Vater ist reich. Ich bin das einzige Kind. – Hier habe ich 800 Franken – mein Eigentum! – Ohne Umstände nehmen Sie an. – Was wir haben, danken wir dem Kaiser, seinen braven Kriegern beizustehen, ist unsere heilige Pflicht, ich biete Ihnen diese Kleinigkeit – es ist nur Gold – Sie sollen auch Freunde finden.«
Ihre Augen leuchteten von Stolz und Würde, da sie also sprach. Der Fremde stand verlegen vor ihr, und da er sich ermannte, rief er: »Ich bin nicht wert, daß mich solch ein Engel rettet, retten Sie Labedoyère, wenn Sie es vermögen.«
»Könnt ich's,« rief Ginevra, «ich tät's bei Gott.« Und dem Fremden dünkte es in diesem Augenblick, als umfloß ein Heiligenschein ihr dem Himmel zugewendetes Haupt.
»Ich möchte ihn rächen und sterben!« sprach er leise mit korsischem Akzent.
Ginevra stutzte bei den vaterländischen Lauten und betrachtete ihn aufmerksam.
Er sank ihr zu Füßen und rief, sich selbst vergessend: »O Dio! che non vorrei vivere dopo averta veduta! (O Gott! wer möchte nicht leben und diese sehen!)«
»Mein Herr!« versetzte Ginevra zornig in italienischer Sprache, »ich bin in Korsika geboren. Ich vergebe Ihnen dies, Ihrer Lage halber, aber seien Sie vorsichtig, ruhig und klug, wenn Sie meine Hilfe begehren!«
»Alles, alles! wie Sie wollen!« versetzte der Jüngling, »befehlen Sie nur.«
»Sie sehen mich morgen wieder,« sprach Ginevra und schickte sich an zu gehen.
»Morgen gewiß?« fragte der Fremde beklommen.
»Setzen Sie sich jetzt,« gebot der Maler. »Ihre Wunde bedarf der Pflege.« Er wollte ihm den Verband von derselben nehmen, aber der Jüngling kam ihm zuvor und riß unmutig die Binden und den Ärmel auf, daß sein Arm von neuem zu bluten anfing.
Ginevra, durch ein unerklärliches Mitleid gefesselt, war noch nicht fort, und da sie den Arm des Fremden, den ein Säbelhieb hart getroffen hatte, bluten sah, stieß sie einen Schrei aus.
»Vergeben Sie!« rief der Jüngling. »Nein, es ist nicht die Wunde, die mich schmerzt, ich habe aber bis jetzt noch nicht gefühlt, daß ich unglücklich bin, jetzt weiß ich's – verkennen Sie mich nicht. – Gott, ich bin sehr elend!« rief er heftig und fing bitterlich an zu weinen.
Der Maler winkte, und Ginevra ging schweigend, denn sie fühlte, wie nahe auch ihr die Tränen waren.
######
Am folgenden Tage hatte sie sich beizeiten wieder eingefunden, auch Servin hatte eine Arbeit im großen Atelier und gestattete dem Gefangenen, nachdem er den Saal verschlossen, sein finsteres Versteck zu verlassen.
Der junge Krieger erzählte den Malenden seine Schicksale. Er hatte im neunzehnten Jahre den russischen Feldzug mitgemacht, war der einzige von seinem Regimente, der über die Beresina gekommen war, und beschrieb mit ehrenwertem Feuer die unglücklichen Schlachten von Leipzig und Waterloo. Ginevra ließ Pinsel und Palette sinken; sie war zu stolz und einfach, um die Teilnahme zu verleugnen, welche sie der natürlichen Beredsamkeit des jungen Kriegers weihte. Bald erzählte dieser auch seine früheren Schicksale und nannte sich Luigi Porta.
»Haben Sie gar keine Erinnerungen aus Ihrer frühesten Jugend in Korsika?« unterbrach sie den eifrig Redenden.
»Ich war erst sechs Jahre alt, als ich meine Heimat verließ, unser Haus brannte, und meine Wärterin, die mich den Flammen entriß, erzählte mir weinend, daß meine Eltern und Geschwister alle umgekommen. Sie starb bald darauf in Mailand.«
»Haben Sie meinen Namen niemals gehört, niemals von den Piombos vernommen?«
»Niemals als gestern hörte ich den teuren Namen meines Rettungsengels.«
Ginevra wandte sich erst zu ihrem Bilde zurück und fing emsig an zu malen, ihr Ernst raubte dem Jüngling alle Lust, weiter zu erzählen, er rückte ihr so viel als möglich näher und sah ihr aufmerksam zu.
Die Zeit rief Ginevra heim, sie erhob sich, fragte den Fremden gleichgültig: »Es scheint, als ob es Ihnen Vergnügen macht, malen zu sehen.«
»Wie glücklich wär ich,« rief er, »besäße ich Ihre Kunst!«
Er wollte ihre Hand begeistert an die Lippen drücken, Ginevra riß sich mit Entsetzen los.
Der Jüngling erschrak.
Ginevra beruhigte ihn durch einen wohlwollenden Blick und versprach während der Stunden im Atelier ihm alle politischen Neuigkeiten, die Bezug auf ihn haben könnten, mitzuteilen, er solle nur auf die korsischen Lieder merken, die sie bei der Arbeit singen würde. –
######
Am folgenden Tage war die Monsaurin wieder die erste und vertraute einer jeden der Ankommenden unter dem Siegel des Geheimnisses, daß Ginevra di Piombo ein Liebesverständnis mit einem schönen, jungen Manne unterhielt, der in der finstern Kammer verborgen wäre.
Ginevra kam und wurde mit aller Neugier, deren junge Mädchen bei solcher Gelegenheit fähig sind, beobachtet; man belauschte auch ihre bald heiteren, bald schwermutvollen Gesänge, erspähte jeden ihrer Blicke und deutete ihr sorgfältiges Lauschen nach dem Kabinett hin auf die verschiedenartigste Weise. Sie aber kümmerte sich um nichts, blieb ruhig und heiter; das Atelier war ihr von jeher der liebste Aufenthalt gewesen.
Nach Verlauf von acht Tagen hatte jede Schülerin des Herrn Servln Gelegenheit gefunden, durch die Spalte den schönen Schläfer zu beobachten, und eine jede hatte aus Schaltzhaftigkeit oder Scheintugend zu Hause gleich alles, so gut sie es wußte, wiedererzählt; in allen Familien wurde darüber geredet, und eine Schülerin nach der anderen blieb aus, bis auf die kleine Laura, welche, trotz allem Zureden der Monsaurin, nicht zu bewegen war, nur einmal durch die Spalte zu blicken.
Laura war seit einigen Tagen schon Ginevras einzige Gesellschafterin, und es herrschte Totenstille in dem sonst fröhlichen Atelier, als der Gefangene hinter der Wand eines Tages das verabredete Zeichen mit dem Knopf einer Stecknadel gab, um anzufragen, ob er erscheinen dürfe.
Ginevra blickte umher, sah niemand als Laura, ging auf sie zu und sagte:
»Sie sind ja sehr steißig, liebes Kind, wollen Sie den Kopf heut noch vollenden?«
»Fräulein von Piombo,« antwortete Laura, »möchten Sie mir wohl den Kopf korrigieren, ich hätte gar zu gern ein Andenken von Ihnen.«
Still setzte sich die hohe Jungfrau auf den Platz des Kindes, um seinen Wunsch zu erfüllen, da fiel ihr dieses plötzlich um den Hals und rief weinend: »Wie gut Sie sind, Fräulein von Piombo, wie engelgut.«
»Was hast du, liebes Kind? Was kommt dir an mit einem Male?«
»Ich sah Sie heut zum letzten Male und nimmer, nimmer wieder. Sie waren so gut gegen mich, haben sich so viel Mühe mit mir gegeben. Ich habe so viel bei Ihnen gelernt, ich bin Ihnen ewig meine Liebe und Dankbarkeit schuldig.«
»Wirst du Herrn Servin ferner nicht besuchen? In Wahrheit, das tut mir leid.«
»Merken Sie denn nicht, daß ich seit einigen Tagen die einzige um Sie bin?«
»Was haben denn die anderen Damen, daß sie nicht kommen?«
»Daran, Fräulein von Piombo, sind Sie ganz allein schuld.«
»Ich?«
»Zürnen Sie mir nicht, mein bestes Fräulein, aber auch meine Mutter will nicht mehr, daß ich herkomme. Jene Damen alle behaupten, daß Sie einen Liebhaber hätten, der sich in jener finstern Kammer dort aufhielte. – Ich habe wahrhaftig kein Wort zu Hause davon gesagt. Aber gestern sprach Madame Planta meine Mutter und fragte sie, ob ich immer noch hierher gehen dürfe, und hat alles erzählt, was man Ihnen nachsagt. Meine Mutter war sehr böse auf mich, weil ich ihr nicht alles gesagt und kein besseres Vertrauen ihr erwiesen hatte. Liebstes, bestes Fräulein, blicken Sie nicht so schrecklich mich an. Ich sage nur die Wahrheit und will Sie nicht beleidigen. Mögen Sie recht oder unrecht haben, ich weiß nur, daß Sie um mich Dank verdienen, wenn meine Mutter es auch nicht glauben will. – Nein, Sie zürnen mir nicht. Sie blicken schon wieder so mild und gütig, wie ich ganz allein angeblickt wurde von allen Damen, die hierher kamen. Sagen Sie mir auch zum Abschiede, daß ich nach wie vor Ihre liebe Laura bleibe.«
Ginevra schüttelte den Kopf. »Gutes Kind!« sprach sie, »ich liebe dich mehr als ich dachte, und es ist mir schwer genug, dich auf immer zu lassen. – Indessen, meine kleine Freundin, bewahre dies Herz, das du mir jetzt zeigst, und es ist dir besser, als wäre Ginevra stets um dich.«
Laura konnte vor Schluchzen keine Worte finden.
»Ja!« sprach Ginevra gerührt, »seltsam geht es in der Welt zu. Was schaden unsere unschuldvollen Bande, was hat die Liebe eines guten Kindes zu ihrer Lehrerin Trennenswertes, daß man dich gewaltsam von mir entfernen will? Je nun! Gott will es so und – denke nichts Böses von mir, obwohl ich vielleicht sehr leichtsinnig gehandelt haben mag.«
Servin trat in diesem Augenblick ein. Laura verbarg ihre Tränen, küßte Ginevra noch einmal herzlich, nahm ihr Bild und ging.
Servin rief triumphierend: »Mein großes Bild ist fertig! Es geht doch nichts über die Freude, eine große Arbeit vollendet zu haben.«
»Wissen Sie auch, daß alle Ihre Schülerinnen Sie verlassen haben?« fragte Ginevra.
»Wieso?«
»Daß ich schuld bin an diesem Verlust, daß ich unwillkürlich Ihren ganzen Ruf untergraben habe?«
»Meinen ganzen Ruf? Und mein großes, neues Bild für die Ausstellung? Ei, Mademoiselle! nehmen Sie sich zusammen! Wissen Sie, mit wem Sie reden?«
»In allem Ernst! mein Herr. Ihre Schülerinnen ahnen von unserem Geheimnis; freilich wissen sie's nur halb, aber um so boshafter ist ihre Deutung. Es geht das Gerede, ich hätte einen Anbeter hier, den Sie mir zuliebe in jener dunkeln Kammer – –« Ginevra stockte, von Scham und Unwillen übermannt.
»Sollte dies so ganz ohne Wahrheit sein?« fragte Servin mit einem feinen Lächeln.
Ginevra senkte das dunkle Auge still sinnend zu Boden.
»Die Eltern hätten klüger sein sollen,« fuhr Servin fort. – »Wenn sie mich wahrhaft achten, warum kommen sie nicht zu mir, warum stellte mich denn kein einziger zur Rede? – Ei! was kümmert's mich! – Ist mein Bild doch fertig. Das Leben ist gar zu kurz, man muß malen und sich nicht um derlei kümmern.«
Der Fremde verließ jetzt sein finsteres Gefängnis. »Ich habe schuld, Herr Servin!« sprach er, »daß Ihre Schülerinnen Sie verließen. Ich habe den Ruf des edelsten, herrlichsten Wesens unter der Sonne vernichtet. – Je nun! Seit ich dem Kaiser diene, wandte sich ja auch sein Glücksstern, und ein Freund nach dem andern fiel ab von ihm. Ich liebte ja auch Labedoyère, und darum ward er vorige Woche erschossen. – Ich bin ein Heilloser, der stets, ohne zu wollen, den trefflichsten, besten Menschen zum Verderben gereicht. Lassen Sie mich fliehen in die fernste, entlegenste Einöde, ehe meine fürchterliche Nähe noch mehr Böses anstiftet. Ja. ich fühl's, die höheren Mächte haben mich verworfen – glauben Sie mir nur, alles Unheil, das ich anrichte, trage ich in dieser Brust.« Flehend nahte er sich Ginevra, welche das Wort nahm:
»Herr Servin! ich bin reich, ich entschädige Sie.«
»Warum nicht gar?« rief der heitere Maler. »Lassen Sie nur bekannt werden, daß ich ein Opfer der royalistischen Verleumdung bin, so senden mir die Liberalen ihre Töchter, und ich bin besser daran und obendrein Ihr Schuldner. – Ich mache mir aus nichts etwas und besorge nichts als – meine Frau. Ach Gott! Madame Servin wird ihren Kopf aufsetzen, und es gibt eine Gardinenpredigt.«
»Herr Porta!« begann Ginevra plötzlich entschlossen, »eine hohe Person, welche der Tochter des Baron von Piombo nichts abschlagen darf, hat gegenwärtig ein Gesuch von mir in Händen, anlangend Ihre stille Begnadigung.«
»Herrliches Mädchen!« rief Servin.
»Ich bin meiner Ehre eine Genugtuung schuldig!« fuhr Ginevra fort, »und bin zu einem Schritte entschlossen, zu dem kein anderer Augenblick mich bewogen hätte. Herr Porta, wenn Ihre ersten Worte, Ihre Blicke und Ihr ganzes bisheriges Wesen mich nicht getäuscht haben, so lieben Sie mich, und vielleicht habe ich Ihnen eine viel zu große Teilnahme bewiesen, um mir selber ferner noch verheimlichen zu dürfen, daß Sie mir nicht gleichgültig sind. – Doch das gilt gleichviel. Ich wähle Sie zu meinem Gatten, wenn nicht Verhältnisse, die Ihnen annoch unbekannt sind, Sie bestimmen, zurückzutreten, oder meine Eltern bewegen, ihre Einwilligung mir zu versagen.« –
Der Jüngling stürzte zu ihren Füßen. »Worte,« rief er, »nennen Ihren Wert nicht, noch die Anbetung, die ich für Sie hege. – Ich soll Napoleon entsagen, dem Verlorenen? soll dem Könige dienen. Oh, daß ich störrisch dem Willen eines Engels mich widersetzen konnte! Hinweg, Napoleon! mein Vater, mein Wohltäler, mein Held! Es lebe der König! Ginevra will es, oh, was tat ich nicht alles, um ihrer wert – ihrer wert? – nein, das bin ich nicht und werde es nie – nur um in den Augen der Welt einer solchen Gattin wert zu sein! – Ich bin nicht unglücklich mehr. Sie sind mein guter Engel!«





























