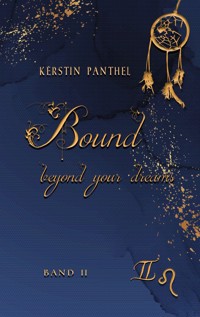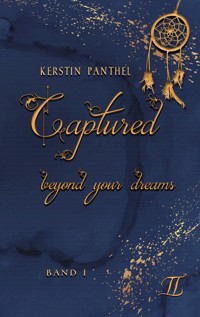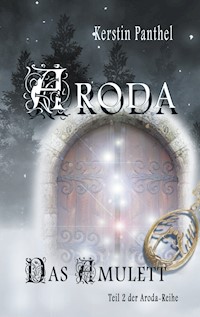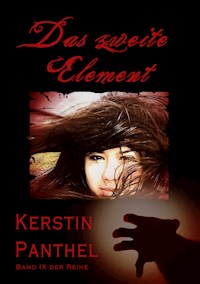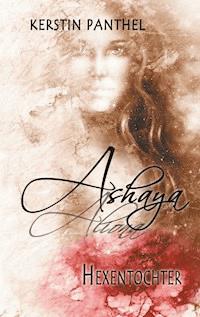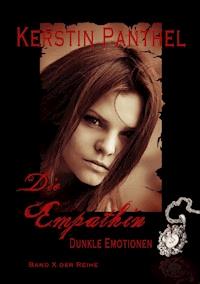Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Phandra-Reihe
- Sprache: Deutsch
"Ich kann das nicht tun, Fendor! Ich kann niemanden dorthin beordern, denn wen ich auch wähle, ich würde den- oder diejenige direkt in den Tod schicken!" Jahre sind vergangen, Camryns und Jareds Tochter Anna sowie ihr Sohn Simon sind Phönixanwärter. Takar hingegen ist bereits erwachsen, der Tag seiner Entscheidung steht unmittelbar bevor. Als Takar, Fendor, Sanara und die Phönixe sich dazu am Siegel einfinden, überstürzen sich die Ereignisse jedoch. Cam wird jäh in eine weit entfernte Vergangenheit katapultiert. In eine Zeit, in der sie dem jungen Rondur begegnet - und den Allerersten: Zwei uralten Feuerwesen, in hoffnungslosem Kampf um ihr bloßes Überleben ringend gegen eine Übermacht von Drachen, allen voran Salaog. Cams Zeitreise hat einen Grund: Die in der Zukunft endende Verknüpfung mit der Erde muss erst etabliert werden, damit künftig überhaupt noch Phönixe Phandra behüten können. Hier das Phandra des Einst mit nur noch drei lebenden Phönixen, in der Zukunft ein riesiges Volk, das noch immer an den Folgen eines Krieges trägt. Und nun noch die Erde? Dort hat Salaog bereits den Grundstein gelegt für eine unangefochtene Herrschaft. Gibt es eine Lösung, die allen gerecht wird? Die Entscheidung fällt Velyn, die Urmutter aller Feuerwesen. Und deren Anweisung stürzt Cam in tiefe Verzweiflung ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 516
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Frage nicht nach der Abkunft, sondern frage nach dem Betragen; denn wahrlich, aus Holz erzeugt sich Feuer.“
Aus Indien
„Nichts ist nützlich, was nicht auch Schaden bewirken kann. Was ist nützlicher wohl als Feuer?“
Ovid (43 v. Chr. – 17 n. Chr.), röm. Epiker
Rückblick auf die Geschehnisse in
„Der Drachengeborene“; Cam erzählt:
„Wieso ich schon wieder?“
…
„Echt jetzt?“
…
„Oh, schon gut, meinetwegen! Also … Seit Dragans Tod waren ein paar Jahre vergangen und Fendor hatte eine behutsame Annäherung an Takar und Sanara gewagt. Genauso vorsichtig und teils argwöhnisch wie Sanara, die übrigens immer noch das alte Stinktier ist, verhielt sich der Großteil des Volkes auf Phandra, wenn es um Drachengeborene ging, die sich zu integrieren versuchten.
In diese Zeit fiel eine Entdeckung Abrams, der in einer Höhle der Slougheris – der Buckelberge – ein leeres Amulett fand, das sich viel später als bedeutsamer entpuppte, als wir alle ahnten. Man könnte sagen, dass ich mich bald danach ein bisschen als Traumdeuterin betätigt habe, auch wenn ich es wenig ‚traumhaft‘ fand, von einer Drachenhöhle zu träumen. Die stellte sich übrigens als diejenige heraus, in der Abram den Anhänger fand.
Meine Traumdeuterei erwies sich also als hilfreich bei der Lösung des Amulett-Höhlen-Rätsels, denn es fand sich eine Art Siegelplatte in der Höhle und der leere Anhänger stellte so etwas wie einen Schlüssel dar. Beides zusammen funktionierte ein bisschen wie ein Phandra-Orakel: Es outete jeden Frager entweder als Drachen oder als Phönix.
Okay, um das alles ein wenig abzukürzen und einen Teil des Endes vorwegzunehmen: Jean, Abrams Zweitgeborener, beäugte nicht nur die Reaktion des Amuletts auf Fendor und Takar und die Bedeutung der Höhlen in den Slougheris besonders misstrauisch, sondern vor allem auch den Umstand, dass Takar ein ganz bestimmtes Erbe in sich trägt. Für Jean war es – wie zuletzt auch für Twegur, Sanaras Großonkel – nicht schwer zu erraten, unter welchen Umständen Takar gezeugt worden war. Daraufhin fürchtete er allen Ernstes, dass Fendor oder zumindest Takar eine ähnliche Machtstellung anstreben könnten wie damals Dragan und dessen Vater Zerbat.
Und jetzt formuliere ich durchaus phönixisch-höflich: Jean hatte seine Aufgabe als Phönix aus den Augen verloren und seine Macht missbraucht als er seinen gut vorbereiteten Plan in die Tat umsetzte. Er machte gemeinsame Sache mit nach dem Krieg entkommenen Drachengeborenen, entführte gewaltsam Sanara, Takar und sogar Jared mit der Absicht, Takar und Fendor und jeden, der sich ihm entgegenstellen würde, in der Höhle einzuschließen und zu verschütten. Was einen ewig dauernden Schlaf und somit irgendwann den sicheren Tod bedeutet hätte. Der Gipfel seines Tuns war der Diebstahl von Jareds Amulett …
Es war mehr als Glück im Spiel, denn Jared konnte sich nur befreien, indem er etwas tat, das so vollständig gegen die Natur eines Phönix war, dass ich bis heute kaum nachvollziehen kann …“
„Schon gut, Cam, das alles ist längst vergangen.“
„Nichts ist gut, Jared! Der Mistkerl hat genau gewusst, was er tat, und er hat unser aller Tod bewusst in Kauf genommen! Aber darüber können wir später reden, ich möchte liebend gerne bald zum Ende kommen.
Es war Jared, Fendor, dessen ehemaligen Verbündeten und unseren neuen Freunden, Abram und ein paar Begabten wie Twegur zu verdanken, dass Jean und seine Helfershelfer scheiterten.“
„Und dir!“
„Quatsch! Ich hab ein Schmuckstück in eine Steinplatte gepfropft, mehr nicht. Tatsache ist: Am Ende bekam Jean seine verdiente Strafe, die, hätte ich sie zu verhängen gehabt, bedeutend härter ausgefallen wäre! So aber blieb er Phönix, wenn auch ohne Amulett, wurde nur verbannt und kann sich eine zweite und letzte Chance erarbeiten.
Und wir alle sind jetzt gespannt, ob Takar in naher Zukunft als neuer Phönix von Phandra aufsteigen wird!… Hab ich was vergessen?“
„Ich denke, du hast alles Wesentliche erzählt, noch dazu sehr verständlich.“
„Verständlich, aha! Irgendwie weiß ich nie, wann du mich hochnimmst, Phönix!“
…
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Rondur
Camryn
Rondur
Kapitel 2
Camryn
Kapitel 3
Rondur
Camryn
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Zurück in der Gegenwart …
Camryn
Kapitel 7
Sanara
Camryn
Kapitel 8
Anna
Camryn
Kapitel 9
Anna
Camryn
Anna
Kapitel 10
Camryn
Kapitel 11
Kapitel 12
Am Anfang …
Kapitel 13
Fendor
Camryn
Kapitel 14
In der Gegenwart
Epilog
Kapitel 1
Rondur
Am Anfang …
Die Sonne ließ den Fluss, der die weite, grüne Landschaft in zwei Hälften teilte, zu einem glitzernden Band werden, das unwillkürlich den Blick jedes Reisenden – und noch immer auch seinen – auf sich zog. Nicht weit von hier, in der Gegend, die bereits hinter ihm lag, gabelte sich der hier noch breite Strom. Ein Teil bog dort nach Norden Richtung Maarthun ab, während der andere seinen Lauf erst noch mehr als einen Tagesmarsch weit nahezu gerade fortsetzte, bevor er in weiten, eleganten Windungen dem Meer entgegenfloss.
Er ging tiefer und schwenkte zuletzt ein, um dicht über dem Wasser dahinzugleiten. In diesem Winkel verschwand das Glitzern fast vollständig und nur hier und da reflektierte die Oberfläche das Licht. Direkt unter ihm aber spiegelte sie seine Gestalt: Den gelborangen Vogel, als der er stets erschien, wenn er so wie jetzt als Phönix reiste.
Er verschwendete längst keinen Blick mehr darauf, doch noch immer klangen ihm die Worte seiner kleinen Schwester im Ohr, die ihn bei ihren wenigen gemeinsamen Flügen gerne damit geneckt hatte. ‚Na? Bewunderst du dich wieder selbst?‘ Dann hatte sie meist gelacht und sich von seinem Rücken herunter und ins Wasser fallen lassen, immer in der Erwartung, dass er ihr folgen und sie wieder herausholen würde.
Doch das war lange her.
Seine Flügel weit ausbreitend bremste er seinen noch immer recht raschen Flug noch ein wenig mehr ab und warf aufmerksame Blicke nach rechts und links, als die Siedlungen seiner Kindheit in Sicht kamen. Sie lagen malerisch und vor allem friedlich da. Hier und da stieg etwas Rauch aus den Kaminen auf und auf den Brachwiesen sah er Menschen, die eifrig das hoch stehende Gras schnitten oder bereits zu langen Reihen aufwarfen, wo immer es schon zu duftendem Heu getrocknet war. Und wie zu erwarten sahen sie alle auf, als die Ersten ihn bemerkten und den anderen ihre Entdeckung zuriefen.
Ein paar Kinder an der seichten Bucht und dort, wo der Bootssteg als Anleger für die Flussfischer diente, sprangen auf und winkten ihm freudig. Wie jedes Mal beantwortete er dies mit einem kurzen Winken und einer Pirouette, die wiederum begeistert bejubelt wurde. Dann ließ er auch diese Orte hinter sich und schwenkte ab, als sich gleich darauf ein Ausläufer des Waldes bis ans Ufer vorschob.
Das Haus seiner Eltern, in dem er die ersten fast fünfundzwanzig Jahre seines rein menschlichen Lebens verbracht hatte, stand von hier aus gesehen vor den hoch über seinen First aufragenden Bäumen. Auf den ersten Blick schien sich nichts verändert zu haben. Auf den zweiten Blick war jedoch zu sehen, dass zwei Bäume gleich hinter dem Haus gefällt worden, die Beerensträucher größer und die Gemüsebeete kleiner geworden waren. Der Hühnerstall sah noch ein wenig baufälliger aus, doch der Schuppen, in dem auch das Maultier stand, hatte ein neues Dach erhalten.
Er landete unweit der Einzäunung, hinter der die einzige Kuh nebst einem Kalb auf ihrer Weide stand, und sein Flammengefieder zerstob und verlosch bereits, als er den Boden mit den Füßen berührte.
Haus und Umgebung lagen still da und er vermutete schon, seine Mutter sei möglicherweise nicht zu Hause, als die Tür sich öffnete und ihre vom Alter geschrumpfte Gestalt mit den grauen Haaren darin erschien.
„Rondur!“
Selbst ihre Stimme klang weniger kräftig als beim letzten Mal!
„Mutter!“, lächelte er liebevoll, beschleunigte seine Schritte und hielt sie so zuletzt davon ab, ihm entgegenzukommen. Sie sanft und vorsichtig in die Arme schließend schloss er die Augen und atmete tief ihren so unglaublich vertrauten Geruch ein: Sie hatte, so lange er denken konnte, immer ein wenig nach Lavendel, ihrem Lieblingsduft, nach Beeren, Obst oder Marmelade und nach frischer Luft gerochen – kein Wunder, denn wann immer sie konnte, verbrachte sie ihre Zeit im Freien und im Garten.
Auch jetzt lagen angefangene Näharbeiten auf dem grob behauenen Tisch vor dem Haus, auf der Bank gleich unter dem Fenster ein Kissen und eine ordentlich zusammengefaltete Decke. Und am Türrahmen und damit gleich neben der Bank lehnte griffbereit ihr Krückstock. Der Korb, der zu dieser Jahreszeit dagegen täglich voll mit frischem Lavendel auf der anderen Seite des Eingangs gestanden hatte, war diesmal allenfalls zu einem Viertel gefüllt. Entweder war die Ausbeute in diesem Jahr ungeheuer mager, was er bezweifelte, oder sie war nicht mehr in der Lage, genügend davon zu ernten, ihn zu bündeln und zu trocknen oder die frischen Blüten abzuzupfen.
„Es ist so schön, dich zu sehen! Dass du wieder daran gedacht hast …“
„Wie könnte ich deinen Jahrestag vergessen?“, lächelte er erneut und sandte ohne zu fragen einen warmen, lindernden Strom durch ihren von Alter und Krankheit geschwächten Körper.
Sie seufzte lächelnd auf.
„Danke, mein Sohn, aber es geht schon. Beseda hat mir erst gestern wieder von den Tropfen gebracht, die meine Schmerzen mildern. Mir geht es gut. Setzen wir uns ein Weilchen? Hier in der Sonne?“
„Sehr gerne. Ich wünsche dir alles nur erdenklich Gute, Mutter! Nichts auf dieser Welt hätte mich davon abhalten können, heute herzukommen. Hier, warte …“, breitete er die Decke sofort über ihre Beine, dann erst nahm er neben ihr Platz und ihre faltige Hand in die seine. Es war schlimmer geworden im letzten halben Jahr. Er würde öfter herkommen müssen, denn der Phönix in ihm konnte jetzt deutlich spüren, dass die dunklen Stellen in ihrem Körper mehr geworden waren und ihr Schmerzen bereiteten. Schmerzen, die sie herunterspielte, eine Krankheit, die er nicht heilen konnte, deren Auswirkungen er jedoch sehr wohl zu erleichtern vermochte.
„Wie ist es dir ergangen im letzten halben Jahr?“, wollte er wissen und verbarg seine Sorge hinter seinem Lächeln, als sie ihn aus nur mehr blassen, wässrigen Augen glücklich anstrahlte. Das früher so kräftige Blau war einem viel zu bleichen Ton gewichen.
„Mir? Wie immer, mein Junge! Dieses Jahr hat es gut mit uns gemeint: Der Winter war kurz, das Frühjahr kam bald und wir blieben von schlimmen Unwettern verschont. Überall wird man dieses Jahr reiche Ernte halten. Die Kuh hat noch einmal ein Kalb bekommen und gibt reichlich Milch und jeden Tag kommt jemand aus dem Ort vorbei und sieht nach mir. Was ich wohl dir zu verdanken habe.“
Er senkte den Blick, dann zuckte er die Schultern.
„Wenn ich schon nicht bei dir bleiben kann, dann soll zumindest täglich jemand nach dir sehen. Das ist das Wenigste, was ich tun kann!“
„Selbstvorwürfe? Nach all den Jahren immer noch?“, beugte sie sich vor. „Rondur, ich komme zurecht. Ich bin mein Leben lang zurechtgekommen, daran hat sich nichts geändert. Das Alter gehört zum Leben dazu und ich beklage mich nicht. Mein Leben war so überreich gesegnet… Das Schicksal hat mir ein Leben nach meinen Vorstellungen geschenkt, dazu einen guten Mann und zwei wunderbare, großherzige und liebenswerte Kinder. Und dass eines davon ein Phönix ist …“
„Wie dein Mann auch! Ein Mann, der fast noch weniger Zeit mit dir verbringen konnte! Überreich gesegnet?“, entfloh es ihm, bevor er es verhindern konnte.
„Ja, das war es!“, wurde sie daraufhin energisch. „Denn jeder einzelne Augenblick mit ihm war so wundervoll und kostbar, dass er Jahre aufwog, Rondur! Dein Vater hat mich geliebt, mehr als sein Leben – selbst als ich älter wurde. Ich war immer nur ein schwacher Mensch neben ihm, aber er hat mich stark gemacht und seine Liebe war neben euch das Schönste und Wertvollste, das ich je geschenkt bekam.
Lass deine Schuldgefühle endlich fahren, mein Junge! Du bist ein Segen für Phandra und was kann sich eine Mutter mehr wünschen, als dass sein Kind ein langes Leben als Beschützer und Hüter der Menschen dieser Welt haben wird?“
„Ein langes Leben, das auch mich seither immer wieder für lange Zeit fort von dir führt!“, warf er ein.
„Weil du gebraucht wirst!“, konterte sie, dann drehte sie sich ihm ein wenig mühsam noch etwas mehr zu und legte ihre zweite Hand über seine. Sie war so rau und viel zu kühl für diesen warmen Sommertag! „Rondur, du wirst gebraucht! Genau wie dein Vater einst! Ich wusste, was auf mich zukommen würde, wenn ich einem Phönix Kinder gebären würde. Ich ahnte, dass sie wie er sein könnten, und ich war bereit, Mann und Kinder mit Phandra zu teilen, denn das machte und macht sie nicht weniger zu meinem Mann und Kind.
Ich spreche die Wahrheit, wenn ich sage, dass ich ein reich gesegnetes, glückliches und erfülltes Leben hatte. Ich kenne deine Gedanken besser als irgendwer und ich sage dir, ich war niemals einsam! Ich mag manchmal alleine hier gewesen sein, aber ich war niemals, nicht einmal für einen noch so kleinen Augenblick einsam! Selbst mir schenkt Phandra viel und dazu gehört auch so etwas wie Trost.“
„Ich wäre froh, wenn du dies weniger wie eine abschließende Rede klingen lassen würdest! Ich bin gekommen, um ein paar Tage gemeinsam mit dir zu verbringen. Frohe Tage anlässlich deines Jahrestages! Und jetzt sitzen wir hier und du schimpfst mit mir, weil ich mir Sorgen um dich mache.“
Sie seufzte, dann lächelte sie schief und blinzelte.
„Du bist so sehr wie dein Vater! Dem musste ich auch immer sagen, dass dazu kein Grund besteht; ich komme zurecht, wie immer. Aber du hast recht: Ich freue mich also, dass du hier bist und ein wenig Zeit mitgebracht hast. Und jetzt erzähle, was es auf Phandra Neues gibt! Ist es wahr, dass überall viele Kinder geboren werden und das Volk allenthalben wächst und gedeiht?“
„Ja, dem ist wohl so!“, lächelte er breit, dann holte er tief Luft. Zeit, seiner Mutter zu erzählen. Und Zeit, ihr etwas zu zeigen.
Noch am Abend erschienen die ersten Bewohner aus den beiden Siedlungen und am nächsten Tag setzte sich dies fort. Immer wieder standen sie in mehr oder minder kleinen Gruppen wartend draußen, immer wieder half er mit einem Rat oder heilte irgendetwas. Dabei hörte er sich ihre Berichte an und sah am Nachmittag des darauffolgenden Tages auch in der weiteren Umgebung nach dem Rechten.
Es war längst schon wieder dunkel und spät, als er nach Hause zurückkehrte. Seine Mutter saß in ihrem Lehnstuhl in der Nähe des Herdes, in dem ein kleines Feuer fast schon verloschen war. Die Augen waren ihr zugefallen. Ein Anblick, den er nur zu gut kannte, wenn sie wie so oft auf ihn hatte warten wollen. Ein Anblick aber auch, der ihm heute fast das Herz zerreißen wollte. Denn so, wie sie jetzt dasaß – halb zur Seite gelehnt, halb in sich zusammengesunken, die bleichen Lippen leicht geöffnet – war mit einem Mal so überdeutlich zu sehen, dass ihre Jahre gezählt waren. Er wehrte sich gegen den Trost, den der Phönix ihm vermitteln wollte, ging vor ihr in die Hocke und betrachtete sie voller Wehmut: Ihr müdes Gesicht mit den zahlreichen Falten, die grauweißen Haare, die sie stets zu einem festen Knoten im Nacken geschlungen trug, ihre schmale Gestalt in dem schlichten Nachtkleid, die Hände, die rechts und links auf den Lehnen ruhten und von ihrem arbeitsreichen Leben zeugten …
Ein arbeitsreiches Leben in einer einfachen Behausung und Umgebung. Hier war sie aufgewachsen, hier hatte sie bleiben und eine Familie gründen wollen. Sein Vater hatte sie hier getroffen, kennengelernt … und lieben gelernt. Ihm war wohl bewusst, wie tief die Liebe zwischen den beiden gewesen war – und wie tief die Wunde, die sein Tod in ihr Herz gerissen hatte! Noch immer war er, Rondur, auf der Suche nach dem Drachen, der seinen Vater zu töten vermocht hatte, aber noch immer fehlte jede Spur von ihm. Selbst nach all den Jahren.
Und seine kleine Schwester Nuhania… Sie hatte vieles von einem Phönix gehabt, aber sie war keiner geworden.
Ein leises Seufzen aus ihrem Mund ließ ihn seine eigenen Gedanken beiseiteschieben. Mit äußerster Behutsamkeit schob er seine Arme hinter ihrem Rücken und unter ihren Kniekehlen hindurch, hob sie sachte hoch und lächelte sie an, als sie sofort blinzelnd die Augen öffnete und seinen Blick suchte.
„Du hättest nicht aufbleiben sollen, Mutter. Wann endlich fängst du an, mit deinen Kräften besser hauszuhalten? Nein, keine Widerrede jetzt, ich trage dich ins Bett und werde für einmal dafür sorgen, dass du sofort weiterschläfst! Höre auf den Phönix, nur dieses eine Mal!“
„Also schön, einverstanden“, seufzte sie erneut und fasst dankbar nach seiner Hand, als er ihre viel zu schmale, viel zu leichte Gestalt auf dem Lager ablegte.
„Rondur, versprich mir etwas!“, bat sie leise.
„Natürlich! Was immer du möchtest!“, erwiderte er sofort.
„Wenn ich gegangen bin, dann lass es zu, dass der Phönix in dir dich tröstet!“, hielt sie seine Hand noch etwas fester. „Ich kenne dich gut, besser als jeder andere, und weiß genau, wie sehr du dir stets alles zu Herzen nimmst. Aber es ist nicht gut für jemanden wie dich, so viel Leid mit sich herumzutragen! Lass es zu, dass die schönen und guten Erinnerungen dich begleiten und dich heilen, lass es zu, dass er dir Frieden schenkt! Versprich es mir!“
„Mutter, bis dahin ist es noch lange hin und …“
„Versprich es!“, beharrte sie fest und noch einmal war der Blick ihrer Augen wie früher: beschwörend, fordernd und flehend zugleich. „Gib mir dein Wort darauf, dass du mich, deinen Vater und Nuhania mithilfe deines Phönix gehen lässt. Dass du uns nicht vergessen wirst, weiß ich sehr gut – und das ist das Einzige, worauf es ankommt! Bewahre uns in deinem Herzen, aber lass den tiefen Gram und die Trauer gehen! Lass es immer zu, egal, was dir in deinem Leben noch zustößt! Bitte!“
Es dauerte lange Augenblicke, in denen er suchend ihren Blick festhielt, dann nickte er. Und als sie ihre Augenbrauen hob, nickte er erneut, hoffentlich etwas überzeugender.
„Also gut, ich verspreche es. Du hast mein Wort darauf, Mutter. Aber bis dahin ist es noch lange hin, also lass mich jetzt dir eine friedliche Nacht ohne Schmerzen schenken. Und morgen werde ich dir etwas zeigen, das dir sicher gefallen wird. Wir werden ein Stück fliegen müssen.“
„Dem werde ich nichts hinzufügen und ganz sicher nicht widersprechen! Danke, Rondur. Und hab auch du einen friedlichen, ruhigen Schlaf.“
„Ganz bestimmt“, lächelte er liebevoll, zog nun endlich die Decke über ihrem Körper zurecht und legte ihr dann seine Hand auf die Stirn, um einen warmen Lichtstrom durch sie hindurch zu schicken. „Helle, lichterfüllte Träume, Mutter!“
„Und dir, allezeit …“, flüsterte sie noch, dann schlossen sich ihre Lider jedoch schon und mit einem leisen Lächeln auf den Lippen war sie eingeschlafen.
Noch minutenlang sah er auf sie hinunter, bevor er sich abwandte, die Tür bis auf einen Spalt zuzog und seinerseits in dem Lehnstuhl vor dem Herd Platz nahm. Ihr Schlaf würde auch in dieser Nacht nicht unbewacht bleiben. Jedenfalls nicht gänzlich.
Am nächsten Morgen war er noch vor Sonnenaufgang hinausgegangen, hatte die Kuh gemolken, das alte Maultier und die Hühner gefüttert und die wenigen Eier eingesammelt. Anschließend hatte er sich gleich daran begeben, eine kleine, kalte Mahlzeit aus in Honigmilch gebrocktem hellem Brot vorzubereiten und den Tisch für sie beide zu decken. Er war gerade dabei, einen Kräutertee aufzugießen, als etwas ihn innehalten ließ. Irgendetwas ließ ihn aufhorchen und die Hand mit dem Kräutersäckchen wieder senken. Im ersten Moment konnte er nichts ausmachen, sich nicht erklären, was ihn aufmerksam gemacht hatte. Den Kopf drehend lauschte er noch etwas intensiver … und dann begriff er. Es war nicht ein Geräusch, das ihn in der umgebenden Stille aufmerken ließ, sondern das Fehlen eines solchen! Mit eiligen Schritten hastete er auf die noch immer einen Spalt breit geöffnete Tür zu und stieß sie vollends auf, achtete nicht einmal darauf, dass sie sofort gegen die raue Bretterwand stieß, und verhielt erst an ihrem Bett …
Es war ihr Atem, der ausgesetzt hatte. Das fehlende Geräusch ihres nur durch ihre Krankheit leise rasselnden und doch bisher immer gleichmäßigen Atems – etwas, das ihm zeit ihres Lebens zu unzähligen Gelegenheiten ihre so vertraute Anwesenheit signalisiert hatte.
Noch immer – oder erneut? – lag ein friedliches Lächeln auf ihren Lippen, die schon jetzt bleich wurden. Ihr ganzes Gesicht wirkte friedlich und entspannt und ihre Hände rechts und links neben ihrem Körper … Als hätte sie sich die ganze Nacht über nicht um eine Winzigkeit gerührt! Sie lag noch so da, wie er sie am gestrigen Abend hingelegt hatte, allenfalls ihr Kopf war ein wenig zur Seite gesunken.
„Mutter!“, flüsterte er tonlos, dann ging er neben ihrem Lager auf die Knie, um seine Hand direkt unterhalb ihres Halses auf ihre Brust zu legen. Ihr Herz schlug nicht mehr. Noch fühlte er die Wärme ihres Körpers, doch er konnte auch fühlen, wie diese langsam davonlief. Mehr als das: War dieser Körper noch vor wenigen Minuten von Leben – wenn auch dahinschwindendem Leben – erfüllt gewesen, dann rann jetzt genau dieses Leben aus ihr heraus, zurück nach Phandra.
Ein tiefer, alles betäubender Schmerz fuhr durch ihn hindurch und raubte ihm buchstäblich den Atem. Mit einem unsäglich wehen Laut, einem wimmernden Klagen nicht unähnlich, senkte er den Kopf, bis seine Stirn ihren Arm berührte. Nur um gleich darauf den Kopf weit in den Nacken zu legen und den Klageschrei eines Phönix auszustoßen und dann weinend ihre kalte Hand zu nehmen und an seine Wange zu legen. Saynea von Derft war gegangen. Er war alleine.
Es mochte fast eine Stunde vergangen sein, bis er wieder aufsah, ihre Hände auf ihrem Bauch ablegte und sich langsam erhob, ihren Anblick noch einmal lange und tief in sich aufsaugend. Dann jedoch wurde es Zeit, sein gegebenes Wort einzuhalten.
Der Phönix in ihm ließ ein sanftes Empfinden durch ihn hindurchrieseln. Es breitete sich von seiner Mitte her aus und durchströmte ihn schließlich bis in die letzte Faser seines Seins. Die unendliche Schwere, die dieser Verlust in ihm hervorgerufen hatte, verschwand dadurch nicht, aber sie milderte sich ab. Sie wurde zu etwas, das zwar noch immer Trauer genannt werden durfte, ihn gleichzeitig aber mit einem Fuß schon jetzt über die Schwelle zur Wehmut schreiten ließ. Und er ahnte, dass er auf diese Weise schon bald mit beiden Füßen jenseits dieser Schwelle stehen würde.
Bald, noch nicht jetzt, signalisierte er dem Phönix, woraufhin dieser sein Tun einstellte. Bald, wenn er seine Mutter bestattet und ihre Habe an die zahlreichen Freunde und Bekannte verteilt haben würde.
Alles bis auf das Amulett, das sein Vater ihr vor vielen Jahren geschenkt hatte. Es zeigte einen Phönix. Und seit seiner Geburt als ebensolcher zeigte es einen Zweiten auf dessen Rückseite.
Vier Monate später …
Die Ebene erstreckte sich im Licht der untergehenden Sonne wie eh weit und fast ohne jede Unterbrechung unter ihm. In einer weiten Kurve ging er tiefer und landete zuletzt unweit des großen Siegels. Vier Monate später als ursprünglich von ihm geplant und vor allem ohne seine Mutter. Und zielsicher, trotz allem, denn die kleinen, vereinzelten Gehölze, das immer gleiche Buschwerk und die sanften Bodenwellen, die nicht einmal annähernd die Bezeichnung Hügel verdienten, waren kaum geeignet, Anhaltspunkte darzustellen.
Auch diesmal war es in allererster Hinsicht ein Instinkt, der ihn so zielsicher hierher geleitet hatte. Erst in zweiter Linie – befand er – war es dem Umstand zu verdanken, dass dies hier nahezu genau in der Mitte des kargsten Teils der steppenähnlichen Fläche lag. Auf den ersten Blick ein eigenartiger Platz für ein so bedeutsames Siegel, doch wenn man es aus letzterem Gesichtspunkt betrachtete, dann hatten sie wohl eben deswegen dieser einsamen und einfachen Gegend den Vorzug gegeben. Abgesehen davon, dass dieser Landstrich annähernd den Mittelpunkt der von Menschen besiedelten Landschaften bildete, war dies hier frei für alle. Frei einsehbar und zugänglich weil frei von irgendwelchen landschaftlichen Schranken, die die Erreichbarkeit hätten erschweren können. Gleichzeitig dennoch auch frei und damit unabhängig von irgendwelchen menschlichen Siedlungen. Wer sich hierher aufmachte, machte sich bewusst auf den Weg zu einem besonderen Ort und ließ in jeder Hinsicht alles Menschliche zurück.
Nach einer erneuten Umschau wandte er sich um und legte die kurze Entfernung in Richtung eines dieser winzigen, niedrigen und jetzt bunt gefärbten Gehölze in langsamem, aber gleichbleibendem Tempo zurück.
Es war eigentlich gleichgültig, ob ihn jemand sah, denn diese Gegend hier mochte zwar einsam sein, doch das Vorhandensein des Siegels war kein Geheimnis. Kaum einmal verirrten sich jedoch Menschen hier heraus, die nächsten Orte lagen in mindestens zwei Tagesmärschen Entfernung von hier. Wobei Orte übertrieben war, denn es waren Flecken, die aus kaum mehr als fünf oder sechs Häusern bestanden. Zwei davon waren erst vor ein paar Jahren entstanden; dort schürften die Bewohner seither nach seltenen Erzen – Vorkommen, die zwar nicht groß waren, aber dicht unter der Oberfläche lagen. Ein dritter Ort, der von hier aus gesehen fast in entgegengesetzter Richtung lag, stellte eine Art Haltepunkt auf einem langen Handelsweg dar.
Umso überraschter blieb er stehen, als vor ihm eine Bewegung zu erkennen war, die nicht von einem Wildtier herrührte.
„Komm heraus, hab keine Angst!“, rief er sofort, als die Gestalt sich offenbar hinter einem der Bäume verstecken wollte.
Es dauerte ein, zwei Wimpernschläge, dann spähte jemand vorsichtig hinter einem Stamm hervor und er verlangsamte absichtlich und zeigte seine offenen Hände in einer friedlichen Geste.
„Bist du ein Phönix?“
„Ja, das bin ich. Mein Name ist Rondur. Und wer bist du?“
Ihr Gesicht verzog sich misstrauisch, also verlangsamte er noch einmal und blieb in angemessener Entfernung stehen.
„Du musst keine Angst vor mir haben. Du bist weit weg von der nächsten Ansiedlung. Bist du alleine? Brauchst du Hilfe?“
„Ja und nein. Und wer weiß schon, ob deinen Worten zu trauen ist?!“, erwiderte sie, trat jedoch zögerlich einen Schritt hervor.
Ihre Kleidung war die einer einfachen Frau: Ein braunes, knöchellanges Kleid von einfachstem, weil geradem Schnitt, unter dessen halblangen Ärmeln und dem Halsausschnitt ein ockerfarbenes Unterkleid hervorlugte. An einem breiten Ledergürtel baumelten neben einem Beutel ein Messer in einer Scheide und auf der anderen Seite eine Schleuder nebst einem zweiten Beutel. Vermutlich beinhaltete dieser einen kleinen Vorrat an flachen, runden Bachkieseln – bestens geeignet als Wurfgeschosse.
Eine Kopfbedeckung fehlte, aber ihre langen, braunen Haare wurden von einer dünnen Lederschnur aus Gesicht und Stirn gehalten und waren offenbar tief im Nacken zu einem dicken Zopf geflochten. Jetzt warf sie sich ein großes, warmes Schultertuch über und schob die überkreuzten Enden vorne unter den Gürtel, um es an Ort und Stelle zu halten.
Sie hatte es abgelegt, weil sie damit gerechnet hatte, sich verteidigen zu müssen? Sehr wahrscheinlich, denn jetzt schob sie auch die Schleuder wieder tiefer hinter den Gürtel und überzeugte sich, dass sie dort fest genug saß.
„Wenn du schon fragst, ob ich ein Phönix bin, hast du mich sicherlich kommen sehen. Was sagt dir das?“, fragte er sanft.
„Wenn du dich auf deine Feuergestalt beziehst: Wenig genug, ich sah deinen Lichtschein erst in letztem Moment! Weil ich dir aber ohnehin nicht entkommen könnte, hatte es auch wenig Sinn, mich weiter vor dir zu verstecken. Was also wirst du tun, wenn ich jetzt gehe?“
„Ich würde dich gehen lassen, was sonst? Vorher aber hätte ich eine Gegenfrage: Weshalb versteckst du dich hier? In dieser Gegend gibt es für einen Menschen nichts und Wild zu erlegen ist wegen der mangelnden Deckung äußerst mühsam, wenn nicht vergebens.“
„Ich habe eine Schleuder und Vorräte“, erwiderte sie abweisend.
„Gut. Ich kann dir also nicht helfen?“
„Nein. Du hilfst mir schon, wenn du mich unbehelligt und in Frieden ziehen lässt.“
„Dann wünsche ich dir einen leichten Weg. Darf ich passieren?“, deutete er an ihr vorbei.
„Seltsame Frage! Könnte ich dich davon abhalten?“, konterte sie, bückte sich nach irgendetwas, das sie hinter dem Baum verborgen hatte, und richtete sich wieder auf. Ein großer, sackartiger Beutel an einer dicken Schnur, den sie jetzt über ihre Schulter warf. Daran befestigt eine Decke, die die Kühle der Nächte auf Dauer kaum mehr abzuhalten imstande sein dürfte. „Du willst zu diesem Siegel!“, ergänzte sie noch und trat beiseite, obwohl er sie in einem kleinen Bogen zu umrunden begonnen hatte.
„Richtig, das war mein Ziel. Du hast es ebenfalls besucht?“
„Ich wüsste nicht, dass dies uns Menschen verboten ist!“, kam es prompt und recht abwehrend.
„Ist es auch nicht!“, schüttelte er den Kopf, blieb erneut stehen und musterte sie forschend. „Dennoch macht es mich neugierig, denn falls das Siegel tatsächlich der Grund war für dich, diese Einsamkeit hier aufzusuchen, dann frage ich mich, was genau dich herführte.“
Sie schnaubte, rückte den Sack zurecht und warf zunächst noch einen Blick in die Umgebung, dann auch nach oben. Und jetzt erst begriff er.
„Du wirst verfolgt!“
Ihr Kopf ruckte herum und aus dem Misstrauen wurde Besorgnis. Er seufzte.
„Wenn du in meiner Gestalt keinen Phönix erkannt hast: Ich kann dir keinen anderen, sofortigen Beweis dafür liefern, dass dir von mir keine Gefahr droht. Ich habe aus deinem Verhalten geschlossen, dass du hier Zuflucht suchen wolltest; weshalb sonst mustert ein Wanderer nicht nur die Umgebung, sondern auch den Himmel über sich? Wer verfolgt dich?“
Sie schwieg, aber ihr bleiches Gesicht sprach Bände!
„Ein Drache“, murmelte er gerade noch laut genug, dass sie ihn hören konnte. „Du schläfst bei Tag und wanderst bei Nacht, um nicht so schnell gesehen zu werden. Mein Auftauchen hat dich dazu veranlasst, schon jetzt, in der Dämmerung, aufbrechen zu wollen. Wann hast du ihn gesehen? Und wo?“
Ihr Blick flackerte, dann schluckte sie und gab sich sichtlich einen Ruck.
„Heute Nachmittag. Ich war gerade erst aufgewacht. Und es ist nicht einer alleine, es sind zwei. Sie sind gemeinsam unterwegs. Vater und Sohn.“
„Weißt du ihre Namen?“
Schweigen.
„Seit wann verfolgen sie dich? Und warum?“
Ihre Miene verschloss sich und wurde hart und die Knöchel ihrer Finger tragen weiß hervor, als sie die dicke Schnur ihres Beutels noch fester umklammerte.
„Schon gut, du musst mir nicht antworten. Aber in diesem Fall solltest du tatsächlich lieber die Dunkelheit abwarten. Hast du Grund zu der Annahme, dass sie zurückkehren? Ahnen sie, welchen Weg du genommen hast? Oder kennen sie gar dein Ziel?“
„Fragen über Fragen! Weshalb gehst du nicht einfach weiter? Vielleicht überlege ich es mir dann noch und warte hier am Rand des Wäldchens auf die Dunkelheit.“
Noch einmal seufzte er, dann überlegte er.
„Du traust meinen Worten nicht, was ich unter diesen Umständen verstehen kann. Aber wie du schon so richtig sagtest: Entkommen könntest du mir ohnehin nicht. Weshalb also begleitest du mich nicht zum Siegel und siehst dir an, was mich dorthin führt? Vielleicht überzeugt dich das ja davon, dass ich kein Drache bin!“
Eine tiefe Falte erschien zwischen ihren Brauen, doch sie ließ seine Aufforderung unbeantwortet. Also lächelte er nachsichtig, nickte ihr dann verabschiedend zu und wandte sich ab, um seinen Weg fortzusetzen.
Es dauerte mehrere Augenblicke, dann hörte er sie in einiger Entfernung langsam und vorsichtig folgen.
Dichte Gräser ringsum verdeckten den direkten Blick auf das Siegel beinahe zur Gänze und er wunderte sich nicht, als er etwas weiter rechts zwischen den kümmerlichen Bäumen Spuren eines nächtlichen Lagers bemerkte. Sie mochte wegen des Siegels gekommen sein, hatte dann jedoch davon abgesehen, es aufzusuchen, denn sie hatte tunlichst vermieden, die kleine, freie Fläche zu betreten. Frisch niedergetretenes Gras wäre für jeden Drachen aus der Luft deutlich sichtbares Zeichen, dass jemand hier gewesen war. Er jedoch nahm jetzt keine Rücksicht darauf, sondern überquerte die wenigen Meter buschloser Fläche, dann betrat er den aus Steinplatten gefertigten Ring, in dessen Mitte sich das große Siegel befand.
Blätter, vom Wind herbeigeweht, lagen darauf verteilt, aber noch immer kehrte es die Seite mit dem Phönix nach oben. Wie schon seit seinem ersten und bislang letzten Aufenthalt hier. Mit einer Bewegung seines Armes, den er dazu in Flammenfedern hüllte, ließ er Blätter und Staub davonstieben. Jetzt waren die Konturen sowohl des Feuerwesens als auch des runden Siegels zu erkennen.
Hinter sich konnte er die leisen Schritte der jungen Frau hören, deren Geräusche nun aussetzten. Sie war stehen geblieben, um vom Rand der kleinen Lichtung aus zuzusehen.
Ohne sich weiter darum zu kümmern, betrat er die leicht gewölbte Steinplatte und ging zuletzt auf ein Knie, um mit der Fingerspitze den Hals des eingravierten Phönix abzutasten. Es dauerte eine ganze Weile, dann ertastete er etwas. Eine Stelle, ein kleiner Kreis, der seinerzeit ganz sicher noch nicht dort gewesen war und nun eine weitere Vertiefung bildete. Deutliches Zeichen, dass Phandra ihn tatsächlich hergerufen hatte, und erneut bedauerte er zutiefst, dass seine Mutter nicht mehr dabei sein konnte, wenn er dieses Rätsel löste. Hoffentlich löste! Vorsichtig die Reste des darin angesammelten Schmutzes herauswischend und -pustend ging er seinem Verdacht nach …
„Was in aller Welt tust du da?“, hörte er sie, näher als vermutet.
„Im Grunde versuche ich, eine Bestätigung für eine Vermutung zu erhalten. Was immer mich hierher gerufen hat, hier ist der Ursprung und das Ziel“, erwiderte er und nestelte zuletzt den Anhänger seiner Mutter aus dem Ausschnitt seines Hemdes hervor, zog ihn über den Kopf und holte noch einmal tief Luft, als er in seiner Hand wie schon am Totenbett seiner Mutter erneut aufleuchtete.
„Wenn ich recht habe, dann… Sag mir, weshalb du dieses Amulett geschaffen hast! Weshalb leuchtet es jetzt auf, wenn ich es in die Hand nehme? Was soll ich damit tun, wozu dient es, wenn es nicht einfach nur ein Geschenk von einem und Andenken an einen großen Phönix ist?“, murmelte er, dann senkte er die Hand mit dem Anhänger …
Er passte. Er passte so exakt in die freigelegte Aussparung, dass es kein Zufall sein konnte. Und während er noch zusah, wie die steinerne Platte das Amulett buchstäblich festzuhalten schien, erschien ein weiteres, eindeutiges und neues Detail in der Darstellung des Phönix: Ausgehend von dem gerade erst eingefügten Anhänger wuchsen zwei neue Rillen mit einem sanften Leuchten hinauf und um den Hals des Feuerwesens herum. Es trug das Amulett damit wie zuvor er. Und nachdem die Schnur, die diese neue Rille offenbar darstellen sollte, fertiggestellt war, leuchteten sowohl das Auge des steinernen Phönix als auch das des Phönix in dem kleinen Amulett in einem hellen Rot auf. Kurz, ganz kurz schien die Platte unter ihm zu erbeben und er hatte sich schon erhoben und war zurückgetreten, doch gleich darauf endete das Zittern schon wieder und alles war so ruhig wie zuvor.
„Sie hat sich nicht gedreht, obwohl du sie um ein Zeichen gebeten hast?“, flüsterte sie hinter ihm.
Sie wusste davon?
„Richtig. Weil ich ein Phönix bin, kein Drache“, wandte er ihr den Kopf zu. „Glaubst du mir jetzt?“
„Ich denke schon“, dehnte sie noch immer ein wenig unsicher. „Aber warum ist sie erbebt?“
Seine Aufmerksamkeit wuchs zusehends.
„Was weißt du über dieses Siegel?“
Ihre Lider flatterten, als sie ihn ansah.
„Nicht viel. Es ist noch nicht alt, heißt es. Es zeigt angeblich, welcher Gesinnung ein Feuerwesen wie du ist, besser gesagt, welches Wesen er darstellt, Drache oder Phönix. Aber das ist Hörensagen. Doch was das mit deinem Anhänger auf sich hat, weiß ich nicht. Wieso hast du mich zusehen lassen? Ist das nicht euch alleine vorbehalten?“
Sie war jetzt erstmals so nahe, dass er ihre Augenfarbe erkennen konnte: Sie waren grün. Sie waren von einem derart intensiven, leuchtenden Grün, wie er es noch nie zuvor gesehen hatte. Aber das alleine war es nicht, was ihn daran fesselte. Nein, nicht nur fesselte, sondern nur noch aufmerksamer werden ließ. Und es lag nicht nur etwas in ihren Augen, sondern auch in dem, was sie gerade behauptet hatte. Sie log.
„Du kennst das hier nicht nur vom Hörensagen!“, widersprach er daher. „Du warst schon einmal hier, weißt zumindest sehr wohl, wozu das Siegel dient. Ja, es ist noch nicht alt. Es ist vor etwas mehr als zweihundert Jahren erschaffen worden. Nicht von Phönixen, jedenfalls nicht alleine. Es waren jedoch die damals existierenden Phönixe, die Phandra darum baten, ein Siegel zu schaffen, das uns das, was sonst selbst unseren Augen und unserem Empfinden verborgen bleiben würde, sichtbar machen sollte. Das hier stammt von Phandra und es ist ein durch und durch magisches Siegel, das uns auf sehr einfache und daher sehr eindeutige Weise zeigt, welche der Seiten in uns Feuerwesen überwiegt.“
„Was überwiegt …“, echote sie, dann starrte sie ihn wieder an und legte den Kopf schief. „Du scheinst nicht glücklich darüber zu sein! Warum?“
„Ich bin weder glücklich noch unglücklich darüber, aber ich bin skeptisch. Es gibt nicht nur Böse und Gut, es gibt immer beides in einem.“
„Du kritisierst Phandra?“, warf sie ihm vor.
„Ich bin weit davon entfernt!“, erwiderte er ernst. „Aber ich fand und finde, dass es nicht nur darauf ankommen darf, was zu einem bestimmten Zeitpunkt überwiegt. Es kommt vielmehr darauf an, wozu sich jemand entschließt und was er für den Rest seines Lebens zu sein gedenkt, wem er abschwören und was zu tun er geloben möchte. Menschen können sich ändern und das gilt auch für Feuerwesen. Die Gnade der Wiedergeburt gehörte bis dahin allen – was denkst du, hat den seit etwas mehr als zweihundert Jahre währenden Streit zwischen Drachen und Phönixen verursacht?“
„Die Schaffung dieses Siegels?“, starrte sie darauf hinab.
„Sehr richtig. Die Bezeichnung Siegel ist in meinen Augen irreführend, es sollte eher danach benannt werden, was es mit uns Feuerwesen tut: Es ist nicht selbst ein Siegel, es drückt uns jedoch ein Siegel auf. Phandras Entscheid hat meiner Meinung nach viele von ihnen erst wirklich aus der Bahn geworfen. Ausgeschlossen zu sein von einem Kreislauf von Geburt und Wiedergeburt ruft Neid und Hass hervor – und den Wunsch, sich anderweitig Macht und Zeit zu verschaffen. Es war jedoch nicht Phandra, das einen Fehler gemacht hat, sondern die Phönixe, die diesen Wunsch aussprachen. Sie formulierten ihn sicherlich mit den besten Absichten, doch sie vergaßen, dass er zu ungenau sein könnte oder zu einseitig oder zu kurzsichtig.“
„Kurzsichtig?“
„Sie vergaßen, dass Phandra stets sachlich entscheidet und auf diese Weise ausschließlich aus dem Moment geborene Entscheidungen trifft.“
„Und weshalb machen diese Phönixe dies alles nicht wieder rückgängig?“
„Weil es zu spät ist: Beide Seiten haben längst die Gültigkeit dieses Siegels anerkannt, womit es Bestandteil unserer Geschichte und Bestandteil von Phandras Magie ist. Vor allem aber weil die Phönixe, die es gemeinsam mit Phandra schufen, nicht mehr sind. Nicht mehr alle jedenfalls. Meiner Meinung nach könnten nur sie aufgrund ihrer erlangten Machtfülle in einem erneuten gemeinsamen Entscheid Phandra darum bitten, es wieder zurückzunehmen.“
„Sie sind nicht mehr?“
Er nickte, ein schweres Gefühl in der Brust, das sein Phönix sofort zu lindern begann.
„Richtig. Zwei von damals Fünfen leben nicht mehr. Und aus einem …“ Er stockte.
„Aus einem … was?“
„Aus einem wurde ein Drache.“
Sie verlor beinahe sämtliche Farbe.
„Was? Weshalb?“
„Weil Phandra seinen Sohn als Drachen bezeichnete, als dessen Zeit gekommen war, hier zu erscheinen. Keiner von den beiden wird noch wiedergeboren werden.“
„Wer?“, flüsterte sie so leise, dass selbst er sie kaum verstand.
„Sein Name ist Salaog. Und der Name seines Sohnes ist …“
„Nerbat!“, krächzte sie.
Er holte tief Atem.
„Die beiden, die dich verfolgen!“, erkannte er. „Zeit, mir die Wahrheit über dich zu sagen! Du bist eine Drachengeborene, richtig?“
Ihr Blick flackerte nervös und sie trat einen Schritt rückwärts.
„Ich wiederhole gerne: Ich bin anders als die ersten Phönixe der Ansicht, dass es ausschließlich auf die Entscheidungen eines jeden ankommt. Was uns ausmacht, ist das, was wir tun. Würde jedes Denken schon Schuldige aus uns machen, dann gäbe es keine Phönixe.“
Noch immer schwieg sie, also nickte er nur, trat dann wieder auf die Platte und kniete neben dem Amulett nieder. Es ließ sich ohne jeden Widerstand herausnehmen, aber eine letzte Antwort stand noch aus – und die würde er nur hier erhalten.
„Ich werde heute Nacht hier übernachten. Du bist eingeladen, hierzubleiben, ein wenig Ruhe dürfte dir guttun. Ich biete dir an, dich morgen wohin auch immer zu bringen. Es wird sicherer für dich sein, wenn ein Phönix dich innerhalb kürzester Zeit fortträgt …“
Wieder rührte sie sich nicht, also nickte er nur noch seufzend, schob das Amulett unter sein Hemd und wandte sich ab, um den Platz anzusteuern, an dem sie den Tag über gerastet hatte.
„Selisha“, hörte er ihre heisere Stimme hinter seinem Rücken. „Und ja, ich bin die Tochter eines Drachen. Aber ich bin kein Drache!“
„Das habe ich auch nie behauptet!“, lächelte er.
Camryn
In der Gegenwart
Es war unbeschreiblich! Noch immer, nach all den Jahren, war es ein absolut unbeschreibliches Gefühl, als Phönix über die weiten und vielfältigen Landschaften Phandras zu fliegen. Getragen vom Feuer, eingehüllt in seinen schützenden, wärmenden und tragenden Mantel, durchdrang mich auch jetzt das Empfinden unvergleichlicher Leichtigkeit, Freiheit und ein überwältigendes Glücksgefühl, das nicht nur der Phönix mir vermittelte. All das schien mich aus meiner eigenen Existenz herauskatapultieren zu wollen, weil es schlicht zu viel war, um es fassen und festhalten zu können.
Jared neben mir hörte mein Lachen und in dem Augenblick, in dem ich zu platzen glaubte vor lauter Glück, jubelte ich laut auf. Meine Arme weit ausbreitend drehte ich mich im Flug mehrmals um mich selbst, um dann steil aufzusteigen und dort oben kurz zu verharren, mich gleich darauf in jeder Beziehung fallen lassend.
Seine Flammen vermischten sich wie stets mit den meinen, loderten auf und ergaben gemeinsam mit ihnen einen bunten Teppich mehrfarbiger Flämmchen, als er mich mit einem Flügel auffing, festhielt, umarmte und langsam wieder nach oben trug, während er mich küsste.
„Ich liebe dich, weißt du das? Ich liebe, wie du dein Dasein hier auf Phandra liebst, wie du mein Leben erfüllst – und ich liebe es, dir zuzusehen, wenn du so wie jetzt heller als die Sonne aufzuleuchten scheinst! Hast du überhaupt eine Ahnung, welchen Anblick du dann bietest? Es ist, als ob du auf und mitten in deinen Flammen tanzt, während sie sich in einem immer größer werdenden Schein ausbreiten. Du bist in jeder Bedeutung des Wortes für dein Leben als Phönix von Bourgause und Phandra geboren, Cam!“, gab er mich wieder frei, ohne jedoch meine Hand loszulassen.
„Viel dichterische Freiheit, die du dir da erlaubst!“, lachte ich, dann zog ich ihn mit mir und weiter über die Kandarwälder, die sich weiß und schneebedeckt unter uns erstreckten.
„Wohin?“, fragte er nur.
„Ist das nicht egal?“, rief ich, ließ los und schraubte mich in mehreren waagerechten Pirouetten vorwärts, bevor ich dann wieder wartend verhielt, bis er bei mir anlangte.
„Kann es sein, dass du neuerdings eine ganz besondere Form von Übermut entwickelst? Gibt es einen bestimmten Grund dafür?“, schmunzelte er, umfasste meine Mitte und ließ uns malerisch langsam nach unten sinken, irgendwo zwischen die dick mit Schnee verschneiten Bäume. Um uns herum schmolz er sofort weg, kaum dass wir den Boden berührten.
„Keinen bestimmten Grund, einfach nur das Bedürfnis, mein Glück herauszuschreien! Ist dir klar, dass das hier das Paradies ist?“
Sein Lächeln wurde um eine Winzigkeit kleiner.
„Phandra mag mitunter paradiesisch sein, aber …“
„Ich weiß! Aber vergiss jetzt für einmal die Schlangen, die in jedem Paradies leben.“
„Dann ist das hier das Paradies! Weil du da bist! Camryn von Bourgause macht Phandra zu einem Paradies für mich, sobald sie nur in meiner Nähe ist“, flüsterte er und fuhr mit seinen Fingerspitzen die Konturen meines Gesichtes nach.
„Es übersteigt meinen Wortschatz, also nutze ich deine Worte: Ja, das ist es, aber nur, weil du hier bist!“, flüsterte ich zurück. „Was denkst du: Haben wir noch etwas Zeit für uns oder sollten wir schon jetzt zum Siegel weiterfliegen und sie dort erwarten?“
„Ich glaube nicht, dass man das von uns erwartet“, lächelte er. „Wir haben noch Zeit. Abram wird bestimmt auch erst morgen dort eintreffen und sie werden ganz sicher auf uns warten, falls sie vor uns da sind.“
„Ist es nicht trotzdem furchtbar egoistisch, dass wir uns einfach davongestohlen haben?“
Er lachte leise.
„Ich denke nicht, dass deine Eltern das genauso sehen! Sie waren froh, Anna und Simon einmal wieder alleine für sich zu haben – sie werden sie hoffnungslos verwöhnen.“
Ich lächelte schief und vergrub mein Gesicht in seinem warmen Pullover. Ein Geschenk von Mom, die auch nach all den Jahren nicht sehen konnte, wenn wir selbst im tiefsten Winter einfach nur in hemdartigen Oberteilen herumliefen. Sein Pullover war in einem dunklen Blau, meiner in einem dunklen Rot gehalten.
Seit Befis und Danar eigene Wege gingen – beide seit Kurzem gemeinsam mit je einem Lebenspartner – war es still in ihrem Haus geworden. Nicht zuletzt, weil Jared und ich in den letzten Jahren immer mehr dazu übergegangen waren, Anna und Simon mitzunehmen auf unsere Reisen. Bei dem Gedanken daran, dass Mom und Dad uns alle dann sicher immer sehr vermissten, stieß ich einen leisen Seufzer aus.
„Sie sind nicht einsam, Cam“, hörte ich ihn.
„Du weißt genau, was ich denke. Wie immer.“
„Wie oft. Besser gesagt, wie zumindest hin und wieder. … Ich überlasse es dir: Sollen wir zurück nach Born fliegen und das hier als kurzen Ausflug ansehen?“
Ich hob den Kopf.
„Nein. Lass uns bleiben und ein wenig Kraft tanken. Anschließend.“
„Anschließend!“, lächelte er und hüllte uns in seine Wärme …
Die letzten Trümmer der ehemaligen Buckelberge waren schon vor Jahren abgetragen und fortgeschafft worden. Wo damals diese eigenartige Stille geherrscht hatte, hatte die Natur das Terrain längst zurückerobert und der Wandel der Jahreszeiten war seither auch hier lückenlos sicht- und spürbar. Eine dicke, weiße Decke lag über der gesamten Landschaft und nur eine einzige Stelle war frei davon. Schon von Weitem erkannte ich Abrams Gestalt und daneben auch die von Fendor, Sanara und Takar.
„Wir sind die Letzten! Offenbar haben sie doch schon länger gewartet“, rief ich Jared zu und ging wie er dann in einen Sinkflug, der punktgenau neben Sanara endete.
„Wie gut, dass wir einen Phönix dabeihatten! Hätten wir auf deine Pünktlichkeit vertraut, wären wir längst erfroren!“, begrüßte Sanara uns gewohnt freundlich und verschränkte demonstrativ ihre Arme vor der Brust. Die Jahre hatten ihr nicht wirklich viel anhaben können, ging mir durch den Kopf. Weder äußerlich noch in ihrem Wesen. Takar dagegen strahlte uns freudig an und umarmte erst mich, dann Jared. Inzwischen war er auf Jareds Größe aufgeschossen und überragte mich.
„Ich freue mich, dass ihr gekommen seid! Ich hatte darauf gehofft, dass ihr dabei sein würdet“, schob er seiner Begrüßung nach.
„Wir wären auf jeden Fall gekommen!“, erwiderte ich und umarmte nun auch Fendor. „Wartet ihr schon lange?“
„Wir haben die letzte Nacht zusammen mit Abram in einem kleinen Ort westlich von hier verbracht, um heute ganz sicher früh genug hier zu sein. Wenn ich also schätzen sollte: eine Viertelstunde?“, lächelte der leise und schlug in Jareds dargebotene Hand ein.
„War ja klar! Erfroren! Ich freue mich also auch, dich und deine Borsten zu sehen, Sanara! Wann darf ich sie dir endlich abfackeln?“
„Nicht in hundert Jahren!“, knurrte sie. „Oder nur über meine Leiche! Wähle!“, konterte sie und hob beide Augenbrauen bis dicht unter den Haaransatz als ich auf sie zutrat und meine Arme zu einer Umarmung hob. Nach einigem Zögern reichte sie mir dann die Hand – die ich kopfschüttelnd ergriff.
„Dann wähle ich Option drei: Ich stopfe dich aus und stelle dich aus, wenn es so weit ist. Du bist sicher die einzige Person auf ganz Phandra, die nicht anders kann als gegenüber einem Phönix Gift zu versprühen… Hallo Abram, es ist schön, dich zu sehen! Geht es dir gut? Gibt es Neuigkeiten?“
„Hallo Camryn, ich freue mich auch! Neues gibt es wenig, zumindest nichts, das der Rede wert wäre. Bislang herrscht überall wohltuender Frieden, kleine Plänkeleien sind schon das Aufregendste, wovon ich berichten könnte. Geht es euch ebenfalls gut? Was machen Anna und Simon?“
Jared übernahm die Antwort:
„Allen geht es gut. Sie sind im Moment bei Shannon und Jack – und werden ganz sicher dementsprechend faul sein. … Fendor? Es freut mich, dass ihr wohlauf seid.“
Ein weiterer Handschlag, dann fand auch diese Begrüßung ein Ende. Zumindest halbwegs, denn nach einem Räuspern wandte ich mich erneut an Abram.
„Hast du irgendetwas von Jean gehört in letzter Zeit?“
Seine Miene wurde sofort um einiges ernster.
„Ja und nein. Zuletzt hörte ich vor etwas mehr als einem Vierteljahr von ihm. Man hat ihn aber an der Grenze zu Maarthun gesehen, wenn auch nur kurz. Die Menschen sagten, er sei in aller Eile südwärts geflogen und seitdem nicht wieder aufgetaucht. Und er war alleine unterwegs.“
Ich warf Fendor sofort einen entsprechenden Blick zu, doch auch er schüttelte den Kopf.
„Fajan verhält sich noch immer nicht sonderlich zugänglich mir gegenüber, aber ich glaube ihm, wenn er sagt, dass weder er noch seine damaligen Helfershelfer noch einmal Kontakt zu Jean hatten, geschweige denn, sich noch einmal mit ihm zusammenschließen würden. Es ist längst überall bekannt, was Jean möglicherweise blüht, wenn seine Zeit gekommen ist. Sie werden sich Phandra kaum in den Weg stellen wollen. Oder können. Und sie wären verrückt, wenn sie nach diesem Richterspruch eine Einmischung wagen würden, denn immerhin könnte auch sie dann eine wie auch immer geartete Strafe erwarten. Jean dürfte alleine sein.“
„Das deckt sich mit dem, was ich über ihn hörte. Ich war ein paarmal in den äußersten Randgebieten der bevölkerten Länder unterwegs und nirgends hörte ich etwas Gegenteiliges“, bestätigte Abram. „Jean beschränkt sich offenbar auf kurze Reisen und noch kürzere Aufenthalte, wenn er irgendwo gebraucht wird. Andererseits …“
„Andererseits?“, hakte ich nach, als er stockte.
„Seht selbst!“, deutete er auf das Siegel, das sich in wenigen Schritten Entfernung hinter mir befand.
Ich wandte mich um – und hielt den Atem an.
„Er war hier und hat versucht, sein Amulett gewaltsam herauszuholen?“, flüsterte ich.
Die Steinplatte war unübersehbar geschwärzt um das Amulett herum. Falls er versucht hatte, es herauszusprengen, war es vergeblich gewesen.
„Falls er es war!“, meinte Takar.
„Wer sollte es sonst gewesen sein? Alle, die davon wissen, wissen auch, dass das Amulett Jean gehört und in fremden Händen nicht das Geringste bewirken würde.“
„Wäre es nicht immerhin möglich, dass jemand es als Druckmittel gegenüber Jean verwenden könnte?“, widersprach er dennoch.
Abram wiegte seinen Kopf ein paarmal hin und her.
„Ausschließen können wir das nicht, aber ich glaube es nicht. Jean würde sich nicht erpressen lassen, weil er sich durch ein erneutes Fehlverhalten selbst der Chance einer Wiedergeburt benehmen würde. Endgültig. Ich glaube, er war hier. Er konnte sich genau wie wir schließlich ausrechnen, wann wir wieder herkommen würden, um Phandra Takar vorzustellen. Falls er die Befürchtung hegte, wir könnten bei dieser Gelegenheit sein Amulett entfernen und woanders deponieren …“
„Wo wäre es sicherer als hier?“, deutete ich.
„Ich weiß. Aber aus Jeans Sicht war es offenbar einen Versuch wert.“
„Womit er hier aufgetaucht ist, obwohl du es ihm untersagt hast.“
Abram seufzte lediglich als Antwort.
„Es ist nicht deine Schuld, Phönix!“, dehnte Sanara, dann warf sie Takar einen kurzen Blick zu. „Wollen wir beginnen?“
Ich musterte sie. Sie machte sich Sorgen. Zumindest aber machte sie sich Gedanken. Da waren ein paar Fältchen um ihre Augen herum, die wohl nicht vom Lachen herrührten.
„Takar?“, fragte Abram sofort.
Der nickte. „Ich bin bereit.“
„Also schön. Würdet ihr euch in einem Kreis um das Siegel herum aufstellen? Ich bin mir natürlich nicht annähernd sicher, wie das hier funktionieren wird, aber ich habe so eine Ahnung – den Rest wird Phandra übernehmen. Wie immer“, deutete er.
Ich warf Sanara noch einen forschenden Blick zu, dann umrundete ich gemeinsam mit Jared den steinernen Kreis, um ihr gegenüber stehen zu bleiben.
„Das Jahr, in dem Takar fünfundzwanzig Jahre alt werden wird, hat heute begonnen. Und damit stehen wir hier im Angesicht Phandras und bitten ihn um seine Entscheidung, als was er künftig leben möchte. Daher frage ich dich, Takar von Born: Ist dir bewusst, was du aufgeben würdest, falls du dich für das Dasein eines Phönix entscheiden solltest? Und ist dir bewusst, welches Opfer ein solches Dasein von dir verlangen könnte?“
Sein Gesicht wirkte eine Winzigkeit blasser als noch Augenblicke zuvor und der Ernst seiner Miene konnte kaum tiefer sein.
„Ja, das ist es! Ich habe viel Zeit gehabt, um darüber nachzudenken, und habe alles gründlich erwogen … und wenn Phandra mich akzeptiert, dann möchte ich den Rest meines Lebens als Phönix verbringen und Phandra und seinen Menschen dienen!“
Ein Beben fuhr durch die steinerne Platte und pflanzte sich durch die Einfassung hinweg fort bis zu uns und weiter unter unseren Füßen hindurch.
Ich hielt den Atem an, als ein Ruck durch das Siegel ging. Es bewegte sich und in einer langsamen Drehung um die eigene Achse verschwand die Seite mit dem Phönix …
„Das kann nicht sein!“, hörte ich Sanara heiser murmeln – und dann verschwamm alles um mich herum in einem grellen Lichtblitz.
Rondur
Am Anfang …
Das Beben weckte ihn kurz nach dem Sonnenaufgang. Er hatte länger und tiefer geschlafen als beabsichtigt und als er nun sofort den Kopf hob und aufsprang, bemerkte er, dass Selisha bereits wach war. Sie saß, in ihre Decke gewickelt, aufrecht da und erhob sich nun ebenfalls hastig.
„Es öffnet sich? Wir müssen fort!“, rief sie und starrte entsetzt in Richtung des sich drehenden Siegels. Auch er trat, durchaus beunruhigt, vor und beobachtete erschrocken, wie die gesamte steinerne Platte sich einmal um sich selbst drehte. Auf der Seite mit dem Drachen verhielt sie für einen Moment und ein greller Lichtschein blendete ihn kurz, dann aber drehte sie sich weiter und rastete mit einem leisen Knirschen auf der Seite mit dem Phönix erneut ein. Und nur ein paar schnelle Herzschläge später rannte er los, auf die leblos scheinende Gestalt zu, die nur zwei oder drei Schritte von der Kopfseite des Siegels entfernt dalag.
„Wer ist das?“
„Ich weiß es nicht! Aber wie es aussieht, ist es jemand, der unsere Hilfe benötigt, also helfe ich!“, rief er halblaut und ging nur wenige Augenblicke danach neben der Fremden auf ein Knie. Es war eine Sie, auch wenn sie äußerst eigentümliche Kleidung und vor allem Hosen trug. Ihre langen, hellen Haare hatten sich halb aus einem Zopf gelöst und das noch junge Gesicht war wie ihre ansonsten intakte Kleidung stellenweise angeschmutzt. Und sie war alleine; jedenfalls gewahrte er ansonsten niemanden in der Umgebung.
Mit einer Hand an ihren Hals fassend stellte er fest, dass sie noch lebte. Ihr Atem ging flach und ihr Herz raste, aber der Phönix in ihm konnte keinerlei Verletzungen feststellen. Doch er konnte sie auch nicht aufwecken. Und noch etwas fühlte er überdeutlich:
„Ein Phönix! Ein junger Phönix! Woher in aller Welt …“, flüsterte er und mühte sich erneut ab, einen intensiven Strom an Licht und Wärme, an Heilung durch ihren Körper zu senden.
„Das soll ein Phönix sein? Woher willst du das wissen?“
Nur ganz kurz sah er auf, dann widmete er sich wieder der bewusstlosen Frau.
„Weil ich es fühlen kann, bis in die letzte Faser meines Seins, Selisha! Woher auch immer sie gekommen ist, sie ist wie ich!“
Ein leises Stöhnen ertönte, aber ihre Augen blieben nach wie vor geschlossen.
„Bei Phandra, was ist dir nur geschehen? Wenn dich nicht einmal ein Phönix wecken kann …“
Selisha stieß erneut einen Laut aus und er wollte schon ungehalten reagieren, dann aber sah er, wohin sie deutete. Am Hals des Phönix auf dem Siegel prangte eindeutig ein Amulett. Ein Leeres. Und als er daraufhin sofort und ohne zu überlegen in ihrem Nacken tastete und an der ledernen Schnur zog, die er dort erfühlte, sog er heftig den Atem ein.
„Ein doppelseitiges Amulett! Wie das meine! Ich hatte zwar um Antworten gebeten, aber ich hatte nicht damit gerechnet … Selisha, ich verstehe dein Misstrauen, aber ich möchte dich bitten, etwas von deinem Wasservorrat zu opfern! Ich möchte sie nicht bewegen, solange ich nicht weiß, ob ich ihr nicht am Ende damit schade, wenn ich sie von dem Siegel entferne. Es muss einen Grund geben, weshalb sie ausgerechnet jetzt und hier auftauchte.“
Sie stieß eine Art unwilligen Schnaubens aus. „Ich mag misstrauisch sein, aber ich bin weder blind noch ein Unmensch! Ich bin gleich zurück.“
Erneut betrachtete er ihr Gesicht. Sie war eine ihm völlig unbekannte Frau, aber was sich ihm bei ihrem Anblick mitteilte, war … Vertrautheit. Etwas, das absolut unmöglich war.
Noch einmal sandte er einen warmen Strom durch sie hindurch und schloss dazu zuletzt sogar die Augen, um sich ausschließlich auf ihre Heilung konzentrieren zu können. Aber mehr als das Empfinden, dass sie im Grunde genommen unverletzt und damit ohne jeden körperlichen Schaden war, eröffnete sich ihm nicht. Sie war und blieb ohnmächtig.
Er gab es auf und öffnete die Augen wieder. Selisha war zurück und hatte offenbar schweigend neben ihm abgewartet.
„Woher kommt sie? Durch das Siegel?“
Er runzelte die Stirn.
„Wie kommst du darauf, dass sie durch das Siegel kam?“, fragte er anstelle einer Antwort.
Sie schwieg, bis er zu ihr hochsah.
„Weil es eine Tür ist?“, erwiderte sie. Eine Frage, die eher einer Feststellung gleichkam.
Sein Stirnrunzeln verstärkte sich noch.
„Noch einmal: Wie kommst du darauf, dass etwas oder jemand hindurchkommen könnte? Wie kommst du darauf, es könnte eine Tür darstellen?“
Ihre Miene verschloss sich, wobei er diesmal nicht wusste, ob wegen seines jetzt fordernden Tonfalls oder wegen des Inhalts seiner Frage.
„Selisha, dies ist nicht der richtige Zeitpunkt, um mir Wissen vorzuenthalten! Wenn du etwas weißt, solltest du es mir sagen! Weshalb bist du hier? Weshalb suchen dich Salaog und Nerbat und überfliegen dazu ausgerechnet die Stelle, an der sie von Phandra als Drachen bezeichnet und von der Wiedergeburt ausgeschlossen wurden? Sie haben keinerlei Veranlassung, noch einmal hierher an den Ort ihrer … nennen wir es Niederlage. An den Ort ihrer Niederlage zurückzukehren.“
Sie zögerte.
„Und wenn doch?“, kam es dann leise.
„Wenn doch? Was beim heilenden Feuer eines Phönix soll ich noch tun, um dir zu zeigen, dass ich dir nicht übelwill? Sprich endlich! Was weißt du?“
Bleichgesichtig reichte sie ihm ihre Kalebasse.
„Ich habe gesehen, wie Salaog und Nerbat durch dieses Siegel kamen, sie tauchten daraus auf. Was anderes als eine Tür nach wer-weiß-wo soll das Siegel außer einer Richterin also sein?“
„Sie tauchten aus diesem Siegel auf wie durch eine Tür? Was meinst du damit? Wann?“
Der bewusstlose Phönix regte sich und stöhnte erneut, aber noch immer war die Ohnmacht zu tief, um daraus aufzuwachen. Selisha hatte sich abgewendet und ein paar Schritte zur Seite getan, wo sie jetzt stehen blieb und nachzudenken schien. Dann ging ein sichtlicher Ruck durch sie hindurch und sie wandte sich ihm wieder zu.
„Sie verfolgen mich, weil sie wissen, dass ich es gesehen habe. Von Verfolgung zu sprechen ist zu wenig und deshalb nicht ganz zutreffend, auch wenn es im Kern stimmt. Das mit der Tür hat aber schon früher jemand entdeckt, jemand anderes war Augenzeuge. Anders als ich jedoch unbemerkt. Es ist jetzt über zwanzig Jahre her – etwa zweiundzwanzig, wenn die Berichte meines Vaters stimmen – als Salaog und Nerbat durch dieses Siegel verschwanden. Ich war damals noch nicht geboren. Vater ist ein Drachengeborener, aber er ist ebenso wenig ein Drache wie ich! Deshalb war er damals hier, gemeinsam mit meiner Mutter. Sie wollte eine Bestätigung dafür, dass sein Herz nicht im Drachenfeuer aufbrennen werde, bevor sie in eine Verbindung mit ihm einwilligen würde.“
Er begriff. Dieser Ort stand allen offen und Menschen suchten ihn offensichtlich durchaus auf, wenn sie ein Erbe wie das ihre in sich trugen.
Zweiundzwanzig Jahre!
„Weiter. Was geschah dann?“, fragte er erstickt.
„Phandra erkannte für ihn, obwohl er der Bastardsohn eines Drachen war. Sie hatten sich anschließend in das Wäldchen zurückgezogen, um am nächsten Tag den Rückweg anzutreten. Mitten in der Nacht aber wurden sie wach, weil Kampflärm sie aus dem Schlaf riss, ein fast tagheller Lichtschein näher kam und zuletzt über dieser freien Fläche auftauchte. Zwei Drachen und ein großer Phönix, die bis aufs Blut miteinander kämpften. Ihre Schreie müssen ohrenbetäubend und die ganze Umgebung muss in ihr rotes Leuchten getaucht gewesen sein –laut Vater und Mutter ein unheimlicher, grauenvoller Anblick …