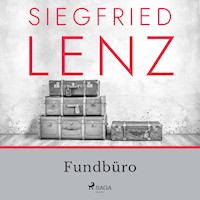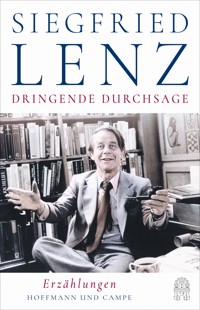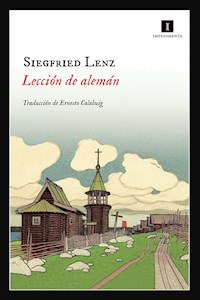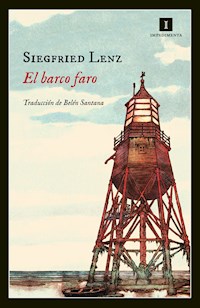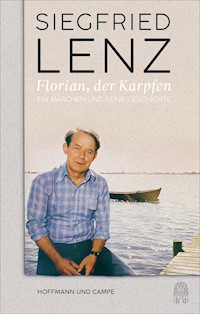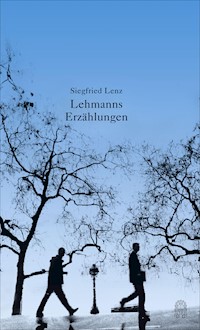
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Siegfried Lenz erzählt mit Leichtigkeit und feinem Humor eine Novelle von zeitloser Aktualität: Schwarzhändler Lehmann erinnert sich wehmütig an seine goldenen Tage auf dem blühenden Schwarzmarkt im Hamburg der Nachkriegsjahre, der durch die Währungsreform jäh zum Erliegen kam.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 85
Ähnliche
Siegfried Lenz
Lehmanns Erzählungen oder So schön war mein Markt
Aus den Bekenntnissen eines Schwarzhändlers
Hoffmann und Campe
Lehmanns Erzählungen oder So schön war mein Markt
Aus den Bekenntnissen eines Schwarzhändlers (1959)
I
Die Not ist meine schönste Zeit. Schon früh erkannte ich, welche Möglichkeiten der Mangel birgt, die Knappheit an allen Dingen; schon als Schüler war mir der Unterschied vertraut zwischen Haben und Nicht-Haben, und nicht nur dies: ich habe einen Gaumen für spezifische Not, spüre eine gewisse schöpferische Erregbarkeit, sobald irgendwo ein quälender Bedarf besteht; kurz gesagt, Armut ist mein höchstes Glück. Nichts inspiriert mich tiefer als die Not der anderen, niemals ist meine Phantasie so zuverlässig, als wenn es darum geht, den Mangel der anderen zu beheben – schon als Junge merkte ich es. Ich merkte es beispielsweise, wenn sich meine jüngere Schwester, sobald sie nichts mehr hatte, Sahnebonbons von mir lieh: bereitwillig half ich ihr aus der Verlegenheit, allerdings mußte sie diese Verlegenheit extra bezahlen. Ich bekam die doppelte Anzahl von Bonbons zurück. Und ich stieß auf die schöpferischen Möglichkeiten des Mangels, als sich mein Vater gegen Monatsende den Rest meines Taschengeldes pumpte, zögernd zuerst, dann mit einträglicher Regelmäßigkeit; ich half ihm, wo ich konnte, denn er zahlte pünktlich fünfzig Prozent Zinsen und war mir sicher.
So erwarb ich bereits im zarten Alter die Erkenntnis, daß die Not viele Vorzüge hat, und daß sie den, der auf sie baut, nicht nur ernährt, sondern auch in seinen Begabungen fördert. Denn Begabung ist nötig, um all die Chancen wahrzunehmen, die sich aus dringendem Mangel ergeben.
In Zeiten des Überflusses stirbt die Phantasie, nichts wird uns abverlangt an Überlegung, an Abenteuer, an Ungewißheit; wem es an irgend etwas mangelt, der drückt die Klinke des nächsten Geschäfts und deckt seinen Bedarf. Diese Zeit ist nicht meine Zeit. Wie einfallslos, wie degeneriert und unkünstlerisch erscheint unser Markt: überschwemmt von Angeboten, überwacht von Preisbehörden, besucht von Leuten, die jederzeit wissen, was sie brauchen und wieviel sie für die Mark bekommen. Überall ist man sich des Wertes gewiß und des Gegenwertes; keine Unsicherheit, kein Zaudern und blitzartiges Zupacken, und auf allen Gesichtern, die ich auf dem weißen Markt des Überflusses sehe, liegt die gleiche Freudlosigkeit, die gleiche träge Selbstgewißheit und der gleiche Überdruß. Die Sinne sind nicht mehr geschärft, das helle, räuberische Bewußtsein ist nicht mehr auf Beute gerichtet: die große Zeit ist vorbei, die Zeit der wundervollen Not.
Damit ist meine Zeit vorbei: der Überfluß hat alle meine Begabungen außer Kraft gesetzt, der Wohlstand hat meine Fähigkeiten verkümmern lassen – alles, was mir bleibt, ist die Erinnerung und die Sehnsucht. Ja, an kühlen Abenden habe ich oft Sehnsucht nach der Zeit der Not, erinnere ich mich an das Abenteuer meines Marktes – des Schwarzen Marktes –, und stumm vor Rührung denke ich an den Ruhm, den ich mir damals erwarb. Der Schwarze Markt war mein Metier.
Ich war für ihn geschaffen, wie Churchill für den Posten eines Kriegspremiers geschaffen war. Meine Fähigkeiten wurden immer vollkommener, und ich näherte mich meiner Vollendung. Schon begann man sich in einigen Hamburger Kreisen ehrenvolle Namen für mich auszudenken, als der Tag hereinbrach, der meine gesamte Muskulatur lähmte: der 20. Juni 1948, der schmähliche Sonntag der Währungsreform.
Seitdem habe ich gewartet, gehofft, daß meine große Zeit wiederkehre – bisher ist sie nicht wiedergekehrt. Ich finde nur noch den Trost der Erinnerung. Erinnerung ist das einzige, was mich wach und aufrecht hält, doch da auch sie – ich spüre es – mehr und mehr an Schärfe verliert wie alte Photographien, möchte ich alles aufschreiben, zum Nutzen eines Gleichgesinnten, für mich selbst aus Notwehr. Wäre ich ein Dichter wie Whitman, würde ich sagen: »Ich singe den Schwarzen Markt« –, doch ich bin nur ein Künstler des Mangels, und ich möchte nur aufschreiben, wie alles gewesen ist: mein Markt, mein Ruhm, mein Untergang. Ich möchte, da ich die nötige Schwermut des Erzählers zu besitzen glaube, anfangen, wo es begann, und enden, wo einstweilen alles endete.
Zuerst kamen Autos mit hohen Offizieren vorbei, Tag und Nacht; dann kamen Omnibusse mit nicht sehr hohen Offizieren, dann Pferdewagen, und zum Schluß staubgepuderte Soldaten ohne Waffen, die Tag und Nacht an dem Gutshof vorbeimarschierten, in dem unser Marinestab damals untergebracht war. Die Offiziere in den Autos und Omnibussen sahen enttäuscht aus, saßen mit schweigender Bitterkeit in den Lederpolstern, während die Soldaten uns zuwinkten und lachten und riefen, daß der ganze Mist vorbei sei. Alle, die müde und lachend vorbeimarschierten, riefen es uns zu, Tag und Nacht, und schließlich muß es unser Admiral gehört haben, denn er nahm sein Auto und fuhr enttäuscht weg. Und nachdem er weg war und die waffenlosen Soldaten nicht aufhörten zu rufen, daß der ganze Mist vorbei sei, setzte sich unser Korvettenkapitän mit den verschiedenen Leutnants in den Omnibus und fuhr ebenfalls enttäuscht weg. Für den Bootsmann war kein Pferdewagen da, so verließ er uns zu Fuß, und während draußen noch immer Soldaten vorbeimarschierten, rief der letzte Stabsgefreite die Schreiber und Burschen zusammen und erklärte uns, daß nun alles vorbei sei. Er führte uns ins Magazin und forderte uns auf, von den Sachen so viel zu nehmen, wie wir tragen konnten, denn hinterher wollte er den Rest in die Luft sprengen. Wir suchten hastig nach Sahnemilch, nach Kognak, Zigaretten und Büchsenschokolade – aber seltsamerweise fanden wir nur Sauerkraut in Dosen und Erbsen und allenfalls fettes Schweinefleisch. Die besseren Sachen mußten offenbar termingerecht ausgegangen sein. Als ich mit meinem Seesack ankam, war nicht einmal mehr fettes Schweinefleisch da, und ich suchte verzweifelt herum, bis ich eine riesige Pappkiste fand, die man offenbar auch schon vor mir entdeckt, doch, weil nichts darin zu finden gewesen war, mit Fußtritten in eine Ecke geschubst hatte, denn quer über die Kiste zogen sich Schrammen von Stiefelsohlen hin – wie Stigmen der Enttäuschung. Ungeduldig öffnete ich die Kiste, sah, daß sie gefüllt war mit Sahnelöffeln, Hunderten von Sahnelöffeln in rosa schimmerndem Seidenpapier, und gerade als ich ihr den letzten Fußtritt geben wollte, rief der Stabsgefreite von unten, daß die Sprengung vorbereitet sei. Verzweifelt sah ich mich um; nichts war in der Nähe als Sauerkraut und ein Gebirge von grauer RIF-Seife, deren Anblick schon genügte, um ein Schaudern hervorzurufen. So zwängte ich – vor der Wahl, entweder ohne etwas umzukehren oder mit dem absurden Reichtum der Sahnelöffel in Sicherheit zu gelangen (denn etwas mußte ich doch mitnehmen) – zwängte ich also die Pappkiste mit Hunderten von Sahnelöffeln in meinen Seesack, schwang ihn auf die Schulter, brach nahezu unter dem Gewicht zusammen, doch die Gefahr, die bereits Hölderlin in ähnlichem Zusammenhang erwähnte, gab mir die rettende Kraft: ich ließ den Seesack die Treppe hinunterfallen und sprang hinterher, gerade noch rechtzeitig genug. Später, nach der Sprengung, habe ich die Löffel gezählt, es waren zweihundertvierzig, oder zwanzig Dutzend, und mit ihnen auf dem Rücken zog ich die Straßen, die auch die lachenden Soldaten gezogen waren, die uns so oft zugerufen hatten, daß der ganze Mist vorbei sei.
Auch die Soldaten brachten etwas aus dem Krieg nach Hause: Konserven, Kugellager, Schnaps, Werkzeuge oder Zigaretten, und einer, der vom Nordkap kam, vertraute mir an, daß er sich zehntausend Stopfnadeln aus einem Schneidermagazin geholt hatte, bevor es in die Luft gesprengt worden war: jeder schleppte etwas nach Hause, die seltsamste Beute manchmal, doch Sahnelöffel hatte keiner, Sahnelöffel hatte nur ich, und ich verdankte diesen überraschenden Besitz lediglich dem Umstand, daß unser Marinestab zwei Jahre in Dänemark stationiert gewesen war. So war ich, als der Friede losbrach, Eigentümer von zweihundertvierzig Sahnelöffeln, ein Besitz, der mich anfangs ständig irritierte, denn einmal haßte ich Sahne, und zum anderen glaubte ich mich überwinden zu können, Schlagsahne, wenn es schon sein mußte, auch mit einem schlichten Löffel zu essen. Das verwirrte mich zunächst sehr, und es gab Stunden, Mittagsstunden in hämmernder Hitze, in denen ich, was sonst keineswegs üblich ist, meinen Besitz verfluchte. Doch ich brachte es nicht übers Herz, mich von ihm zu trennen, vor allem deswegen nicht, weil ich die Sahnelöffel mit der Zeit als ein ausgefallenes Honorar ansah, mit dem man mich für den ganzen Mist bezahlte, in dem ich gesteckt hatte. Ich behielt es also bei mir, zog in südliche Richtung und erreichte in frischem Frieden die Freie und Hansestadt Hamburg.
Da ich mich nicht entscheiden konnte, ob die Stadt mir gefiel, marschierte ich zum Bahnhof, ging in den Wartesaal und schob den Seesack unter den Tisch und stellte einen Fuß drauf, so wie alle, die ich sah, einen Fuß auf ihren Koffer, ihren Karton oder Beutel gestellt hatten. Ich bestellte eine warme Steckrübensuppe, einen Steckrübensalat hinterher, und während ich aß, kam ein kleiner Junge an meinen Tisch, Rotz und Fröhlichkeit im Gesicht; er beobachtete mich durch das blaßgrüne Glas einer Flasche, schnitt mir Grimassen, dann tauchte er, nestelte unter dem Tisch an meinem Seesack, und bevor ich ihn wegjagen konnte, hatte er drei Sahnelöffel in der Hand, mit denen er zu seiner Mutter rannte. Seine Mutter riß ihm die Löffel aus der Hand und brachte sie mir unter Entschuldigungen zurück.
Als ich bezahlen wollte, den verdrossenen Kellner heranwinkte, fiel sein Blick sofort auf die Sahnelöffel. Überraschend beugte er sich zu mir herab und flüsterte: »Wieviel?« Und ich flüsterte zurück: »Wieviel was?«, und er legte eine Schachtel englischer Zigaretten auf den Tisch, legte fünfzig Mark dazu und strich die Löffel ein und fragte: »Einverstanden?« Ich verstand schneller, als ihm angenehm sein konnte, obwohl ich mir Mühe geben mußte, meine Verblüffung zu verbergen. Ich brachte einen Ausdruck von Zögern, von Unentschiedenheit in mein Gesicht, worauf er zwanzig Mark zulegte und ging. Instinktiv hob ich meinen Seesack auf, nahm ihn fest zwischen die Knie – so als sei mir in diesem Augenblick erst bewußt geworden, welch einen Schatz ich bei mir hatte.