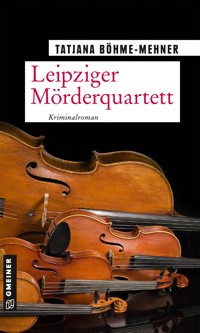
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Musikkritikerin Anna Schneider
- Sprache: Deutsch
Eigentlich ist Anna Schneider gern Musikkritikerin in Leipzig, nur manchmal träumt sie von der großen Enthüllungsgeschichte, auch in der Hoffnung auf mehr Respekt und Anerkennung von den Kollegen. Da kommt ihr der Tod eines Streichquartettmitglieds während eines Konzerts gerade recht, genau wie die absurde Begegnung mit dem Gewandhaus-Bratscher Habakuk C. Brausewind, der fortan ihr Co-Ermittler ist. Die beiden durchpflügen den musikstädtischen Sumpf und bekommen es mit einem ominösen Instrumentenhändler zu tun. Steckt er hinter dem Mord?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 249
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tatjana Böhme-Mehner
Leipziger Mörderquartett
Kriminalroman
Zum Buch
Mord in der Musikstadt Es ist kein alltägliches Konzert, zu dem Anna Schneider in den Club In-and-Out kommt. Normalerweise würde das Streichquartett hier nicht spielen. Und auch die Leipziger Musikkritikerin ist alles andere als zu Hause an diesem Ort. Wer zum Henker kommt auf die Idee, hier ein klassisches Konzert anzusetzen? Von vornherein scheint nichts zu passen. Als der Bratscher des Quartetts während des Konzerts von einem losen Scheinwerfer erschlagen wird, entdecken Anna und Habakuk C. Brausewind, ein Kollege des Toten, eine Reihe von Ungereimtheiten, die sie zunächst auf die Fährte dubioser Machenschaften auf dem Musikinstrumentenmarkt und dann in die Schwulenszene führen. Oder ist der Täter doch in der intimen Welt des Streichquartettspiels zu finden? Hatte der Getötete etwa ein dunkles Geheimnis?
Tatjana Böhme-Mehner lebt im Saarland und arbeitet als Programme Editor an der Philharmonie Luxembourg. Nach dem Studium der Musikwissenschaft und Journalistik sowie ihrer Promotion an der Universität Leipzig forschte und lehrte sie an unterschiedlichen Institutionen in Deutschland und Frankreich und arbeitete rund zwei Jahrzehnte als freie Musikjournalistin und Kulturpublizistin in Mitteldeutschland. Sie veröffentlichte Sachbücher sowie Erinnerungen an ihren Vater Ibrahim Böhme.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2021 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Christine Braun
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Murushki / stock.adobe.com
ISBN 978-3-8392-6928-2
1
Tok-tok-tok-tok und dann ein permanentes heftiges Rütteln, das in den ganzen Körper hineinströmte. Anna liebte das Gefühl des Hochdruckreinigers in ihrer Hand, das sich fortsetzen würde, weit über diesen Moment hinaus in die geordneten Klänge des Abends. Während die Wassertropfen vor der schon recht westlich stehenden Sonne einen Miniaturregenbogen bildeten, malte sie kleine Kreise auf den fleckigen Terrassenboden … Hier ein Smiley, dort … Was immer es war, es machte Anna Spaß. Selbstvergessen verbrachte sie mehr Zeit mit der Reinigung der winzigen Dachterrasse, ihrem Refugium über der Stadt, als es im Entferntesten nötig gewesen wäre. Hätte sie jemand beobachtet bei dieser eigenwilligen Putzaktion, hätte der wohl gemeint, dass sie tief in ein sehr kompliziertes Gedankenkonstrukt versunken war. Doch im Gegenteil: Anna genoss es, gar nichts zu denken. Sie wollte nichts weiter, als mit der Vibration des Hochdruckreinigers sich selbst zu spüren.
Ohnehin würde sie gleich wieder in jene feinsinnige Welt eindringen müssen, die eigentlich die ihre war. Während andere sich dem Klang in seiner Flüchtigkeit hingaben, analysierte sie das Erlebnis mit ihrem geistigen Ohr, fragte sich, was das Wesentliche, das Besondere dieses Abends, dieser Aufführung war, um es am nächsten Tag kurz und prägnant in ansprechende Worte zu fassen, die bestenfalls ihren journalistisch-ästhetischen Eigenwert entfalteten.
Anna war gern die Musikkritikerin des »Täglichen Anzeigers«, der letzten verbliebenen großen Tageszeitung der Stadt, auch wenn sie sich ab und an nach der Chance und der damit verbundenen Anerkennung einer großen Geschichte sehnte – nach einer Enthüllungsstory, wie sie sich die Reporterkollegen aus den Ressorts »Politik« oder »Wirtschaft« durchaus erhoffen konnten. Selbst im Sport standen die Chancen größer, dort konnte man auf einen dubiosen Wettskandal oder wenigstens eine Dopingenthüllung stoßen. Doch in der Kultur und noch dazu in der Musik, besonders der klassischen – Annas Domäne –, konnte man bestenfalls schiefe Töne und wackelnde Metren anprangern. Zwar machte man sich damit nicht unbedingt Freunde, aber im Wesentlichen hatte man seine Ruhe – manchmal mehr als gut war. Doch auch das war im Prinzip okay für Anna. Nur heute irgendwie nicht. Es war der erste heiße Samstag des Jahres, und der Abend versprach lau und angenehm zu werden. Was gäbe es also Besseres, als auf der dann sauberen Terrasse zu sitzen und mit einem Glas Wein und einem Buch den unstrukturierten Klängen des Abends über Leipzig zu lauschen, zu erleben, wie das Klanggewaber der Südvorstadt allmählich abebbte, und anschließend in den Sonntag hineinzuschlafen?
Aber daraus wurde leider nichts – Anna musste ins Konzert, wie meistens. Sie liebte Musik, sonst hätte sie einen anderen Beruf ergriffen. Trotzdem – wie es war, sich ohne Zwang und aus freien Stücken auf ein Musikereignis vorzubereiten, hatte sie fast schon vergessen. Wenigstens war das, was sie heute erwartete, ein angenehmes und noch dazu überschaubares Programm: Brahms, Mozart und noch mal Brahms. Ein mehr als anständiger Streichquartettabend mit dem Kleistenes-Quartett – musikalische Philosophie, kein Lärm und keine Bravo-grölenden Klassikgroupies. Zwar keine Weltklasse, doch eines der besseren von hier. Kein Grund also, sich in der Pause wegzusehnen und jenen verzweifelt hinterherzuschauen, die sich die Jacke an der Garderobe holten und in die Nacht verschwanden – meist zu zweit.
Mit etwas Glück konnte sie um halb elf wieder zurück sein. Bestimmt wäre es auch dann noch nicht zu kalt für ein halbes Stündchen hier oben über der Stadt. Sie würde dann zwar bereits – das war ein Automatismus, der mit dem Beruf einherging – darüber grübeln, was sie am Morgen zu Papier, besser gesagt zu Bildschirm bringen konnte, aber dennoch hätte sie ein bisschen was von diesem lauen Samstagabend.
2
Der Wasserstrahl spritzte auf ihre nackten Füße. Sie hatte den kleinen Vorsprung getroffen, der einstmals den Schornsteinschacht verborgen hatte, als das Haus noch mit Kohle geheizt worden war. Schmerzhaft und erfrischend zugleich brannte das versprühte Wasser auf der nackten Haut. Stundenlang könnte Anna so weitermachen. Doch wenn sie jetzt nicht aufhörte, kam sie unweigerlich zu spät.
Die Reinigungsmaschine provisorisch beiseite geräumt – regnen würde es gewiss nicht –, die Treppe hinunter ins Dunkel der kleinen Wohnung. Sie wollte unbedingt eine Fußmatte vor die Terrassentür legen – ein Schwur, den sie jedes Mal nach derartigen Reinigungsaktionen leistete, wenn sie die feuchten Drecktapsen auf der hellen Holztreppe sah. Wieder konnte sie ein wahrhaft böses Ausrutschen gerade noch verhindern, das sie unweigerlich in den Wäschekorb hätte stürzen lassen. Aus diesem starrten sie jene Teile gnadenlos an, die sie seit mindestens einer Woche bügeln wollte. Anna hatte sich den Wäschekorb selbst in den Weg gestellt, um sich zu dieser verhassten Aktivität zu zwingen. Bisher ohne Erfolg. Es war lediglich eine neue Unfallquelle in der winzigen Dachgeschosswohnung entstanden, die sie der Terrasse wegen nicht aufgeben wollte. Eine weitere Gefahr für Leib und Leben.
Im Moment rief ihr der Wäschekorb aber ein ganz anderes Problem ins Bewusstsein: Was sollte sie anziehen? Nicht, dass sie nicht genug Kleider im Schrank hängen hatte. Allen Berufsklischees zum Trotz legte die Musikkritikerin Anna Schneider durchaus Wert auf ihr Äußeres. Doch man konnte nicht mit allem überall hingehen. Und gerade für heute hätte sie den schwarzen Leinenanzug gebraucht, der ganz oben auf dem Wäschekorb lag. Absolut logisch und auch alternativlos für das In-and-Out mit seinem Vintage-Mobiliar und den improvisierten Stuhlreihen, die sie unter der Hand als »versifft« beschreiben würde. Welcher Geisteskranke kam eigentlich auf die Idee, ein solches Programm in einem Club wie dem In-and-Out zu spielen? Akustisch daneben und unbequem. Dabei war die Veranstaltung Teil einer Abonnementreihe des Gewandhauses und hätte in den Kammermusiksaal, den Mendelssohnsaal, gehört, benannt nach einem der vielen Sockelheiligen dieser Musikstadt. Was manchmal in den Köpfen von Programmmachern vorging? Ärgerlich, aber nicht ärgerlich genug, um daraus die ersehnte Geschichte zu machen.
Langsam verflog bei Anna das letzte Fünkchen Lust auf den Konzertabend. Wenn sie den Anzug jetzt noch bügelte, wäre sie gnadenlos zu spät. Ausgeschlossen in ihrem Job und bei dem Programm. Keine Verhandlungsmasse mit dem Schrank … Mit dem beigen Kassettenkleid würde sie komplett overdressed sein im düsteren Ambiente des In-and-Out. Wenigstens widersprach das Material nicht ganz dem alternativen Charakter der Location. Sie blieb beim Leinen und wusste, dass sie die Entscheidung bereuen würde, während sie sich insgeheim eingestand, dass es keine wirkliche Entscheidungsmöglichkeit gab.
3
Nein, ein Kind der Club-Szene war Anna in der Tat nicht, auch wenn ihre Dachgeschosswohnung nicht weit entfernt lag von der »Karli«, der Szenemeile, die eigentlich Karl-Liebknecht-Straße hieß. Sprachaffin, wie sie von Berufs wegen sein musste, aber auch von jeher gewesen war, mochte sie die Marotte der Leipziger, bestimmte Orte mit dem Vornamen anzusprechen. Darin äußerte sich eine gewisse Zuneigung. Als sie vor 18 Jahren zum Studium hierhergekommen war, war ihr das schnell klar geworden. Man traf sich im Clara-Park zum Picknick. Damit bekam der Ort gleich etwas Vertrautes, Gemütliches wie das Picknick selbst. Manchmal fragte sie sich, ob es Ur-Leipziger gab, die gar nicht wussten, dass diese innerstädtische Grünoase Clara-Zetkin-Park hieß, geschweige denn, wer Clara Zetkin war. Anna hatte eine Weile gebraucht, um zu begreifen, dass diese Verkürzung offenbar keine politische Dimension hatte; denn zur August-Bebel-Straße gleich um die Ecke sagten sie artig »Bebelstraße«. Irgendwann war Anna klar geworden: Die Bebelstraße war einfach keine Kultstätte.
Jedenfalls schlängelte sie sich jetzt den Bürgersteig der »Karli« entlang und blickte etwas neidvoll auf die Menschen, die mit erfrischenden Getränken die Freisitze bevölkerten, während Anna gleich im stickigen Dunkel des In-and-Out verschwinden musste.
Unweigerlich spürte sie dem Widerhall des Bebens des Hochdruckreinigers in ihrem Körper nach, als sie in dem – ihrer Meinung nach – für ein seriöses Kammerkonzert unpassenden Clubsessel versank, damit unbewusst auf der Suche nach dem eben errungenen Gefühl von Sauberkeit auf der eigenen Terrasse. In letzter Minute vom Einlasspersonal in den erstaunlich gut gefüllten Club geschoben, war es dieser überdimensionierte Sessel in Türnähe, der ihr als Sitzgelegenheit blieb und der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit quietschte, wenn sie die kleinste Bewegung machte. Das gaben die lockeren Federn unter dem abgenutzten Samtbezug unweigerlich zu verstehen, die sich sofort mit Vehemenz in ihr Sitzfleisch bohrten. Keinesfalls die beste Voraussetzung für ungetrübten Musikgenuss.
Das Saal-, besser Clublicht war schon erloschen und ein paar wenige Spots richteten sich auf das Podium. Die vier Notenpulte nahmen sich absurd aus in diesem Club-Setting. Anna wäre gern dazu übergegangen, dem Ganzen etwas Positives abzugewinnen. Sie wollte als Kritikerin nicht als die Mäkeltante vom »Täglichen Anzeiger«rüberkommen und noch viel mehr wollte sie Spaß an ihrem Job haben. Doch heute war das wie verhext.
Während sie versuchte, sich möglichst geräuscharm auf dem viel zu tiefen Sessel zurechtzurücken, was voraussetzte, dass sie sich wenigstens in Ansätzen aus dem archaischen Sitzmöbel heraushievte, fasste sie in einer Mischung aus Zwangsläufigkeit und Ungeschick mit der Hand auf die hölzerne Armlehne. Ein kapitaler Fehler. Sie klebte … Nicht in dem Sinne, dass Anna – untrennbar mit der Lehne verbunden – im In-and-Out gefangen war, aber immerhin so, dass die Kontaktfläche ihrer Hand nun ebenfalls klebte. Anna wollte nicht darüber nachdenken, welcher Art die klebrige Substanz war, mit der sie kontaminiert war. Eines stand fest: Sie bräuchte ein Waschbecken und viel Seife, um das Problem zu lösen. Wenigstens garantierte ihr die Türnähe des Platzes, dass sie zur Pause als eine der Ersten in Richtung Toilette stürmen konnte. Bis dahin dauerte es aber noch rund eine Dreiviertelstunde.
Obschon das Konzert gerade begann, konnte Anna den Gedanken nicht aus ihrem Kopf vertreiben, was das Schmuddel-Sitzmonster mit dem – sie hatte es ja gewusst – unpassenden beigen Leinenkleid anrichten würde. Wenn sie sich jetzt nicht langsam konzentrierte, konnte sie genauso gut gleich gehen. Was sie natürlich nicht tat. Während sie sich sammelte und konsequent die Berührungsfläche zwischen sich und dem Sessel auf ein notwendiges Minimum beschränkt hielt, ging der erste Brahms an ihr vorüber.
Gar nicht so übel, zumindest das, was sie davon wahrgenommen hatte. Anständig. Das subjektive Unbehagen ob der Location würde sie routiniert aus ihrer Kritik heraushalten. Diese würde kein Meisterwerk sein, aber wer erwartete das schon bei einer solchen Veranstaltung. Das Ambiente war ohnehin nicht geeignet für die vollkommene musikalische Kontemplation.
Wenigstens hatte man die Bar im Saal geschlossen, was den Vorteil hatte, dass das Brummen der Bierkühlung wegfiel. Auf die schwerfällige Klimaanlage, die das fensterlose Gemäuer bestenfalls mit einem Mindestmaß an so etwas wie Frischluft versorgte, hatte man nicht verzichtet. Wahrscheinlich gingen die Veranstalter davon aus, dass man sich an das Summen mit der Zeit gewöhnte.
Jetzt Mozart. Mit ein bisschen Glück konnte Anna in der aktuellen Position bis zur Pause durchhalten und weiteren Kleberkontakt vermeiden. Einen Satz der »Kleinen Nachtmusik«hatte sie schon überstanden. Das Kleistenes-Quartett machte seine Sache immer noch ordentlich. Sie würde sich in ihrem Text mit Goethe und den vier vernünftigen Leuten, die ein Gespräch führen, aus der Affäre ziehen. Das funktionierte bei Streichquartetten beinahe immer.
Was war das? Anna traute ihren Ohren nicht. Ein Fauxpas, und das in diesem Stück, das jeder mitpfeifen konnte. Ein Fehler, den die Kritikerin nicht ignorieren konnte, falls sie am Montag noch ernst genommen werden wollte. Was genau tat der Bratscher Thorsten Steinmüller da? Solide – für Annas Geschmack etwas zu solide für ein relativ junges Ensemble – hatte sich das Kleistenes-Quartett durch den unvermeidlichen ersten Satz gearbeitet. Na ja, bei dieser Musik störte es niemanden, wenn die Darbietung allenfalls nett war. Aber das hier hatte mit nett nichts zu tun. Die wunderschöne Themenexposition des zweiten Satzes war durchgestanden. Doch in der Themenwiederholung, gerade da, wo die Bratsche inmitten des bis dahin dreistimmigen Satzes die seltene Chance zu sinnlicher Virtuosität erhält, setzte Steinmüller zwar korrekt ein und trillerte im richtigen Moment los, schien aber aus seinem Triller nicht mehr herauszufinden. Er trillerte noch in aller Gemütlichkeit, als die anderen gefühlt Takte voraus waren … Das war keine selbstverliebte Virtuosität … Es war absurd. Als würde der Bratscher in einer völlig anderen Zeitebene und Musiktradition verfangen sein, als steckte dieser in seinem Triller fest. Die »Kleine Nachtmusik«war schließlich kein spätes Beethoven-Quartett, sondern irgendwo im Übergang zwischen dem Streichquartett als Hausmusikform, die von versierten Amateuren zu bewältigen war, zum hoch expressiven, Professionalität fordernden Quartett der Romantik anzusiedeln. Für einen halbwegs routinierten Musiker kein Hexenwerk.
Anna war hellwach.
Steinmüller war kein Anfänger und erst recht kein Amateur. Er hatte bis vor Kurzem einen Lehrauftrag an der Musikhochschule innegehabt. Warum er den nicht mehr hatte? Weiß der Geier. Anna hatte sich darüber bisher keine Gedanken gemacht. Wohl kaum, weil er die Bratschenstimme der »Kleinen Nachtmusik«nicht mehr auf die Reihe bekam!
Die Spannung in der Luft des Clubs, die man ohnehin hätte schneiden können, war förmlich zu greifen. So empfand das zumindest Anna, die der latente Kneipengeruch seit Betreten des Raumes nervte.
Peinlich berührt starrte der Cellist Christoph Weinmann den Kollegen an und spielte dabei ostentativ die eigene Stimme, als wäre es ein Reinigungsritual. Der zweite Geiger Sebastian Mönkeberg hingegen war das personifizierte Entsetzen. Anna war fasziniert, wie angesichts der Mischung aus Verwirrung und Verzweiflung die Finger des Musikers dennoch jene Stellen auf den Saiten fanden, die Mozart sich vorgestellt hatte. Unweigerlich fragte sich die Kritikerin, wie weit man diese Abläufe mechanisieren konnte. Dass die Primaria des Quartetts, Theresa Steinmüller, Schwester des Übeltäters, mit einer stoischen Ruhe nicht nur das zusammenhielt, was noch zusammenzuhalten war, sondern ihrem Mienenspiel nichts anmerken ließ, hatte etwas Erschreckendes.
Anna hatte in einer Mischung aus Faszination, Resignation und Entsetzen die Abwehrhaltung gegen den Sessel aufgegeben und war, während die vier sich ein wenig angestrengt, aber in einem geordneten Miteinander dem Ende des Werkes und damit der Konzertpause näherten, tief in den Sessel hineingerutscht. Inzwischen war sie der Überzeugung, dass sie neben Seife auch unbedingt eine Erfrischung benötigte, und schwankte gedanklich zwischen Wasser, Wein und dem für sie dekadentesten aller Getränke – Cola. Bei ihrem heutigen Glück konnte sie fast sicher sein, dass der Wein in diesem In-and-Out wahlweise von minderer Qualität oder schlecht temperiert sein würde, höchstwahrscheinlich beides. Außerdem brauchte sie einen klaren Kopf, gerade in diesem absurden Konzert. Cola war der Inbegriff der Verführung, dem sie sich angewöhnt hatte zu widerstehen, weil das die Vernunft gebot. Angesichts des Zuckergehalts. Und überhaupt … Die Vernunft war auch jetzt noch auf dem Vormarsch. Also: Wasser.
Gemäßigter Applaus. Die Kleistenes-Musiker retteten sich von der Bühne. Der Beifall rechtfertigte nicht die Rückkehr für eine weitere Verbeugung. Anna verschwand zielstrebig Richtung Wasser und Seife. Das Erste, was ihr an diesem Tag auf Anhieb gelang.
Wahrscheinlich wäre es ratsam gewesen, eine Brise Luft vor der Club-Tür zu schnappen. Doch die gab es dort ohnehin nicht, weil sich die gefühlt 90 Prozent Raucher um die drei Aschenbecher scharten. Ein Blick zum Ausgang bestätigte das.
Oben im zweiten Saal begann eine andere Veranstaltung, wie die dröhnenden Bässe aus der noch offenen Tür vermuten ließen. Hoffentlich untermalten die nicht den verbleibenden Brahms …
Eine Person im dunklen Kapuzenpulli drängte sich an Anna vorbei – unhöflich, rempelte sie beinahe an, schwang sich die kleine Wendeltreppe empor und verschwand in der Tür, die vermutlich zur Regie führte. Wahrscheinlich ein Techniker, denn nun schloss sich die obere Saaltür. Anna beeilte sich, um an der Theke noch ein Wasser zu ergattern. Sie hatte den festen Vorsatz, aus diesem Abend das Beste zu machen. Schließlich war es nicht allzu spät, draußen schien noch immer die Sonne. Die Terrasse wartete; und bisher sah es nicht so aus, als würde jemand gesteigertes Interesse daran haben, den Kleistenes-Abend mit unnötigen Zugaben zu verlängern.
Die Schlange vor Anna wurde kürzer. Der Barmann kam in Sicht, eigentlich eher ein Barjunge, aber das sagte man wohl nicht. Zuversicht auf der ganzen Linie. Da spürte sie es – zunächst am Hals, dann auf dem Dekolleté. In der Tat spürte sie zuerst die Flüssigkeit an sich herunterlaufen, bevor sie das Unglück sah geschweige denn realisierte, was genau passiert war.
Vor ihr stand ein entsetzt dreinblickender Mensch – gar nicht so unattraktiv, abgesehen von dem schreiend bunten Oberhemd, das er in die schwarze Jeans gesteckt hatte. Äußerst akkurat, dennoch verbarg es die athletische Statur keinesfalls. Trotzdem wirkte der Lockenkopf unbeholfen – charmant unbeholfen, aber unbeholfen. Und er hatte ein leeres Weinglas in der Hand. Die Bar im Rücken … Das Weinglas in der Hand leer … Er redete schnell und intensiv auf Anna ein.
Als er bei »Natürlich werde ich für die Reinigung aufkommen« angelangt war, wurde Anna allmählich klar, dass dieses maskuline Riesenbaby ihr von oben nach unten ein komplettes Rotweinglas aufs beige Leinenkleid gegossen hatte. Hätte es noch irgendeinen Zweifel daran gegeben, dass dies nicht Anna Schneiders Tag war, jetzt wäre er ausgeräumt.
»Darf ich mich zunächst mit einem Drink revanchieren?«
Er hatte wirklich »Drink« gesagt – wahrscheinlich einer von der ganz coolen Sorte. Anna hatte ihre Sprache noch nicht wiedergefunden, zumal ihr der Rotwein vom Hals bis mindestens zum Nabel triefte. Was in ein einziges Glas hineinpasste … Anna trat hinter dem sehr bemühten Mann an die Theke. Als dieser sie freundlich einlud, zu bestellen, »was immer sie möge«, sagte sie ausgerechnet: »Eine Cola, bitte!« Das hatte sie sich verdient.
Beide hielten sie nun ein Cola-Glas in der Hand, als Mister Tollpatsch ihr freudig – weil sie die Einladung angenommen und nicht um Hilfe geschrien hatte – die Hand entgegenstreckte und sagte: »Habakuk, Habakuk C. Brausewind.«
Wie bitte, wollte Anna fragen, musste aber derart an sich halten, um nicht loszusprudeln, dass sie wieder keinen Ton herausbrachte. Wie müssen dich deine Eltern gehasst haben, schoss es ihr durch den Kopf.
Da fügte er strahlend hinzu: »Sie können aber Heinz sagen.«
Das war endgültig zu viel für Anna Schneider an diesem Tag. Sie brach in schallendes Gelächter aus, streckte ihm die Hand entgegen und erwiderte: »Anna, Anna Schneider.«
Ihr Gegenüber starrte sie ungläubig an. »Die Anna Schneider? Anna Schneider vom ›Täglichen Anzeiger‹?«,stotterte er.
Um Gottes Willen, was war das denn? Es passierte Anna nicht allzu oft, dass sie als die Kritikerin enttarnt wurde. In der Hoffnung, dass sich alles ordnen würde, nippte sie verlegen an der Cola, während dieser Habakuk-Heinz-wer-auch-immer seiner Bewunderung für ihr kritisches Ohr und ihren Scharfsinn und Wortwitz Ausdruck verlieh. Ob sie heute etwa auch beruflich hier sei?
Eigentlich war ihr Gesprächspartner ganz witzig. Wäre Anna ihm in einer anderen Situation begegnet, hätte sie ihn wahrscheinlich unterhaltsam gefunden, Spaß an der Konversation gehabt. Warum sollte sie also das Offensichtliche verneinen? Am Montag würde es sich eh aufklären, falls sie jemals eine Konzertkritik über diesen vermaledeiten Abend zustande brachte.
Er sei in gewisser Weise ebenfalls beruflich hier. Nicht, dass sie Kollegen wären, aber heute sei auch sein kritisches Ohr gefragt.
Was sollte das jetzt werden? Habakuk nervte, dabei hatte er einen Unterhaltungswert, der der verwirrten Anna guttat.
Sie habe auch über ihn schon häufiger geschrieben. Nicht namentlich natürlich. Nein, in Form des Gewandhausorchesters. Er sei dort Bratscher.
Dass sie nicht erneut in schallendes Gelächter ausbrach, grenzte an ein Wunder. Ein Bratscher hatte ihr gerade das schönste und empfindlichste Kleid, das sie besaß, komplett mit Rotwein versaut; ausgerechnet ein Mitglied jener Instrumentengruppe, über deren Tollpatschigkeit und Unvermögen es die mit Abstand meisten Witze gab. Diese Witze musste man sich nicht einmal hinter vorgehaltener Hand erzählen. Ein Bratscher, der von sich behauptete, Habakuk C. Brausewind zu heißen. Sie würde morgen überprüfen, ob das Jahresprogramm des Gewandhausorchesters in der Bratschengruppe tatsächlich diesen Namen auswies. Was es bedeutete, wenn das nicht der Fall war, wollte sie dann entscheiden. Für den Moment taten ihr Habakuks warme Augen und sein arglos leidenschaftliches Geplapper über Musik einfach gut.
Was seine berufliche Aufgabe heute war, konnte er nicht mehr erklären, denn die Konzertpause war, zwar reichlich spät, aber nun endgültig beendet. Trotz des an sich kurzen Programms wurde es außerdem langsam knapp für den Wein auf der Terrasse. So warm waren die Nächte noch nicht. Und sie müsste sich erst einmal vollständig umziehen, was sie am allerliebsten auf der Stelle täte.
Wieder überstürzt, aber dieses Mal selbst komplett verschmutzt, sank Anna in ihren Club-Sessel. Saal dunkel, Spot auf die kleine Bühne. Das Licht flackerte ein wenig. Hoffentlich würde ab jetzt alles gut gehen; schließlich wollte sie nicht die ganze Nacht im In-and-Out verbringen.
4
Inzwischen machte es für Anna auch keinen Sinn mehr, der Vibration des Hochdruckreinigers nachzuspüren. Sie konnte sich nicht erinnern, wann sie das letzte Mal so durch den Wind gewesen war, oder besser, dass sie jemals zuvor so durch den Wind gewesen war. Klebrigkeit, das Mozart-Debakel und dann Ha-ba-kuk und der Rotwein auf ihrem Kleid – das waren deutlich mehr außergewöhnliche Vorfälle als üblich in ihrem Job.
Der Spot flackerte noch immer. Anna stellte sich die Frage, ob das bei LEDs überhaupt möglich war und ob ein moderner Scheinwerfer noch ohne LEDs funktionierte.
Im Saal verdichtete sich die Anspannung spürbar, ein untrügliches Zeichen, dass die Musiker des Kleistenes-Quartetts im Anmarsch auf die Bühne waren. Mit Anna hatten sie gemein, dass dieser Samstag auch nicht ihr Tag war. Der Bratscher Thorsten Steinmüller hatte es tatsächlich fertig gebracht, in der »Kleinen Nachtmusik«den Faden zu verlieren. Ein lebendiger Bratscherwitz. Anna stellte amüsiert fest, dass dieser Tag so etwas wie ein Tag der Bratscher war: erst der Fauxpas Steinmüllers, dann die nasse Begegnung mit Habakuk C. Brausewind. Ein schräger Zufall, denn die Zahl der Bratscher, mit denen man es in ihrem Job zu tun bekam, war denkbar gering, verglichen mit Pianisten, Geigern, Bläsern oder gar Komponisten. Ironie des Schicksals! Aber folgte man dem Klischee, so musste man sich sagen: Kein anderer Musikertyp wäre besser geeignet gewesen, ihr das Kleid und die »Kleine Nachtmusik«zu versauen.
Anna Schneider schämte sich für diesen Gedanken und bezichtigte sich eines musikalischen Chauvinismus, der jemandem wie ihr nicht gut zu Gesicht stand. Als Journalistin war sie verpflichtet, vorurteilsfrei zu Werke zu gehen, was besonders schwer war, wenn man einen Komponisten oder ein ganzes Genre oder den Klang eines bestimmten Instruments nicht mochte. Wie sollte man da offen und ohne betrübliche Vorahnungen ins Konzert gehen? Den Klang der Bratsche jedoch mochte Anna, genau wie Mozart und Brahms. Also konnte der Abend durchaus noch eine positive Wendung nehmen.
Wie die Umsitzenden wusste Anna, was sich gehört: Sie applaudierte den Quartettspielern artig, die sich in einer bemerkenswerten Umständlichkeit miteinander, nebeneinander und aneinander vorbei an ihre Plätze manövrierten. Anna ertappte sich bei dem Gedanken, dass das im Mendelssohnsaal weniger umständlich gewesen wäre. Warum bitteschön mussten jetzt alle noch einmal an Stühlen und Notenpulten herumruckeln? Na endlich …
Anna würde heute mit Sicherheit nicht mehr in den Rang eines Zen-Meisters erhoben werden. Sie hoffte, dass ihre Geduld ausreichte, um den Konzertabend verhaltensunauffällig zu absolvieren.
Doch irgendjemand wollte das anscheinend verhindern. Welcher Geisteskranke war auf die Idee verfallen, einen albernen Drehscheinwerfer – so bezeichnete das Unterbewusstsein der Musikexpertin die angesagten Moving Lights des Clubs – lustig übers Publikum kreisen zu lassen, als säße Kleistenes unter einem Leuchtturm und die Zuhörer wären der wogende Ozean? Wenigstens war Brahms Norddeutscher und hatte Leuchttürme gekannt. Innerlich schüttelte Anna den Kopf über das In-and-Out. Auf wessen Mist sollte sonst so ein Schwachsinn gewachsen sein? Nichts anderes war das in ihren Augen. Obendrein verursachte das Teil, während es sich bewegte, unüberhörbare Geräusche.
Anna versuchte, keine weiteren Gedanken darauf zu verschwenden, denn angesichts von etwa 70 Druckzeilen, die ihr für ihre – wohlgemerkt musikalischen – Erkenntnisse zur Verfügung standen, wäre es ungebührlich, über das Licht zu schreiben. Hätte sie bloß eine Sonnenbrille dabei – das wäre im versauten Kleid auch egal …
Jetzt hoben die vier gemeinsam den Bogen als Zeichen des Beginns. Gleich würden sie diesen auf die Saiten setzen, um die dicke Luft des In-and-Out mithilfe von Schallwellen umzuschaufeln. Doch dazu kam es nicht.
Es gab einen Riesenschlag, einen wie er in klassischen Konzerten nicht vorkommen sollte. Anna konnte nicht sagen, ob es zuerst rumste oder das Licht ausging oder die allgemeine Panik, das jämmerliche Geschrei aller Anwesenden einsetzte. Das hatte vermutlich auch damit zu tun, dass sie noch immer nicht auf ihre eigentliche Aufgabe konzentriert war und sich, als es passierte, gerade fragte, aus welchem Grund dieser alberne Drehscheinwerfer nun auch noch so unelegant schaukelte. Wahrscheinlich wurde Anna allmählich paranoid, was heute kein Wunder mehr wäre.
Dass der Scheinwerfer sich nach dem Schaukeln aus seiner Befestigung löste und zur Ursache des allgemeinen Drunter-und-Drübers wurde, sah sie genauso wenig wie alle anderen. Denn mit dem Sturz des Scheinwerfers ging das Licht aus.
5
»Aaaaaahhhhhh!!« – »Ein Arzt! Ist hier ein Arzt??« – »Polizei!« – »Hilfe!!!«
Angesichts dessen, was jetzt geschah, erwies es sich als keine gute Idee, das Saallicht wieder einzuschalten. Der Anblick, der sich auf dem Konzertpodium bot, war auch für Hartgesottene nicht leicht zu ertragen, schien einem Horrorfilm entsprungen. Nicht nur, dass die Bratsche von Thorsten Steinmüller zu Kleinholz gemacht worden war, der Musiker selbst hatte den besagten Scheinwerfer mit einer so beachtlichen Wucht und Präzision auf seinen Kopf bekommen, dass es diesen wie einen Nagel in den Steinmüller’schen Rumpf geschlagen hatte und der Markenscheinwerfer der Firma Bero mit Logo jetzt an Kopfes Stelle zwischen den Schultern ruhte.
Wie eingefroren saßen die drei übrigen Musiker um das Opfer, während das Personal vom In-and-Out mit bemerkenswerter Effizienz eine Massenpanik verhinderte. Anna beobachtete die Szene wie durch eine Glocke und stellte fest, wie gut es war, dass der Scheinwerfer nicht mehr leuchtete, wobei sie sich die Absurdität der Szene vorstellte. Sie sah, dass erstaunlich wenig Blut im Spiel war, wohl, weil der Scheinwerfer wie eine Art Stöpsel oben auf Steinmüller saß. Steinmüller wiederum hatte – wenn auch etwas lasch – ebenfalls die Sitzposition beibehalten.
»Bitte bewahren Sie Ruhe und bleiben Sie auf Ihren Plätzen, ein Notarzt ist schon unterwegs!«
Als ob der noch etwas ausrichten könnte! Anna wunderte sich selbst über ihren kaltschnäuzigen Hintergedanken und schüttelte den Kopf, froh, dass sie das mit dem eigenen noch tun konnte.
Ein schrulliges spitzbärtiges Männchen sprang um den reglosen Steinmüller herum. Es hatte sich sofort bei dem Ruf nach einem Arzt mühselig, aber durchaus effizient durch die viel zu engen Sitzgelegenheitsreihen gequetscht. Man hatte für das Konzert nicht nur Stühle, sondern auch Sessel, Hocker und Sofas – Markenzeichen des In-and-Out – herangeschleppt. Das Männchen, offenbar Arzt, zählte zu den ebenfalls unpassend gekleideten Klassikfreaks – der Smoking wäre sogar für den Mendelssohnsaal zu dick aufgetragen gewesen. Besonders damit errang der bemühte Ersthelfer jedoch Annas unterbewusste Sympathien.
Das Männchen schüttelte den Kopf, nachdem es den Bratscher mehrere Male umrundet und am herabhängenden Bratscherarm keinen Puls mehr gefühlt hatte.
Den Notarzt brauchte eher Sebastian Mönkeberg. Der zweite Geiger war aus seiner Schockstarre direkt in eine Ohnmacht gefallen und wurde in bemerkenswerter Routine und Eile von den mittlerweile eingetroffenen Rettungskräften fortgetragen, zumindest verschwand er recht schnell aus dem Sichtfeld. Überhaupt ging man jetzt dazu über, die grausige Szenerie vor den Augen der Betrachter zu verbergen.
Mit den Rettungssanitätern war auch eine beachtliche Zahl an Polizisten in den Saal gekommen. Diese forderten abermals auf, Ruhe zu bewahren und auf den Plätzen zu bleiben.
Anna klebte im wahrsten Wortsinne in ihrem Sessel und ging zu etwas über, das sie so gut wie nie tat: Sie dachte gar nichts mehr. Nicht, dass sie nicht mehr in der Lage gewesen wäre, einen Gedanken zu fassen, vielmehr war es eine bewusste Entscheidung angesichts der bizarren Ereignisse, denen Anna an diesem Abend ausgeliefert war. Außerdem wäre sie ansonsten unwillkürlich in einen Modus verfallen, in dem die Journalistin bereits an Formulierungen und sprachlichen Bildern gefeilt hätte. Sollte sie in der Redaktion anrufen, um zu sagen, dass sich hier im In-and-Out ein spektakuläres Unglück ereignet hatte? Wahrscheinlich schon, mit Sicherheit sogar. Doch erstens wusste Anna Schneider aus einschlägigen Erfahrungen in diesem Club, dass sie hier keinen Handy-Empfang hatte, und zweitens war sie von Ordnungskräften ausdrücklich dazu aufgefordert worden, auf ihrem Platz zu bleiben – journalistischer Auftrag hin oder her. Jetzt war es ohnehin zu spät, der Polizeifunk dürfte längst seine Schuldigkeit getan haben. Den hörten die Kollegen im Lokalen mit großer Begeisterung ab, obwohl das illegal war. Die offensichtlich maroden Sicherheitsvorkehrungen im angesagten In-and-Out waren eindeutig ein Thema fürs Lokale. Im Lokalen wollte Anna auf keinen Fall landen. Da war ihr der intellektuelle Anspruch des weit weniger rezipierten Kulturteils lieber, auch wenn sie sich regelmäßig darüber aufregte, dass es genau an diesem Anspruch fehlte.
Anna hatte ihre Nicht-denk-Haltung also längst aufgegeben, um für sich einfallsreich zu rechtfertigen, warum sie die Redaktion nicht ins Bild gesetzt hatte. In dem Moment erklomm ein ansprechend unauffällig gekleideter, attraktiver Mittdreißiger die halb verdeckte Szene und richtete das Wort an die allmählich etwas enervierten Besucher.
Er sei Kriminalhauptkommissar Schmiedinger und bitte alle, so lange im In-and-Out zu bleiben, bis die Kollegen in Uniform die Personalien zum Zwecke etwaiger Zeugenbefragungen erfasst haben. Man möge ihnen gleich einige Fragen beantworten, das sei wichtig bei einem so dramatischen Unglücksfall, weil jetzt die Eindrücke noch frisch und unverfälscht seien.





























