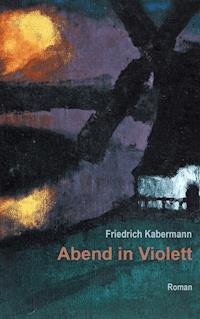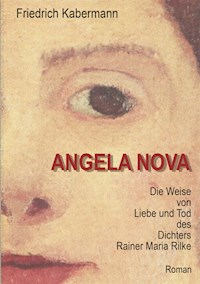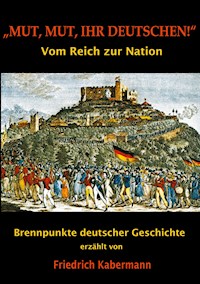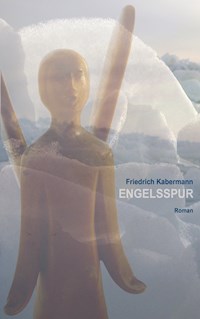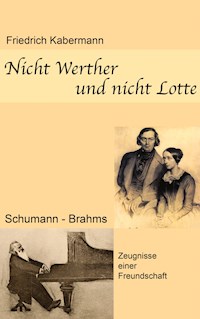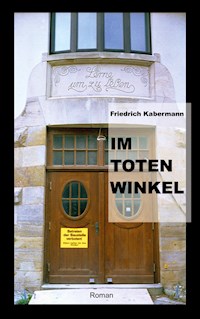Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Nachdem Aline Bussmann den Brief gelesen hatte, legte sie ihn beiseite. Er war vom 24. Oktober 1967 datiert und enthielt die Frage einer jungen Historikerin nach Lebenszeugnissen von Gorch Fock. Seit dessen 50. Todestag wurde Aline immer wieder mit derartigen Anliegen konfrontiert., als wäre sie Gorch Focks Nachlassverwalterin. Sie war als junges Mädchen mit dem Dichter befreundet gewesen, vier reiche Jahre, die zugleich auch Schatten über ihr Leben geworfen hatten. Inzwischen ist ein halbes Jahr vergangen, und der Brief liegt noch immer unbeantwortet auf dem Schreibtisch. Aline Bussmann ist beinahe achtzig und blickt auf ein bewegtes Leben zurück. Lange war sie am Hamburger Ohnsorg-Theater die beliebteste Schauspielerin gewesen und als Grande Dame der hanseatischen Kulturszene eine Institution. Begonnen hatte ihre Karriere vor fünfundfünfzig Jahren, in jener Zeit war sie auch Jan Kinau zum ersten Mal begegnet, alias Gorch Fock. Dessen Roman "Seefahrt ist not" war gerade erschienen und hatte seinen Verfasser über Nacht berühmt gemacht. Mit ihm konnte sie über ihre Träume sprechen, so über den wichtigsten vom "Jahrhundert der Frau". In den letzten Jahren hatte sie sich öfter gefragt, ob sie nicht Gorch Focks Briefe publizieren sollte. Die meisten davon waren Liebesbriefe - gehörten auch sie der Öffentlichkeit? Aline Bussmann entschließt sich, der jungen Historikerein endlich zu antworten, und zwar so, dass sie nicht nur über Gorch Fock berichtet, sondern über ihr Leben insgesamt. Doch aus der Niederschrift wird unversehens ein "Nachruf für Jan", der Aline Bussmann überrascht. Sie steht am Ende ihres Lebens - reicht ihre Kraft für den Briefband noch aus? Gern hätte sie dem Freund das Kompliment zurückgegeben, das er ihr einst in seinem ersten Brief gemacht hatte: "Da steht ein Mensch". Was aber ist ein Mensch? "Manche werden posthum geboren, andere sterben ihr Leben lang", so der Anfang des Berichts und, wie es scheint, auch der Schluss. Doch der Schein trügt. Hatte Aline Bussmann zunächst nur das eigene Ich im Blick gehabt, nimmt sie am Ende auch das Ganz Andere wahr, das sich ihr im Ringen um das Du erschließt - der letzte Vorhang wird transparent.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 141
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Nachdem Aline Bußmann den Brief gelesen hatte, legte sie ihn beiseite. Er war vom 24. Oktober 1967 datiert und enthielt die Frage einer jungen Historikerin nach Lebenszeugnissen von Gorch Fock. Seit dessen 50. Todestag wurde Aline immer wieder mit derartigen Anliegen konfrontiert, als wäre sie Gorch Focks Nachlassverwalterin. Sie war als junges Mädchen mit dem Dichter befreundet gewesen, vier reiche Jahre, die zugleich auch Schatten über ihr Leben geworfen hatten.
Inzwischen ist ein halbes Jahr vergangen, und der Brief liegt noch immer unbeantwortet auf dem Schreibtisch. Aline Bußmann ist beinahe achtzig und blickt auf ein bewegtes Leben zurück. Lange war sie am Hamburger Ohnsorg-Theater die beliebteste Schauspielerin gewesen und als Grande Dame der hanseatischen Kulturszene eine Institution.
Begonnen hatte ihre Karriere vor fünfundfünfzig Jahren. In jener Zeit war sie auch Jan Kinau zum ersten Mal begegnet, alias Gorch Fock. Dessen Roman „Seefahrt ist not“ war gerade erschienen und hatte seinen Verfasser über Nacht berühmt gemacht. Mit ihm konnte sie über ihre Träume sprechen, so über den wichtigsten vom „Jahrhundert der Frau“. In den letzten Jahren hatte sie sich öfter gefragt, ob sie nicht Gorch Focks Briefe publizieren sollte. Die meisten davon waren Liebesbriefe – gehörten auch sie der Öffentlichkeit?
Aline Bußmann entschließt sich, der jungen Historikerin endlich zu antworten, und zwar so, dass sie nicht nur über Gorch Fock berichtet, sondern über ihr Leben insgesamt. Doch aus der Niederschrift wird unversehens ein „Nachruf für Jan“, der Aline Bußmann überrascht. Sie steht am Ende ihres Lebens – reicht ihre Kraft für den Briefband noch aus? Gern hätte sie dem Freund das Kompliment zurückgegeben, das er ihr einst in seinem ersten Brief gemacht hatte: „Da steht ein Mensch“.
Was aber ist ein Mensch? „Manche werden posthum geboren, andere sterben ihr Leben lang“, so der Anfang des Berichts und, wie es scheint, auch der Schluss. Doch der Schein trügt. Hatte Aline Bußmann zunächst nur das eigene Ich im Blick gehabt, nimmt sie am Ende auch das Ganz Andere wahr, das sich ihr im Ringen um das Du erschließt – der letzte Vorhang wird transparent.
Für Renate H.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
I.
Manche werden posthum geboren, andere sterben ihr Leben lang. Ich gehörte nicht zum Überfluss meiner Zeit, durch mich erschien kein neues Licht in der Welt. Im Grunde war ich ein unglücklicher Mensch, vielleicht deshalb, weil ich glaubte, dass sich das Leben im Tod verneint.
So existierte ich dreißig Jahre wie in mich selbst verpuppt, richtig zur Welt kam ich erst nach Ende des Kaiserreichs. Damals war meine Mutter schon lange tot, doch nahm ich es ihr noch immer übel, dass ich von ihr geboren worden war. Eigentlich wollte ich nicht da sein, mich interessierte das Welttheater nicht. Auch fühlte ich mich gespalten, mitunter doppelt oder halb, dann wieder gar nicht, als wäre meine Seele taub. War ich krank auf die Welt gekommen, vielleicht schizophren?
Schon mein Name machte mich unsicher, ich wusste nicht, welcher denn galt. Mein Vater nannte mich Eva, die Mutter Ariane, mir selbst sagte Aline am meisten zu. Der Grund war, dass ich niemanden kannte, der außer mir noch so hieß. Daher sollte Aline mein Künstlername sein, das beschloss ich als zehnjähriges Kind. Damals träumte ich davon, als Stern am Bühnenhimmel zu glänzen, mein Name sollte unsterblich sein.
Wenn ich sagte, dass ich mit dreißig erst geboren wurde, geht es nicht um das Dasein, sondern um das Bewusstsein, das Wissen um sich selbst. Fünfundzwanzig Jahre hatte ich nach mir gesucht und nichts Authentisches entdeckt. Wie sollte ich auch, da ich nicht wusste, wem die Suche denn galt? Natürlich mir, sagte ich mir, suchst du nicht dich? Aber das war das Problem: Ich wollte nicht Ich sein, ich wollte überhaupt nicht sein. Ich nahm es den Eltern übel, dass sie mich vergewaltigt, mich mit Gewalt auf die Welt gebracht hatten. Ich war sicher, dass sie bei der Zeugung nur an sich gedacht hatten. War überhaupt Liebe im Spiel gewesen oder wenigstens Lust? Wie dem auch sei, gefragt worden war ich nicht, ob ich die Bühne des Lebens betreten wollte. Lange war ich davon überzeugt, dass ich die Frage mit Nein beantwortet hätte: Nichtsein war besser als Sein.
In alldem war ich keine Ausnahme, das war mir klar. Niemand wurde vor seinem Leben gefragt, ob er es haben wollte – genau das fand ich unerhört! Die meisten wollten natürlich leben, wenn sie gemerkt hatten, dass sie lebten, nicht aber ich. Als mir zum ersten Mal bewusst wurde, dass ich atmete, hatte eben die Schule begonnen. Da zog ich mir die Bettdecke über den Kopf und hielt den Atem an, bis ich Sterne sah. Gleich platzt dir der Kopf, dachte ich erleichtert, und du bist tot, dann ist alles wieder wie vor der Geburt.
Aber er platzte nicht, ich musste leben und mich damit abfinden, irgendwann erwachsen zu sein. Von den dreißig Jahren bis zur eigentlichen Geburt war ich fünfundzwanzig Jahre auf der Suche nach mir. Das weiß ich deshalb so genau, weil kurz nach meinem fünften Geburtstag der Vater starb und damit die Suche nach mir begann. Der Vater war tot und blieb tot – das war ein Ereignis, das ich nicht verstand. Bis dahin hatte ich wie ein Schmetterling gelebt, ich taumelte lichttrunken durch den Tag. Und das hatte am Vater gelegen, er war das Leben, er war Sicherheit und Halt. Auch kam er mir ungeheuer groß vor in der dunkelblauen Marineuniform.
Die Mutter kannte ich nur kränkelnd, blass schlich sie durch den halbdunklen Flur, der mit dicken Teppichen ausgelegt war. In der staubigen Luft versickerte das Tageslicht, und die Geräusche des Alltags erstarben im verblichenen Plüsch. Oft nahm ich die Mutter nur als Schemen wahr, sie wandelte als weißer Schatten durch den Tag. Manchmal saß sie Stunden am Fenster des Salons und starrte in die fahle Dämmerung. Nie sah ich sie arbeiten, die häuslichen Pflichten erledigte das Personal.
Dass ich nicht Ich sagen wollte, lag am Vater, nicht an ihr. Der Vater war mehr als ich, als jedes Ich, er war das Du, das Er, Sie, Es, das Wir. Er trug mich auf dem Arm durch die Wohnung, durch den Garten, dabei sang er leise vor sich hin – das ist die erste glückliche Erinnerung. Ich sehe uns Vorhänge von lichtem Grün durchschreiten, Wogen von Fliederduft kommen auf uns zu, Goldregen tropft durchs dunkle Geäst; im Hintergrund schäumen Azaleen auf. Ich fühle mich sicher in seinem Arm, an der Backe kitzelt der Schnurrbart, den er wie der junge Kaiser trägt. Der Vater ist sehr nah, ich höre ihn atmen, was er sieht, sehe auch ich, wenngleich der Sinn ein anderer ist. In der Erinnerung gleicht das, was ich sehe, dem Blick durch ein Kaleidoskop. Die Einzelheiten ändern sich, nichts bleibt wie es ist, bei jeder Drehung ergibt sich ein anderes Bild. Aus dieser Zeit rührt das Gefühl, dass Farben schwindlig machen können vor Glück.
So geht es mir inzwischen mit dem Rückblick überhaupt. Der Zusammenhang ist nicht vorgegeben, im Grunde stiftet er sich erst jetzt. Der lange Blick der späten Jahre verjüngt sich in der gedehnten Zeit. Noch nach fünfundsiebzig Jahren spüre ich die Wärme des Vaters und mit ihr die Sicherheit einer durch ihn erschlossenen Welt. Wenn ich müde war, neigte ich mich zur Seite und ruhte wie versunken an seinem Hals. Auch zwischen Schlafen und Wachen verließ mich das Gefühl der Sicherheit nicht. Vom Getragenwerden, vom Abgrund unter mir, nahm ich nichts wahr, Höhen und Tiefen waren einerlei. Der Vater trug mich, ich war geborgen, die Gefahren, das Böse waren durch ihn gebannt. Die Zeit konnte an sich halten mit ihrem Kommen und Gehen, sie erscheint mir heute wie ein einziger Augenblick. Damals muss ich glücklich gewesen sein, ich brauchte mich nicht zu suchen. Der Vater war da und ich war da – noch hatte ich nichts verloren in der Welt.
Ich will nicht verheimlichen, dass trotz alledem eines der frühsten Erlebnisse von Angst begleitet war. Ich ritt auf den Schultern des Vaters, da hob er mich über den Kopf und setzte mich auf dem Kleiderschrank ab. Zum ersten Mal stand er unter mir, ich blickte auf ihn herab. Ich sah seine Hände, die Arme waren geöffnet, er rief mir zu: Komm, Evchen, komm! Ich zögerte und wollte weinen, aus der Höhe drohte die Tiefe als schwarzer Abgrund herauf; er schien bodenlos zu sein. Aber da war der Vater, die Stimme, sein Ruf – ich schloss die Augen und ließ mich fallen, ich stürzte in die Tiefe, ein endloser Augenblick.
Aber dann spürte ich seine Hände, ein sicherer Griff fing mich auf. Der Bann war gebrochen, von nun an ließ ich mich lachend fallen, die Tiefe hatte ihre Schrecken eingebüßt. Auch später war mir in abgründigen Zeiten, wenn ich vor Schwindel die Augen schloss, als ob mir der Vater unter die Arme griff. Aber da kam kein Jubel mehr auf, der Vater war tot und mit ihm das Ordnungsgefüge der alten Zeit. Die neue Welt hatten wir Jungen zu verantworten, und da war kein Halt, kein Halten mehr.
Doch ich will noch bei der Zeit der Morgenröte verweilen, in der mir die Welt jung und voller Hoffnung erschien. Mir ist, als wäre der Vater immer um mich gewesen, obwohl er als Marineoffizier oft nach Kiel oder Wilhelmshaven fuhr, manchmal auch zum Stab nach Berlin. Das zeigt, wie gegenwärtig er selbst in der Abwesenheit war, meine Welt hatte sich aufgeladen mit seiner Präsenz. Manchmal hob er mich am Abend noch einmal aus dem Bett und raunte mir zu: Komm, Evchen, komm! Dann ging er mit mir zum Balkon und zeigte auf den Mond, der voll oder halb, mitunter als Sichel zwischen den Pappeln stand. Die Erde war tief, wie ohne Grund, und der Himmel unendlich weit. Doch die Tiefen und Weiten ängstigten mich nicht, der Vater war da, er trug mich ins Bett und deckte mich zu. So schlief ich ein mit dem sicheren Gefühl, dass es nichts zwischen Himmel und Erde gab, das sich der Macht des Vaters entzog.
Nahm er mich mit auf einen Gang in die Stadt, trug er die kaiserliche Uniform – für mich war er der Kaiser selbst. Er wurde von den Passanten mit Achtung gegrüßt, so dass ich glaubte, er verfüge über große Macht. Sagte ich des Abends das Nachtgebet auf, nahm er sich im Dämmern wie übermenschlich aus. Die Konturen verschwammen, Wände und Decke taten sich auf, der Vater stieß mit dem Kopf ans Himmelszelt. In solchen Augenblicken war ich überzeugt, dass der Vater Gott-Vater war, jener Vater-Gott, zu dem ich betete: der liebe Gott selbst.
An den Bruder habe ich zunächst keine Erinnerung, er war auf einmal da und nahm die Mutter in Beschlag. Erst später prägte er sich genauer ein, er war ein Mutter-Sohn,so wie ich ganz Vaters Tochter war. Sicherlich bildete ich mir ein, dass sich alles nur um ihn drehte, dass er der Mittelpunkt der Familie sei. Vater, Mutter, Sohn – war so nicht die Heilige Familie komplett? Offenbar störte die Tochter, im Heilsplan der Schöpfung war sie nicht vorgesehen. Später fragte ich mich erstaunt, warum es ein Gleichnis vom verlorenen Sohn, nicht aber von der verfehlten Tochter gab? Mir war, als fehlte ich weder der Familie noch der Welt, ich gehörte nicht dazu oder wollte ich nicht dazugehören? Wenn ich mich im Spiegel sah, bewunderte und bemitleidete ich mich, oft beides zugleich. Ich war mir fremd und fand mich dennoch schön, eine abgründige Schönheit, fremd und geheimnisvoll.
An diesen Bemerkungen wird deutlich, dass ich von ihm nur reden kann, wenn mir das Sprechen über mich selber gelingt. Wie soll aber die beinahe Achtzigjährige das Kind, die Halbwüchsige, die Frau in sich entdecken, wenn schon die Zehnjährige vergeblich nach sich Ausschau hielt? Der Traumspiegel des Lebens zerbrach, was blieb, waren Scherben, die scharfen Splitter drangen tief unter die Haut. Es sind die Bruchkanten, die schmerzen, die Zusammenhanglosigkeit der Details. Oft scheint mir, als kehrte das, was man geliebt hat, nur noch als Karikatur zurück. Das liegt am Zeitgeist mit seinen Interessen, es ist, als rächte er sich, wenn man ihm nicht verfällt. Vielleicht war das Jans stärkster Charakterzug: Er litt unter dem Zeitgeist, versteckte sich aber nicht, sondern zeigte Flagge und – lachte ihm ins Gesicht.
Sie sehen, Frau Döring, es geht nicht nur um Erinnerungen, es geht auch um die Bedingungen, unter denen sie möglich sind. Meist ist uns das eigene Leben am wenigsten deutlich, wir geben es nur nicht zu. Sollte nicht am Ende unserer Tage zumindest die eigene Biografie durchsichtig sein? Erst wenn ich mir selber verständlich bin, kann ich auch Auskunft über andere erteilen. Das ist der Grund, warum ich erst heute schreibe, abgesehen davon, dass ich den Winter über krank und keines Gedankens fähig war.
Doch die Wartezeit war nicht umsonst, in ihr reifte der Entschluss, die Briefe, die Sie erwähnen, selber noch herauszugeben – die Briefe von ihm, nicht die von mir. Durch ihn habe ich überhaupt erst erfahren, dass nur Ich sagen kann, wem das Du begegnet ist. Deshalb war sein Tod ein Unglück, bis zum dreißigsten Lebensjahr war ich wie gelähmt. Der Vater war kein Du, er war das Wir, ein übermächtiger Pluralis Majestatis, der selbst dann noch wirkte, wenn er abwesend war. Eine der Uniformen hing immer in der Garderobe, an ihr musste ich vorbei, wenn ich die Wohnung betrat. Sie repräsentierte eine uniforme Lebenshaltung, eine gleichförmige Ordnung, die keine Unklarheit zuließ. Wenn ich an ihr vorüber ging, schaute ich scheu empor, selbst als bloße Hülle hatte sie noch Autorität. Sie vertrat den Vater, der Vater den Kaiser und der Kaiser vertrat wiederum Gott – eine Dreieinigkeit, deren Bann bis in den Krieg und darüber hinaus ungebrochen blieb.
Die Mutter hatte eine eigene Aura, die der Leidenden, der Passion, die für jeden Gesunden ein Vorwurf war. Eine Weile ahmte ich ihre Leidenshaltung nach, bis ich spürte, dass ich davon Kopfschmerzen bekam; so ernst hatte ich es auch wieder nicht gemeint. Als der Vater starb, hatte die Uniform ausgedient, hing aber trotzdem noch Jahre im halbdunklen Flur, so als hätte sich der Tod geirrt. Der Vater ohne Stiefel, ohne Kopf, ohne Gesicht – scheu drückte ich mich an der Garderobe vorbei. Nun waren die Mutter, der Bruder und ich allein, stille Hamburger Jahre hinter schweren Gardinen, Licht und Laute drangen nur gedämpft von draußen herein. Die tiefen Teppiche sogen den Trittschall auf, vom Kaminsims klang Großmutters Standuhr durch den Tag. Ich liebte sie schon deshalb, weil sie mehr Zeit zu haben schien als andere Uhren, mit ihrem silbernen, leicht zögerlichen Stundenschlag.
Eigentlich zählte Mama als Familienmitglied nicht, sie hustete viel und war ständig krank, ich musste sie pflegen, obwohl ich selbst pflegebedürftig war. Damit meine ich die Seele, die ich mir wie Chlothilde, meine Lieblingspuppe dachte. Noch mit vierzehn trug ich sie mit mir herum, wenn ich allein zu Hause war. Zugleich wurde mir in jener Zeit klar, dass die Klosterschule, die ich besuchte, ein Martyrium war. Alles war dort aus grauem Stein, dazu kalt, es zog in den Fluren, als herrschte Gegenwind. Ich ging vornüber geneigt, mit hochgezogenen Schultern, vielleicht weil ich fürchtete, dass ich den Kopf verlor. Mehr aber noch bangte ich um meine frierende Seele, ich sah sie schon versteinern wie eine marmorne Skulptur.
War es mir in der Schule zu still, plagte mich in der Stadt der Verkehr, die Menschen, der Staub, der gesamte hektische Betrieb. Es waren die Jahre des U-Bahn-Baus, nach Berlin ging auch die Hansestadt unter Tage, die City glich einem riesigen Maulwurfbau. Das sorgte für endlosen Streit unter den Bürgern, auch ich hatte die alten Pferdebusse geliebt. Die Stadt war voller Lärm, auch der Hafen war laut, die Zukunft würde noch lauter sein. Sie lag auf dem Wasser, so hörte man künden, lärmend baute Blohm & Voss an ihrem eisernen Gewand. Glich Berlin einer Kaserne, deren Casino-Ton das Kommando gab, sah sich Hamburg als deutsches London, als das Symbol der neuen Zeit. Banken und Versicherungen, Handel und Verkehr – hier wurde das Geld für die eiserne Zukunft verdient. Wussten Sie, verehrte Frau Döring, dass die HAPAG damals die größte Reederei auf der Welt war?