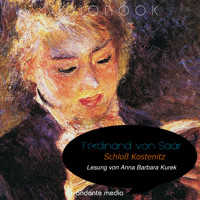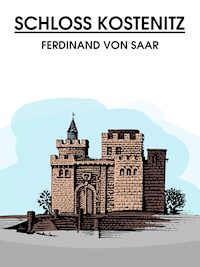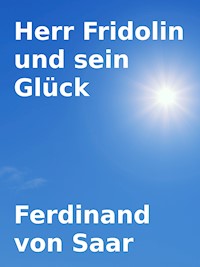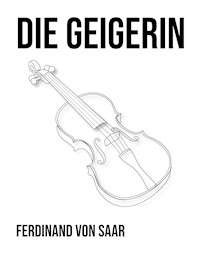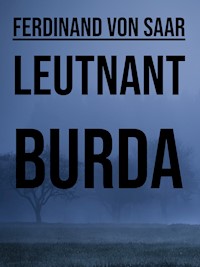
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Leutnant Burda ist eine Novelle von 1887; sie gehört zu den selten gelesenen Werken von Ferdinand von Saar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 86
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Leutnant Burda
Leutnant BurdaAnmerkungen zu dieser AusgabeImpressumLeutnant Burda
I
Bei dem Regiment, in welchem ich meine Militärzeit verbracht hatte, befand sich auch ein Leutnant namens Joseph Burda. In Anbetracht seiner Charge erschien er nicht mehr allzu jung; denn er mochte sich bereits den Dreißigern nähern. Dieser Umstand würde schon an und für sich genügt haben, ihm bei seinen unmittelbaren Kameraden, die fast durchweg flaumige Gelbschnäbel waren, ein gewisses Ansehen zu verleihen; aber er besaß noch andere Eigenschaften, die ihn besonders auszeichneten. Denn er war nicht bloß ein sehr tüchtiger, verwendbarer Offizier, er hatte sich auch durch allerlei Lektüre eine Art höherer Bildung erworben, die er sehr vorteilhaft mit feinen, weltmännischen Manieren zu verbinden wußte. Als Vorgesetzter galt er für streng, aber gerecht; Höheren gegenüber trug er eine zwar bescheidene, aber durchaus sichere Haltung zur Schau; im kameradschaftlichen Verkehr zeigte er ein etwas gemessenes und zurückhaltendes Benehmen, war jedoch stets bereit, jedem einzelnen mit Rat und Tat getreulich beizustehen. Niemand wachte strenger als er über den sogenannten Korpsgeist, und in allem, was den Ehrenpunkt betraf, erwies er sich von peinlichster Empfindlichkeit, so zwar, daß er in dieser Hinsicht, ohne auch nur im geringsten Händelsucher zu sein, mehr als einmal in ernste Konflikte geraten war und diese mit dem Säbel in der Faust hatte austragen müssen. Infolgedessen wurde er ein wenig gefürchtet, aber auch um so mehr geachtet, ohne daß er dadurch anmaßend oder hochfahrend geworden wäre, wenn es gleichwohl dazu beitrug, die etwas melancholische Würde seines Wesens zu erhöhen.
Dem allem hatte er es zu danken, daß man auf eine große persönliche Schwäche, die ihm anhaftete, kein Gewicht legte – oder, besser gesagt, sie wie auf Verabredung einmütig übersah. Er war nämlich ungemein eitel auf seine äußere Erscheinung, die auch in der Tat eine höchst einnehmende genannt werden mußte. Von hoher und schlanker Gestalt, hatte er ein wohlgebildetes Antlitz, dessen leicht schimmernde Blässe durch einen dunklen, fein gekräuselten Schnurrbart noch mehr hervorgehoben wurde, und auffallend schöne graue Augen, die von langen Wimpern eigentümlich beschattet waren. Es fehlte zwar nicht an Krittlern, welche behaupteten, daß er eigentlich schief gewachsen sei, und wirklich pflegte er beim Gehen die rechte Schulter etwas emporzuziehen. Aber gerade das verlieh seiner Haltung jene vornehme Nachlässigkeit, die mit der Art, wie er sich kleidete, in sehr gutem Einklange stand. Denn obgleich sein Uniformrock stets von untadelhafter Weiße und Frische war, so zeigte er doch niemals jenes gleißende Funkeln, welches das unmittelbare Hervorgehen aus der Schneiderwerkstätte bekundet hätte, und wiewohl Burda gar sehr auf »taille« hielt, so saß doch, bis zur eleganten Beschuhung hinab (von der man wußte, daß sie stets nach einem eigenen Leisten hergestellt wurde), an ihm alles so leicht und bequem, als wäre es nur so obenhin zugeschnitten und angepaßt worden. In dieser Weise erschien das, was ein Ergebnis sorgfältiger Berechnung war, nur als der natürliche gute Geschmack eines vollendeten Gentleman, dessen Taschentücher, wenn sie entfaltet wurden, einen kaum merkbaren Wohlgeruch von sich gaben, und wenn man auch im stillen seine Glossen machte, daß sich Burda von seinem Burschen – der ein kurzes Privatissimum bei einem Haarkünstler hatte nehmen müssen – täglich frisieren ließ, so trachtete doch mancher, es ihm in seiner Weise gleichzutun, ohne jedoch das Original auch nur im entferntesten zu erreichen.
Daß diese raffinierte und gewissermaßen verborgene Sorgfalt, die er auf sein Äußeres verwendete, im letzten Grunde mit dem Bestreben zusammenhing, bei dem anderen Geschlechte den günstigsten Eindruck hervorzubringen, braucht wohl nicht erst ausdrücklich gesagt zu werden, und ebenso selbstverständlich ist es, daß sich Burda nach dieser Richtung hin für unwiderstehlich hielt. Nicht daß er etwa dieses Bewußtsein irgendwie zur Schau getragen oder gar, wie es wohl einige von uns pflegten, mit Herzenseroberungen geprahlt hätte; er beobachtete vielmehr in solchen Dingen die äußerste Zurückhaltung, und nur aus manchen Symptomen konnten Schlüsse gezogen werden. Da waren es denn entweder zarte Damenringe, die er am kleinen Finger seiner wohlgepflegten Hand trug, oder ein aus Haaren geflochtenes Armband, das zufällig unter seiner Manschette zum Vorschein kam – sowie plötzliches geheimnisvolles Verschwinden zu gewissen Stunden, was zu allerlei Vermutungen Anlaß gab, denen er zwar nicht geradezu widersprach, aber deren weitere Erörterung er sofort mit ernstem Stirngerunzel abschnitt. Überhaupt nahm er nur selten an Gesprächen teil, welche die Liebe und somit auch die Frauen zum Gegenstand hatten, welch letztere er von einem ganz eigentümlichen Standpunkt aus betrachtete. Wie nämlich für einen mehr berüchtigten als berühmten Feldherrn der Mensch erst beim Baron anfing, so begann für Burda das weibliche Geschlecht erst bei der Baronesse. Den einfachen Geburtsadel einer jungen Dame ließ er nur dann gelten, wenn der betreffende Vater General oder Präsident irgendeiner hohen Landesstelle war; auf gewöhnliche Hofratstöchter pflegte er mit einer Art von Mitleid herabzusehen; Damen der Plutokratie verachtete er gründlich. Alles andere existierte für ihn einfach gar nicht, und er gab jedesmal seiner Verwunderung Ausdruck, wenn er erfuhr, daß ein Offizier irgendeine wohlhabende Bürgerstochter geheiratet hatte (was er eine Mesalliance nannte); im schärfsten Tone aber tadelte er es, wenn jemand zu einer Dame von zweifelhaftem Rufe in mehr als ganz vorübergehende Beziehung getreten war.
Diese hochstrebenden Neigungen konnten um so seltsamer erscheinen, als Burda selbst sehr bescheidener Herkunft war. Als Sohn eines kleinen Rechnungsbeamten hatte er eine nur dürftige Erziehung erhalten, anfänglich das Gymnasium besucht, aber sich bald als Eleve in das Amt seines Vaters aufnehmen lassen, um diesem weiterhin nicht mehr zur Last fallen zu müssen. Später, als die Zeitläufte günstige Aussichten bei der Armee eröffneten, war er als Kadett in unser Regiment getreten. In jene Zeit schienen auch seine ersten Erfolge bei den Frauen gefallen zu sein. Denn wie die Sage ging, hatte sich damals die Tochter eines höheren Generals, in dessen Adjutantur er, seiner schönen Handschrift wegen, verwendet wurde, schwärmerisch in ihn verliebt. Diesem Roman hatte jedoch der General, nachdem er einem geheimen Briefwechsel auf die Spur gekommen, sofort damit ein Ende bereitet, daß er den Helden nach Verona versetzen ließ, wo sich der Werbebezirk des Regimentes – das ein italienisches war – befand. Dort, unter südlichem Himmel, in der Vaterstadt Romeos und Julias, hatte auch unverzüglich eine dunkellockige Marchesa ihr Auge auf den schmucken Krieger geworfen und mit ihm – einem eifersüchtigen, der österreichischen Fremdherrschaft äußerst abholden Gemahl zu Trotz – ein höchst leidenschaftliches Verhältnis begonnen, bei welchem es an nächtlichen Zusammenkünften mittels Strickleiter, blutigen Überfällen von seiten des Marchese usw. nicht gefehlt haben sollte. Kein Wunder also, daß Burda, einmal Offizier geworden, nicht tiefer mehr herabsteigen konnte und seine Netze bloß in den oberen Regionen aufrichtete. So glaubte man auch jetzt trotz seiner Zurückhaltung zu wissen, daß er in der ansehnlichen Provinzstadt, wo diese Geschichte zu handeln beginnt, die besondere Gunst einer Stiftsdame erworben habe, die, obgleich nicht mehr ganz jung, als vollendete Schönheit galt. Nebenher wurde freilich auch behauptet, das Ganze bestehe darin, daß Burda sehr häufig unter den Fenstern des Stiftsgebäudes vorüberwandle und in der daranstoßenden Kirche jeden Sonntag die Messe höre; ein unschuldiges Vergnügen, das eigentlich jedermann geboten wäre. Wie dem aber mochte gewesen sein: die meisten von uns, von einem ähnlichen romantischen Hange beseelt, hielten an der Überzeugung fest, daß Burda infolge seiner Vorzüge ein Auserwählter sei, und fuhren fort, mit einer Art sehnsüchtiger Bewunderung nach ihm emporzublicken.
Indessen sollte doch einmal seinem Ansehen ein gelinder Stoß versetzt werden. Es war nämlich unter den jüngeren Offizieren die Gepflogenheit entstanden, schriftliche Meldungen und sonstige Eingaben mit absichtlicher Flüchtigkeit zu unterzeichnen (was genial aussehen sollte) oder dabei die Buchstaben so grillenhaft zu verschnörkeln, daß die betreffenden Namen in der Tat oft nicht zu entziffern waren. Unser Oberst, eine schwarzgallige, pedantische Natur, nahm somit die stets erwünschte Gelegenheit wahr, dem jungen Volk am Zeuge flicken zu können, und ließ die hervorragendsten Übeltäter, darunter auch meine Wenigkeit, vor sich bescheiden. Wir hatten schon vorher von der Sache Wind bekommen und waren nicht wenig erstaunt, auch Burda, dessen Unterschrift an kalligraphischer Deutlichkeit nichts zu wünschen übrigließ, unter den Vorgeladenen zu erblicken. Nachdem uns der Oberst mit sarkastischem Behagen die Corpora delicti vor Augen gehalten und mit näselnder Stimme jeden einzelnen gefragt hatte, wie er denn eigentlich heiße – und was dies und was jenes zu bedeuten habe, schloß er mit einem sehr scharfen Verweise, für die Zukunft exemplarische Strafen in Aussicht stellend. Dann wandte er sich in etwas gemäßigtem Tone an Burda: »Und auch Sie, Herr Leutnant, habe ich kommen lassen, um eine Frage an Sie zu richten. Seit wann sind Sie denn Graf geworden?«
Burda zuckte leicht zusammen. Dann erwiderte er, allmählich bis unter die Stirnhaare errötend, mit fester, fast herausfordernder Stimme: »Graf? In welcher Hinsicht meinen dies der Herr Oberst?«
Der Oberst trat einen Schritt zurück und kniff, wie es in Erregung seine Gewohnheit war, das rechte Auge zu. »In welcher Hinsicht? Mit Hinsicht auf Ihren letzten Wache-Rapport. Derselbe ist« – er hielt ihm das Schriftstück entgegen – »mit Gf Burda unterzeichnet. Dieses Gf ist, wie ich aus den Unterschriften des Herrn Majors Grafen N ... und des Herrn Hauptmanns Grafen K ... entnehme, eine beliebte Abkürzung des Wortes Graf. Was haben Sie darauf zu erwidern?«
»Ich erlaube mir zu bemerken«, sagte Burda in strammster Haltung, »daß dieses Gf keineswegs das Wort Graf bedeuten soll. Es ist die Abkürzung meines Namens Gottfried.«
»Gottfried? Sie heißen ja Joseph!«
»Allerdings. Aber es dürfte dem Herrn Oberst bekannt sein, daß man bei der Taufe in der Regel den Namen des Vaters mit empfängt. Mein Vater führte den Namen Gottfried; somit heiße ich Joseph Gottfried.«
Der Oberst trat noch einen Schritt zurück und zwinkerte krampfhaft mit dem rechten Auge. »Dann muß ich Sie bitten, Ihren Taufschein aktenmäßig vorzulegen, damit die Regimentslisten, in welchen, soviel ich weiß, bloß der Name Joseph eingetragen erscheint, richtiggestellt werden können. Aber trotzdem werden Sie künftighin weniger zweideutige Abkürzungen zu wählen haben.« Er machte eine kurze Verbeugung, und wir waren entlassen.
Als wir die Tür hinter uns hatten und nun insgesamt die Treppe hinabschritten, herrschte peinliches Schweigen. Das Komische des ganzen Auftrittes hätte eigentlich zu allgemeiner Heiterkeit angeregt; aber die Gegenwart Burdas, der die Sache sichtlich ernst nahm und überdies nicht ganz ohne Verlegenheit schien, drängte die Äußerung einer solchen Stimmung zurück. Wir verabschiedeten uns von ihm mit einigen oberflächlichen Worten, und auch in der nächsten Zeit blieb uns diese Befangenheit ihm gegenüber; es war, als hätte etwas Fremdes, Unerwartetes seine leuchtende Erscheinung getrübt.
Er selbst aber legte noch am selben Tage seinen Taufschein, der wirklich beide Namen enthielt, auf dienstlichem Wege vor und unterzeichnete von nun an mit augenfälliger Absichtlichkeit und ohne jede Abkürzung: Joseph Gottfried Burda.
II
Dieser unliebsame Zwischenfall wurde Übrigens wie alles, das keine bemerkenswerten Folgen nach sich zieht, um so eher wieder vergessen, als bald darauf ein Ereignis eintrat, welches die Gemüter in leicht begreifliche Aufregung versetzte. Das Regiment erhielt nämlich eines Tages ganz plötzlich den Befehl, in die Wiener Garnison einzurücken, was man damals als besondere Auszeichnung zu betrachten pflegte. Aber auch aus sonstigen Gründen wurde diese Anordnung von den Offizieren mit großer Freude begrüßt. Denn viele von uns waren gebürtige Wiener und konnten nunmehr ihre Angehörigen auf längere Zeit wiedersehen, während den übrigen Gelegenheit geboten wurde, das mehr oder minder fremde Leben der Hauptstadt kennen und genießenzulernen. Nebenbei galt es, das Regiment in der kurzen Spanne Zeit, die hierzu noch vergönnt war, in den allerbesten Stand zu setzen, was jedem einzelnen rastlose Tätigkeit auferlegte – bis endlich der große Tag erschien, an welchem wir die Waggons bestiegen und, im Wiener Nordbahnhofe angelangt, mit klingendem Spiele der Kaserne entgegenzogen, die uns in einer der nächsten Vorstädte angewiesen war.