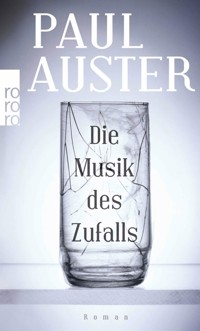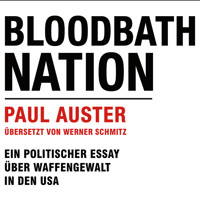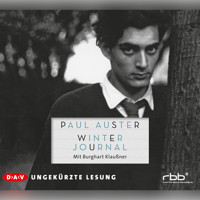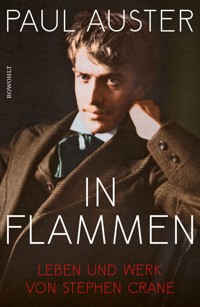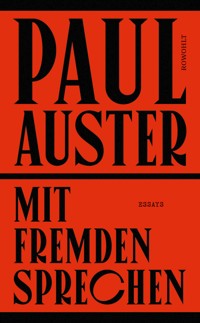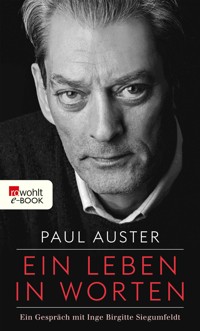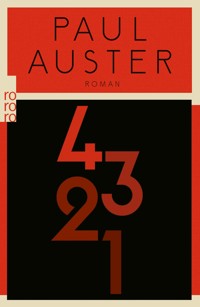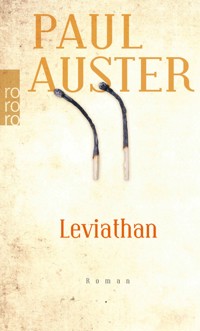
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Der Schriftsteller Peter Aaron setzt sich hin, um die Lebensgeschichte seines Freundes Ben Sachs aufzuschreiben. Aber wo anfangen? Er könnte mit dem Mord beginnen. Oder besser damit, dass ein Terrorist Anschläge auf Freiheitsstatuen überall im Land verübt? Dass eine Frau ein Adressbuch findet und sich eine neue Identität zulegt? Egal: Aaron will die Wahrheit ans Licht bringen, bevor das FBI seine eigenen Schlüsse zieht. «Sie können den Auster aufschlagen, wo Sie wollen, und er ist immer interessant. Ein geistreicher Schriftsteller, der mit großem Können erzählt.» (Marcel Reich-Ranicki) «So ein wunderbar geschriebenes Buch, so eine Mischung aus Thriller, Unterhaltung und Nachdenklichkeit findet man in unseren Breiten nur äußerst selten.» (Spiegel special)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 460
Ähnliche
Paul Auster
Leviathan
Roman
Aus dem Englischen von Werner Schmitz
Rowohlt Digitalbuch
Inhaltsübersicht
Für Don DeLillo
Jeder existierende Staat ist korrupt.
Ralph Waldo Emerson
Eins
Vor sechs Tagen hat sich im nördlichen Wisconsin ein Mann am Rand einer Straße in die Luft gesprengt. Zeugen gab es keine, doch offenbar saß er im Gras neben seinem geparkten Wagen, als die Bombe, an der er bastelte, plötzlich hochging. Dem soeben veröffentlichten gerichtsmedizinischen Gutachten zufolge war der Mann auf der Stelle tot. Sein Körper wurde in winzige Stücke zerrissen, und noch fünfzehn Meter vom Explosionsort entfernt wurden Leichenteile gefunden. Bis heute (4. Juli 1990) scheint niemand zu wissen, um wen es sich bei dem Toten handelt. In Zusammenarbeit mit der örtlichen Polizei und Agenten vom Amt für Alkohol, Tabak und Schusswaffen begann das FBI seine Recherchen mit einer Überprüfung des Autos, eines in Illinois zugelassenen, sieben Jahre alten blauen Dodge, wobei sich aber schnell herausstellte, dass es gestohlen war – am 12. Juni bei helllichtem Tag von einem Joliet-Parkplatz geklaut. Nicht anders erging es den Polizisten, als sie den Inhalt der Brieftasche des Mannes untersuchten, die die Explosion wie durch ein Wunder nahezu unversehrt überstanden hatte. Sie glaubten, auf eine Fülle von Hinweisen gestoßen zu sein – Führerschein, Sozialversicherungsnummer, Kreditkarten –, doch als sie den Computer damit fütterten, erwies sich all dies als entweder gefälscht oder gestohlen. Als Nächstes hätte man Fingerabdrücke genommen, nur gab es in diesem Fall keine zu nehmen, denn die Hände des Mannes waren von der Bombe völlig zerfetzt worden. Auch der Wagen selbst half ihnen nicht weiter. Der Dodge war nur noch ein Klumpen verkohlten Stahls und geschmolzener Kunststoffe, und trotz aller Bemühungen ließ sich kein einziger Abdruck darauf finden. Vielleicht haben sie mit seinen Zähnen mehr Glück, vorausgesetzt, es sind noch genug Zähne übrig; aber das wird einige Zeit dauern, womöglich ein paar Monate. Am Ende wird ihnen bestimmt etwas einfallen, doch bevor sie nicht die Identität des zerfetzten Opfers festgestellt haben, werden sie mit dem Fall kaum von der Stelle kommen.
Was mich betrifft, können sie gar nicht lange genug brauchen. Die Geschichte, die ich zu erzählen habe, ist ziemlich kompliziert, und sollte ich noch nicht damit fertig sein, wenn sie die Antwort gefunden haben, wird das, was ich hier aufschreiben will, überhaupt keinen Sinn ergeben. Sobald das Geheimnis enthüllt ist, werden alle möglichen Lügen in Umlauf kommen, in Zeitungen und Zeitschriften werden hässliche Verzerrungen zirkulieren, und binnen weniger Tage wird der gute Ruf eines Mannes zerstört sein. Nicht dass ich seine Taten verteidigen möchte, aber da er sich nicht mehr selbst verteidigen kann, will ich wenigstens erklären, wer er war und was er wirklich auf dieser Straße im nördlichen Wisconsin zu suchen hatte. Deshalb muss ich mich beeilen: damit ich auf sie vorbereitet bin, wenn es so weit ist. Sollte das Rätsel zufällig ungelöst bleiben, werde ich meine Aufzeichnungen einfach für mich behalten, und niemand wird irgendetwas darüber zu erfahren brauchen. Das wäre das bestmögliche Ergebnis: ein völliger Stillstand, Schweigen auf beiden Seiten. Aber darauf darf ich mich nicht verlassen. Um zu tun, was ich zu tun habe, muss ich davon ausgehen, dass sie ihn bereits einkreisen, dass sie früher oder später herausfinden werden, wer er war. Und das nicht erst, wenn ich genug Zeit gehabt haben werde, diesen Bericht zu beenden – sondern jederzeit, von nun an jederzeit.
Am Tag nach der Explosion brachten die Nachrichtenagenturen eine kurze Meldung über den Fall. Es war einer dieser rätselhaften Zweispalter, die irgendwo mitten in der Zeitung versteckt werden, doch als ich an jenem Nachmittag beim Essen in der New York Times blätterte, stieß ich zufällig darauf. Fast zwangsläufig begann ich an Benjamin Sachs zu denken. Nichts in dem Artikel wies irgendwie eindeutig auf ihn hin, und dennoch schien alles zu passen. Wir hatten seit einem knappen Jahr nicht mehr miteinander geredet, aber bei unserem letzten Gespräch hatte er genug gesagt, um mich davon zu überzeugen, dass er tief in Schwierigkeiten steckte und Hals über Kopf auf irgendeine dunkle, namenlose Katastrophe zueilte. Falls das zu vage ist, sollte ich hinzufügen, dass er auch etwas von Bomben erwähnte, ja, dass er bei seinem Besuch von kaum etwas anderem sprach und dass ich in den folgenden elf Monaten genau so etwas befürchtet hatte – dass er sich umbringen würde, dass ich eines Tages die Zeitung aufschlagen und lesen würde, mein Freund habe sich in die Luft gesprengt. Damals war das nur so eine konfuse Ahnung, eine dieser verrückten Vermutungen, und doch wurde ich den Gedanken, nachdem er mir einmal in den Sinn gekommen war, nicht mehr los. Und dann, zwei Tage nach Lektüre jenes Artikels, klopften zwei FBI-Agenten an meine Tür. Kaum hatten sie sich mir vorgestellt, wusste ich, dass ich recht gehabt hatte. Der Mann, der sich in die Luft gesprengt hatte, war tatsächlich Sachs. Es konnte keinen Zweifel geben. Sachs war tot, und für mich gab es jetzt nur eine Möglichkeit, ihm zu helfen: Ich musste seinen Tod für mich behalten.
Dass ich den Artikel überhaupt gelesen hatte, war wohl eine glückliche Fügung, obwohl ich mich erinnere, mir zu dem Zeitpunkt gewünscht zu haben, es wäre mir erspart geblieben. Immerhin bekam ich dadurch zwei Tage Zeit, um den Schock zu verarbeiten. Als die Männer vom FBI hier auftauchten und ihre Fragen stellten, war ich schon darauf vorbereitet, und das half mir, nicht die Fassung zu verlieren. Es schadete auch nichts, dass zusätzliche achtundvierzig Stunden vergangen waren, ehe sie mich aufgespürt hatten. Unter den in Sachs’ Brieftasche sichergestellten Gegenständen befand sich anscheinend ein Zettel mit meinen Initialen und meiner Telefonnummer. Damit hatten sie mich schließlich ausfindig machen können; doch wie es der Zufall wollte, handelte es sich bei der Nummer um die meiner New Yorker Wohnung, und ich bin seit zehn Tagen in Vermont, wo meine Familie und ich in einem gemieteten Haus wohnen, in dem wir den Rest des Sommers verbringen möchten. Weiß der Himmel, wie viele Leute sie befragen mussten, ehe sie erfuhren, wo ich mich aufhalte. Wenn ich nebenbei erwähne, dass dieses Haus Sachs’ Exfrau gehört, dann nur, um anhand eines Beispiels klarzumachen, wie verworren und kompliziert diese Geschichte letzten Endes ist.
Ich tat mein Bestes, mich dumm zu stellen, ihnen so wenig wie möglich zu verraten. Nein, sagte ich, den Zeitungsartikel hätte ich nicht gelesen. Von Bomben, gestohlenen Autos oder irgendwelchen Landstraßen in Wisconsin sei mir nichts bekannt. Ich sei Schriftsteller, erklärte ich, ich lebte vom Verfassen von Romanen, und wenn sie mich überprüfen wollten, bitte, nur zu – aber damit kämen sie in ihrem Fall auch nicht weiter, das wäre pure Zeitverschwendung. Schon möglich, sagten sie, aber was ist mit dem Zettel in der Brieftasche des Toten? Sie wollten mir ja gar nichts vorwerfen, aber dass er meine Telefonnummer bei sich getragen habe, scheine doch auf eine Verbindung zwischen uns beiden hinzuweisen. Was ich kaum bestreiten konnte. Ja, gab ich daher zu, aber nur dass es so aussehe, bedeute noch lange nicht, dass es auch der Wahrheit entspreche. Es gebe tausend Möglichkeiten, wie der Mann an meine Nummer gekommen sein könne. Ich habe Freunde in der ganzen Welt, und jeder von ihnen habe sie irgendeinem Fremden geben können. Und dieser Fremde habe sie vielleicht an einen anderen Fremden weitergegeben, und der wiederum könne sie noch einmal weitergegeben haben. Möglich, sagten sie, aber warum sollte jemand die Telefonnummer eines ihm unbekannten Menschen mit sich herumtragen? Weil ich Schriftsteller bin, sagte ich. Ach?, sagten sie, und wo bitte ist da der Unterschied? Meine Bücher werden veröffentlicht, sagte ich. Irgendwelche Leute lesen sie, und ich kenne keinen Einzigen von ihnen. Ohne dass ich selbst etwas davon mitbekomme, trete ich in das Leben von Fremden ein, und solange sie meine Bücher in Händen halten, sind meine Worte die einzige Realität, die für sie existiert. Das ist normal, sagten sie, so gehe es mit Büchern zu. Ja, sagte ich, genauso ist es, doch manche dieser Leser sind nicht ganz richtig im Kopf. Sie lesen ein Buch, und irgendetwas darin schlägt tief in ihrer Seele eine Saite an. Und plötzlich bilden sie sich ein, der Verfasser gehöre zu ihnen, er sei ihr einziger Freund auf der Welt. Zur Veranschaulichung gab ich ihnen einige Beispiele – alle aus der Wirklichkeit gegriffen, alle von mir selbst erlebt. Die verrückten Briefe, die Anrufe um drei Uhr morgens, die anonymen Drohungen. Erst voriges Jahr, fuhr ich fort, sei ich dahintergekommen, dass jemand unter meinem Namen aufgetreten sei – er habe Briefe in meinem Namen beantwortet, sei in Buchläden gegangen und habe meine Bücher signiert; wie ein böser Beschatter habe er sich an der Peripherie meines Lebens herumgetrieben. Ein Buch ist ein geheimnisvoller Gegenstand, sagte ich, und wenn es sich einmal auf den Weg in die Welt gemacht hat, kann alles Mögliche passieren. Alles mögliche Unheil kann daraus entstehen, aber es lässt sich gar nichts dagegen machen. Man hat niemals die Kontrolle darüber.
Ob sie meine Erklärungen überzeugend fanden oder nicht, kann ich nicht sagen. Wohl eher nicht, aber selbst wenn sie mir kein einziges Wort geglaubt haben, dürfte ich mit meiner Taktik immerhin etwas Zeit gewonnen haben. Wenn ich bedenke, dass ich vorher noch nie mit einem FBI-Agenten gesprochen hatte, kommt es mir gar nicht so übel vor, wie ich mich bei der Befragung geschlagen habe. Ich war ruhig, ich war höflich, es gelang mir, die richtige Mischung aus Hilflosigkeit und Bestürzung vorzuführen. Dies allein war für mich schon ein Triumph. Im Allgemeinen besitze ich nämlich kein sonderliches Talent, andere Leute zu täuschen, und trotz meiner langjährigen Bemühungen habe ich nur selten jemanden hinters Licht führen können. Wenn mir vorgestern eine glaubhafte Vorstellung gelungen ist, so waren die Männer vom FBI zumindest teilweise selbst schuld daran. Und das lag nicht so sehr an dem, was sie sagten, sondern eher an ihrem Äußeren, an ihrer perfekten Maskerade, die in jeder Einzelheit meine Vorstellungen davon bestätigte, wie FBI-Leute auszusehen hätten: die leichten Sommeranzüge, die robusten Schnürschuhe, die bügelfreien Hemden, die Pilotensonnenbrillen. Diese Sonnenbrillen waren gewissermaßen obligatorisch, und sie verliehen der ganzen Szene etwas Künstliches, als wären ihre Träger nur Schauspieler oder Statisten, die eine Nebenrolle in irgendeinem billigen Film bekleideten. All dies empfand ich als eigenartig tröstlich, und wenn ich jetzt daran zurückdenke, wird mir klar, wieso dieses Gefühl des Unwirklichen mir zum Vorteil gereichte. Es erlaubte mir nämlich, mich selbst ebenfalls als Schauspieler zu betrachten, und da ich jemand anders geworden war, hatte ich plötzlich das Recht, sie zu täuschen und ohne die geringsten Gewissensbisse zu belügen.
Dabei waren sie keineswegs dumm. Der eine war Anfang vierzig, der andere beträchtlich jünger, etwa fünfundzwanzig oder sechsundzwanzig, aber beide hatten einen gewissen Ausdruck in den Augen, der mich während der ganzen Zeit ihres Besuchs auf der Hut sein ließ. Es lässt sich schwer beschreiben, was genau an diesem Blick so bedrohlich war, aber es hatte wohl etwas mit seiner Leere zu tun, mit seiner Unbestimmtheit: Es war, als hätten sie gleichzeitig alles und nichts im Auge. So wenig gab dieser Blick preis, dass ich nie sicher sein konnte, was die beiden dachten. Ihre Augen waren irgendwie zu geduldig, zu geschickt darin, den Eindruck von Gleichgültigkeit hervorzurufen, dabei aber trotzdem wachsam, geradezu gnadenlos wachsam, als wären sie darauf trainiert, einem ein unbehagliches Gefühl zu verursachen, einem seine Fehler und Vergehen bewusstzumachen, sodass man sich in seiner Haut nicht mehr wohlfühlte. Sie hießen Worthy und Harris, doch weiß ich nicht mehr, wer welcher war. Physisch ähnelten sie einander beunruhigend, fast als wären sie ein und dieselbe Person in verschiedenen Altersstufen: groß, aber nicht zu groß; gut gebaut, aber nicht zu gut gebaut; rotblondes Haar, blaue Augen, dicke Hände mit makellos sauberen Fingernägeln. Gewiss, ihr Gesprächsstil war nicht der gleiche, doch will ich dem ersten Eindruck nicht allzu viel Gewicht beimessen. Ich nehme an, sie wechseln sich ab und tauschen die Rollen, wann immer ihnen danach ist. Als sie mich vor zwei Tagen besuchten, spielte der Jüngere den Hartgesottenen. Seine Fragen kamen sehr unverblümt, und er schien seinen Job allzu ernst zu nehmen; zum Beispiel lächelte er kaum einmal und behandelte mich mit einer Förmlichkeit, die mitunter an Sarkasmus und Gereiztheit grenzte. Der Ältere gab sich entspannter und liebenswürdiger und schien eher bereit, das Gespräch seinen natürlichen Gang gehen zu lassen. Ebendies macht ihn zweifellos gefährlicher, obwohl ich zugeben muss, dass es durchaus nicht unangenehm war, mit ihm zu sprechen. Als ich von einigen der verrückten Reaktionen auf meine Bücher zu erzählen begann, merkte ich, dass ihn das Thema interessierte; er ließ mich länger bei meiner Abschweifung verweilen, als ich erwartet hätte. Vermutlich wollte er mir nur auf den Zahn fühlen, mich schwafeln lassen, um herauszufinden, was für ein Mensch ich war und wie mein Verstand arbeitete, doch als ich zu der Geschichte mit dem Hochstapler kam, machte er mir tatsächlich das Angebot, der Sache für mich nachzugehen. Natürlich könnte das ein Trick gewesen sein, aber irgendwie bezweifle ich das. Ich brauche nicht hinzuzufügen, dass ich ablehnte, aber unter anderen Umständen hätte ich es mir vielleicht doch überlegt, seine Hilfe anzunehmen. Diese Sache quält mich schon seit langem, und ich hätte wahrlich nichts dagegen, ihr auf den Grund zu kommen.
«Ich lese selten Romane», sagte der Agent. «Sieht aus, als hätte ich einfach keine Zeit dazu.»
«Stimmt, das tun die wenigsten», sagte ich.
«Aber Ihre müssen ziemlich gut sein. Sonst würde man Ihnen wohl nicht so zusetzen.»
«Vielleicht setzt man mir zu, weil sie schlecht sind. Heutzutage fühlt sich doch jeder als Kritiker. Bist du mit einem Buch nicht zufrieden, bedroh den Verfasser. Das Ganze hat eine gewisse Logik. Lass den Mistkerl dafür bezahlen, was er dir angetan hat.»
«Ich sollte mich wohl mal hinsetzen und selbst eins lesen», sagte er. «Um zu sehen, was das ganze Theater soll. Sie hätten doch nichts dagegen?»
«Natürlich nicht. Dazu sind sie ja in den Buchhandlungen. Damit die Leute sie lesen können.»
Kurioses Ende des Besuchs – ein FBI-Agent notiert sich die Titel meiner Bücher. Noch jetzt ist mir schleierhaft, was er eigentlich wollte. Vielleicht glaubt er, in den Büchern irgendwelche Hinweise finden zu können, vielleicht wollte er mir damit auch subtil zu verstehen geben, dass er noch einmal zurückkommen werde, dass er mit mir noch nicht fertig sei. Schließlich bin ich noch immer ihr einziger Anhaltspunkt, und wenn sie davon ausgehen, dass ich sie belogen habe, werden sie nicht von mir ablassen. Abgesehen davon habe ich nicht die leiseste Ahnung, was sie sich gedacht haben mögen. Es scheint kaum vorstellbar, dass sie mich für einen Terroristen halten, aber das sage ich nur, weil ich ja weiß, dass ich keiner bin. Sie hingegen wissen nichts, deshalb könnten sie durchaus von dieser Voraussetzung ausgehen und fieberhaft nach irgendetwas suchen, das mich mit der vorige Woche in Wisconsin explodierten Bombe in Zusammenhang bringt. Und selbst wenn sie das nicht tun, muss ich akzeptieren, dass sie noch lange hinter mir her sein werden. Sie werden Fragen stellen, sie werden in meinem Leben herumschnüffeln, sie werden meine Freunde ermitteln, und früher oder später wird auch Sachs’ Name fallen. Mit anderen Worten, während der ganzen Zeit, die ich hier in Vermont meine Geschichte schreibe, werden sie sich ihre eigene Geschichte zusammenreimen. Es wird meine Geschichte sein, und wenn sie damit fertig sind, werden sie ebenso viel über mich wissen wie ich selbst.
Zwei Stunden nach dem Weggang der Männer vom FBI kamen meine Frau und meine Tochter nach Hause. Sie waren früh am Morgen losgefahren, um den Tag mit Freunden zu verbringen, und ich war froh, dass sie bei Harris’ und Worthys Besuch nicht zugegen gewesen waren. Meine Frau und ich haben so gut wie keine Geheimnisse voreinander, aber in diesem Fall scheint es mir ratsam, ihr den Vorfall zu verschweigen. Iris hat Sachs immer sehr gerngehabt, aber ich bin nun einmal ihre Nummer eins, und wenn sie dahinterkäme, dass ich seinetwegen in Schwierigkeiten mit dem FBI gerate, würde sie alles tun, um mich zum Aufhören zu bewegen. Dieses Risiko kann ich jetzt nicht auf mich nehmen. Selbst wenn ich sie davon überzeugen könnte, dass ich das Richtige tue, würde es lange dauern, bis ich ihren Widerstand gebrochen hätte, und das kann ich mir einfach nicht leisten; ich muss jede Minute an die Aufgabe wenden, die ich mir gestellt habe. Zudem würde sie, auch wenn sie nachgäbe, nur in tausend Ängsten schweben, und ich wüsste nicht, was daraus Gutes erwachsen könnte. Am Ende wird sie die Wahrheit ohnehin erfahren; wenn es so weit ist, wird alles ans Licht kommen. Ich will sie nicht hintergehen, sondern sie einfach so lange wie möglich schonen. Im Übrigen sehe ich da keine sonderlichen Probleme. Schließlich bin ich ja zum Schreiben hier, und was kann es schaden, wenn Iris meint, ich säße wieder Tag für Tag in meiner Hütte und triebe meine alten Mätzchen? Sie wird annehmen, dass ich an meinem neuen Roman herumkritzele, und wenn sie sieht, wie viel Zeit ich darauf verwende, wie gut ich während meiner langen Arbeitsstunden vorankomme, wird sie glücklich sein. Auch Iris ist ein Teil der Gleichung, und ohne den Gedanken an ihr Glück dürfte mir wohl der Mut fehlen, überhaupt damit anzufangen.
Dies ist der zweite Sommer, den wir hier verbringen. Früher, als Sachs und seine Frau jeden Juli und August hierherzukommen pflegten, haben sie mich manchmal eingeladen; aber das waren immer nur kurze Ausflüge, und ich blieb selten mehr als drei oder vier Nächte. Seit unserer Hochzeit vor neun Jahren haben Iris und ich diese Reise mehrmals gemeinsam unternommen, und einmal haben wir Fanny und Ben sogar geholfen, das Haus von außen neu zu streichen. Fannys Eltern hatten das Anwesen während der Weltwirtschaftskrise gekauft, zu einer Zeit also, in der solche Farmen praktisch umsonst zu haben waren. Das Grundstück umfasste über hundert Morgen Land und einen Teich, und mochte das Haus auch heruntergekommen sein, so war es doch innen geräumig und luftig, und einige kleinere Schönheitsreparaturen genügten, es bewohnbar zu machen. Da die Goodmans beide als Lehrer in New York arbeiteten und es sich nach dem Erwerb des Hauses nicht leisten konnten, viel daran zu tun, behielt es über all die Jahre hin sein primitives, schmuckloses Aussehen: die eisernen Bettgestelle, der Kanonenofen in der Küche, die Risse in Decken und Wänden, die grau gestrichenen Böden. Dennoch hat es bei aller Baufälligkeit etwas Solides, und es würde wohl kaum jemandem schwerfallen, sich hier wie zu Hause zu fühlen. Für mich liegt der größte Reiz dieses Hauses in seiner Abgeschiedenheit. Es steht oben auf einem kleinen Berg, vier Meilen vom nächsten Dorf entfernt, das nur über einen schmalen Feldweg zu erreichen ist. Die Winter auf diesem Berg müssen grausam sein, aber im Sommer grünt hier alles, überall singen die Vögel, und die Wiesen sind übersät mit Blüten: Habichtskraut, Rotklee, Hahnenfuß. Etwa dreißig Meter vom Haupthaus steht ein kleines Nebengebäude, das Sachs bei seinen Aufenthalten immer als Werkstatt benutzt hat. Eigentlich ist es nur eine Hütte mit drei kleinen Zimmern, Kochnische und Bad; und seit es in einem Winter vor zwölf oder dreizehn Jahren mutwillig demoliert wurde, verfällt es immer mehr. Die Rohrleitungen sind gebrochen, der Strom ist abgestellt, das Linoleum schält sich vom Boden. Ich erwähne das alles, weil ich jetzt hier sitze – an einem grünen Tisch mitten im größten der drei Zimmer, mit einem Füller in der Hand. Solange ich ihn kannte, verbrachte Sachs jeden Sommer schreibend an ebendiesem Tisch, und dies ist auch das Zimmer, in dem ich ihn zum letzten Mal gesehen habe, in dem er mir sein Herz ausgeschüttet und mich in sein furchtbares Geheimnis eingeweiht hat. Wenn ich nur konzentriert genug an jenen Abend zurückdenke, kann ich mir fast einbilden, er sei noch hier. Es ist, als hingen seine Worte noch in der Luft, als könne ich noch immer die Hand ausstrecken und ihn berühren. Wir hatten damals ein langes und zermürbendes Gespräch, und als wir schließlich (zwischen fünf und sechs Uhr morgens) ans Ende gelangten, nahm er mir das Versprechen ab, sein Geheimnis niemals aus diesem Zimmer zu lassen. Das hat er wörtlich gesagt: Nichts von dem, was er mir anvertraut habe, dürfe dieses Zimmer verlassen. Fürs Erste werde ich mein Versprechen halten können. Bis ich werde vorzeigen müssen, was ich hier geschrieben habe, kann ich mich mit dem Gedanken trösten, dass ich Wort halten werde.
Als wir uns kennenlernten, schneite es. Mehr als fünfzehn Jahre sind seit jenem Tag vergangen, aber die Erinnerung daran kann ich jederzeit wachrufen. So viele andere Dinge habe ich inzwischen vergessen, doch die Begegnung mit Sachs steht mir noch immer deutlich vor Augen.
Es war ein Samstagnachmittag im Februar oder März, und wir beide hatten eine Einladung zu einer gemeinsamen Lesung aus unseren Werken in einer Bar im West Village. Ich hatte noch nie von Sachs gehört, aber die Frau am Telefon war zu hektisch, um meine Fragen zu beantworten. «Er schreibt Romane», sagte sie. «Sein erstes Buch ist vor zwei Jahren erschienen.» Ihr Anruf kam an einem Mittwochabend, nur drei Tage vor dem Termin der Lesung, und in ihrer Stimme klang etwas wie Panik an. Michael Palmer, der Dichter, der am Samstag eigentlich auftreten sollte, habe seine Reise nach New York soeben abgesagt, und sie wolle wissen, ob ich bereit sei, für ihn einzuspringen. Eine wenig schmeichelhafte Bitte, aber ich sagte trotzdem zu. Damals hatte ich noch nicht sehr viel veröffentlicht – sechs oder sieben Erzählungen in kleineren Zeitschriften, eine Handvoll Artikel und Rezensionen –, und es war nicht gerade so, dass sich die Leute um öffentliche Lesungen von mir rissen. Also ging ich auf das Angebot der entnervten Dame ein, um nun meinerseits für die nächsten zwei Tage in Panik zu geraten: Verzweifelt suchte ich in der winzigen Welt meiner gesammelten Erzählungen nach irgendetwas, das mich nicht in Verlegenheit bringen würde, nach irgendeinem Stück Text, der gut genug wäre, ihn einem Raum voller Fremder vorzutragen. Am Freitagnachmittag ging ich in mehrere Buchhandlungen und fragte nach Sachs’ Roman. Es schien nur richtig, mich ein wenig mit seinem Werk vertraut zu machen, bevor ich ihn kennenlernte, aber das Buch war schon zwei Jahre alt und daher nirgends mehr vorrätig.
Wie der Zufall es wollte, fand die Lesung gar nicht statt. Freitagnacht fuhr ein gewaltiger Sturm aus dem Mittelwesten übers Land, und am Samstagmorgen lag die Stadt unter einer halbmeterhohen Schneedecke. Nun wäre es vernünftig gewesen, Kontakt mit der Frau aufzunehmen, die mich angerufen hatte, aber dummerweise hatte ich vergessen, sie nach ihrer Nummer zu fragen, und als ich um ein Uhr noch immer nichts von ihr gehört hatte, meinte ich, so schnell wie möglich in die City fahren zu müssen. Ich packte mich in Wintermantel und Galoschen ein, schob das Manuskript meiner letzten Erzählung in eine der Manteltaschen und stapfte dann den Riverside Drive entlang zur U-Bahn-Station Ecke 116th Street und Broadway. Die Wolken verzogen sich allmählich, aber die Straßen und Bürgersteige lagen noch immer voller Schnee, es herrschte kaum Verkehr. Ein paar Autos und Lastwagen standen verlassen in hohen Schneewehen am Bordstein, und nur gelegentlich krochen vereinzelte Fahrzeuge die Straße herauf und gerieten sofort ins Rutschen, wenn der Fahrer an einer roten Ampel zu halten versuchte. Normalerweise hätte ich dieses Chaos genossen, doch an diesem Tag war das Wetter so widerlich, dass ich kaum die Nase aus dem Schal hob. Die Temperatur war seit Sonnenaufgang stetig gefallen, und jetzt war es bitterkalt, vom Hudson her bliesen heftige Windstöße, gewaltige Böen, die mich buchstäblich die Straße hinaufschoben. Völlig durchgefroren erreichte ich die U-Bahn-Station, aber die Züge schienen trotz allem noch zu fahren. Das überraschte mich, und als ich die Treppe hinabstieg und mein Ticket löste, nahm ich es als Hinweis darauf, dass die Lesung wohl doch stattfinden werde.
Um zehn nach zwei stand ich vor Nashe’s Tavern. Das Lokal hatte geöffnet, aber nachdem meine Augen sich an das Dunkel gewöhnt hatten, sah ich, dass niemand da war. Hinter der Theke stand ein Barkeeper in weißer Schürze und rieb methodisch mit einem roten Handtuch Schnapsgläser trocken. Er war ein kräftiger Mann um die vierzig; als ich näher trat, musterte er mich sorgfältig, fast als bedaure er diese Unterbrechung seiner Einsamkeit.
«Soll hier nicht in zwanzig Minuten eine Lesung stattfinden?», fragte ich. Noch während die Worte aus meinem Mund drangen, kam ich mir töricht vor.
«Ist abgesagt worden», antwortete der Barkeeper. «Bei dem Matsch da draußen hätte das auch nicht viel Sinn gehabt. Gedichte sind was Schönes, aber wer will sich dafür schon den Arsch abfrieren.»
Ich nahm auf einem Barhocker Platz und bestellte einen Bourbon. Ich schlotterte noch immer von meiner Wanderung durch den Schnee und brauchte etwas zum Aufwärmen, ehe ich mich wieder nach draußen wagte. Mit zwei Schlucken kippte ich den Drink hinunter und ließ mir dann noch einen nachschenken, weil der erste so gut geschmeckt hatte. Während dieses zweiten Bourbons trat ein neuer Kunde in die Bar. Ein großer, außerordentlich dünner junger Mann mit schmalem Gesicht und braunem Vollbart. Ich sah zu, wie er ein paarmal mit den Stiefeln auf den Boden stampfte, seine behandschuhten Hände zusammenschlug und dann, vor Kälte schnatternd, hörbar ausatmete. Er machte zweifellos einen komischen Eindruck – dieser lange Mann in seinem mottenzerfressenen Mantel, mit einer Baseballmütze der New York Knicks auf dem Kopf und einem marineblauen Schal, den er sich, um seine Ohren zu schützen, um die Mütze gewickelt hatte. Er sieht aus wie jemand, der schlimme Zahnschmerzen hat, dachte ich, oder wie ein halb verhungerter russischer Soldat, den es an den Stadtrand von Stalingrad verschlagen hat. Diese beiden Bilder kamen mir schnell hintereinander, erst das komische, dann das verzweifelte. Trotz seiner lächerlichen Aufmachung lag in seinem Blick etwas Grimmiges, eine Intensität, die jede Anwandlung, ihn auszulachen, im Keim erstickte. Vielleicht ähnelte er Ichabod Crane, aber er war auch der Sklavenbefreier John Brown, und sobald man nicht mehr nur seinen Aufzug und die schlaksige Gestalt eines Basketballangreifers betrachtete, begann man einen ganz anderen Menschen zu sehen: einen Mann, dem nichts entging, einen Mann, in dessen Kopf sich tausend Räder drehten.
Er blieb kurz im Eingang stehen und taxierte das leere Lokal, dann trat er an den Barkeeper heran und stellte mehr oder weniger die gleiche Frage wie ich zehn Minuten zuvor. Der Barkeeper gab ihm mehr oder weniger die gleiche Antwort wie mir, wies dabei aber jetzt mit dem Daumen ans Ende der Theke in meine Richtung. «Der da ist auch wegen der Lesung hier», sagte er. «Schätze, Sie beide sind die Einzigen in ganz New York, die verrückt genug waren, heute aus dem Haus zu gehen.»
«Nicht ganz», sagte der Mann mit dem Schal um den Kopf. «Sie haben vergessen, sich selbst mitzuzählen.»
«Nicht vergessen», sagte der Barkeeper. «Aber ich zähle nun mal nicht. Ich muss ja hier sein – Sie nicht. So meine ich das. Wenn ich nicht hier auftauche, verliere ich meinen Job.»
«Aber ich bin auch wegen eines Jobs hier», sagte der andere. «Man hat mir fünfzig Dollar versprochen. Jetzt ist die Lesung abgesagt, und ich bekomme nicht mal das Fahrgeld ersetzt.»
«Na, das ist was anderes», sagte der Barkeeper. «Wenn Sie selber hier lesen sollten, zählen Sie auch nicht, schätz ich.»
«Bleibt also nur ein einziger Mensch in der ganzen Stadt, der ausgegangen ist, ohne es zu müssen.»
«Falls Sie von mir reden», mischte ich mich nun endlich ein, «ist Ihre Liste bei null angelangt.»
Der Mann mit dem Schal um den Kopf drehte sich lächelnd zu mir um. «Ach, dann sind Sie also Peter Aaron, stimmt’s?»
«Könnte man meinen», sagte ich. «Aber wenn ich Peter Aaron bin, dann müssen Sie Benjamin Sachs sein.»
«Volltreffer», erwiderte Sachs und stieß ein kurzes ironisches Lachen aus. Er kam herüber und streckte mir seine rechte Hand entgegen. «Freut mich sehr, dass Sie hier sind», sagte er. «Ich habe kürzlich was von Ihnen gelesen und hab mich schon darauf gefreut, Sie kennenzulernen.»
Und so begann unsere Freundschaft – fünfzehn Jahre ist es her, dass wir uns in dieser verlassenen Bar gegenseitig Drinks ausgaben, bis wir beide kein Geld mehr hatten. Drei oder vier Stunden müssen wir dort gesessen haben, denn ich erinnere mich noch deutlich, dass es, als wir schließlich in die Kälte hinaustorkelten, bereits dunkel geworden war. Jetzt, da Sachs tot ist, ist es mir unerträglich, mich daran zu erinnern, wie er damals war, an seine Großzügigkeit, seinen Humor, seine Intelligenz, an all das, was bei unserer ersten Begegnung aus ihm herausströmte. Den Tatsachen zum Trotz habe ich Schwierigkeiten, mir vorzustellen, dass der Mensch, mit dem ich an jenem Tag in der Bar gesessen habe, derselbe sein soll, der sich da letzte Woche umgebracht hat. Die Reise muss für ihn so lang gewesen sein, so entsetzlich, so voller Leid, dass mir beim Gedanken daran schier die Tränen kommen wollen. In fünfzehn Jahren ist Sachs von einem Ende seines Ich ans andere gereist, und als er diesen letzten Ort erreichte, dürfte er selbst nicht mehr gewusst haben, wer er eigentlich war. Inzwischen hatte er eine so große Strecke zurückgelegt, dass ihm wohl kaum noch bewusst war, wo er aufgebrochen war.
«Im Allgemeinen gelingt es mir, mich auf dem Laufenden zu halten», sagte er, während er den Schal unterm Kinn löste und ihn zusammen mit der Baseballmütze und dem langen braunen Mantel ablegte. Er warf den ganzen Haufen auf den Hocker neben ihm und setzte sich. «Bis vor zwei Wochen hatte ich noch nie von Ihnen gehört. Und jetzt scheinen Sie plötzlich überall aufzutauchen. Als Erstes bin ich auf Ihren Aufsatz über Hugo Balls Tagebücher gestoßen. Ein ausgezeichneter kleiner Artikel, habe ich gedacht; geschickt und gut argumentiert, eine bewundernswerte Antwort auf die entscheidenden Probleme. Ich stimmte nicht in allen Punkten mit Ihnen überein, aber Sie haben Ihre Sache gut verfochten, und die Ernsthaftigkeit Ihres Standpunktes schien mir aller Achtung wert. Der Mann glaubt zu sehr an die Kunst, habe ich mir gesagt, aber immerhin weiß er, wo er steht, und ist klug genug, zu erkennen, dass man die Sache auch anders sehen kann. Drei oder vier Tage danach kam mit der Post eine Zeitschrift, und als ich sie aufschlage, sehe ich als Erstes einen Text mit Ihrem Namen darüber. ‹Das geheime Alphabet›, wo es um diesen Studenten geht, der immer irgendwelche Botschaften an Hauswänden zu lesen glaubt. Hat mir sehr gefallen. Hat mir so gut gefallen, dass ich es dreimal gelesen habe. Wer ist dieser Peter Aaron?, habe ich mich gefragt, und wo mag er stecken? Und als mich Kathy Wie-heißt-sie-noch-gleich anrief und sagte, Palmer wolle sich vor der Lesung drücken, habe ich ihr vorgeschlagen, es mal bei Ihnen zu versuchen.»
«Dann sind also Sie dafür verantwortlich, dass man mich hierhergelockt hat», sagte ich, zu betäubt von seinen überschwänglichen Komplimenten, um auf etwas Besseres als diese schwache Antwort zu kommen.
«Na ja, zugegeben, es ist nicht so gelaufen, wie wir es uns vorgestellt haben.»
«Vielleicht ist das ja gar nicht so schlecht», sagte ich. «So brauche ich wenigstens nicht im Dunkeln zu stehen und meine Knie schlottern zu hören. Das hat auch was für sich.»
«Mutter Natur als Retterin.»
«Genau. Unverhofft kommt oft.»
«Freut mich, dass Ihnen die Tortur erspart geblieben ist. Ich hätte ungern mein Gewissen damit belastet.»
«Trotzdem danke, dass Sie mir die Einladung verschafft haben. Das bedeutet mir sehr viel, und ich bin Ihnen wahrhaftig sehr dankbar dafür.»
«Ich habe das nicht getan, weil ich auf Ihren Dank aus bin. Ich war neugierig, und früher oder später hätte ich selbst Kontakt mit Ihnen aufgenommen. Aber dann ergab sich diese Gelegenheit, und ich dachte mir, damit könnte ich eleganter ans Ziel kommen.»
«Und da bin ich nun und sitze mit Admiral Peary persönlich am Nordpol. Da will ich Ihnen wenigstens einen Drink spendieren.»
«Das Angebot nehme ich an, aber nur unter einer Bedingung. Sie müssen vorher meine Frage beantworten.»
«Gern, wenn Sie mir die Frage nennen. Ich entsinne mich nicht, dass Sie mir eine gestellt hätten.»
«Aber ja doch. Ich habe Sie gefragt, wo Sie gesteckt haben. Vielleicht irre ich mich, aber ich vermute, Sie sind noch nicht allzu lange in New York.»
«Ich habe früher hier gelebt, bin dann aber weggezogen. Ich bin erst vor fünf, sechs Monaten zurückgekommen.»
«Und wo sind Sie gewesen?»
«In Frankreich. Fast fünf Jahre habe ich dort gelebt.»
«Das wäre also geklärt. Aber was hat Sie denn bloß nach Frankreich gezogen?»
«Es gab keinen besonderen Grund. Ich wollte einfach irgendwo anders sein als hier.»
«Sie haben also nicht studiert? Nicht für die UNESCO oder irgendeine dieser aufgeblasenen internationalen Anwaltskanzleien gearbeitet?»
«Nein, nichts dergleichen. Meistens habe ich von der Hand in den Mund gelebt.»
«Also das alte Exil-Abenteuer? Junger amerikanischer Schriftsteller geht nach Paris, um Kultur und schöne Frauen kennenzulernen, um selbst zu erleben, wie schön es ist, in Cafés zu sitzen und starke Zigaretten zu rauchen.»
«Auch das war es wohl nicht. Ich hatte einfach das Gefühl, dass ich Raum zum Atmen brauchte. Für Frankreich habe ich mich entschieden, weil ich Französisch konnte. Hätte ich Serbokroatisch gekonnt, wäre ich wahrscheinlich nach Jugoslawien gegangen.»
«Also sind Sie losgezogen. Ohne besonderen Grund, wie Sie es ausdrücken. Gab es irgendeinen besonderen Grund für Ihre Rückkehr?»
«Eines Morgens im vorigen Sommer bin ich aufgewacht und habe mir gesagt, es ist Zeit, nach Hause zu fahren. Einfach so. Ich hatte plötzlich das Gefühl, ich sei lange genug dort gewesen. Zu viele Jahre ohne Baseball, nehme ich an. Wenn man ständig auf double plays und home runs verzichten muss, trocknet einem allmählich der Verstand ein.»
«Und Sie haben nicht vor, wieder wegzugehen?»
«Nein, ich glaube nicht. Was auch immer ich damit beweisen wollte, scheint mir jetzt nicht mehr wichtig.»
«Vielleicht haben Sie es bereits bewiesen.»
«Schon möglich. Vielleicht muss man auch die Frage anders stellen. Vielleicht habe ich sie die ganze Zeit falsch gestellt.»
«Na schön», sagte Sachs und schlug unvermittelt mit der Hand auf die Theke. «Jetzt nehme ich den Drink. So langsam fühle ich mich befriedigt, und davon werde ich immer durstig.»
«Was möchten Sie denn?»
«Das Gleiche wie Sie», sagte er, ohne mich überhaupt zu fragen, was das war. «Und da der Barkeeper ohnehin herkommen muss, lassen Sie sich auch gleich noch einen einschenken. Jetzt ist ein Toast angebracht. Immerhin sind Sie in die Heimat zurückgekehrt, und wir müssen Sie stilgerecht in Amerika willkommen heißen.»
Ich glaube, noch nie hat mich jemand so vollkommen entwaffnet wie Sachs an jenem Nachmittag. Er drang vom ersten Augenblick an auf mich ein, stürmte meine geheimsten Verliese und Schlupfwinkel und stieß eine verschlossene Tür nach der anderen auf. Dieses Vorgehen war, wie ich später herausfand, typisch für ihn, ein nahezu klassisches Beispiel seiner Art, sich durch die Welt zu schlagen. Kein Herumreden, keine Förmlichkeiten – einfach die Ärmel hochkrempeln, und los ging’s. Er schaffte es mühelos, mit völlig Fremden ins Gespräch zu kommen, sich mit Fragen auf sie zu stürzen, die kein anderer zu stellen gewagt hätte, und hatte immer wieder Erfolg damit. Man hatte das Gefühl, dass er sich an keinerlei Spielregeln hielt, dass er, da er selbst völlig unbefangen war, von allen anderen die gleiche Offenherzigkeit erwartete. Und dennoch hatten seine bohrenden Fragen immer etwas Unpersönliches, als versuche er nicht so sehr, eine menschliche Beziehung zu einem herzustellen, als vielmehr, nur für sich selbst irgendein intellektuelles Problem zu lösen. Dies verlieh seinen Fragen eine gewisse abstrakte Färbung, und dies wiederum flößte Vertrauen ein, machte einen bereit, ihm Dinge zu erzählen, die man sich zuweilen noch nicht einmal selbst eingestanden hatte. Er bildete sich nie ein Urteil über die Leute, die er kennenlernte, behandelte niemanden als Unterlegenen, machte keine Unterschiede zwischen den Menschen nur aufgrund ihrer gesellschaftlichen Stellung. Ein Barkeeper interessierte ihn ebenso sehr wie ein Schriftsteller, und wäre ich an diesem Tag nicht dort aufgetaucht, hätte er wahrscheinlich mit ebendem Mann, mit dem ich keine zehn Worte gewechselt hatte, zwei Stunden lang gesprochen. Sachs setzte bei seinen Gesprächspartnern automatisch hohe Intelligenz voraus und vermittelte ihnen damit ein Gefühl ihrer eigenen Würde und Bedeutung. Ich glaube, diese Eigenschaft habe ich am meisten an ihm bewundert, diese Naturbegabung, aus anderen das Beste herauszuholen. Oft machte er den Eindruck eines verschrobenen Sonderlings, eines geistesabwesenden Tölpels, der immerzu in obskure Gedanken und Träumereien vertieft war, und doch verblüffte er einen immer wieder mit hundert kleinen Zeichen seiner Aufmerksamkeit. Wie jedem anderen auf der Welt, nur vielleicht ein wenig mehr, gelang es ihm, eine Fülle von Widersprüchen in einer einzigen, nie nachlassenden Präsenz zu vereinen. Wo er auch sein mochte, stets schien er sich in seiner Umgebung wie zu Hause zu fühlen, und doch habe ich selten jemanden kennengelernt, der so schwerfällig, so unbeholfen und bei der Ausführung simpelster Tätigkeiten so hilflos gewesen wäre. Während unseres Gesprächs an jenem Nachmittag stieß er immer wieder seinen Mantel vom Barhocker auf den Boden. Das muss sechs oder sieben Mal passiert sein, und einmal, als er sich bückte, um ihn wieder aufzuheben, gelang es ihm sogar, mit dem Kopf an die Theke zu schlagen. Später kam ich jedoch dahinter, dass Sachs ein ausgezeichneter Sportler war. Er war bester Korbwerfer des Basketballteams seiner Highschool gewesen, und in allen Solopartien, die wir über die Jahre gegeneinander spielten, habe ich ihn höchstens ein- oder zweimal geschlagen. Beim Reden war er weitschweifig und nicht selten sentimental, beim Schreiben hingegen ausgesprochen präzise und ökonomisch und mit einer echten Begabung für das richtige Wort ausgestattet. Dass er überhaupt schrieb, war mir oft ein Rätsel. Er war viel zu weit weg davon, viel zu fasziniert von anderen Leuten, viel zu bereit, sich in die Menge zu mischen, um einer so einsamen Beschäftigung nachzugehen. Dabei störte ihn die Einsamkeit kaum, und er arbeitete stets mit ungeheurer Disziplin und Leidenschaft, wobei er sich manchmal wochenlang zurückzog, um ein Projekt zu beenden. In Anbetracht seiner Persönlichkeit und der einzigartigen Art und Weise, wie er die verschiedenen Seiten seiner selbst in Bewegung hielt, hätte man nicht vermutet, dass Sachs verheiratet war. Ihm schien alles zu fehlen, was für ein häusliches Leben nötig ist, seine Vorlieben schienen allzu demokratisch, als dass man ihm die Fähigkeit zu einem intimen Verhältnis mit einem einzigen Menschen zugetraut hätte. Aber Sachs hatte in jungen Jahren geheiratet, wesentlich früher als jeder andere meiner Bekannten, und er erhielt diese Ehe nahezu zwanzig Jahre lang lebendig. Dabei war Fanny nicht gerade eine Frau, die sonderlich zu ihm zu passen schien. Zur Not hätte ich ihn mir mit einer fügsamen, fürsorglichen Frau vorstellen können, einer jener Ehefrauen, die, ohne zu murren, im Schatten ihres Mannes bleiben und sich ganz der Aufgabe widmen, ihren Kindmann vor der rauen Wirklichkeit des Alltagslebens zu schützen. Aber Fanny war ganz anders. Sachs’ Ehepartnerin war ihm auf allen Gebieten gewachsen, eine komplexe und hochintelligente Frau, die ihr eigenes, unabhängiges Leben führte, und sie über all die Jahre zu halten gelang ihm nur, weil er hart daran arbeitete und weil er ein enormes Talent besaß, sich in sie einzufühlen und ihr seelisches Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Zweifellos war sein freundliches Wesen der Ehe förderlich, obwohl ich diesen Aspekt seines Charakters nicht überbetonen möchte. Bei aller Sanftheit konnte Sachs ein sturer Dogmatiker sein, und zuweilen erging er sich in wüsten Wutausbrüchen, in wirklich erschreckenden Tobsuchtsanfällen, die sich aber nicht gegen ihm Nahestehende richteten, sondern eher gegen die Welt im Allgemeinen. Er war entsetzt über die Dummheit der Welt, und unter seiner Unbeschwertheit und guten Laune spürte man gelegentlich ein ganzes Reservoir von Intoleranz und Verachtung. Fast alles, was er schrieb, hatte einen grämlichen, bissigen Unterton, und im Lauf der Jahre erwarb er sich den Ruf eines Unruhestifters. Und das zu Recht, nehme ich an, auch wenn dies letztlich nur einen kleinen Teil seiner Persönlichkeit ausmachte. Man sieht, es ist schwierig, ihn rundum stimmig zu beschreiben. Dafür war Sachs zu unberechenbar, zu geistreich und schlau; er hatte zu viele neue Ideen und konnte einfach nicht lange in einer Position verharren. Manchmal fand ich es ziemlich anstrengend, mit ihm zusammen zu sein, aber langweilig war es nie. Sachs hielt mich fünfzehn Jahre lang auf Trab, reizte und provozierte mich unablässig, und während ich jetzt hier sitze und aus ihm schlau zu werden versuche, vermag ich mir mein Leben ohne ihn kaum vorzustellen.
«Sie bringen mich da in eine ungünstige Lage», sagte ich und trank einen Schluck Bourbon aus meinem wiedergefüllten Glas. «Sie haben fast jedes Wort gelesen, das ich geschrieben habe, und ich habe noch nicht eine Zeile von Ihnen gesehen. Das Leben in Frankreich hat seine Vorteile, aber mit der amerikanischen Literatur auf dem Laufenden zu bleiben gehörte nicht dazu.»
«Viel verpasst haben Sie nicht», meinte Sachs. «Das können Sie mir glauben.»
«Trotzdem ist mir das ein bisschen peinlich. Abgesehen vom Titel weiß ich über Ihr Buch rein gar nichts.»
«Sie bekommen ein Exemplar von mir. Dann werden Sie keine Ausreden mehr haben, es nicht zu lesen.»
«Ich habe gestern in einigen Buchläden danach gesucht …»
«Lassen Sie nur, sparen Sie das Geld. Ich habe etwa hundert Freiexemplare und bin froh, wenn ich sie loswerde.»
«Falls ich nicht zu betrunken bin, werde ich noch heute Abend mit der Lektüre anfangen.»
«Das hat keine Eile. Schließlich ist es nur ein Roman, Sie sollten das nicht so ernst nehmen.»
«Romane nehme ich immer ernst. Besonders wenn Sie mir vom Verfasser geschenkt werden.»
«Na, dieser Verfasser hier war noch sehr jung, als er sein Buch geschrieben hat. Vielleicht zu jung. Manchmal bedauert er, dass es überhaupt erschienen ist.»
«Aber Sie hatten vor, heute Nachmittag daraus zu lesen. Da können Sie es doch nicht für schlecht halten.»
«Ich sage ja nicht, dass es schlecht ist. Es ist einfach nur jung. Zu literarisch, zu sehr von seiner eigenen Cleverness eingenommen. So etwas zu schreiben würde mir heute nicht mehr im Traum einfallen. Und wenn ich mich jetzt noch dafür interessiere, dann nur wegen des Ortes, an dem es entstanden ist. Das Buch selbst bedeutet mir nicht viel, aber an seinem Geburtsort hänge ich noch immer.»
«Und was für einer war das?»
«Ein Gefängnis. Ich habe das Buch im Gefängnis zu schreiben begonnen.»
«Sie meinen ein richtiges Gefängnis? Mit Zellen und Gitterfenstern? Mit einer Nummer vorne auf Ihrem Hemd?»
«Ja, ein richtiges Gefängnis. Das Bundesgefängnis in Danbury, Connecticut. Siebzehn Monate war ich in diesem Hotel zu Gast.»
«Großer Gott. Und wie sind Sie dort reingekommen?»
«Eigentlich ganz einfach. Nach der Einberufung habe ich den Wehrdienst verweigert.»
«Aus Gewissensgründen?»
«Ja, aber mein Antrag wurde abgelehnt. Sie kennen das ja sicher. Wenn man einer Religionsgemeinschaft angehört, die Pazifismus predigt und jeglichen Krieg ablehnt, dann besteht eine Chance, dass das respektiert wird. Aber ich bin weder Quäker noch Zeuge Jehovas, und ich bin auch nicht grundsätzlich gegen den Krieg. Nur gegen diesen Krieg. Und leider war das genau der, bei dem ich mitmachen sollte.»
«Aber warum ins Gefängnis? Es gab doch andere Möglichkeiten. Kanada, Schweden, ja sogar Frankreich. Tausende von Leuten sind in diese Länder gegangen.»
«Weil ich ein sturer Bock bin, deshalb. Ich wollte nicht weglaufen. Ich hielt es für meine Pflicht, aufzustehen und denen zu sagen, was ich dachte. Und das konnte ich nur, wenn ich bereit war, dafür geradezustehen.»
«Also haben die sich Ihre hehren Bekenntnisse angehört und Sie dann trotzdem eingesperrt.»
«Natürlich. Aber das war es mir wert.»
«Schon möglich. Aber diese siebzehn Monate müssen furchtbar gewesen sein.»
«Nicht so schlimm, wie man meinen sollte. Man braucht sich dadrin um nichts zu sorgen. Man bekommt drei Mahlzeiten am Tag, man muss sich nicht um seine Wäsche kümmern, die ganze Lebensplanung wird einem abgenommen. Sie würden staunen, wie viel Freiheit einem das gibt.»
«Freut mich, dass Sie darüber scherzen können.»
«Ich scherze nicht. Na ja, vielleicht ein bisschen. Aber gelitten habe ich dort nicht, jedenfalls nicht so, wie Sie denken mögen. Danbury ist nicht so ein Albtraum von Gefängnis wie Attica oder San Quentin. Die meisten Leute dort sitzen wegen irgendwelcher Wirtschaftsvergehen – Unterschlagung, Steuerhinterziehung, Scheckfälschung und dergleichen. Ich hatte Glück, dorthin zu kommen, aber mein größter Vorteil war, dass ich darauf vorbereitet war. Mein Fall zog sich monatelang hin, und da ich von Anfang an wusste, dass ich verlieren würde, hatte ich Zeit genug, mich an den Gedanken der Haft zu gewöhnen. Ich war keiner von diesen Schlappschwänzen, die dauernd herumjammern und ihre Tage zählen und jedes Mal vor dem Zubettgehen ein Kästchen im Kalender auskreuzen. Als ich da reinkam, sagte ich mir: Das ist es also, hier lebst du jetzt, Alter. Die Grenzen meiner Welt waren geschrumpft, aber ich war noch am Leben, und was bedeutete es schon, wo ich war, solange ich noch atmen und furzen und meinen Gedanken nachhängen konnte?»
«Seltsam.»
«Nein, gar nicht seltsam. Eher wie in dem alten Henny-Youngman-Witz. Der Ehemann kommt nach Hause, geht ins Wohnzimmer und erblickt im Aschenbecher eine brennende Zigarre. Er fragt seine Frau, was da vorgeht, aber die stellt sich ahnungslos. Immer noch argwöhnisch, beginnt der Mann das Haus zu durchsuchen. Als er ins Schlafzimmer kommt, macht er den Schrank auf und findet einen Fremden darin. ‹Was haben Sie in meinem Schrank verloren?›, fragt der Ehemann. ‹Keine Ahnung›, stottert der Fremde zitternd und schweißüberströmt. ‹Jeder muss doch irgendwo sein.›»
«Aha, verstehe. Trotzdem waren doch sicher einige unangenehme Typen mit Ihnen im Schrank. Das kann doch nicht immer sehr erfreulich gewesen sein.»
«Es gab einige heikle Augenblicke, das gebe ich zu. Aber ich habe gelernt, ganz gut damit fertigzuwerden. Es war die einzige Zeit in meinem Leben, wo mein komisches Aussehen sich als nützlich erwiesen hat. Keiner wusste, was er von mir halten sollte, und nach einer Weile konnte ich die meisten meiner Mitgefangenen davon überzeugen, dass ich spinne. Sie würden staunen, wie gründlich Sie in Ruhe gelassen werden, wenn man Sie für einen Irren hält. Wenn man erst diesen verrücken Blick draufhat, ist man gegen jeden Ärger gefeit.»
«Und das alles, weil Sie Ihren Grundsätzen nicht untreu werden wollten.»
«So schlimm war es gar nicht. Wenigstens wusste ich immer, warum ich dort war. Hatte es nicht nötig, mich mit Reue zu quälen.»
«Ich hatte vergleichsweise Glück. Ich bin wegen Asthma durch die Tauglichkeitsprüfung gerasselt und musste nie wieder darüber nachdenken.»
«Und so sind Sie nach Frankreich gegangen und ich ins Gefängnis. Wir sind beide irgendwohin gegangen, und beide sind wir zurückgekommen. Soweit ich das beurteilen kann, sitzen wir jetzt im selben Boot.»
«So kann man das auch sehen.»
«Man kann es gar nicht anders sehen. Unsere Methoden waren verschieden, haben aber zu exakt denselben Ergebnissen geführt.»
Wir bestellten die nächste Runde. Danach noch eine und noch eine und schließlich noch eine. Zwischendurch spendierte uns der Barkeeper zwei Drinks auf Kosten des Hauses – eine freundliche Geste, die wir prompt erwiderten, indem wir ihn ermunterten, sich selbst einen einzuschenken. Dann begann die Kneipe sich langsam zu füllen, und wir verzogen uns an einen Tisch in der hintersten Ecke des Raumes. Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, worüber wir sprachen – jedenfalls habe ich den Beginn jener Unterhaltung wesentlich besser behalten als ihr Ende. In der letzten halben oder Dreiviertelstunde hatte ich so viel Bourbon intus, dass ich buchstäblich doppelt sah. Das war mir noch nie passiert, und ich hatte keine Ahnung, wie ich das wieder abstellen sollte. Immer wenn ich Sachs ansah, war er zweimal vorhanden. Blinzeln half nichts, und vom Kopfschütteln wurde mir nur schwindlig. Sachs hatte sich in einen Mann mit zwei Köpfen und zwei Mündern verwandelt, und ich weiß noch, wie er mich, als ich mich zum Gehen erhob, in seinen vier Armen auffing und vor einem Sturz bewahrte. Vermutlich hatte es sein Gutes, dass an diesem Nachmittag so viele von ihm anwesend waren. Ich muss inzwischen eine ziemliche Bettschwere gehabt haben, und ein Mann allein hätte mich wohl kaum tragen können.
Ich kann nur von Dingen sprechen, die ich weiß, von Dingen, die ich mit eigenen Augen gesehen und mit eigenen Ohren gehört habe. Mit Ausnahme von Fanny dürfte ich Sachs nähergestanden haben als irgendjemand sonst, aber das macht mich noch nicht zum Experten für die Einzelheiten seines Lebens. Als ich ihn kennenlernte, ging er bereits auf die dreißig zu, und keiner von uns hielt sich lange mit Erzählungen über seine Vergangenheit auf. Der Großteil seiner Kindheit liegt für mich im Dunkeln, und abgesehen von einigen beiläufigen Bemerkungen, die er im Lauf der Jahre über seine Eltern und seine Schwestern fallenließ, weiß ich von seiner Familie so gut wie nichts. Unter anderen Umständen würde ich jetzt versuchen, mit manchen dieser Leute zu reden, und mich bemühen, so viele Lücken auszufüllen wie möglich. Doch meine Lage gestattet mir nicht, mich auf die Suche nach Sachs’ Grundschullehrern und Highschool-Freunden zu begeben und Interviews mit seinen Vettern, College-Kommilitonen und Mitgefangenen zu führen. Dazu ist keine Zeit, und da ich gezwungen bin, schnell zu arbeiten, kann ich nur auf meine eigenen Erinnerungen zurückgreifen. Ich sage nicht, dass diesen Erinnerungen nicht zu trauen wäre, dass an dem, was ich über Sachs weiß, irgendetwas falsch oder zweifelhaft wäre, aber ich will dieses Buch nicht für etwas ausgeben, das es nicht ist. Es hat keinen endgültigen Charakter. Es ist weder eine Biographie noch ein erschöpfendes psychologisches Porträt, und selbst wenn Sachs mir während der Jahre unserer Freundschaft eine ganze Menge anvertraut hat, kann ich nicht behaupten, mehr als einen partiellen Einblick in seine Persönlichkeit gewonnen zu haben. Ich will die Wahrheit über ihn erzählen, ich will diese Erinnerungen so aufrichtig niederschreiben, wie es mir möglich ist, aber ich kann nicht ausschließen, dass ich mich irre, dass die Wahrheit völlig anders aussieht, als ich mir einbilde.
Er wurde am 6. August 1945 geboren. Ich erinnere mich an das Datum, weil er selbst es immer wieder erwähnte und sich in verschiedenen Gesprächen als «Amerikas erstes Hiroshima-Baby», «ein echtes Kind der Bombe» oder «den ersten Weißen des Atomzeitalters» bezeichnete. Er pflegte zu behaupten, der Arzt habe ihn genau in dem Augenblick auf die Welt geholt, da «Fat Man» aus dem Bauch der Enola Gay gekommen sei, aber das ist mir stets wie eine Übertreibung vorgekommen. Seine Mutter habe ich nur einmal gesehen, und da konnte sie sich nicht darauf besinnen, wann genau die Geburt stattgefunden hatte (sie habe vier Kinder, erzählte sie, und deren Geburten gingen ihr alle im Kopf durcheinander), aber immerhin bestätigte sie das Datum und fügte noch hinzu, sie erinnere sich genau, dass sie von Hiroshima erst nach der Geburt ihres Sohnes erfahren habe. Sollte Sachs den Rest erfunden haben, so war dies von seiner Seite her lediglich harmlose Mythenbildung. Er war ganz groß darin, Fakten in Symbole zu verwandeln, und da ihm Fakten stets in Hülle und Fülle zur Verfügung standen, fiel es ihm leicht, seinen Zuhörer aus einem unerschöpflichen Vorrat seltsamer historischer Verknüpfungen damit zu bombardieren, wobei er weit hergeholte Personen und Ereignisse miteinander in Verbindung brachte. Einmal zum Beispiel erzählte er mir, dass Mrs. Jefferson Davis, die Witwe des Konföderationspräsidenten, als Kropotkin in den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts zum ersten Mal in die Vereinigten Staaten gekommen sei, um ein Treffen mit dem berühmten Anarchistenführer gebeten habe. Das war schon reichlich bizarr, meinte Sachs, aber wie soll man es nennen, dass nur Minuten nach Kropotkins Ankunft in Mrs. Davis’ Haus niemand anders als Booker T. Washington ebenfalls dort auftauchte? Er erklärte, er suche nach dem Mann, der Kropotkin hierherbegleitet habe (ein gemeinsamer Freund), und als Mrs. Davis erfuhr, dass Washington unten in der Eingangshalle stand, ließ sie ihn zu sich hereinbitten. Und so saß dieses unwahrscheinliche Trio für die nächste Stunde gemeinsam beim Tee und machte höfliche Konversation: der russische Adlige, der jede ordentliche Regierung zu stürzen trachtete, der ehemalige Sklave, der zum Schriftsteller und Pädagogen geworden war, und die Frau des Mannes, der Amerika in den blutigsten Krieg seiner Geschichte geführt hatte, um die Sklaverei zu verteidigen. Nur Sachs konnte solche Dinge wissen. Nur Sachs konnte einem mitteilen, dass die Filmschauspielerin Louise Brooks, als sie zu Beginn des Jahrhunderts in einer Kleinstadt in Kansas aufwuchs, mit Vivian Vance zu spielen pflegte, ebenjener Frau, die dann später der Star der I Love Lucy-Show wurde. Die Entdeckung erregte ihn geradezu: dass die beiden Aspekte der amerikanischen Frau – der Vamp und die Schreckschraube, der geile Sexteufel und die schlampige Hausfrau – an ein und demselben Ort angefangen hatten, auf ein und derselben staubigen Straße irgendwo mitten in Amerika. Sachs liebte solche Ironien des Schicksals, die gewaltigen Torheiten und Widersprüche der Geschichte und überhaupt die Art und Weise, wie Tatsachen sich unablässig selbst auf den Kopf stellten. Durch Einverleibung all dieser Tatsachen vermochte er die Welt zu lesen wie ein Werk der Phantasie; er machte verbürgte Ereignisse zu literarischen Symbolen, zu Metaphern, die auf irgendein dunkles, kompliziertes, im Realen verankertes Muster hinwiesen. Ich war mir nie ganz sicher, wie ernst er dieses Spiel nahm, aber er spielte es oft, und manchmal schien es mir fast so, als wäre er nicht in der Lage, sich zu bremsen. Auch die Sache mit seiner Geburt entsprang diesem Drang. Einerseits war es eine Art Galgenhumor, andererseits aber auch der Versuch, sich selbst zu definieren, eine Methode, sich in Beziehung zu den Schrecknissen seiner Zeit zu setzen. Sachs sprach häufig von der «Bombe». Sie war für ihn eine zentrale Tatsache dieser Welt, eine äußerste geistige Grenzlinie, und in seinen Augen trennte sie uns von allen anderen Generationen der Geschichte. Sobald wir einmal die Macht erlangt hätten, uns selbst zu vernichten, sei bereits die Idee des menschlichen Lebens eine andere geworden; selbst unsere Atemluft sei vom Gestank des Todes verseucht. Sachs war wohl kaum der Erste, der dies entdeckt hatte, aber wenn man bedenkt, was ihm vor neun Tagen zugestoßen ist, hat seine Obsession doch etwas Unheimliches, als wäre sie eine Art tödlicher Witz gewesen, ein verqueres Wort, das sich in ihm festfraß und dann unkontrollierbar fortwucherte.
Sein Vater war osteuropäischer Jude, seine Mutter irische Katholikin. Wie die meisten amerikanischen Familien hatte die Not sie im 19. Jahrhundert hierher verschlagen (die Große Hungersnot der vierziger Jahre, die Pogrome der achtziger Jahre), doch über diese rudimentären Einzelheiten hinaus weiß ich von Sachs’ Vorfahren nichts. Er pflegte gern zu sagen, die Familie seiner Mutter sei von einem Dichter nach Boston gebracht worden, aber das war nur eine Anspielung auf Sir Walter Raleigh, den Mann, der die Kartoffel und damit auch die Kartoffelpest eingeführt hatte, die dann dreihundert Jahre später jene Hungersnot auslöste. Über die Familie seines Vaters erzählte er mir einmal, sie sei nach New York gekommen, weil Gott gestorben war. Dies war auch so eine seiner rätselhaften Anspielungen, und solange man die kindliche Logik dieser Behauptung nicht durchschaute, konnte man nichts damit anfangen. Gemeint war Folgendes: Die Pogrome begannen nach dem Attentat auf Zar Alexander II.; Alexander war von russischen Nihilisten getötet worden; die Nihilisten waren Nihilisten, weil sie nicht an die Existenz Gottes glaubten. Letzten Endes also eine simple Gleichung, die aber nur zu lösen war, wenn man die in der Mitte fehlenden Glieder einsetzen konnte. Sachs’ Bemerkung war so ähnlich, als ob jemand sagen würde, das Königreich sei verlorengegangen, weil ein Hufnagel gefehlt habe. Kennt man das Gedicht, kommt man dahinter. Wenn nicht, dann nicht.