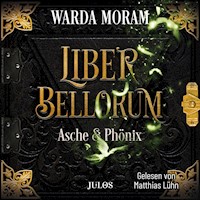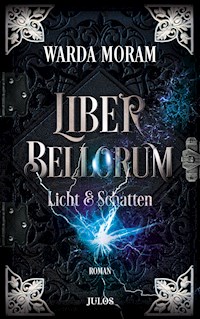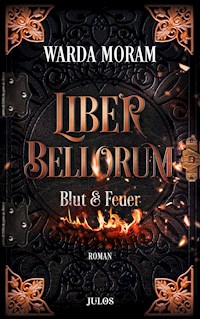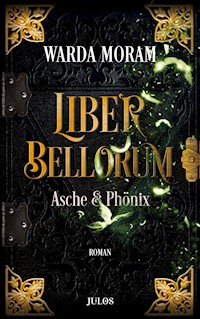
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Mankau Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Liber Bellorum
- Sprache: Deutsch
"Der Grat zwischen Licht und Dunkel ist schmal. Und genau dort an der Grenze, wo die grauen Schatten herrschen, endet die Vergangenheit und beginnt die Zukunft. Gegenwart ist eine Illusion, die Faszination des Moments hat sie geschaffen. Doch wird jeder Moment, im selben Augenblick, in dem er passiert, Teil der Vergangenheit, die uns immer wieder einholt. Blickt zurück und ihr werdet sie sehen – blickt nach vorne und dort wird sie ebenfalls sein. Die Zeit ist eine grausame Freundin. Und eine mächtige Feindin. Und letzten Endes bekommt sie immer ihren Willen." Leviathan Ein hinterhältiger Mord bringt das unsichere Bündnis zwischen Allianz und Schattenclan ins Wanken. Als Schattenfürst Kyle der Allianz Rache schwört, schwindet die letzte Hoffnung auf eine diplomatische Lösung. Doch höhere Mächte haben ihre Finger mit im Spiel. Halbvergessene Legenden enthüllen ihren wahren Kern, und eine uralte Prophezeiung droht sich zu erfüllen, als das Land im Krieg versinkt. Lässt das Schicksal noch mit sich verhandeln?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 450
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Warda Moram
LIBER BELLORUM
ASCHE UND PHÖNIX
Band III
IMPRESSUM
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Warda Moram
LIBER BELLORUM
ASCHE UND PHÖNIX
BAND III
E-Book (epub): ISBN 978-3-86374-635-3(Druckausgabe: ISBN 978-3-86374-633-9, 1. Auflage 2022)
Mankau Verlag GmbH
D – 82418 Murnau a. Staffelsee
Im Netz: www.mankau-verlag.de
Soziale Netzwerke: www.mankau-verlag.de/forum
Bilder: © stock.adobe.com (Hintergrund Innenklappen, 318/319, 320)
Lektorat: Julia Feldbaum, www.redaktionsbuero-feldbaum.deEndkorrektorat: Susanne Langer-Joffroy M.A., GermeringCover/Umschlag: Guter Punkt GmbH & Co. KG, München, unterVerwendung von Bildern von istock / Getty Images PlusLayout/Satz Innenteil: Mankau Verlag GmbH
Illustrationen: Mankau Verlag
Für Arnan,der mich aufgerichtet hat
INHALT
DAS ERBE DES JÄGERS
AM ENDE ALLER TRÄUME
SKLAVEN DER ZEIT
OFFENBARUNG
MASKENFALL
NEUE STIMME
BOTSCHAFT
DAS LICHT EINER KERZE
KALTER WINTER
DAS ERBE DES JÄGERS
Leviathan, mein guter Leviathan.Du warst mir immer ein Freund, ein Bruder.Sie sagen, du wärst ein Dämon geworden.Sie sagen, du hättest deine Seele verloren.Sie sagen, du wärst längst tot.Was ist nur aus dir geworden, Leviathan? Du warst mir immer ein Freund, ein Bruder.Leviathan, mein guter Leviathan. Warum sprichst du nicht mehr?
Epistulae Exustae, Kapitel 103
Als die ersten Sterne zwischen den herbstkahlen Ästen der Bäume aufleuchteten, fing sie an, nervös zu werden. Melenis versuchte verzweifelt, sich abzulenken, indem sie dem Fenster demonstrativ den Rücken zuwandte, ihren Lichtfunken heller aufleuchten ließ und das Buch in ihrem Schoß bestimmt zum vierten Mal aufschlug.
Raven hatte sie darauf vorbereitet, dass er vermutlich erst spät am Abend zurückkommen würde. Er hatte ihr gesagt, sie solle nicht auf ihn warten und ruhig schon schlafen gehen. Er hatte ihr versprochen, dass sie sich spätestens am nächsten Morgen sehen würden. Und immerhin war das doch schon etwas Gutes, ein Grund zur Beruhigung, denn immerhin war er nicht mehr tagelang weg, wenn er mal wieder eine Botschaft überbringen musste. Immerhin war er nur in der Akademie und nicht am anderen Ende der Welt. Trotzdem konnte sie es kaum erwarten, dass er endlich zurückkam.
Seufzend schlug Melenis das Buch zu, als sie es endgültig aufgab. Sie wusste unerträglich wenig darüber, was Raven eigentlich tat. Die Gerüchte von einem Bündnis mit dem Schattenclan und einem Krieg gegen die Götter wurden immer lauter. Die tot geglaubten Legenden und Märchen waren schlagartig zum Leben erwacht, die ganze Welt stand kopf, und er steckte mitten drin. Als Botschafter für den Frieden zwischen den ungleichen Parteien.
Vielleicht gefiel es ihr auch einfach nicht, dass er immer noch mit seinem Bruder zu tun hatte. Denn wenn man den Gerüchten glauben konnte, was das betraf, war ausgerechnet er der Anführer des Clans: Kyle der Wilde. Ein ausgesprochen treffender Titel.
Melenis schüttelte kurz die finsteren Gedanken ab, die sie bei der Erinnerung an Ravens Bruder überkamen, und stand vom Bett auf. Sie nahm den Stuhl von ihrem Schreibtisch, stellte ihn ans Fenster und setzte sich. Gedankenversunken stützte sie die Ellbogen auf dem Fensterbrett und das Kinn auf den Händen ab und sah nach draußen. Sehnsüchtig suchte sie den dunklen Wald nach einem Licht ab, aber nichts passierte. Niemand kam, und sie wurde müde. Das Mondlicht warf fahle Schatten auf den Waldboden, trübe Gespenster, die langsam durch die Dunkelheit krochen.
Es fiel ihr immer schwerer, die Augen offen zu halten. Irgendwann verschränkte sie die Arme auf dem Fensterbrett und legte erschöpft den Kopf darauf ab. Aber sie konnte sich nicht einfach friedlich schlafen legen, solange Raven nicht zu Hause war. Bestimmt verbrachte er einfach die Nacht in der Akademie, weil es zu spät geworden war, und sie machte sich völlig umsonst Sorgen um ihn.
Vielleicht sollte sie sich einfach mit ihrer Magie wach halten, wie so viele Blutmagier es regelmäßig taten. Meister Sangius war nicht hier, um es ihr zu verbieten, und Serin ebenso wenig. Und Saphira musste ja nichts davon erfahren, dass sie …
Melenis schrak auf, als ein plötzliches Geräusch die Stille durchbrach. Sie war einen Moment desorientiert, und ihr taten alle Knochen weh. Es dauerte lange, bis sie verstand, dass sie am Fenster eingeschlafen war – draußen wusch die Morgendämmerung bereits die Sterne vom Himmel. Sie rieb sich benommen das Gesicht und richtete sich langsam auf, wobei ihre steifen Gelenke ihr jede Bewegung unnötig erschwerten. Als sie daraufhin wieder aufsah, erschrak sie erneut, denn sie glaubte, im Zwielicht zwischen den Bäumen eine blutrote Robe vorbeihuschen zu sehen.
Erleichtert sprang sie auf und wollte Raven entgegenlaufen. Sie wollte sich ihm in die Arme werfen und ihn nie wieder loslassen. Aber auf halbem Wege durch ihr Zimmer rächte sich die Nacht am Fenster, denn plötzlich wurden ihr die Knie weich. Für einen Moment sah sie Sterne, und alles drehte sich, sodass sie sich an ihrem Schreibtisch abstützen musste. Das Schwindelgefühl hielt nur einen kurzen Moment an, aber es hatte Raven wohl genug Zeit gegeben, vor ihr die Haustür zu erreichen. Gerade als ihr Kreislauf sich wieder beruhigt hatte, klopfte es.
Melenis’ Freude über dieses Geräusch hielt nicht viel länger an als ihre kurze Benommenheit. Noch bevor sie überhaupt die Tür zu ihrem Zimmer erreicht hatte, hielt sie inne, denn mit einem Schlag kamen sämtliche Sorgen zurück, die sie sich während der Nacht gemacht hatte. Raven hatte keinen Grund anzuklopfen. Sie erinnerte sich nicht daran, ob er schon jemals angeklopft hatte, bevor er Saphiras Hütte betreten hatte. Welchen Grund sollte er also heute haben? Es sei denn, es war nicht Raven, der jetzt vor der Tür stand. Aber wer sollte es denn sonst sein? Warum sollte irgendjemand …?
Verunsichert öffnete Melenis ihre Zimmertür nur einen Spalt weit und warf einen verstohlenen Blick auf den Flur. Sie entdeckte sofort die Waldhexe an der Eingangstür, die sich gedämpft mit jemandem unterhielt. Und als sie sich letztendlich doch aus ihrem Zimmer wagte, erkannte sie auch, mit wem Saphira da sprach. Wie sie befürchtet hatte, war es nicht Raven.
„Meister Sangius?“, wunderte sie sich, womit sie den kühlen Blick des Altmagiers auf sich zog. Er stand gewohnt stolz und unnahbar auf der Türschwelle, die Schultern gestrafft, die Hände vornehm hinter dem Rücken verschränkt. An seinem unerschütterlichen Gesicht war nicht abzulesen, was sein unerwarteter Besuch zu bedeuten hatte. Als die Waldhexe sich zu ihr umdrehte, standen in ihren moosgrünen Augen jedoch unterdrückte Tränen.
„Oh, Melenis!“, rief sie aus und lief zu ihr, schlang die Arme um sie und drückte sie fest an sich.
Melenis konnte den Blick nicht vom ausdruckslosen Blutmeister abwenden. „Was hat das alles zu bedeuten? Was ist passiert?“, wollte sie wissen, aber niemand antwortete.
Es dauerte unerträglich lange, bis Saphira sich endlich von ihr löste. Die Hände immer noch auf ihren Schultern schob sie Melenis von sich und sah ihr tief in die Augen. „Es tut mir so leid, Melenis, es geht um Raven, er ist …“, begann die Waldhexe, unterbrach sich dann aber selbst.
Melenis wurde fast wahnsinnig vor Anspannung.
„Was?“, hakte sie ungeduldig nach. „Was ist mit ihm? Saphira, sag schon!“
„Hör zu, Melenis“, begann Saphira erneut, aber Sangius fiel ihr ins Wort.
„Er ist tot.“
Die Worte des Blutmeisters trafen Melenis wie ein Schlag ins Gesicht, und ihre schonungslose Deutlichkeit raubte ihr jegliche Selbstkontrolle. Sie glaubte zu hören, wie Saphira den Altmagier für seine Direktheit rügte und ihr daraufhin beruhigend zuredete, aber sie konnte ihre Worte nicht mehr verstehen.
„Das ist nicht wahr“, murmelte sie geistesabwesend, während sich in ihrem Inneren alles zusammenzog. Ihr stockte das Herz in der Brust, und sie bekam kaum noch Luft. Der Schwindel von vorhin kehrte zurück, und ihr wurde eiskalt. Ihr Körper versuchte verzweifelt, die Worte abzuwehren, ihr Verstand weigerte sich mit aller Macht, sie zu verstehen. „Das ist nicht wahr“, wiederholte sie, während sie beinahe flehend den steinernen Blick des Altmagiers erwiderte, als könnte sie ihn so dazu bewegen, seine Meinung zu ändern. Die Worte zurückzunehmen und alles ungeschehen zu machen.
Saphira sagte irgendetwas zu ihr, aber es war, als würde sie plötzlich eine fremde Sprache sprechen. Und als die Hexe erkannte, dass ihre Worte wirkungslos an Melenis abprallten, nahm sie sie erneut in die Arme und hielt sie einfach nur fest. Der Blutmeister verharrte noch einen Moment regungslos und schweigend in der Tür, dann nickte er ihr einmal kurz zu und zog sich zurück.
„Das ist nicht wahr!“, rief Melenis ihm mit bebender Stimme hinterher, aber es war zwecklos.
Die Kälte des frühen Herbstmorgens wehte durch die offen stehende Tür und bedeckte sie wie eine klamme Erkenntnis, bis sie vollständig davon eingehüllt war und es kein Entkommen mehr gab. Sie stand einfach nur da, unfähig, die Umarmung der Waldhexe zu erwidern, und brach hemmungslos in Tränen aus.
Serin saß an dem gläsernen Tisch bei seiner Balkontür. Er hatte die Arme mit den Ellbogen abgestützt und die Lippen auf die verschränkten Finger gesenkt. Sein ausdrucksloser Blick ruhte unbewegt auf der verschwommenen Spiegelung des Himmels in der Tischplatte.
Heute wehte zum ersten Mal nicht der Klang aufeinanderprallender Schwerter vom nahe gelegenen Kampfplatz zu ihm herauf, sogar in der Stadt schwiegen die Menschen, zogen sich in ihre Häuser zurück, denn sie ahnten, was Serin bereits wusste.
Er schloss für einen Moment die Augen, dann sah er wieder auf – regungslos, gedankenlos, sinnlos. Heute erst hatte die Nachricht aus Lunaris die Kaserne erreicht. Sie war knapp und deutlich gewesen. Ein toter Bote und Krieg mit dem Schattenclan. Und es war, als wäre erst dadurch der Feind greifbar geworden. Plötzlich war es kein Spiel mehr, kein kindisches Kräftemessen zwischen einem unbesiegbaren Bündnis und lächerlichen zehn Göttern.
Der Krieg war echt.
Der Gegner real.
Und er hatte endlich sein wahres Gesicht gezeigt.
Serins Blick verdunkelte sich unwillkürlich und mit ihm seine Gedanken. Ein Feuer von eisiger Rachsucht flammte in ihm auf, und es brannte so unerträglich kalt, dass er das halbschattige Dämmerlicht hinter den Vorhängen nicht mehr aushielt. Er stand auf und ging zur Balkontür. Davor blieb er stehen, öffnete sie nicht. Stattdessen lehnte er tief seufzend die Stirn an das warme Glas.
Die Sonne tat gut, konnte jedoch nur die Kälte seines Körpers vertreiben, nicht aber die Dunkelheit seiner Gedanken.
Als sich die Tür hinter ihm öffnete, hatte sich wenigstens seine zerstörerische Wut ein wenig gelegt, ihm aber noch genug der ungesunden Entschlossenheit übrig gelassen, die er jetzt brauchte. Langsam drehte er sich um, verdrehte entnervt die Augen, als er Aria erkannte. „Ich habe doch gesagt, ich muss mit dem General sprechen“, schnaubte er und wandte den Blick wieder nach draußen.
Schwebende, fast lautlose Schritte durchquerten den Raum, dann spürte er eine zarte Berührung an der Schulter. „Sprich erst einmal mit mir“, bat Arias sanfte Stimme.
Serin schüttelte ihre Berührung ab, begann bedächtig, aber mit ernstem Blick, im Raum auf und ab zu gehen. „Ich glaube nicht, dass du in dieser Sache entscheiden darfst“, meinte er dunkel.
Als Aria das hörte, schrak sie auf und machte einen strengen Schritt auf ihn zu. „Was in aller Welt hast du vor?“
Serin hielt kurz an, warf ihr einen Blick zu, als würde er überlegen. Aber er wusste selbst gut genug, dass er sich damit nur etwas vormachte. Er überlegte nicht, und er würde auch nicht überlegen. Seine Entscheidung stand fest. So viele der Entscheidungen, die er in Zukunft fällen musste, standen bereits fest. „Das werde ich dem General sagen. Wann kann ich ihn sprechen?“
„Nie!“, entgegnete Aria trotzig.
In ihrem goldenen Blick standen so viele verstörende Emotionen. Die Unsicherheit über den Krieg, die Angst vor den Plänen, die er ihr nicht verraten wollte, und sogar … die Sorge um seinen Verstand. Aber sie war berechtigt. Denn seit seinem ersten Tag hier hatte er noch nie so mit ihr gesprochen, mit niemandem. Aria suchte verzweifelt nach einem Zauber, und er nahm es ihr nicht übel. Ein wenig wünschte er sich selbst, dass diese lichtlose Kälte zwischen seinen Gedanken von einem Zauber stammte, in den er sich unbemerkt hineinsteigerte. Aber so war es eben nicht. Die Wut war echt. Der Hass ebenso.
„Solange der General sich noch erholt, habe ich die volle Befehlsmacht über die Kaserne. Du sprichst also entweder mit mir oder mit niemandem!“, fuhr Aria fort, stemmte zur Bekräftigung ihrer Worte die Hände in die Seiten.
Serin setzte langsam seinen sinnlosen Weg durch den Raum fort, schritt bedächtig und würdevoll dahin, als könnte ihm das helfen, seine Gedanken zu beruhigen. Er faltete die Hände unter der Brust, verband jeden neuen Schritt mit einem weiteren Atemzug. „Gut, ich werde es dir sagen. Aber nur, weil ich nicht noch länger warten will“, gab er zögernd nach, blieb erneut stehen, sah sie an. „Ich organisiere einen Angriff.“
„Du organisierst …Wie soll ich das verstehen?“
„Ich habe die Pläne bereits im Kopf, ich muss sie nur noch aufschreiben. Ich brauche fünftausend Mann, die ich nach Necropolis schicke.“
„Bist du wahnsinnig?“, unterbrach Aria ihn aufgebracht, und er konnte ihr ansehen, dass sie mit dem Gedanken spielte, ihn mit einer Ohrfeige zurück auf den Boden der Realität zu holen. „Ist das … ist das deine Art der Überreaktion, was diesen Brief betrifft? Die Kriegserklärung? Das hat uns alle schwer getroffen, Serin, aber gerade deswegen sollten wir jetzt nichts überstürzen.“
„Es gibt keine Kriegserklärung!“, gab Serin ebenso aufgebracht zurück. „Vielleicht ist es dir ja entgangen, aber wir wissen offiziell gar nicht, dass wir uns im Krieg befinden! Derselbe Mensch, der uns das Bündnis aufgedrängt hat, hat uns jetzt verraten und … den Boten getötet.“ Er senkte für einen Moment den Blick und atmete tief durch, was Aria nicht einmal zu bemerken schien.
„Und das ist dein ganzes Problem? Ein einziger toter Bote, Serin! Weißt du überhaupt, was Krieg bedeutet? Wir werden noch viel mehr Tote sehen, nimm das nicht so persönlich!“
„Ich soll das nicht so persönlich nehmen?“, brach Serin so plötzlich und so ungehalten aus, dass Aria erschrocken zusammenzuckte. Er bemühte sich daraufhin zwar, ruhiger zu sprechen, aber es blieb bei einem vergeblichen Versuch. „Du hast keine Ahnung, wovon du da sprichst, Aria! Lass mich dir etwas erklären: Dieser Bote war mein Freund, kapiert? Einer meiner – ach, was sage ich – der beste! Und ich kann einfach nicht anders, als das persönlich zu nehmen, denn ich kenne den Mann, der ihn ermordet hat! Ich kenne den Fürsten des Clans, Kyle den Wilden, denn er war mein Schüler! Und ich kenne ihn eben gut genug, um zu wissen, dass unter all den Gründen, die er für einen derartigen Verrat vielleicht haben mag, auch der ist, mich zu ärgern. Mich bloßzustellen, weil ich ihn nicht so unterrichten konnte, wie er es sich vorgestellt hat. Du verzeihst also meine Überreaktion, was diesen Brief betrifft!“
Aria war für einen Moment sprachlos. Aber es war ihre Art als Mensch und ihre Natur als Wüstenkind, sich von nichts und niemandem einschüchtern zu lassen. Zumindest nicht für lange, deswegen war es auch nicht verwunderlich, dass sie sofort reagierte.
„Das wusste ich nicht“, entgegnete sie gefasst, aber immer noch mit einem leichten Vorwurf in der Stimme. „Aber trotzdem kannst du nicht einfach eine ganze Legion in den Tod schicken! Fünftausend Mann!“
„Ich will sie auch nicht in den Tod schicken, ich will in Necropolis einfallen“, erklärte Serin – zu seiner eigenen Überraschung vergleichsweise ruhig. „Irgendjemand muss es ja tun. Die Stadt sehen und ihre Menschen, um überhaupt einschätzen zu können, wie stark der Clan wirklich ist. Und wenn ich schnell genug bin und das Überraschungsmoment auf meiner Seite habe, genügt es vielleicht sogar, um diesen Krieg im Keim zu ersticken.“
Aria seufzte tief. „Aber doch nicht so. Du denkst nicht rational. Du hast es heute erst erfahren, schlaf doch erst einmal darüber.“
„Ich kann nicht länger warten, Aria. Ich habe schon fünf Tage verloren, in denen diese Nachricht unterwegs war. Ich muss jetzt handeln, wenn der Fürst nicht damit rechnet. Wenn er vielleicht noch nicht einmal ahnt, dass wir von seinem Verrat wissen.“
Daraufhin musterte Aria ihn lange schweigend. Immer wieder wich sie seinem Blick aus, seufzte nachdenklich oder schwermütig. Kurz bevor sie anfangen konnte, wie ein kleines Mädchen nervös mit ihren Haaren zu spielen, fällte sie endlich eine Entscheidung. „Nein, Serin, das kann ich nicht tun. Du hast das nicht einmal mit der Akademie abgesprochen, das geht einfach nicht.“
„Für eine lange Absprache ist keine Zeit!“, regte Serin sich auf, suchte nach den richtigen Worten, um Aria doch noch zu überzeugen, dann überlegte er es sich anders. Er sah sie an, und sein Blick verlor jeden Ausdruck. Dann drehte er sich wortlos um und wollte gehen, als ihre Stimme ihn aufhielt.
„Wo willst du hin?“
„Du willst mir meine Legion nicht geben, also gehe ich eben allein.“ Er hatte nicht vor, eine Antwort abzuwarten, aber nur einen Augenblick später wurde er auch schon von Aria aufgehalten, die sich an ihn klammerte, ihn fassungslos mit ihren goldgelben Augen anstarrte.
„Das ist nicht dein Ernst“, hauchte sie, und ihre Stimme war sich wohl nicht sicher, ob sie wütend oder besorgt klingen sollte. „Das ist dein Tod!“
Serin wollte sie abschütteln, hatte aber keine Chance. „Ich habe ein Ziel vor Augen: den Kopf von Kyle dem Wilden auf seinem eigenen verfluchten Schwert in die Stadt tragen zu können. Und dieses Ziel werde ich verfolgen, mit oder ohne Legion.“
Aria wich beunruhigt von der Grausamkeit seiner Worte zurück, sah ihm flehend in die Augen. „Aber ich kann dir die Krieger einfach nicht geben, die du willst.“
Er hielt ihrem Blick problemlos stand. „Und ich kann das verstehen“, sagte er nur, dann ließ er sie ohne ein weiteres Wort stehen.
Kyle wusste nicht, warum er sein Schwert in der Hand hielt. Er fühlte eine innere Leere, eine tiefe Dunkelheit, die seine Gedanken umhüllte und alles, was noch von ihm übrig war, in eisige Finsternis stürzte. Er stand vor den Toren seiner Festung neben dem gläsernen Thron und zeichnete mit dem Finger dünne flammende Linien auf die Armlehne. Die Feuer seiner Stadt waren fast heruntergebrannt, glühten nur noch wie verblassende Sterne in der Ferne. Selbst das wirbelnde Himmelsinferno hatte sich in die Wolken zurückgezogen, war nur noch ein zartes rötliches Leuchten. Zum ersten Mal seit so langer Zeit brach wieder die Nacht über Necropolis herein.
Kyle hob den erschöpften Blick, und eine letzte Träne tropfte von seinem Kinn, dann hatte er nicht mehr die Kraft für weitere. Er konnte nicht mehr. Seine Stadt spürte es, und er selbst wusste es. Er konnte nicht mehr. Er war nicht stark genug, um in dieser Welt zu überleben, die ihm jetzt auch noch seinen Bruder genommen hatte. Er atmete schwer, hatte Stunden damit verbracht, um Raven zu trauern, konnte sich nicht erinnern, wann er gegangen war, warum er gegangen war.
Vielleicht hielt er deswegen sein Schwert in der Hand? Weil er es beenden wollte? Nachdenklich hob er die Waffe ein wenig, betrachtete die schimmernde Klinge im schattigen Dämmerlicht. Warum wollte er diese Welt noch retten, die ihn so sehr quälte?
Welchen Sinn hatte das Leben noch?
Raven war tot.
Es war vorbei.
Nichts und niemand konnte ihn ihm wiederbringen.
Zögernd hob er die Hand, berührte ehrfürchtig die Schwertschneide. Er war schon dabei, sich mit dem Gedanken anzufreunden, seinem Bruder zu folgen, als ihn eine Stimme innehalten ließ.
„Warte, Kyle.“
Überrascht sah er sich um.
Es war still. Unendlich still und dunkel. Er war irgendwo und doch nicht. Es war ein Traum. Ein leerer Traum, in dem weder Raum noch Zeit existierten. Langsam, viel zu langsam, mischte sich ein Geräusch in die Dunkelheit, flüsternd, gleichmäßig, rauschend. Dann kehrte ein winziges farbloses Licht in die Stille zurück, irgendwo in der Ferne. Es war ein leises Flackern, wie von fernem Feuer.
Feuer …
Da war ein Gedanke, der mit Feuer zusammenhing. Was hatte er noch gleich zu bedeuten? Andere Gedanken lösten sich aus dem Nichts, sammelten sich um den einen. Dann wurde aus der Dunkelheit plötzlich Nacht, aus der Stille wurde Raum, nur das leise Rauschen blieb.
Was für ein Traum.
Und schließlich schlug Raven die Augen auf.
Er erkannte das zwielichtige Leuchten von Necropolis, das sich in der gläsernen Zimmerdecke spiegelte. Er glaubte fast, es sei dunkler als sonst. Aber darüber konnte und wollte er sich im Moment keine Gedanken machen. Da war eine leichte Verwirrung in ihm, die ihn an allem zweifeln ließ. Und eine entfernte Erinnerung, die diese Zweifel erklärte.
Raven atmete tief ein, dann atmete er wieder aus. Und so machte er weiter, ganz normal, ganz wie immer, wie er es gewohnt war. Er stützte die Hände neben sich auf der Matratze ab – bemerkte bei der Gelegenheit, dass er in einem Bett lag – und setzte sich langsam auf. Er sah an sich hinunter, stellte fest, dass er nicht mehr seine Robe trug. Gedankenverloren schob er eine Hand unter das Hemd, wo er auf seiner Brust eine lächerlich winzige Narbe spürte.
Also doch kein Traum?
Aber das war unmöglich. Er konnte sich noch genau erinnern, es spielte sich immer wieder vor seinen Augen ab, wollte gesehen, wollte verstanden werden.
Unmöglich. Noch einmal senkte er den Blick auf seine Brust, und eine qualvolle Erinnerung flackerte auf, in der er dort die blutige Schwertklinge gesehen hatte. Und die Schmerzen … unerträgliche Schmerzen, die ihm erst den Atem genommen und dann den Verstand geraubt hatten. Und dann war er ohnmächtig geworden?
Aber das war doch vollkommen unmöglich!
Verwirrt und verstört sah Raven sich um, entdeckte seinen Bruder neben dem Bett. Der Anblick entlockte ihm ein gerührtes Lächeln. Kyle schlief dort zusammengekauert in einem Sessel, die Knie bis unter das Kinn gezogen und mit den Armen umschlungen. Er war nicht rasiert, seine Haare waren völlig zerzaust, und unter seinen Augen zeugten dunkle Schatten von vielen schlaflosen Nächten. Er war wohl die ganze Zeit nicht von seiner Seite gewichen. Die ganze Zeit … Wie lange es wohl her war?
Die dünne Decke über seiner Schulter hatte ihm wohl Shaíra gebracht, denn man konnte sehen, dass er sich nicht selbst damit zugedeckt hatte. Sie war ein wenig verrutscht, aber bevor Raven dem Impuls nachkommen konnte, seinen Bruder wieder fürsorglich zuzudecken, öffnete dieser die Augen.
Kyle blinzelte verschlafen, murrte leise und rieb sich erschöpft das Gesicht. Er streckte sich halbherzig, achtete nicht darauf, dass die Decke dadurch auf dem Boden landete. Erst dann wandte er Raven den Blick zu, blinzelte ihn einmal ausdruckslos an. Und noch einmal, bevor er erkannte und verstand, was er da sah.
Von einem Moment auf den nächsten fiel alle Müdigkeit von Kyle ab, er riss ungläubig die Augen auf – und erstarrte. Für eine ganze Weile blickte er ihn nur wortlos an, schien sogar das Atmen zu vergessen, dann stand er langsam auf.
„Raven“, hauchte er fassungslos, während er sich vorsichtig zu ihm setzte. „Du bist wach.“
Raven konnte nur wortlos mit den Schultern zucken. Sein Bruder hingegen stand völlig neben sich, hob zitternd die Hände, berührte ihn verstört im Gesicht und so zärtlich, als hätte er Angst, Raven könnte unter seiner Berührung zerbrechen.
„Du bist wirklich wach“, wiederholte Kyle, dann zog er ihn plötzlich zu sich und presste ihm einen rauen Kuss voller Dankbarkeit auf die Lippen, bevor er ihm um den Hals fiel und ihn so fest drückte, dass Raven fast die Luft wegblieb.
„Ganz ruhig, um Himmels willen!“, keuchte Raven, ließ seinem Bruder aber die Zeit, die dieser brauchte. Und er brauchte viel Zeit. Eine halbe Ewigkeit war es wieder einfach nur still, im Hintergrund rauschte es leise. Irgendwann löste Kyle sich endlich von ihm, hielt aber trotzdem seine Hände fest und konnte den seligen, wenn auch immer noch ungläubigen Blick nicht von ihm losreißen.
„Ich dachte wirklich, ich hätte dich für immer verloren“, erklärte er mit ehrfürchtig gesenkter Stimme.
„Das dachte ich auch.“
„Aber du bist wach. Du bist tatsächlich wach!“
„Scheint so, ja.“
„Weißt du, wie lange du weg warst?“
Raven schüttelte schon den Kopf, doch dann lief ein schwaches Lächeln über sein Gesicht. „Wenn ich dich so ansehe, wohl etwa vier, fünf Tage.“
Kyle lachte lustlos auf, kratzte sich verlegen am Kinn. „Fünf Tage“, bestätigte er. „Es ist inzwischen Wochenende. Aber ich konnte dich nicht allein lassen. Ich wollte bei dir sein, wenn du aufwachst. Wissen, dass es dir gut geht.“
Raven warf einen Blick aus dem Fenster. Das war also das Rauschen gewesen. Heute musste der Tag sein, an dem es in Necropolis regnete.
„Es geht mir gut“, beruhigte Raven seinen Bruder zu seiner eigenen Überraschung. Er wäre fast gestorben, war tagelang bewusstlos gewesen, und dann wachte er auf und fühlte sich … einfach nur wohl.
„Ich hatte solche Angst um dich.“
„Mir geht es gut“, wiederholte Raven, aber als er sich dann wieder seinen Bruder ansah, seufzte er schwermütig. „Aber dir nicht.“
„Ach was, ich bin in Ordnung, viel wichtiger ist außerdem, dass …“
„Nein, fang erst gar nicht damit an!“
Kyle blinzelte ihn verwirrt an. „Womit?“
„Damit. Es wundert mich selbst ein wenig, aber ich fühle mich momentan einwandfrei erholt. Und genau deswegen wirst du dich jetzt um dich selbst kümmern.“
„Oh nein, Raven, ich will bei dir bleiben, bitte!“
„Nichts da. Ich laufe dir schon nicht davon.“
„Ich dachte, ich hätte dich verloren! Bitte, schick mich jetzt nicht weg!“, flehte Kyle der Verzweiflung nahe.
Raven schenkte seinem Bruder ein friedliches Lächeln, drückte leicht seine Hand und sah ihm beschwörend in die Augen. „Jetzt hör mir mal ganz genau zu, Kyle. Du wirst jetzt aufstehen, diesen Raum verlassen …“
„Aber …!“
„Nichts aber. Dann wirst du dir Shaíra schnappen und mit ihr ein langes, heißes Bad nehmen. Und danach wirst du mit ihr ins Bett gehen und dich ordentlich ausschlafen.“ Er wählte seine Worte ganz absichtlich doppeldeutig, um seinen Bruder auf andere Gedanken zu bringen. Und offensichtlich funktionierte es, denn Kyle konnte sich endlich zu einem flüchtigen Lächeln durchringen.
„Wenn ich mich ausschlafen soll, sollte ich sie wohl besser nicht mit ins Bett nehmen“, bemerkte er leise, senkte fast schon verlegen den Blick. „Was ist mit dir?“
„Ach, ich weiß noch nicht. Ich werde mich wohl ein wenig umsehen, vielleicht einen kleinen Spaziergang durch die Festung machen. Ich finde schon eine Beschäftigung.“
„Aber du bleibst hier, ja?“
„Aber sicher.“
„Ich gehe nur, wenn du mir schwörst, dass du noch da bist, wenn ich wiederkomme.“
„Keine Sorge.“
Kyle atmete tief durch und fiel ihm noch einmal um den Hals. „Ich liebe dich, Raven, das weißt du, nicht wahr?“
Raven klopfte ihm beruhigend auf den Rücken. „Ich weiß.“ Er musste sich ganz schön anstrengen, um Kyle abzuschütteln. Kaum hatte er es geschafft, stand er auf und zog ihn mit sich, um ihn nicht noch einmal in Versuchung kommen zu lassen. Er führte seinen Bruder zur Tür, wo er ihn noch einmal aufmunternd am Arm berührte. „Wir sehen uns morgen.“
„Versprochen?“
„Versprochen.“
Nachdem er seinen Bruder auf den Flur geschoben hatte, beeilte er sich, die Tür zu schließen, damit Kyle nicht auf die Idee kommen konnte, doch noch zu bleiben. Kopfschüttelnd lehnte Raven sich mit dem Rücken an die Tür und seufzte tief. Fast tat sein Bruder ihm ein wenig leid. Fünf Tage lang hatte Kyle an seinem Bett Wache gehalten, und nun warf er ihn einfach so aus dem Zimmer. Aber Raven musste jetzt allein sein, denn er selbst hatte keine fünf Tage Zeit gehabt, um zu verarbeiten, was geschehen war. Für ihn waren nur wenige Augenblicke vergangen, seit er in den Armen seines Bruders gelegen hatte, blutend und – wie er gedacht hatte – sterbend. Die Erinnerung an den Moment, als der kalte Stahl ihm die Brust durchbohrt hatte, war immer noch frisch. Fast war ihm, als sei der unerträgliche Schmerz noch nicht ganz abgeklungen, als könne er immer noch sein eigenes Blut auf den Lippen schmecken. Und es bereitete ihm Kopfschmerzen.
Raven atmete tief durch und straffte seine Haltung, um die jüngste finstere Vergangenheit abzuschütteln und sich bewusst zu machen, dass sie nichts Geringeres war als das: Vergangenheit. Er hatte es überstanden und war gesund und munter in der Festung seines Bruders aufgewacht. In Sicherheit. Alles war gut.
Er musste nur erst einmal seine Gedanken ordnen. Aber bevor er damit anfangen konnte, beschloss er, um sich herum Ordnung zu schaffen. Langsam stieß er sich von der Tür ab, hob die Decke vom Boden auf, legte sie sorgfältig zusammen und auf dem Sessel ab, den er dann an die Wand schob. Er betrachtete kurz sein Werk, bevor er erneut seufzend ans Fenster ging. Er fand es immer ein wenig merkwürdig, wenn es in Necropolis regnete. Wie Blut leuchteten die Regentropfen im roten Dämmerlicht der Stadt. Ravens Blick wanderte auf seine Hand, die er sich dann gedankenverloren auf die Brust legte. Blut hatte er für die nächste Zeit genug gesehen.
Also wandte er sich wieder vom Fenster ab, entdeckte einen Spiegel an der Wand links neben sich. Zögernd ging er darauf zu. Er war immerhin fünf Tage lang bewusstlos gewesen, er musste grauenvoll aussehen. Aber als er angekommen war, konnte er sein Spiegelbild nur verwirrt anblinzeln. Er sah aus, wie er sich fühlte: rundum zufrieden. Seine Haut hatte eine gesunde Farbe, sein Blick war klar und aufgeweckt. Nur die Haare waren ein wenig durcheinandergeraten, aber als er sich nur einmal mit der Hand hindurchfuhr, war auch das behoben. Er konnte sich nicht erinnern, wann er das letzte Mal so gut ausgesehen hatte.
Vor lauter Verwunderung darüber konnte er sich lange nicht von seinem Spiegelbild losreißen. Er war schon zu oft nach langer Bewusstlosigkeit aufgewacht, er hatte schon zu viele magische Heilungen hinter sich, und er kannte selbst die Magie von Urias, wusste, wie sie wirkte, wie sie sich anfühlte.
Jetzt aber …
Raven stützte sich auf dem Tisch ab, über dem der Spiegel hing, und erwiderte gedankenverloren seinen eigenen kritischen Blick. Erschrocken wirbelte er herum, als er glaubte, eine Bewegung hinter sich wahrzunehmen, aber da war niemand. Er war allein, nur das gleichmäßige Rauschen des Regens war bei ihm. Das Licht neben ihm glühte geduldig.
Kopfschüttelnd wandte er sich wieder seinem Spiegelbild zu. Er konnte nicht sagen, was ihn daran so fesselte, er wusste nur, dass er einfach nicht wegsehen konnte. Immer wieder zuckte sein Blick zu seinem Schatten, der, von einem unsichtbaren Licht geworfen, unruhig über die schwarzen Wände flatterte, als wollte er sich von ihm losreißen. Erstaunt legte er den Kopf schräg, und sein Spiegelbild folgte seinem Beispiel – er glaubte fast, ein wenig verzögert.
Und dann traute er seinen Augen nicht, als sein Schatten sich tatsächlich von ihm und von der Wand löste und langsam, rauchig auf ihn zuschwebte. Raven war wie versteinert. Er sah nur eine schwarze Silhouette, die immer mehr Form gewann und gleichzeitig immer weniger menschlich wurde. Der Schatten hob die Hände, legte sie ihm vorsichtig auf die Schultern und senkte dann den Kopf neben sein Gesicht, als wollte er ihm etwas zuflüstern. Raven machte sich unwillkürlich bereit, eine Stimme zu hören, die ähnlich dämonisch klang, wie das Schattenwesen aussah, doch in dem Moment blitzten in dem konturlosen Gesicht des Schattens zwei eisblaue Augen auf.
Als Raven den stechenden Blick kreuzte, durchfuhr ihn eine brennende Kälte. Panisch sprang er zur Seite, warf sich mit dem Rücken an die Wand und versteinerte dort erneut schwer atmend. Verängstigt ließ er den Blick durch den Raum wandern und suchte nach dem dämonischen Schattenwesen, das er eben noch im Spiegel gesehen hatte. Aber da war nichts. Er war allein. Das Licht glühte immer noch leise, sein Schatten lag immer noch friedlich an der Wand hinter ihm. Als Raven sich überfordert mit der Hand durch die Haare fuhr, folgte sein Schatten auch treu jeder seiner Bewegungen. Er versuchte gar nicht zu verstehen, was er da eben gesehen hatte, entschloss sich aber, sich für die nächste Zeit von Spiegeln fernzuhalten.
Er atmete noch einmal tief durch, dann ließ er sich langsam auf den Boden sinken, zog die Beine an und legte die Arme auf den Knien ab. So kurz nach einer Begegnung mit dem Tod konnte er sich angenehmere Dinge vorstellen. Und vor allem verstand er einfach nicht, was es mit diesen merkwürdigen Dingen auf sich hatte, die er immer öfter sah. Und sie wurden immer seltsamer!
Erschöpft lehnte er den Kopf an die Wand, schloss die Augen und lauschte dem Regen. Er konzentrierte sich ganz auf das gleichmäßige Geräusch, bis er sich ein wenig beruhigt hatte. Er nahm sich fest vor, am nächsten Tag mit irgendjemandem darüber zu sprechen. Vielleicht mit Shaíra. Sie konnte unheimlich gut zuhören. In dieser Hinsicht war sie ein wenig wie der Regen: ruhig, geduldig, unvoreingenommen. Vielleicht konnte sie ihm helfen, seine finsteren Erinnerungen fortzuwaschen.
Raven konnte nicht schlafen. Gedankenlos lag er in demselben Bett, in dem er aufgewacht war, und starrte sinnlos an die Decke. Er lag bestimmt seit mehreren Stunden still auf dem Rücken, konnte sich nicht bewegen, wollte nicht, tat es einfach nicht. Bereits vor einer halben Ewigkeit hatte der Regen aufgehört, es war also schon lange nach Mitternacht. Als er beschlossen hatte, sich schlafen zu legen, war es bereits spät gewesen, zumindest hatte er das Gefühl gehabt. Außerhalb der Stadt ging wahrscheinlich schon in wenigen Stunden die Sonne auf. Aber er konnte einfach nicht schlafen.
Er setzte sich auf, warf einen Blick aus dem Fenster. Brennende Wolken, die sich in schwarzem Glas spiegelten. Unverändert. Dann sah er sich noch einmal im Zimmer um, und sein Blick blieb am Spiegel hängen. Er erinnerte sich an den eigenartigen Vorfall vom vorherigen Abend, war aber momentan nicht in der Lage, sich Gedanken darüber zu machen. Er brauchte jetzt etwas, wonach er bestimmt seit zehn Jahren kein Bedürfnis mehr verspürt hatte.
Zögernd stand er auf und verließ langsam, wie im Traum, das Zimmer, schlich den Gang entlang. Die Festung war so einsam in der Nacht, vollkommen menschenleer, nicht einmal eine Wache begegnete ihm. Raven wusste, welches Zimmer er suchte. Es war immer dasselbe. Nicht sonderlich weit weg, aber auch nicht mehr in der Nähe. Bevor er die Tür öffnete, zögerte er erneut, aber dann huschte er lautlos in den Raum und schloss sie hinter sich wieder.
In dem Bett dort erkannte er sofort seinen Bruder. Shaíra war nicht bei ihm, und nur deswegen schlief er wohl auch. Kyles Anblick strahlte eine warme Geborgenheit aus, wie er völlig entspannt in die Decke gekuschelt dalag. Nur der Kopf und die linke Hand, die neben seinem Gesicht lag, blitzten unter der Decke hervor.
Raven schlich zu ihm, in der ewig dämmrigen Dunkelheit musste er sich nicht einmal ein Licht erschaffen. Neben seinem Bruder ging er in die Knie, berührte ihn vorsichtig an der Schulter.
„Kyle?“, flüsterte er mit leichtem Nachdruck. „Kyle, bist du wach?“ Er bekam keine Antwort. „Jetzt wach schon auf!“, zischte Raven und stieß seinen Bruder unsanft an der Schulter an.
Kyle hatte einen unglaublich tiefen Schlaf. Er erschrak nicht einmal, sondern murmelte nur genervt und öffnete dann langsam die Augen. Er blinzelte Raven ein paar Mal an und rieb sich mit der freien Hand verschlafen das Gesicht. „Verdammt, Raven, was zur Hölle willst du hier?“, murmelte er halb in sein Kissen, während ihm bereits wieder die Augen zufielen.
„Ich kann nicht schlafen“, gestand Raven und senkte verlegen den Blick. Diese Worte kamen ihm so kindisch vor, er fürchtete sich ein wenig vor der Reaktion seines Bruders. Aber die brüderlichen Instinkte ließen Kyle nicht einen Augenblick zögern. Er machte ihm nur ein wenig Platz, ohne dabei seine Haltung zu verändern, und klopfte zweimal auf das Kopfkissen.
„Na, spring schon rein“, gab er nach und sogar ohne irgendeinen besonderen Ton in der Stimme.
Raven schenkte ihm ein flüchtiges Lächeln, das Kyle nicht einmal bemerkte, und schlüpfte dann schnell zu ihm unter die Bettdecke. „Danke“, flüsterte er und erntete ein genervtes Raunen von seinem Bruder.
„Weniger reden, mehr schlafen“, murmelte Kyle, und nur wenig später verrieten seine tiefen Atemzüge auch schon, dass er seiner eigenen Aufforderung bereits nachgekommen war.
Raven beobachtete seinen Bruder durch das glühende Zwielicht hindurch, und der Anblick machte ihn plötzlich ganz sentimental. Vor langer Zeit, als sie beide noch Kinder gewesen waren, hatte er regelmäßig so die Nähe zu Kyle gesucht, wenn ihn in der Nacht die Albträume wach gehalten hatten. Irgendwann war er dem dann entwachsen gewesen und hatte als „großer Junge“ nicht mehr das Bett mit seinem Bruder teilen wollen. Aber zuletzt war Raven aus dem wohl schlimmsten Albtraum seines Lebens erwacht. Die Begegnung mit dem Tod hatte ihre Spuren hinterlassen. Er sehnte sich wie nie zuvor nach der tröstenden, beständigen Nähe seines großen Bruders.
Und Kyle hatte sich sehr verändert. Die Position des Fürsten, das Geheimnis der Epistulae, Shaíra … Das alles hatte ihn zu einem anderen Menschen gemacht. Vielleicht sogar zu einem besseren.
Kyle fluchte im Schlaf leise und drehte sich auf den Rücken. Ein sanftes Lächeln huschte über Ravens Gesicht, dann rückte er näher zu seinem Bruder und klammerte sich an dessen Arm. Es war momentan einfach alles zu viel für ihn, was er daran merkte, dass er sich selbst jetzt – so nah bei seinem Bruder – immer noch merkwürdig einsam fühlte. Und schuldig … Da war ein Schuldgefühl in ihm, das er nicht einordnen konnte. Als hätte er etwas Wichtiges vergessen, was er nie wiedergutmachen konnte.
Raven schluckte in einem Anflug von Verzweiflung, dann legte er seinem Bruder den Kopf auf die Schulter. Er schloss die Augen und lauschte seinem Herzschlag, spürte seine Wärme, und es beruhigte ihn wenigstens ein bisschen.
Irgendwann fluchte Kyle erneut leise, und schüttelte ihn ab, dann war es wieder ruhig. Raven brauchte lange, um das zu realisieren, aber es war sogar zu ruhig. Verwirrt lauschte er in die Dunkelheit, legte sich die Hand auf die Brust. Dann tastete er beunruhigt sein Handgelenk ab und schließlich verängstigt seinen Hals. Und dann rüttelte er der Panik nahe seinen Bruder an der Schulter, bis dieser verstört aus dem Schlaf schrak.
„Verflucht, Raven, was ist denn jetzt los?“, fuhr Kyle ihn noch ein wenig benommen an, als Raven seine Hand nahm und sie sich an den Hals legte.
„Spürst du das?“, fragte er, hatte Mühe, seine Stimme zu beherrschen.
„Was? Beruhig dich wieder, da ist nichts“, knurrte Kyle und wollte sich wieder hinlegen, aber Raven hielt ihn fest.
„Richtig erkannt, Kyle, da ist nichts!“, entgegnete er mit unterdrückter Hysterie. „Aber weißt du, was da sein sollte?“
Erst jetzt schien Kyle wirklich aufzuwachen und zu verstehen, was gerade passierte. Er legte sich wie ertappt die Hand über die Lippen. „Oh nein!“
„Da sollte ein Herzschlag sein, Kyle!“
„Oh, er hat mich gewarnt, dass so etwas passieren würde.“
„Was hast du mit mir gemacht, Kyle? Warum spüre ich meinen Herzschlag nicht?“
„Ich hatte die Hoffnung, es würde länger dauern, bis du etwas merkst …“
„Tja, zu spät! Erkläre es mir, verdammt!“ Raven war schon kurz davor, seinen Bruder anzugreifen, als dieser endlich schwach nickte und seinem Blick auswich.
„Es tut mir leid, Raven“, begann Kyle, und es konnte keine angenehme Erklärung werden, wenn er schon so anfing. „Aber ich konnte den Gedanken einfach nicht ertragen, dich zu verlieren …“
„Warte, Kyle.“
Überrascht sah er sich um. Er war kaum noch in der Lage zu verstehen, was er da sah. Als sich seine wirren Gedanken wenigstens ein bisschen beruhigt hatten, war Urias bereits fast bei ihm angekommen. Kyle wischte sich verstört die Tränen aus dem Gesicht. Den einzigen Lichten des Clans hier zu sehen bedeutete ein kleines Wunder. Urias schritt aufrecht und stolz auf ihn zu, in seiner Haltung war keine Spur seines Alters zu erkennen, seine Schritte waren weich und fließend, wie ein Geist schwebte er neben ihn, verschränkte dann würdevoll die Hände hinter dem Rücken, sah ihn nicht an.
„Urias?“, wunderte sich Kyle, der immer noch ein wenig benommen war. „Was … was macht Ihr hier draußen, ich dachte, Ihr verlasst niemals Euren weißen Tempel?“
Der Lichte nickte, warf ihm einen kurzen Blick zu, hinter dem ein schwaches Lächeln verborgen lag. „Ja, bis eben entsprach das noch der Wahrheit.“
„Warum seid Ihr dann hier?“
Urias antwortete nicht. Er ließ nur lange nachdenklich den Blick über die Ebene schweifen, nahm sich Zeit, sich alles genau anzusehen. Aber wenn Kyle das richtig verstand, dann sah er diese Stadt zum ersten Mal seit unvorstellbar langer Zeit wieder.
„Ich bin alt, Kyle“, begann Urias irgendwann. „Alt genug, um noch an Götter zu glauben.“
„Gut, dann seid Ihr schon einmal mindestens so alt wie ich.“
Urias seufzte leise, reagierte sonst aber nicht auf Kyles Sarkasmus. „Ich bin das älteste Mitglied des Schattenclans. Und das einzige, das es noch erleben durfte, die Festung im heiligen Glanz der Lichtmagie erstrahlen zu sehen.“
Kyle ließ die Worte auf sich wirken. Schon allein die Vorstellung, dass Necropolis in der Magie eines Lichten Fürsten erglühte, erfüllte ihn mit romantischer Ehrfurcht. Und er konnte dieses Gefühl sogar wahrnehmen, fast genießen, denn Urias’ Anwesenheit lenkte ihn ab, ließ nicht zu, dass er in dunklen Gedanken verloren ging. Zumindest für den Moment.
Necropolis würde wohl nie wieder in diesem silbernen Licht aufgehen, denn Lichte hassten nicht. Außer …
„Aber das bedeutet, Ihr wart Schattenfürst!“, erschrak Kyle, dann fiel er demütig auf die Knie, als ihm die volle Bedeutung dieser Worte bewusst wurde. „Ihr seid der Reisende!“
Urias neben ihm seufzte tief, berührte ihn nachdrücklich an der Schulter, bis Kyle endlich wieder ehrfürchtig den Blick hob. Er hielt ihm die Hand hin, und als Kyle sie zögernd annahm, zog der Lichte ihn einfach wieder auf die Beine.
„Ich war vieles in meinem Leben“, erklärte Urias weiter. „Ich war der Reisende, und ich war Schattenfürst. Und ja, es gab sogar eine Zeit, in der war ich Altmagier des Lichts. Aber ich habe all diese Titel abgelegt. Heute bin ich nur noch Urias. Und nun bist du es: mein Führer, mein Herrscher, mein Gott.“
„Aber wie ist das möglich? Es heißt, Ihr seid einem mächtigen Fluch erlegen! Eure verfluchten Knochen sollen in der ewigen Dunkelheit von Nachtfalls Auge begraben liegen!“
„Nun, ganz offensichtlich tun sie das nicht. Die Geschichte um mein sagenumwobenes Ableben haben die Barden von Necropolis gesponnen. In Wahrheit habe ich mich aber lediglich zurückgezogen, ganz einfach. Ich habe meinem Nachfolger angeboten, in seiner Festung zu bleiben und ihm jederzeit mit meiner Lichtmagie zur Verfügung zu stehen, wenn er mich im Gegenzug am Leben lässt. Das Licht ist keine Kriegsmagie, ich war nie der größte Kämpfer.“ Er machte eine Pause, schenkte Kyle ein schwaches, verschlagenes Lächeln. „Und dieses winzige bisschen Wissensmagie, das noch in meinen alten Knochen steckt, habe ich auch erst vor ein paar Jahren entdeckt. Ich hätte niemals gewinnen können.“
„Das war wohl schon immer so.“
„Der Clan hat sich wenig verändert. Gib mir das, bevor du noch auf dumme Gedanken kommst.“
Kyle warf einen kurzen Blick auf sein Schwert, dann reichte er es dem Lichten.
„Aber das ist doch ewig her, ich meine … die Chroniken … Ihr müsst doch mindestens siebenhundert Jahre alt sein.“
Urias nickte nur. „Wahrscheinlich sind es schon fast neunhundert. Man hört irgendwann auf zu zählen.“
„Oh“, war alles, was Kyle dazu sagen konnte.
„Gewinnt ein wenig Haltung, mein Fürst.“
Kyle schrak bei diesen Worten unwillkürlich auf und straffte seine Schultern. „Aber warum seid Ihr überhaupt Schatten geworden, immerhin … Ihr habt den Clan ja sogar gegründet, ich meine …“ Er fand keine Worte mehr, war erleichtert, als Urias ihn mit einem sanften Lächeln unterbrach.
„Das, mein junger Freund, bleibt mein Geheimnis. Lass mich nur so viel sagen: Unsterblichkeit ist in der Allianz nicht gern gesehen.“
„Ich verstehe“, sagte Kyle, obwohl er sich nicht sicher war, ob er noch irgendetwas verstand.
„Aber genug davon. Es gibt einen bestimmten Grund, warum ich dir das alles erzähle.“
Überrascht sah Kyle auf. „Gibt es?“
„Ich bin alt. Und nur deswegen kann ich dir sagen, dass es jemanden in deiner Festung gibt, von dem du nichts weißt.“
„Wie ist das möglich?“
„Auch das wird vielleicht für immer ein Geheimnis bleiben. Ich weiß nur, dass er alt genug ist, um den Göttern selbst begegnet zu sein. Er war schon hier, als ich diese Stadt gefunden habe, und wie ich ihn kenne, wird er wahrscheinlich noch hier sein, wenn ich sie für immer verlasse.“ Urias brach ab, als würde es ihm unendlich schwerfallen, sich zu erinnern – als wäre er sich selbst nicht mehr sicher, ob das, was er da erzählte, tatsächlich passiert war. „Er hat nicht viel mit mir gesprochen, aber das, was er zu mir gesagt hat …“ Er verstummte erneut.
„Was? Was hat er gesagt, warum erzählt Ihr mir das alles?“, hakte Kyle nach, den langsam die Ungeduld überkam.
Urias sah sich noch einmal eingehend um, warf einen Blick über die Schulter auf die Festung, dann atmete er tief durch.
„Viele Fürsten vor dir haben schreckliche Verluste erlebt“, erzählte der alte Mann mit bedächtig gesenkter Stimme. „Geliebte Menschen, Familie, Freunde. Sie alle haben unendlich gelitten und Himmel und Erde verflucht. Einige habe ich zu ihm gebracht, aber nur in den ersten … etwa hundert Jahren, denn keinem von ihnen wollte er helfen. Aber du bist anders. Etwas an dir ist anders. Du sprichst von Göttern und verbündest dich mit der Allianz. Was auch immer es ist, das dich hinter die Fassade dieser Welt blicken lässt … ihre Lügen konnten dich nicht blenden, und deine Fähigkeit, den wahren Kern der Legenden und Märchen aufzudecken, hat den Clan so stark zusammengeschweißt, wie es keinem Fürsten vor dir gelungen ist. Du bist anders. Und deswegen erzähle ich dir das alles. Denn es gibt sie. Die Verbotene Magie, die Schwarze Magie, die die Toten wiederkehren lässt. Ihr habt einen Nekromanten in Eurer Festung, mein Fürst.“
Kyle blieb vor lauter Fassungslosigkeit die Luft weg. Vor Ungläubigkeit verstummt starrte er Urias an, konnte nicht glauben, was er hörte. Erst als ihm schon schwindlig wurde und sein Körper ihn wieder zum Atmen zwang, konnte er sich aus seiner Starre befreien.
„Ein Nekromant“, wiederholte er die Worte des Lichten, konnte sie immer noch nicht begreifen.
„Wenn du es … wagst, dann kann er dir deinen Bruder wiederbringen.“
„Nein … nein, das ist … Ist das wahr?“
„Vielleicht. Seit wir nicht mehr allein in dieser Stadt sind, hat er nicht mehr gesprochen, ich kenne nicht einmal seinen Namen. Aber wenn jemand zu ihm durchdringen kann, dann bist du es. Und wenn du ihn erreichst, ja, dann ist es zumindest möglich.“
Kyle wurde für einen Moment schwarz vor Augen. Er stolperte einen Schritt zurück, fuhr sich schwer atmend mit beiden Händen durch die Haare. Das war alles zu viel für ihn. Von einem Extrem in das nächste geschleudert konnte er kaum den eigenen Körper unter Kontrolle halten. Er war so durcheinander, dass ihm fast die Sinne schwinden wollten … aber nicht jetzt. Nicht, wenn er jemanden hier hatte, der seinen Bruder zurückholen konnte!
„Bring mich zu ihm!“, befahl er dem Lichten. „Sofort!“
Urias nickte, drehte sich um und ging zurück in die Festung. Kyle folgte ihm wie verzaubert. Er war so unendlich aufgeregt und immer noch verwirrt, dass er das Gefühl hatte, sich selbst von außen zu beobachten, wie er die Flure seiner Festung entlanggeführt wurde, nervös und ungläubig mit seinen zitternden Fingern spielte und einfach nicht fassen konnte, dass das alles doch noch ein gutes Ende nehmen sollte.
Urias führte ihn zu einer Tür, die nicht anders aussah als alle anderen. Der Raum lag weder versteckt noch war der Weg besonders lang gewesen. Es war wohl wieder einmal die Magie der Festung, die bisher nicht zugelassen hatte, dass jemand bis hierher gekommen war.
Kyle starrte vor sich hin. Raven lag kalt und grau in seinen Armen, aber er konnte nicht darüber nachdenken. Er konnte keine Hoffnung fassen beim Gedanken an den Nekromanten, der die Toten wiederkehren ließ. Er hatte einfach keine Kraft mehr für solche Gedanken. Deswegen fragte er auch nicht, als Urias vor der Tür noch einmal stehen blieb und lange zögerte.
„Das ist sie, die Schwarze Kathedrale“, erklärte der Lichte und machte eine weitere, lange Pause. „Es gibt einige Dinge, die du beachten musst, wenn du da hineingehst.“
Kyle sah ihn nur an, nickte jedes Mal, wenn Urias einen Satz beendete, wie zur Zustimmung.
„Ich werde ihm sagen, was du von ihm willst. Hab Geduld, wenn er eine Weile braucht, um zu antworten, denn die Zeit hat für ihn bereits eine andere Bedeutung angenommen. Stelle keine Fragen, versuche nicht, ihn zu berühren, und sieh ihn nicht direkt an. Er erträgt sein Spiegelbild in deinen Augen nicht.“
Nun warf Kyle dem Lichten doch noch einen fragenden Blick zu, bekam aber keine Antwort mehr. Urias machte einen Schritt an ihm vorbei, öffnete die Tür und winkte ihn zu sich, während er in dem dunklen Raum verschwand. Kyle folgte ihm mit Raven, ohne zu zögern, wurde aber doch ein wenig langsamer, als er in eine Dunkelheit eintauchte, die er so schon seit Langem nicht mehr erlebt hatte. Die Tür fiel hinter ihm ins Schloss, und er war für einen Moment blind, bis nicht weit entfernt ein Licht aufleuchtete und er wenigstens Urias erkannte. Vorsichtig, weil der Funke des Lichten nicht einmal stark genug war, um den Boden zu erreichen, ging er zu ihm, sah ihn abwartend an.
„Es ist lange her, alter Freund“, grüßte Urias in die Dunkelheit, und Kyle folgte seinem Blick, glaubte, einen Schatten zu erkennen. „Ich bringe dir mal wieder einen Fürsten. Es geht um seinen Bruder. Vielleicht kannst du dich ja doch überwinden, mit ihm zu sprechen.“
Ein zweites Licht flammte auf und zog sofort Kyles Blick auf sich. Vor ihm, nur wenige Schritte entfernt, saß jemand auf dem Boden, wie auch Urias es in seinem weißen Tempel zu tun pflegte. Er war in eine weite schwarze Robe gehüllt, die jede Vermutung unmöglich machte, wer oder was er war. Nur die rechte Hand konnte man sehen, die jetzt einen winzigen blassen Lichtfunken hielt.
Auf eine ermutigende Berührung von Urias hin setzte Kyle sich zögernd in Bewegung, sank vor dem Nekromanten auf die Knie, ließ Raven vorsichtig auf den Boden gleiten. Er war schon dabei, unter der dunklen Kapuze nach einem Gesicht zu suchen, als er sich noch rechtzeitig an Urias’ Worte erinnerte.
Also atmete er tief durch, senkte den Blick und faltete die Hände im Schoß. Kaum saß er so da und der erste schweigsame Moment verging, kamen die Gedanken zurück. Aber immer noch konnte er nicht über seinen Bruder nachdenken, den er schwermütig betrachtete. In seinem Kopf herrschte das pure Chaos. Ihm war, als würden alle Erinnerungen seines ganzen Lebens wild durcheinanderwirbeln. Bilder, Worte, Stimmen, alles verschwamm zu einem einzigen grauen Nebel. Der Nekromant bewegte leicht die Finger der Hand, in der er den Funken hielt, regte sich sonst aber nicht. Er saß nur da, sagte nichts.
Und nachdem er eine halbe Ewigkeit nur auf ein Wort des Nekromanten gewartet hatte, löste sich plötzlich ein Gedanke aus dem Nebel in Kyles Kopf. Eine Erinnerung folgte ihm und verschmolz mit der Gegenwart zu einem völlig neuen Verständnis.
„Leviathan?“, vermutete Kyle, und der Nekromant erstarrte vollständig. Dann bewegte sich der schwere Stoff der Kapuze ein wenig, als er kaum merklich den Kopf hob.
„Woher kennst du meinen Namen?“, fragte die klare Stimme eines jungen Mannes, was Kyle schon genug erstaunte, da half ihm das fassungslose Aufatmen von Urias nur wenig weiter.
„Also bist du es wirklich. Leviathan.“
„Woher kennst du meinen Namen?“, wiederholte der Nekromant nachdrücklich.
„Von einer gemeinsamen Bekannten.“
Ein kaum sichtbares Zucken lief durch Leviathans Körper. „Das ist völlig unmöglich“, murmelte er dann mit ungläubig zitternder Stimme. „Das ist unmöglich, du kannst unmöglich …“
Kyle entfuhr ein Laut der Überraschung, als der Nekromant daraufhin plötzlich die Hände vorstreckte und sie ihm an das Gesicht legte. Von der Berührung ging eine unangenehme Fremdartigkeit aus, die Kyle unwillkürlich frösteln ließ.
„Oh ja“, seufzte Leviathan irgendwann, während er ihn immer noch festhielt. „Oh, du sprichst die Wahrheit! Ich kann es kaum glauben!“ Seine Hände schnellten genauso hastig wieder zurück, legten sich nun Raven auf die Brust. „Ich war schon fast dabei, alles für einen Traum zu halten. Aber ihr seid es tatsächlich! Ihr habt sie getroffen, nicht wahr? Leyana?“
Kyle nickte, bevor ihm einfiel, dass Leviathan das wohl kaum sehen konnte, so tief, wie er die Kapuze vor das Gesicht gezogen hatte. „Vor Kurzem erst, ja“, antwortete er ein wenig durcheinander.
„Oh ja, ich kann es spüren.“
„Heißt das, du kannst mir helfen?“
„Wie könnte ich nicht? Du trägst immerhin ihr Erbe in dir!“ Leviathan brach ab, bewegte den Kopf ein wenig, als er sich Raven genauer ansah. Dann leuchtete sein Licht heller auf und enthüllte die kalte Leblosigkeit, die sich wie ein grauer Schleier über ihn gelegt hatte. „Wie ist das passiert?“, fragte der Nekromant dann mit gesenkter Stimme.
„Der Blutmeister hat versucht … Er hat ihn umgebracht. Erstochen – mit dem Schwert“, erklärte Kyle. Er musste sich zu jedem Wort zwingen. Es selbst auszusprechen fühlte sich fast an, als würde er aufgeben. Obwohl doch genau das Gegenteil der Fall war. Er wollte fortfahren, doch in diesem Moment schnaubte Leviathan verächtlich.
„Natürlich, ein Altmagier. Was für ein Amateur, der sich einbildet, er könne mit einer Klinge ernsthaften Schaden anrichten.“
„Was? Was meinst du damit?“
„Ich meine damit, dass sein Mordversuch nicht sonderlich nachhaltig war. Wollte wohl das Herz treffen; hat er nicht. Zu seinem Pech. Und deinem Glück. Denn nur so kann ich deinen Bruder retten.“
Bei diesen Worten überschwemmte Kyle eine Welle unbändiger Glücksgefühle. Er wollte dem Nekromanten am liebsten um den Hals fallen, aber auch davor hatte Urias ihn gewarnt. Also blieb er einfach sitzen, ballte angespannt die Hände zu Fäusten, während er innerlich mit dem endlosen Auf und Ab seiner Emotionen kämpfte. „Worauf wartest du dann noch?“
Leviathan zögerte. „Vielleicht solltest du lieber nicht hier sein. Das wird kein schöner Anblick.“
Aber Kyle dachte gar nicht daran, jetzt zu gehen. „Ich will bei ihm sein, wenn er aufwacht.“
„Er wird jetzt nicht aufwachen. Diese Form der Magie braucht lange, um zu wirken. Es wird mehrere Tage dauern, bis er die Augen aufschlägt.“
„Ich werde nicht gehen.“
Leviathan seufzte tief. „Gut, wie du willst. Dann solltest du wohl besser auch hierbleiben, Urias.“
„Aber natürlich“, versicherte der Lichte voller Ehrfurcht und machte einen unsicheren Schritt auf sie zu.
„Bist du dir sicher, dass du das auch wirklich willst?“, fragte Leviathan noch einmal nach. „Dein Bruder wird Fragen stellen, vielleicht nie wieder derselbe sein.“
„Ich will nur, dass er lebt.“