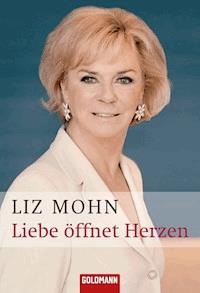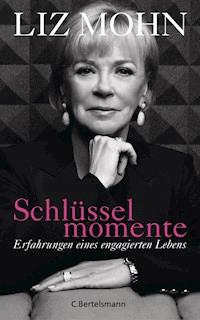Inhaltsverzeichnis
Buch
Titel
Widmung
1. Anfänge – Wurzeln
Meine Mutter
Ein tapferes Kind
Die prägenden Jahre: Schule und Pfadfinderzeit
Aufwachsen in einer Kleinstadt – Traditionen und Werte
Abenteuerlust
Die erste Begegnung
2. Frauenleben
Eine schwere Prüfung
Eine gute Erziehung
Vorbild sein und Grenzen setzen
Gemeinschaftssinn
Miteinander reden
Eine folgenschwere Entscheidung
3. Erste Schritte ins Berufsleben
Aus Schicksalsschlägen lernen
Die Bertelsmann Stiftung
Helfen als Lebensinhalt
Nächstenliebe ist wahre Menschlichkeit
Learning by doing
4. »Neue Stimmen«
Die Bedeutung von Wettbewerben
Eine harte Auslese
Vom europäischen Wettbewerb zur internationalen Talentbörse
Erfolgreiche Teilnehmer
Ein rauschendes Fest
Musikerziehung in Kindergärten und Grundschulen
5. Die Rolle der Frau und der Wert der Familie
Frauen stärken im Beruf
Der Wert der Familie
Fehlende Kinderbetreuungsmöglichkeiten
6. Meine Rolle als Gastgeberin und bei Veranstaltungen
7. Meine Einstellung zu Menschen – meine Vorbilder
8. Begegnungen – internationale Kontakte
Auf Staatsbesuch in England
Begegnungen mit beeindruckenden Persönlichkeiten
Kulturelle Projekte in aller Welt
9. Medizinische Projekte
Wenn es dunkel wird
Manuelle Medizin
Das nächste Gesundheitsprojekt: Hilfe bei Stoffwechselstörungen
Meine Ratschläge zur gesunden Lebensführung
Die Rolle der Ernährung
10. Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe
Der Start
Kontakte knüpfen, Spenden sammeln
Die notwendige Aufklärung
Tragische Schicksale
Die bisherigen Ergebnisse
11. Neue Aufgaben – die Unternehmenskultur
Der Wiederaufbau der Firma nach dem Krieg
Unternehmenskultur und Führungsgrundsätze
Delegation von Verantwortung – Dezentralisation
Kommunikation und Dialog
Motivation und Identifikation
Mein persönlicher Führungsstil
Die Bertelsmann-Essentials
12. Zeitenwende
Schlussthesen
Bildnachweis
Copyright
Buch
Liz Mohn repräsentiert zusammen mit ihrem Ehemann Reinhard Mohn die fünfte Generation der Eigentümerfamilien Bertelsmann/Mohn des internationalen Medienunternehmens Bertelsmann. Sie ist unter anderem Vorsitzende der Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft und stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann Stiftung. Die Gründerin und Präsidentin der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe ist außerdem das erste weibliche Mitglied im Club of Rome, Trägerin des Bundesverdienstkreuzes Erster Klasse sowie des spanischen Großkreuzes des Zivilen Verdienstordens. Liz Mohn hat neben vielen anderen Auszeichnungen die Ehrendoktorwürde der Universität Tel Aviv, die Ehrenmedaille der Deutschen Ärzteschaft sowie den »Charity«-Bambi erhalten.
»Liebe öffnet Herzen« – für Liz Mohn sind diese Worte Lebenserkenntnis, Programm und Mahnung zugleich. Mit großer Sorge beobachtet sie eine zunehmende Orientierungslosigkeit in einer nicht selten von Gleichgültigkeit, Vereinsamung und Egoismus geprägten Gesellschaft. Ob als Frau, Mutter oder Bürgerin – Liz Mohn engagiert sich tatkräftig und leidenschaftlich für Toleranz und gegenseitiges Verständnis über kulturelle und religiöse Grenzen hinweg. So rief sie den internationalen Gesangswettbewerb »Neue Stimmen« ins Leben und gründete 2005 die Liz Mohn Kultur- und Musikstiftung. In ihrer Arbeit bei der Bertelsmann Stiftung befasst sie sich zudem mit Fragen einer globalen, gesellschaftlich verantwortungsvollen Unternehmensführung. Mit ihrem energischen Plädoyer für Respekt und Menschlichkeit im Umgang miteinander versucht Liz Mohn, andere Menschen für ihre Ideale zu begeistern und zu gewinnen – auch in diesem Sinne ist sie ein Vorbild.
Gewidmet meinem Mann Reinhard -als Dank an meinen besten Lehrmeister,der mein Leben und Denken am meisten geprägtund stets partnerschaftlich begleitet hat.
1. Anfänge – Wurzeln
Die Limousine surrt die Landstraße entlang. Ich sitze im Fond des Wagens und sehe das dichte Grün der Bäume vorbeifliegen. Es ist ein Frühlingstag, der das Herz jubeln lässt – strahlende Sonne, tiefblauer Himmel im Kontrast zu dottergelben Butterblumenwiesen und Rapsfeldern. Gedankenversonnen betrachte ich die Schönheit der Natur. Ich bin auf dem Weg zu einer Selbsthilfegruppe der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe. Die Gegend ist mir sehr vertraut. Tief unten fließt die Ems, der Fluss, der mich seit frühester Kindheit begleitet hat. Es gibt dort einen Platz, den ich besonders liebe. Weidenäste hängen tief ins Wasser. »Bitte halten Sie doch mal kurz an«, sage ich zu meinem Fahrer Thomas Barnhöfer. Er nickt verständnisvoll – er weiß, wie sehr ich diesen Ort mag. Wie oft haben wir hier schon für einen Moment gestoppt.
Ich gehe hinunter zum Flussbett, beobachte, wie sich mein Gesicht im Wasser spiegelt. Die Erinnerung an ferne Tage steigt in mir auf. Ich sehe ein kleines blondes Mädchen, das hier immer wieder Anlauf nimmt und sich, an den Weidenästen festhaltend, ans andere Ufer schwingt. Es hat riesigen Spaß dabei. Wieder und wieder schwingt es hin und her. Manchmal hat es Glück und erreicht das andere Ufer, oft hat es Pech und fällt ins Wasser. Doch dann prustet und schüttelt sich das Mädchen nur und startet einen neuen Versuch.
Das kleine Mädchen war ich. Damals konnte ich nicht schwimmen. Aber so lernte ich es. Ich brachte es mir selbst bei. Da war ich vier Jahre alt. Meine Mutter sagte mir später, hier hätte sie zum ersten Mal geahnt, welch starker Wille und wie viel Unerschrockenheit in mir steckten.
Dieser Platz ist die Verbindung zu meinen Wurzeln. Ich brauche diese Erinnerung von Zeit zu Zeit. Sie tut mir gut. Sie gibt mir neue Kraft für meine Arbeit. Es war ein weiter Weg von dem hartnäckigen kleinen Mädchen zu der Frau, die ich heute bin. Nachdenklich gehe ich zum Auto zurück. Die Patienten der Selbsthilfegruppe warten auf mich.
»Alles in Ordnung, Frau Mohn?«, fragt Thomas Barnhöfer und öffnet die Autotür. Ich nicke. Er fährt mich schon viele Jahre, wir kennen einander gut. Wir brauchen nicht viele Worte, um einander zu verstehen. Während wir weiterfahren, denke ich an die untergegangene Welt meiner Kindheit.
Tod und Verwüstung herrschten überall, als ich geboren wurde. Auf den Schlachtfeldern Europas starben Millionen Menschen – doch mein Leben begann. Wir Menschen sind Teil des ewigen Kreislaufs von Werden und Vergehen. Ich bin ein Kriegskind, meine Chancen auf ein glückliches, erfolgreiches Leben waren – wie die vieler Neugeborener damals – gering. Es ging nur um das Überleben. Die Frauen, die in dieser Zeit Kinder bekamen, sie behüteten und beschützten, sich aufopferten, um sie großzuziehen, sind noch heute Heldinnen für mich. Meine Mutter erzählte später, ich sei bei Fliegeralarm zur Welt gekommen. Es war am Vorabend des Tages, an dem der Krieg mit Russland begann – Deutschland lag wie unter einer Glocke der Angst. Angst war das beherrschende Gefühl meiner Mutter bei meiner Geburt – Angst um ihr Leben, um den Lebensstart ihres Kindes, Sorge vor einer ungewissen Zukunft. Und diese Angst übertrug sich offensichtlich auf mich. Ich habe später viel darüber gehört und gelesen, wie Kinder bereits während der Schwangerschaft Emotionen, Stimmungen und Ängste der Mutter wahrnehmen. Bei uns muss es exakt so gewesen sein: Ich war ein sehr ängstliches Baby, das nachts viel schrie und schlecht träumte. Jede Nacht musste meine Mutter mich auf den Arm nehmen, trösten, wickeln oder umziehen. Vielleicht lag hier der tiefere Grund für die besondere Bindung, die wir immer zueinander hatten.
An den Krieg habe ich – wie viele Kinder meiner Generation – nur bruchstückhafte Erinnerungen. Aber die Ängste sind mir noch gegenwärtig. Oft hatten wir Fliegeralarm in Wiedenbrück – wegen der Nähe von Bielefeld oder des Ruhrgebiets, die bombardiert wurden. Auch am Rande unserer Stadt gingen die Bomben nieder. Wie oft wurden wir Kinder aus den Betten gerissen, weil wir nachts in den Luftschutzbunker mussten. Die Angst, die ich hatte, während die Sirenen heulten und ich – oftmals noch im Nachthemd – an der Hand der Mutter die Straße entlanglief, werde ich nie vergessen. Auch nicht den muffigen Geruch in dem engen Keller, in dem Menschen ängstlich dicht an dicht bei spärlicher Beleuchtung in stickiger Luft hockten.
Eines Morgens kamen wir aus dem Bunker, und mein ganzes Bett war voller Reif. Alles war gefroren, die Eisblumen blühten am Fenster, denn es gab keine Heizung in unserem Haus. Meine Mutter erwärmte dann Steine im Backofen, die in die Kinderbetten gelegt wurden, damit wir nicht froren. Das war sehr behaglich, dieses Gefühl ist mir heute noch gegenwärtig.
Wenn ich an meine Kindheit und Jugend zurückdenke, so waren Liebe und Fürsorge die prägenden Einflüsse. Die Welt um uns herum versank in Schutt und Asche, es herrschte Hunger, Elend und Not – als Kind kann man jedoch die Tragweite des Geschehens kaum erfassen. Wir lebten bescheiden zu Hause, aber wir waren eine Gemeinschaft, die Geborgenheit und Verlässlichkeit vermittelte. Und dieses Gefühl erinnere ich bis heute. Es offenbart mir, was Kinder wirklich glücklich macht: nicht schöne Kleider, teures Spielzeug oder weite Reisen, sondern Liebe und Geborgenheit. Und davon bekamen wir in meinem Elternhaus genug, besonders von meiner Mutter!
Heute weiß ich: Man kann von materiellen Dingen keine Sinngebung erwarten. Ein Auto oder ein schönes Haus, Erfolg im Beruf ersetzen keine liebevolle Umarmung. Man kann Liebe, Zärtlichkeit oder Vertrauen nicht durch materielle Güter und aufwendige Geschenke erlangen, sondern nur im vertrauten Miteinander mit nahe stehenden Menschen.
Unsere Mutter sorgte von früh bis spät für uns. Sie hatte einen kleinen Garten gepachtet, in dem sie Gemüse und Kartoffeln anpflanzte, damit wir genug zu essen bekamen. Ich erinnere mich heute noch an den säuerlichen Geschmack der Brotsuppe, die sehr häufig zum Mittagessen auf dem Tisch stand – sie war in den Nachkriegsjahren eine unserer Hauptnahrungsquellen. Ich glaube, da ging es mir wie vielen anderen Kindern in dieser Zeit – bald wollte ich Brotsuppe weder riechen noch essen. Doch der Hunger trieb sie in den Magen. Hungersnot wie in den Großstädten gab es aber bei uns nicht. In der kleinen Stadt mit dem ländlichen Umfeld tauschte und teilte jeder mit jedem, wenn er etwas zu essen hatte. Wurde in der Nachbarschaft ein Schwein geschlachtet, bekamen alle etwas davon ab. Es war selbstverständlich, dass Nachbarn einander halfen. Häufig sammelten wir Kinder mit unserer Mutter Bucheckern, daraus wurde dann Öl gepresst. Oder wir holten Brennholz aus dem Wald. Und morgens mussten wir Kinder im Garten Käfer von den Kartoffeln abklauben. Ich weiß es noch bis heute, wie ich mich ekelte, wenn sie meinen Arm hochkrabbelten.
Langeweile und Überdruss kannten wir Kinder damals nicht. In den Familien ging es um das Überleben und den Erhalt der Existenz – wir Kinder waren in dieses Leben mit einbezogen.
Meine Mutter
Meine Mutter war gelernte Hutmacherin und stammte aus einer Familie mit neun Kindern. Mein Vater kam aus einer Bauernfamilie und machte sich als Handwerker selbstständig. Er hatte einen schweren Schicksalsschlag verkraften müssen: Er wurde vom Blitz getroffen, lag zwei Wochen bewusstlos in der Uniklinik Münster und war danach arbeitsunfähig. Er wurde nicht in den Krieg eingezogen, was ihm sehr zugesetzt hat. Ich glaube, er empfand dies als unehrenhaft, was dem damaligen Zeitgeist entsprach. Er starb früh mit sechzig Jahren.
So war meine Mutter die entscheidende Bezugsperson für uns fünf Kinder – sie trug die Verantwortung für die ganze Familie. Heute würde man sagen, sie war eine starke Frau, die eigenständige Entscheidungen traf. Damals war das selbstverständlich, darüber sprach man gar nicht. Heute nennt man eine Frau wie sie eine starke Persönlichkeit. Damals meisterten die Frauen das Leben so, wie es kam, und machten nicht viele Worte darum. Dennoch gingen die nervlichen und körperlichen Belastungen nicht spurlos an ihnen vorüber.
Unsere Mutter war immer für uns da – sie kochte, wusch, nähte Kleidung. Natürlich merkten wir Kinder, dass sie es nicht einfach hatte. Man erlebte ja, dass die Mutter jeden Pfennig zweimal umdrehen musste, dass sie oft Sorgen hatte, wie es weitergehen solle. Schon als kleines Kind spürte ich sehr genau, wenn sie etwas bedrückte. Ich nahm dann ihre Hand und streichelte sie. Ich glaube, sie verstand mich ohne Worte. Ich wollte sie auf meine kindliche Art trösten. Ich liebte sie sehr.
Trotz der schweren Zeit war sie im Grunde ein fröhlicher Mensch. Eine zierliche Frau mit schwarzen Haaren und blauen Augen, die neugierig und interessiert in die Welt schauten. Nur nicht unterkriegen lassen, war ihr Lebensmotto und Lebensgefühl – sie dachte immer positiv. Sie kannte und sang alle Lieder dieser Welt. Sie hatte viele Freunde und Bekannte, die jeden Tag kamen und sie besuchten. Nie redete sie schlecht über jemanden, hatte für jeden ein offenes Herz und war sehr hilfsbereit.
In der Nachkriegszeit gab es viele Bettler, die Leute hatten oft nichts zu essen. Meine Mutter gab immer etwas, wenn jemand vor der Tür stand – ein Stück Brot, etwas Gemüse, einen Teller Suppe. Und wir hatten auch immer Ferienkinder aus dem Ruhrgebiet, die sie aufpäppelte. Ich weiß nicht, wie sie es bewerkstelligte, aber später hat sie uns Kindern vieles ermöglicht – wir hatten Fahrräder, Rollschuhe, Schlittschuhe. Die Ufer der Ems waren unser liebster Spielplatz. Im Sommer schwammen wir darin, im Winter liefen wir Schlittschuh auf dem zugefrorenen Fluss. Wenn wir wie zu Eiszapfen gefroren nach Hause kamen, hatte sie Berliner gebacken. Sie verstand es, eine behagliche Atmosphäre zu schaffen. Was sie für uns Kinder getan hat, konnte ich erst richtig ermessen, als ich eigene Kinder hatte. Sie gab uns liebevolle Geborgenheit.
Ich weiß, dass sie in dieser Zeit viel Kraft aus ihrem Glauben geschöpft hat. Später im Alter sah sie die Religion distanzierter.
Meine Mutter liebte die Menschen. Das habe ich von ihr gelernt. Sie hat mich in dieser Hinsicht mehr geprägt, als ich als junger Mensch wahrhaben wollte und konnte. Später als Erwachsene, als Mutter von drei Kindern und berufstätige Frau mit Verantwortung für andere Menschen, bin ich mir dessen bewusst geworden.
Auch die optimistische, positive Grundeinstellung habe ich sicher von ihr. Sie blieb unternehmungslustig bis ins hohe Alter. Als sie achtundachtzig Jahre alt war, besuchte sie uns in unserem Haus auf Mallorca. Sie genoss den Blick von der Terrasse auf das Meer. Dann aber sagte sie: »Nur immer aufs Meer schauen, das wird langweilig.« Sie wollte etwas unternehmen, ins Städtchen fahren, unter Menschen gehen.
Meine Mutter wurde vierundneunzig Jahre alt. Als sie starb, erfüllte mich dies weniger mit Trauer als vielmehr mit Dankbarkeit für alles, was sie mir gegeben hatte. Abschied genommen hatte ich schon vorher, während ihrer langen Krankheit. Ich habe ganz bewusst allmählich losgelassen. So konnte ich den Schmerz besser verkraften. Diese Art des Abschiednehmens würde ich auch meinen Kindern wünschen, wenn eines Tages die Zeit für mich gekommen ist. Ich habe den Sarg meiner Mutter über und über mit weißen und rosa Orchideen schmücken lassen – es waren ihre Lieblingsblumen.
Ein tapferes Kind
Wir waren fünf Kinder zu Hause, ich war das vierte Kind. Mit meiner drei Jahre älteren Schwester Hannelore und dem fünf Jahre älteren Bruder Heinz hatte ich den engsten Kontakt, wir passten altersmäßig zusammen. Meine andere Schwester ist fünf Jahre jünger als ich. Über ihre Geburt war ich damals nicht besonders glücklich. Ich war eifersüchtig und befürchtete, die Liebe meiner Mutter teilen zu müssen.
Wenn ich heute zurückblicke auf das Kind, das ich einmal war, sehe ich ein kleines Mädchen mit blonden Zöpfen, das schmächtig und zart war und deshalb immer als das Sorgenkind der Mutter galt. Ich musste mehr essen als meine Geschwister, und ich suchte und brauchte auch mehr die Hilfe und die Nähe meiner Mutter. Ich war anlehnungsbedürftig und zärtlich – anders als meine Geschwister. So hatten wir eine besonders enge Beziehung. Meine Mutter kannte meine Ängste, die mich lange begleiten sollten: Angst, in einen dunklen Keller zu gehen, Angst vor unbekannten neuen Situationen, vor geforderten Leistungen – ich brauchte viel Ermutigung.
Ich hatte das Glück, dass ich immer Menschen in meinem Leben fand, die mich ermutigten, den nächsten Entwicklungsschritt in Angriff zu nehmen.
Andererseits – wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt hatte, tat ich alles, um es zu erreichen. Und in solchen Momenten flossen mir ungeahnte Kräfte zu: Ich wurde mutig für neue Abenteuer, vergaß alle Ängste. So zum Beispiel, als ich mir selbst das Schwimmen beibrachte.
»Ein Teil jeden Talents besteht in der Courage«, sagt Bertolt Brecht. Dieser Satz trifft auf meine Situation während der Entwicklungsjahre genau zu.
In der ersten Schulklasse war ich die Einzige, die sich traute, vom Fünfmeterbrett ins Schwimmbad zu springen. Ich war ja inzwischen eine gute Schwimmerin, nachdem ich so lange in der Ems trainiert hatte. Der Lehrer ermutigte mich. Er sagte einfach: »Probier’s mal. Du schaffst das.« Ich merkte, dass er es mir zutraute. Das beflügelte mich. Ich erinnere mich noch genau an meine Gefühle, als ich die Leiter zum Sprungbrett hochkletterte. Es ging höher und höher, als führte sie geradewegs in den Himmel. Mein Herz klopfte bis zum Hals, meine Knie zitterten. Als ich oben stand und die erwartungsvollen Gesichter des Lehrers und meiner Klassenkameraden sah, gab es kein Zurück. Ich sprang. Hinterher war ich sehr stolz auf mich. Solche Momente hatte ich öfter im Leben. Immer wenn ich das Gefühl hatte, jemand glaubt an mich, konnte ich meine Ängste überwinden. Diese Erfahrung bringe ich in meine Arbeit ein. Ich motiviere meine Mitarbeiter, indem ich sie immer und immer wieder ermutige. Übrigens: Später sprang ich dann sogar mit Salto.
Das Wasser sollte mein Element bleiben – ich wurde eine ausdauernde Schwimmerin. Heute kann ich mühelos bis zu einer Stunde im Mittelmeer schwimmen und mich dabei gemütlich unterhalten. Manager unseres Unternehmens, die uns manchmal in unserem Ferienhaus auf Mallorca besuchen, geraten dabei schon einmal aus der Puste.
In diesen frühen Jahren lebte ich eingesponnen in eine eigene Welt. Ich war ein freundliches Kind, manchmal ein bisschen verträumt. Oft saß ich nachts auf der Fensterbank in der Küche und sang Lieder. Oder ich schlüpfte um fünf Uhr morgens aus dem Bett und ging spazieren. Ich liebte es, über die taunassen Wiesen zu laufen, an der Ems entlang durch einen kleinen Wald, der Vögel erstes Tschilpen zu hören und das Rauschen der Blätter im Wind – es war wie ein Traum. Ein kleines Abenteuer, das ich bestand, so ganz allein.
Das intuitive Naturerlebnis ist eine ganz frühe Prägung. Auch heute brauche und suche ich es. Ich bin froh, dass ich Natur so intensiv erleben kann. Immer wenn ich mich ein bisschen einsam oder ratlos fühle oder wenn ich viel Stress habe, gehe ich hinaus in die Natur – über die Felder, durch die Wälder, auf die Berge. Meistens gehe ich mit raschen Schritten und atme dabei tief ein. Ich genieße den Blick in die Weite des flachen Münsterlandes bis zum Horizont. Schon nach kurzer Zeit steigt eine wohltuende Ruhe in mir auf.
So ein Spaziergang hilft, Gedanken zu klären und zu sortieren, Wesentliches von Unwesentlichem zu trennen. Wir Menschen sind nur ein kleines Rädchen im Weltgetriebe – das wird mir klar, wenn ich eine jahrhundertealte Eiche betrachte. Was könnte sie wohl erzählen … Manche Leute reisen nach Indien, um zur Ruhe zu kommen, um ihre Mitte zu finden. Es entspricht auch dem Zeitgeist, ins Kloster zum Meditieren zu gehen. Ich finde meine Mitte in der Natur. Der Wind, der über mein Gesicht streicht, wehte auch schon vor zweitausend Jahren, als die Römer unweit im Teutoburger Wald gegen Arminius, den Cherusker, kämpften – die Endlichkeit des menschlichen Seins wird mir bewusst. Auf einmal nehme ich mich nicht mehr so wichtig. Glücklichsein beginnt im Kopf. Es ist meine Entscheidung, das Innenleben nicht von äußeren Umständen abhängig zu machen. Ich bin sehr froh, dass ich den Blick für die kleinen Dinge des Lebens behalten habe und mich daran erfreuen kann. An einer schönen Blume, einem Sonnenuntergang am Meer, dem Anblick riesiger Berge, dem Lächeln eines Menschen, einem vertrauten Gespräch.
Die prägenden Jahre: Schule und Pfadfinderzeit
Der Tag meiner Einschulung war ein schwerer Tag. Ängste marterten mich: Ich musste mich zum ersten Mal von meiner Mutter trennen, fühlte mich schutzlos und preisgegeben. Ich weiß noch genau, wie bang ich in der ersten Reihe saß und zu der Lehrerin hochguckte. Frau Verhoff war schon etwas älter und ein absoluter Glücksfall für mich, sie ging so mütterlich und warmherzig mit uns Erstklässlern um, dass ich schnell meine Ängste verlor. Ich bekam mehr Zutrauen zu mir selbst und wurde dann das kleine Strahlemädchen, das es einfach mit den Lehrern hatte, weil es ihre Herzen gewann.
Später, als ich schon längst in Gütersloh wohnte und diese Lehrerin pensioniert war, sah ich sie zufällig an einer Bushaltestelle stehen, als ich mit dem Auto vorüberfuhr. Ich hielt an und nahm sie ein Stückchen mit. Sie hatte mich kaum erkannt. Wir sprachen über die frühen Jahre, und ich dankte ihr für ihre Zugewandtheit und Güte, die mir als Schulkind viel Geborgenheit und Hilfe gegeben hatten.
In Erinnerung geblieben ist mir, dass ich fast immer als Letzte und meistens mit offener Schultasche in die Schule kam. Auch meine Aufgaben, zum Beispiel Auswendiglernen, machte ich lieber morgens um vier oder fünf Uhr vor Schulbeginn als am Tag vorher. Dann war ich gut. Deutsch und Geschichte fand ich spannend und interessant, Mathematik war nicht mein Fach. Auch Sport nicht. Geräteturnen zum Beispiel war mir verhasst, weil ich Angst hatte und auch zu schwach war. Erst später, durch die veränderten Lebensumstände, wurde ich so sportlich, wie ich es heute bin.
Fazit meiner Schulzeit ist die Erkenntnis, dass nicht unbedingt die besten Schüler die Garantie auf den größten Erfolg im Leben hatten. Und auch manch schönes Mädchen aus meiner Schule ist einen schweren Lebensweg gegangen. Ich glaube, dass für den Lebenserfolg ganz andere Eigenschaften entscheidend sind als nur Schönheit, Wissen oder erstklassige Studienabschlüsse. Die Bereitschaft, sich anzustrengen, zum Beispiel ist ganz wichtig, und die logisch-rationale Intelligenz muss gepaart sein mit emotionaler Intelligenz. Und natürlich auch mit Ausdauer, Disziplin, Energie und Durchsetzungsvermögen. Herz und Gefühl spielen ebenfalls eine Rolle: die Fähigkeit, auf Menschen zuzugehen, sie für sich zu gewinnen und neue Ideen zu vermitteln. Selbstmotivation, Intuition, Kreativität und Teamfähigkeit – das sind Eigenschaften, die im neuen Jahrtausend zählen werden.
Je älter ich wurde, desto mehr zeigte sich mein quirliges Temperament. Meine Neugierde trat immer stärker hervor. Alles interessierte mich. Schickte meine Mutter mich los, Besorgungen zu machen, entdeckte ich unterwegs so viel Interessantes und Neues, plauderte mit diesem und jenem, dass ich viel zu spät wieder heimkam.
Um meine Abenteuerlust und Impulsivität zu kanalisieren, meldete sie mich bei den katholischen Pfadfindern an. Mit sechs Jahren wurde ich »Wichtel«.
Das war eine fabelhafte Schule für mich. Ich lernte das Gemeinschaftsleben in Jugendherbergen. Bis heute begleiten mich wunderschöne Erinnerungen an Lagerfeuer, Sternfahrten in der Nacht, Schlafen im Stroh in irgendwelchen Hütten oder auch im Freien, gemeinsames Singen und Kochen mit den Herbergseltern, Waschen mit kaltem Wasser – »einfaches Leben pur«, das heute für zivilisationsmüde Menschen von Reiseveranstaltern für viel Geld als Abenteuertour verkauft wird. Besonders aufregend waren Nachtwanderungen ohne Taschenlampe beim Schein des Mondes und lange Fahrradtouren, bei denen ich immer die Letzte, weil eben die Schmächtigste war. Niemand schalt mich deshalb oder wurde ungeduldig mit mir. Im Gegenteil, man wartete und nahm Rücksicht auf die Schwächeren.
Insofern war das Pfadfinderleben ein Erziehungsprogramm für junge Menschen, das den Charakter bildete. Man war aufeinander angewiesen, wenn man gemeinsam auf Fahrt ging. Zelt aufbauen, Feuer machen mit nur einem Streichholz, Kochen, Abwaschen – jeder tat etwas für die Gemeinschaft. Keiner konnte ausscheren oder Sonderwünsche verlangen. Das hätte das ganze Gefüge gestört. Damit wuchs eine gesellschaftliche Tugend in uns heran, die anderswo kaum noch gelehrt und gelernt wird: Verantwortung für andere zu übernehmen.
In der Gruppe fühlte ich mich geborgen. Ich musste aber auch lernen, Eigeninteressen zu Gunsten der Gruppe zurückzustellen. Da hieß es, manchmal ganz schön die Zähne zusammenzubeißen und die Tränen zurückzuhalten. Als ich dann älter war, teilte ich mir mit einer Kameradin die Führung einer Mädchengruppe. Das machte mir großen Spaß. Man musste Vorbild sein für die kleinen »Wichtel« und gleichzeitig auch auf sie aufpassen. Schließlich hatte man die Verantwortung für die Kleinen. Übrigens: Die Wander- und Fahrtenlieder, die ich damals gelernt habe, kann ich heute noch. Ich habe sie auch meinen Kindern beigebracht. Den Text meines Lieblingsliedes »Gedanken sind frei« habe ich gerahmt in meinem Büro stehen.
Und noch etwas habe ich dabei gelernt: Jeden Tag eine gute Tat – das Pfadfindermotto. Ich habe es bis heute verinnerlicht. Und wenn es nur ein Lächeln ist, das ich einem Menschen schenke – aber ich schenke es ihm und gehe nicht achtlos vorüber.
Als meine Kinder klein waren, suchte ich übrigens für sie Pfadfindergruppen. Allerdings wurden zu dieser Zeit, als Folge der »68er-Bewegung«, die Pfadfinder mit ihrer Gemeinschaftsdisziplin und strengen Organisation in die konservative Ecke gestellt. Ich fand keine Gruppe für meine Kinder. In den letzten Jahren haben die Pfadfinder offenbar wieder mehr Zulauf bekommen; Eltern suchen heute dort für ihre Kinder fernab von der übersättigten Konsumgesellschaft Naturverbundenheit und Abenteuer – eine Erlebnispädagogik, die sie ihnen in der Stadt nicht bieten können.
Dreißig Millionen Pfadfinder gibt es inzwischen weltweit. Das hätte sich der Begründer der Bewegung, der englische General Baden-Powell, 1907 nicht träumen lassen. Viele Prominente waren übrigens Pfadfinder – fast alle US-Präsidenten und in Deutschland der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Wolfgang Clement, Ex-Arbeitsminister Norbert Blüm, auch Entertainer Thomas Gottschalk sowie Christiane Herzog, die verstorbene Ehefrau des früheren Bundespräsidenten Roman Herzog.
Aufwachsen in einer Kleinstadt – Traditionen und Werte
Wiedenbrück hatte in meiner Kindheit circa achttausend Einwohner. Die Anfänge der Stadt gehen bis ins 12. Jahrhundert zurück. Der Grundriss der mittelalterlichen Stadt ist bis heute erhalten. Straßen mit Kopfsteinpflaster bilden ein engmaschiges Netz um Markt- und Kirchplatz. Giebelständige Ackerbürgerhäuser prägen das Stadtbild: Es gibt zweiundvierzig mit Inschriften und Datum versehene Ackerbürgerhäuser, die zwischen 1500 und 1850 gebaut wurden und die heute wunderschön restauriert sind. Ihre mit geschnitzten, bunt bemalten Ornamenten geschmückten Fassaden zeigen Formen der Renaissance, des Barock und des Klassizismus. Die großen Einfahrtstore der Ackerbürgerhäuser zeugen von der großen Bedeutung, die die Landwirtschaft einst für die Stadt hatte. Wiedenbrück blieb über lange Jahrhunderte hinweg katholisch, erst im 19. Jahrhundert konnte sich eine evangelische Gemeinde etablieren.
Man kannte einander damals in der kleinen Stadt. Uns Kindern gab das ein Gefühl von Schutz und Sicherheit, überall war man gern gesehen, keiner konnte verloren gehen. Ich mochte das. Gern tobten wir durch die engen mittelalterlichen Gassen. Ein bevorzugter Wettstreit war auch der Versuch, die erhaltenen deutschen und lateinischen Inschriften an den Häusern zu entziffern. Auf der Rückseite des 1619 erbauten Rathauses zum Beispiel findet man die zum Teil erhaltene lateinische Inschrift: »… die Kriege sind das Ende. Der Friede ist Mutter von allem, der Hüter der Dinge … kein Vergnügen, keine Liebe, kein Werk der Religion. Friede lässt die Zeiten sich erneuern, Friede bringt goldene Zeiten, und er hat die Sitten der strengen Einfachheit.«
Mich hat es als Kind sehr fasziniert, dass dort die Worte und Gedanken unserer Vorfahren verewigt waren. Es gab mir eine Ahnung von gelebter Geschichte. Was würden wir dereinst an unsere Nachfahren weitergeben?
Wiedenbrück hat sich seinen Charme bis heute bewahrt. Unter den Bürgern herrscht ein gutes Zusammengehörigkeitsgefühl, sie sind stolz auf ihre Stadt. Zum alljährlichen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz gehe ich heute noch gern, trinke dort Punsch mit alten Freunden und plaudere über frühere Zeiten.
Meine Erziehung war katholisch geprägt. Morgens um sieben Uhr vor der Schule mussten wir Kinder immer zur Andacht, an Weihnachten um fünf Uhr morgens zur Kirche. Ich erinnere mich, wie jämmerlich ich fror. Es war ja noch nicht geheizt zu Hause, und in der Kirche war es auch bitterkalt.
Zu Hause beteten wir Kinder reihum bei Tisch. Mein Gebet war immer sehr kurz: »Für Speis und Trank sag ich dir Dank. Amen.« Zu längerem Gebet hatte ich keine Lust.
Die alljährliche Fronleichnamsprozession dagegen gefiel mir. Das war ein schöner Brauch. Die Kinder gingen schulklassenweise in die Wiesen, pflückten Margeriten und Wiesenschaumkraut, die Erwachsenen schnitten Pfingstrosen in ihren Gärten. Damit wurden die Altäre in der Hauptstraße geschmückt. Ich habe heute noch den Geruch der frisch abgehackten kleinen Maibäume in der Nase, die entlang der Straße aufgestellt wurden und sie wie eine Allee erscheinen ließen. Wir Mädchen trugen weiße, mit Spitzen verzierte Kleider und durften Kniestrümpfe oder Söckchen anziehen. Aus kleinen Henkelkörbchen streuten wir Blumen auf die Straßen. Die Menschen kamen aus ihren Häusern und schlossen sich der Prozession zum Kirchplatz an. Dort sangen sie: »Großer Gott, wir loben dich.« Es war alles sehr feierlich und berührte mich sehr.
Es war eigentlich eine schöne Tradition, sie vermittelte Menschen ein Gemeinschaftserlebnis. Aber auch andere Bräuche oder gesellschaftliche Ereignisse außer den kirchlichen – zum Beispiel Schützenfeste, Gesangsvereine oder auch Familienfeste – sind für mich positiv besetzte Traditionen. Sie geben den Menschen ein Wertegerüst, vermitteln Mitmenschlichkeit, Zusammenhalt und Geborgenheit. Ich finde, diese Traditionen sollten wir uns erhalten und nicht über Bord werfen. Sie sind ein Stück Kulturgut. Menschen ohne Traditionen leben gleichsam geschichtslos, wie im luftleeren Raum. Es ist, als seien sie von ihren Wurzeln abgeschnitten. Für mich sind meine Erinnerungen an diese Traditionen sehr schön. Es war eine kleine Welt für sich. Aber sie gab mir ein festes Fundament. Psychologen sagen, dass so etwas für Kinder sehr wichtig ist, um später eine eigenständige, in sich ruhende Persönlichkeit zu entwickeln. Laut meiner heutigen Erfahrung stammen viele erfolgreiche Manager und Unternehmer aus einem Umfeld mit solch stabilen Strukturen.
Ich erinnere mich auch besonders gern an die Weihnachtszeit. Es war eine Zeit der Erwartung und der Freude. Wie oft haben wir Kinder mit meiner Mutter zusammen Plätzchen gebacken und sie hinterher bei heißem Kräutertee und Kerzenlicht verzehrt. Dabei sangen wir Weihnachtslieder, bastelten selbst den Christbaumschmuck. Unsere Mutter sprach dann über die Bedeutung des Weihnachtsfestes, das daran erinnern soll, dass die Menschen mit all ihren Fehlern Hilfe brauchen und ihnen Vergebung durch Liebe geschenkt wurde.
Mein schönstes Weihnachtsgeschenk war eine selbst gemachte Puppe, die meine Mutter für mich aus Stoffresten gefertigt hatte. Später war ich stolz, als ich eine »richtige« Puppe mit einem Porzellankopf und einer Wiege geschenkt bekam.
Mein Taschengeld verdiente ich mir schon früh selbst. Ich trug den »Dom« aus, das war eine katholische Zeitung. Das habe ich gern gemacht. Alle Leute kannten mich, und immer ergab sich eine kurze Unterhaltung an der Haustür. Ich hatte keine Scheu und keine Ängste, sondern war sehr kommunikativ. Da ich so ein fröhliches Strahlekind war, bekam ich auch immer ein kleines Trinkgeld. So lernte ich, wie positiv Menschen auf Freundlichkeit reagieren, getreu dem Sprichwort »Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus.«
Abenteuerlust
Als ich etwas älter war und schon gut lesen konnte, wurde ich eine richtige Leseratte. Ich verschlang alle Bücher, die ich bekommen konnte: »Heidi«, »Die Schatzinsel«, »Onkel Toms Hütte«, auch die Werke von Karl May, Mark Twain, Jules Verne. Abenteuergeschichten liebte ich besonders. Sie weckten meine Neugierde. Ferne Welten interessierten mich – wie sieht eine Kokosnuss aus, wie ist es in Brasilien, wie gefährlich sind Krokodile, wie leben Missionare, wie Indianer? Das wollte ich alles einmal selbst kennen lernen, nahm ich mir insgeheim vor.
Doch zuerst wollte ich Deutschland erkunden. Dazu hatte ich Gelegenheit, als ich mit meiner Cousine eine Radtour machte. Ich war vierzehn, sehr neugierig und sehr abenteuerlustig. Mein Vater hatte es organisiert, dass ein bekannter Spediteur uns mit dem Lastwagen nach Würzburg mitnahm, und von dort sollten wir mit dem Fahrrad nach Wiedenbrück zurückfahren. Da wir beide erfahrene Pfadfinderinnen waren, hatten wir unsere Zelte dabei und etwas Proviant in den Satteltaschen.
Ich erinnere mich genau, als uns der Freund unseres Vaters an der Straße absetzte. Nach Norden ging es Richtung Heimat, doch in die andere Richtung ging es nach Rothenburg ob der Tauber. Von diesem romantischen Städtchen hatten wir schon viel gehört. Warum sollten wir uns nicht erst Rothenburg anschauen, bevor wir heimfuhren? So radelten wir los.
Rothenburg gefiel uns gut, aber es gab dort ein Hinweisschild nach München. Warum sollten wir nicht noch nach München fahren? Es wäre doch schön, wenn wir München kennen lernten, schlug ich vor. Wir hatten Glück, ein Lastwagenfahrer nahm uns mit nach München. Ja, und von dort ging’s dann an die oberbayerischen Seen, von da aus mit einem Lastwagen nach Hamburg und sogar mit dem Schiff »Bunte Kuh« nach Helgoland – die Fahrräder immer im Gepäck.
So ließen wir uns durch Deutschland fahren, machten Station, wo es uns gefiel. Wir fanden es herrlich, waren aber so vorsichtig, dass wir uns die Lastwagenfahrer genau anschauten, bevor sie uns mitnahmen. Einer hatte seine beiden Kinder dabei – er erschien uns als besonders vertrauenswürdig. Die Kinder saßen vorn bei ihm im Führerhaus, wir schliefen hinten auf der Ladefläche. Unseren Eltern schrieben wir Ansichtskarten. Sie fielen aus allen Wolken über unsere Reiseroute. Nach drei Wochen waren wir wieder zu Hause, völlig verdreckt – aber glücklich über das Abenteuer. Wie froh und erleichtert waren unsere Eltern, dass wir wieder heil nach Hause gekommen waren. Erst in diesem Moment wurde uns bewusst, wie viele Sorgen wir ihnen bereitet hatten, und es tat uns aufrichtig leid. Aber unsere Neugier und Abenteuerlust hatten alle Bedenken beiseitegeschoben – wie das bei Jugendlichen so oft geschieht.
Diese Reise hatte in mir den Wunsch entstehen lassen, eines Tages die enge Welt von Wiedenbrück hinter mir zu lassen. Ich wollte mehr sehen, mehr erleben.
Ich hatte die feste Absicht, aus meinem Leben etwas zu machen. Wie und was, das wusste ich nicht genau. Von einer Karriere träumte ich nicht, eher von einem guten Arbeitsplatz, einem netten Mann und vielen Kindern. Ich bin ein intuitiver Mensch. Und meine Intuition war mein Leben lang ein guter Kompass. Es war nicht so, dass ich Ziele bewusst angepeilt habe. Aber wenn sich Möglichkeiten ergaben, dann war ich hellwach, sie zu erkennen und zu ergreifen. Dann entwickelte ich viel Entschlusskraft. Ich war stets gern mit Menschen zusammen, die anders waren als ich. Die vom Leben etwas wussten, die eine andere Bildung hatten, von denen ich lernen konnte.
Es hat immer Bruchstellen in meinem Leben gegeben; ich würde sie als Zustand plötzlicher Klarheit und Erkenntnis bezeichnen. Ein solches Schlüsselerlebnis war für mich damals die Begegnung mit einer Studentengruppe. Ich erkannte, dass sie die Chance hatten, aus ihrem Leben etwas zu machen. Das wollte ich auch. Ich wusste aber auch, dass man sich die Chance dazu erarbeiten muss, sie fliegt einem nicht zu. Man muss sich schon sehr anstrengen.
Und ich wollte eine Chance!
Die erste Begegnung
Noch heute wundere ich mich über die Courage, die ich bewies, als ich mich bei Bertelsmann vorstellte. Das hat eine Vorgeschichte: Meine Mutter hatte mir eine Lehrstelle bei einem Zahnarzt als Helferin besorgt. Damals, in den Fünfzigerjahren war man – wie heute – froh, wenn man einen Ausbildungsplatz bekam. Ich trat die Stelle an. Doch es gefiel mir nicht. Ich hatte etwas anderes im Kopf. Eine Freundin arbeitete bei Bertelsmann, und das erschien mir wesentlich interessanter und ausbaufähiger.
Also bewarb ich mich – ohne meine Mutter einzuweihen – bei Bertelsmann. Zum Vorstellungsgespräch in der Vertriebsstelle des Buchclubs zog ich meine beste weiße Bluse an. Damals liebte ich weiße Blusen. Sie wirkten immer so gepflegt, und man sah darin frisch und sauber aus.
Die drei Kilometer von Wiedenbrück zur Vertriebsgeschäftsstelle in Rheda bin ich gelaufen. Als ich mit Frau Ehrmann sprach – sie war damals für das Personal zuständig -, war ich sehr nervös. Sie war eine Frau mit großem Einfühlungsvermögen, und ich glaube, ich gefiel ihr auf Anhieb. So gab sie mir einen Ausbildungsplatz. Ihr Mann war übrigens Geschäftsführer der Vertriebsstelle.
Nach diesem Gespräch hätte ich die ganze Welt umarmen können, so stolz war ich. Irgendwie hatte ich eine Ahnung, dass das Leben noch Überraschungen für mich bereithielt.
Sechs Wochen später fand das alljährliche Betriebsfest statt. Ich musste mit meinen Eltern darüber diskutieren, ob ich überhaupt dorthin gehen durfte, denn mit siebzehn Jahren war man noch nicht volljährig. Es war eine andere Erziehung damals, ich durfte noch nicht abends ausgehen. Nach langem Hin und Her gaben sie mir Ausgang bis zweiundzwanzig Uhr.
Ich erinnere mich noch genau an diesen Abend. Ich saß in einer Schar von jungen Mädchen, die alle Auszubildende waren. Ich fand mich hübsch in dem neuen weißen Wollkleid, das meine Mutter mir genäht hatte. Ich sah Reinhard Mohn inmitten einer Gruppe von Menschen hereinkommen, die ich nicht kannte. Ich war neugierig auf ihn. Wie die anderen Mädchen reckte ich den Hals nach ihm. Ich fand, dass er eine starke Ausstrahlung hatte. Seine Haltung war sehr aufrecht, ein kleines Lächeln umspielte seinen Mund. Ich fand ihn sehr charismatisch.
Als er dann ausgerechnet mich aus dieser Mädchenschar zum Tanzen aufforderte, war ich völlig überrascht. Wir tanzten einen Walzer. An unser Gespräch erinnere ich mich nicht mehr genau, ich schätze, es war der übliche Smalltalk. Aber ich weiß, dass ich sehr überrascht war, wie offen und charmant er war. Bei dem Spiel »Eine Reise nach Jerusalem« blieben wir beide übrig und kämpften um den letzten Stuhl. Er gewann das Spiel.
Ich merkte, dass wir uns gut verstanden. Wir feierten bis in den Morgen. Um fünf Uhr in der Früh brachte er mich nach Hause. Ich erinnere mich noch, dass uns die Polizei ein Weilchen verfolgte, weil er zu schnell fuhr. Meine Mutter erwartete mich an der Haustür. Sie hatte die ganze Nacht nicht geschlafen, weil ich nicht um zweiundzwanzig Uhr zu Hause war. Es tat mir leid um ihre Sorgen, das ist bis heute so. Aber ich war jung, offen für alles Neue und wollte so viel erleben.
Auf die Frage, warum er gerade mich aus dieser Schar junger Mädchen aussuchte, sagte mein Mann später augenzwinkernd: »Es war gute Personalarbeit.«
Unsere Begegnung war ein Zufall – sage ich immer. Mein Mann sieht es mystischer – er glaubt eher an Bestimmung. Von dem Tag an war für mich nichts mehr so, wie es vorher war …
Später wurde daraus eine glückliche Ehe und Lebensgemeinschaft. Eine große Liebe – Hand in Hand!
2. Frauenleben
Ich musste schnell erwachsen werden.