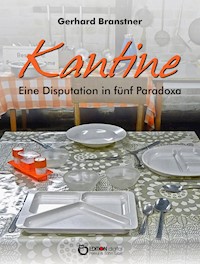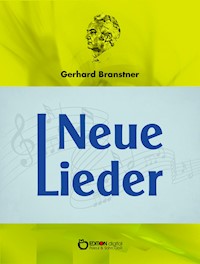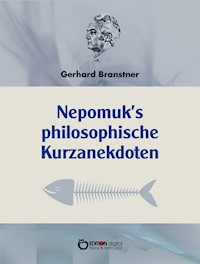8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Diese prominenten Persönlichkeiten kann man in „Liebengrün" anders als gewöhnlich sehen: Rudolf Bahro, Peter Bause, Johannes R. Becher, Manfred Bieler, Wolf Biermann, Lothar Bisky, Johannes Bobrowski, Bertolt Brecht, Gunther Emmerlich, Hanns Eisler, Friedrich Engels, Konstantin Fedin, Günther Fischer, Jean Kurt Forest, Franz Fühmann, Johann W. von Goethe, Egon Günther, Gregor Gysi, Klaus Gysi, Peter Hacks, Kurt Hager, Wolfgang Harich, Stefan Heym, Hans Heinz Holz, Erich Honecker, Hermann Kant, Barbara Kellerbauer, Friedrich Karl Kaul, Heinz Knobloch, Manfred Krug, Günter Kunert, Christa Lehmann, Wladimir I. Lenin, Richard Löwenthal, Georg Lukacs, Wladimir Majakowski, Siegfried Matthus, Karl Marx, Michelangelo, Heiner Müller, Konrad Naumann, Hans Pischner, Friedrich Schinkel, Erich Schmidt, Horst Schönemann, Kurt Schwaen, Peter Sodann, Friedo Solter, Josef Stalin, Rudi Strahl, Erwin Strittmatter, Walter Ulbricht, Leonardo da Vinci, Sahra Wagenknecht, Christa Wolf, Marianne Wünscher, Gerhard Zwerenz Erst lachen - dann denken (ist keine alte Bauernregel, sondern die 2000-jährige Lebensregel der Pygmäen) mit dem großen Spaßmacher aller vier Himmelsrichtungen, dem bedeutenden Dichter und Denker Dr. Gerhard Branstner.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 369
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum
Gerhard Branstner
Liebengrün
Ein Schutzengel sagt aus - Autobiografie
ISBN (E-Book) 978-3-95655-729-3
Die Druckausgabe erschien erstmals 2007 im Kay Homilius-Verlag Berlin.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2016 EDITION digital® Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
VORSATZ
Branstner gibt mit„Liebengrün" einen völlig unüblichen, ungewöhnlichen Lebensbericht. Und er hat dafür ein eigenes Genre geschaffen.
B. ist Schöpfer eines verblüffend neuartigen Geschichtsbildes und geht damit nicht nur weit über Marx hinaus, sondern findet eine grundlegend höhere Weitsicht, eine Gegenwelt der Beletage. Von dieser Höhe aus gewinnt er Maßstäbe, die alle bisher geltenden Urteile (in Ökonomie, Politik, Moral und Kunst) über den Haufen werfen und ganz andere, unerwartete Urteile an ihre Stelle setzen.
B. ist originärer Religionsstifter, indem er die Philosophie der unbotmäßigen Heiterkeit zur Religion der Atheisten ausbildet, einer unfrommen aber heilsamen Religion. Und er gibt historische Beispiele von Vorläufern dieser Religion.
B. bietet mit „Liebengrün" das Kompendium eines enormen Weltwissens und gibt uns damit eine Bibel der Weltweisheit in die Hand.
Bs. Autobiografie ist folglich ein Lehrbuch der Lebenskunst, die in Art und Universalität den konventionellen Rahmen sprengt.
B. beherrscht 18 Berufe, im speziellen über 30 Genres der Belletristik und über 10 Genres der Dramatik. Er hat 8 Wissenschaften begründet, womit der Mensch endlich in seiner inneren Beziehung von der Natur bis zur Kunst erfasst wird. Leonardo da Vinci, das universellste Universalgenie, verzwergt dagegen zu einem Torso.
B. hat von kindauf kraft seines Charakters und seiner Geistesart seine Umwelt zu Reaktionen provoziert, die uns sein Leben wie ein Märchen erscheinen lassen. Wie das gute und wie das böse Märchen. Wodurch uns aber unser eigenes Leben erst in seiner Wirklichkeit erkennbar wird.
All das ist hinter Branstners schlichter Wesensart nicht zu vermuten.
I. Das Entree
Indem du, geneigter Leser, dieses Buch liest, trittst du in eine andere Welt ein. Eine Welt, die es nicht gibt, die es nur in meinem Kopfe gibt. Und in diesem Buche. Als mein Leben. Und das ist unglaublich wie ein Märchen, so schön wie das schöne aber auch so böse wie das böse Märchen.
Und beides, das Schöne wie das Böse, erklärt sich aus einer anderen Unglaublichkeit, meinen Naturbegabungen.
Ich bin, sobald ich laufen konnte, langsam gegangen. Ich weiß das, weil mich die anderen dauernd gestupst haben. Erst Jahrzehnte später, an der Uni Jena, als man mich fragte, warum ich so langsam gehe, sagte ich: „Ich habe keine Zeit, schnell zu gehen. Da genießt man das Gehen nicht, sieht nicht die Umgebung, die Menschen, rennt blindlings über die Straße, kommt nicht zum Denken und Arbeiten.“ Schnell gehen ist verlorene Zeit. Eine andere Begabung. Ich wollte, kaum vier Jahre, unbedingt herausbekommen, warum die Menschen gut oder böse sind, was sie antreibt und ihr Verhalten überhaupt erklärt. Da die Frauen, wenn ein Windstoß kommt, die Hände auf den Rock halten, vermutete ich, dass sich darunter des Rätsels Lösung befand. Also kroch ich, als sich meine Mutter, die Tanten und Nachbarinnen zum Kaffeeklatsch an den Tisch gesetzt hatten, unter den Tisch, um das Rätsel zu entdecken. Da man mich vermisste, rief meine Mutter: „Wo ist denn nur der Gerhard, wo ist er denn nur?“ Vor Schreck stieß ich einer Tante ans Bein. Die schrie auf, guckte unter den Tisch und meinte empört: „Da ist er ja, nein so ein Ferkel, wollte wohl unter die Röcke gucken, nein so ein Ferkel!“ Das war der erste Ärger, den mir meine gute Absicht einbrachte.
Eine andere Naturgabe war, dass ich gut lügen konnte. Mein Vater war ein Wahrheitsfanatiker. Daher war er fanatischer Antifaschist.
Und in Thüringen war Gauleiter Saukel (mein Vater tauschte das G gegen S und S gegen G aus) schon lange vor Hitler an der Macht. Die illegalen Treffs meiner Eltern mit Gleichgesinnten fanden in unserer Wohnung statt. Also musste ich, wenn mich jemand fragte, was die Leute bei uns gewollt hätten, sagen: Die haben Karten gespielt und Witze erzählt. Einerseits bläute mir mein Vater dauernd ein, stets nur die Wahrheit zu sagen, andrerseits musste ich glaubhaft lügen. Ich glaube, dass ist für ein Kind in meinen Alter kaum ein Problem. Aber bei mir brachte es eine Quelle zum Sprudeln: die Fantasie. Ich dachte mir immer neue Lügen aus, die weit über die Treffs hinausgingen und die immer glaubhaft sein mussten. Lieber Leser, Nachtigall, du hörst sie trapsen. Da meldete sich der Dichter an. Und die Ahnung, dass die Wahrheit nicht das Höchste ist, sondern die Weisheit.
Da gibt es eine hübsche Anekdote: Ein Passagierschiff macht auf hoher See Halt, da einige Leute ein Bad nehmen wollen. Der Kapitän steht an der Reling und beobachtet die Schwimmer. Zwei von ihnen wagen sich weit hinaus. Eben da sieht der Kapitän, dass ein Hai auf sie zukommt. Er zieht seine goldene Uhr, hält sie an der Kette hoch und ruft: „Wer als erster hier ist, bekommt die goldene Uhr.“ Die beiden kraulen aus Ehrgeiz und um der Uhr wegen wie verrückt drauflos und kommen, bevor der Hai zuschnappen kann, an Bord. Als der erste nach der Uhr verlangt, zeigt der Kapitän auf den Hai. Die beiden begreifen die rettende Weisheit des Kapitäns und fallen vor ihm auf die Knie.
Allerdings ist es nicht immer leicht, die Schädlichkeit der Wahrheit und den Nutzen der Weisheit zu erkennen. Und manchmal ist die Weisheit für den, der ihr den Vorzug gibt, nicht nur ein Risiko, sondern sogar lebensgefährlich, wie die Tierfabel zeigt.
Klugheit und Mut wohnen unter einem Hut
Dem Löwen war ein Junges entlaufen, und er befürchtete, dass es einem anderen Raubtier zum Opfer fallen könnte.
Da kam das Wiesel gelaufen und sagte dem Löwen: Dein Junges wurde gefunden; es ist wohlauf und wird noch heute von der Hyäne zurückgebracht. Über die frohe Nachricht geriet der Löwe außer sich und soff sich einen gewaltigen Rausch an. Als er so voll war, dass er nicht mehr auf den Beinen stehen konnte und unanständige Lieder zu singen begann, brachte die Hyäne das Löwenjunge, es war aber tot. Der Löwe brauchte in seinem Schumm einige Zeit, bis er das begriffen hatte. Na warte! drohte er jetzt dem Wiesel, wenn ich wieder auf den Beinen stehen kann, sollst du die Lüge büßen.
Die Lüge hat dich, entgegnete das Wiesel, in einen Zustand versetzt, in dem du die Wahrheit ertragen konntest; was soll ich da büßen?
Als der Löwe wieder nüchtern war, sagte er zu dem Wiesel: Du warst nicht nur klug, du warst auch mutig. Hätte ich die Wahrheit erfahren, als ich noch einigermaßen auf den Beinen stehen konnte, wäre es um dich geschehen gewesen.
Um das Entree abzurunden und dem Leser einen Vorgeschmack von den Kuriositäten meines Lebens zu geben, einen Sprung in das Jahr 1959. Da hatte ich meine Dissertation abgeschlossen. Ich hatte sie nicht wie üblich in einer vierjährigen Aspirantur angefertigt, sondern nebenbei und in anderthalb Jahren. Und da man, so die gültige Auffassung, als Lehrer im gesellschaftswissenschaftlichen Grundstudium bei der Lehrbelastung überhaupt nicht nebenbei schreiben konnte, habe ich sie zum Spotte dieser Auffassung bei doppelter Lehrbelastung geschrieben. Außerdem verfasste ich schon kleinere literarische Sachen, vor allem aber war ich Hausmann. Da meine Frau an der ABF studierte und ein Baby zu versorgen war, habe ich die Babypflege sowie das Kochen und Backen übernommen.
Diese verrückte Zeit habe ich nicht als verrückt begriffen und bin unbeschadet über sie hinweggekommen. Richtig verrückt wurde es ja auch erst jetzt. Die Dissertation wurde von sechs Professoren abgelehnt, drei verlangten Änderungen. Das ging über drei Jahre. Da wurde es meinem Institutsdirektor, Professor Forgbert, zu viel und er organisierte ein Streitgespräch mit den Ablehnern und Interessierten, etwa 20 Leuten, und mir. Ich habe die gesamte versammelte Gesellschaft widerlegt und lächerlich gemacht. Beim Hinausgehen legte mir Professor Scheler, mein schlimmster Gegner, den Arm auf die Schulter und sagte: „Alle Achtung, wir haben dich nicht aufs Kreuz gekriegt.“ Meine Antwort: „Und da habe ich nicht mal die Hand aus der Hosentasche genommen.“
Aber abgelehnt blieb die Dissertation nach wie vor. Eine Dissertation wird abgelehnt, weil sie zu schlecht oder zu gut ist. Als sie nach vier Jahren von Professor Girnus angenommen wurde, sagte er mir: „Das ist doch klar, dass sie abgelehnt wurde, da sind zu viel neue Gedanken drin.“ Und er bot mir an, sein Assistent zu werden. Aber da war ich schon im Eulenspiegel Verlag.
Die Dissertation brachte ein ganz anderes und wichtigeres Problem an dem Tag. Professor Albrecht lehnte die Dissertation mit der Begründung ab, dass sie keine wissenschaftliche Arbeit, sondern eine Aphorismensammlung sei. Dass sie das auch war, wusste ich selber und hatte sie bereits dem Aufbau Verlag angeboten, in Auszügen und mit Aphorismen aus der Diplomarbeit und aus dem Zettelkasten. Und da begann neben dem Hürdenlauf mit der Dissertation ein zweiter Hürdenlauf. Allerdings mit lustigen Einlagen. Joachim Schreck, ein sehr guter Lektor, bestellte mich zur Vertragsunterzeichnung. Es war Sommer, und ich hatte kurze Hosen an. Als erstes fragte Schreck, warum mein Vater nicht selber komme. Ich sagte, ich sei doch volljährig. Aber unterschreiben, meinte Schreck, müsse der Autor. Als ich mich als Autor vorstellte, sagte Schreck, dass Aphorismen nur ein altersweiser Mensch schreiben könne. So ein junger wie ich könne das unmöglich. Nachdem ich unterschrieben hatte, warnte ich ihn, dass es Schwierigkeiten geben könne. Da hatte der Ärger mit der Dissertation noch gar nicht angefangen. Die Druckgenehmigung des Ministeriums ließ denn auch über Gebühr auf sich warten. Schreck rief an und man sagte ihm, das Manuskript sei verloren gegangen. Ich forderte Schreck auf, den Leuten zu sagen, dass das Verlorengehen zwecklos sei, da ich noch Exemplare habe. Also fand man das Manuskript und lehnte es ab. Schreck nahm das nicht hin und verlangte konkrete Angaben. Das Ministerium monierte etwa ein halbes Dutzend Aphorismen. Da der Umschlag nicht der Zensur unterliegt, setzte Schreck diese Aphorismen auf die hintere Seite des Umschlages. Währenddem begegnete ich Professor Heise, einem der Ablehner. Und er erkundigte sich, was ich mache. Ich sagte, dass ich einen Aphorismenband herausbringe. „Das kannst du nicht“, sein Urteil, „die Zeit der Aphorismen ist vorbei, heute kann man nicht mehr zitierbar schreiben.“ Heise war Anhänger von Georg Lukacs, und bei dem hatte ich eben das vor Kurzem gelesen. Lukacs: Die Welt ist zu kompliziert geworden, um sie in kurze Formen zu fassen.
Lieber Leser, jetzt halte dir das alles mal vor Augen. Die Unmöglichkeit des Zustandekommens der Dissertation, ihre Ablehnung von 6 Professoren, die Ablehnung der Aphorismen vom Ministerium, von Heise und von Lukacs, der immerhin eine international anerkannte Kapazität war und ist. Und der kleine Assistent G. B., der sich sicher ist, dass er recht hat, als Anfänger gegen eine Horde von erfahrenen und angesehenen Leuten.
Zum Abschluss dieser „Angelegenheit“ noch ein Spaß. Da ich nicht eitel bin, konnte ich Schreck für das Bild auf der Innenklappe des Aphorismenbuches nur ein albernes Foto geben und bat ihn, es ein bisschen kaschieren zu lassen. Als er mir den Andruck zuschickte, war ich entsetzt und griff nach dem Telefon. Eben da klingelte es und Schreck lobte das Bild über alles. Ich brachte es nicht über mich, ihn zu enttäuschen und sagte nur, dass ich einen Vorschlag hätte. Ich schlug ihm vor, das Bild herauszustanzen und drunter zu schreiben, dass der Autor bereit sei, falls ein Leser darauf bestehe, durch das Loch zu gucken.
Das nur als Beispiel für eine andere Naturbegabung. Meine unerschütterliche Heiterkeit, die, wenn es angebracht ist, witzige Form annimmt.
Zum weiteren Schicksal der Dissertation und des Aphorismenbandes. Nach vier Jahren Ablehnung gingen die Ablehnungen weiter. Erst nach zwanzig Jahren wurde sie veröffentlicht, nach 40 Jahren wieder. Immer unverändert, da nicht überholt, ja noch nicht einmal eingeholt. Bis heute nicht. Und die Aphorismen erfahren dauernd Nachauflagen, da weltweit Spitze.
Wem diese selbstsichere Sprache missfällt, der erinnere sich, dass ich bei der Dissertation wie bei den Aphorismen unfaire Fußtritte in den Bauch verkraften musste, was ich nur konnte, weil ich mir des Wertes meine Arbeit absolut sicher war. Gegen ein halbes Dutzend honorige Leute und ein Ministerium.
(Die Dissertation ist unter dem Titel „Kunst des Humors — Humor der Kunst“ und die Aphorismen sind als „Branstners Spruchsäckel“ zu haben.)
Hier die historische Begründung, warum ich aus meinen Begabungen keinen Hehl mache.
Drei mal Drei ist Sieben, sagte der Bescheidene
Der Mensch ist für die Anlagen, die geistigen sowohl wie die körperlichen, nicht verantwortlich, denn er hat sie nicht geschaffen, ebenso wenig die Verhältnisse, unter denen er seine Anlagen bildet. Folglich ist er für sich nicht verantwortlich, ebenso wenig für sein Tun und Lassen. Und auch das, was er aus sich macht, kann er nur mit dem machen, was er nicht gemacht hat. Da bleibt kein Schlupfloch. Die Selbstverantwortlichkeit des Menschen ist ein epochaler Irrtum. Die Naturvölker haben ihn nicht gekannt. Die Klassengesellschaft hat ihn gebraucht und deshalb kultiviert. Die eigentliche Geschichte, die klassenlose Zukunft schließt ihn aus allen Gründen aus.
Wer die irrige Vorstellung, ein Verdienst daran zu haben, dass er so ist, wie er ist, fahren lässt, der lässt auch allen Hochmut fahren, allen Stolz, alle Eitelkeiten, alle Überheblichkeit. Aber auch alle Bescheidenheit. Wenn er seine schlechten Seiten nicht verschweigen muss, weil er nichts dafür kann, muss er auch seine positiven Seiten nicht verschweigen, denn auch für sie kann er nichts. Wenn er objektiv über anderes oder andere urteilen will, muss er auch objektiv über sich urteilen. Alles andere ist Schizophrenie.
Also verlange man nicht von mir, dass ich auf die Moral der Klassengesellschaft hereinfalle.
Hier einige Beispiele meiner Aphorismen. Natürlich nicht nur von 1959
Ist etwas faul, schlag keinen Krach, du kriegst nur selber was aufs Dach.
Der eigne Gestank macht keinen krank.
Ohne Wahrheit ist die Kunst, was die Pflaume ohne Wurm, ein Ding, worüber sich kein Mensch aufregt.
Sehen kann man auch mit einem Auge, Schielen aber nicht.
Der Unbelehrbare ist wie eine Schachtel, in die ständig etwas danebengelegt wird.
Das Einfache schwer verständlich zu machen ist die Genialität der Dummköpfe.
Die ernstesten Zeiten bedürfen der größten Heiterkeit.
Es gibt Frauen, die nur deshalb an Gott glauben, weil er ein Mann ist.
Wo der Zweck die Mittel heiligt, verderben die Mittel den Zweck.
Ohne das Unmögliche zu wollen, ist das Mögliche nicht erreichbar.
Seife ohne Dreck ist ohne Lebenszweck.
Wer wenig leistet, braucht viel Anerkennung.
Auch hohe Tiere müssen mal aufs Örtchen, nur tun sie oft, als schissen sie ein Törtchen.
Dummheit auf der Leiter klettert immer weiter.
Wer hinten kratzt, wenns vorne juckt, schnäuzt sich die Nas, wenns Schwänzlein zuckt.
Wer zuletzt lacht, lacht allein.
Gar mancher würde die Hälfte seines Lebens hingeben, wenn ihm der Tod erspart bliebe.
Glück ist die Übereinstimmung von Wollen, Können und Dürfen.
Lieber Leser, nun hast du schon einiges von meinen Naturbegabungen und meiner Art des Umgangs mit ihnen erfahren. Aber es kommt noch schlimmer, noch unglaublicher und märchenhafter. Da könntest du skeptisch werden. Aber damit würdest du dir alles verderben. Den Nutzen und den Genuss. Lass dich vielmehr vertrauensvoll in eine andere Welt hinüber führen. Eine Welt, die wirklicher ist als die wirkliche, weil sie unwirklich ist. Auf eine Art unwirklich, die der Fahrt mit dem Freiballon vergleichbar ist, von wo man dem Himmel näher ist und doch die Erde deutlicher sieht.
Komm mit. Jetzt geht es mit dem Anfang los und chronologisch weiter.
Aber zum Abschluss dieses Kapitels noch eine Fotomontage mit Zitaten aus Kritiken und Rezensionen.
II. Die Legende
Marc Christian ist ein in Michigan lebender Branstner. Von Beruf Historiker, lag es nahe, dass er unsere Familiengeschichte erforscht und von mir wissen wollte, wovon ich Kenntnis habe.
Im folgenden mein Antwortbrief.
Lieber Mark Christian,
über Deinen Brief habe ich mich sehr gefreut. Ich glaube, ich kann Dir einige sehr interessante Dinge sagen. Natürlich ist manches nicht ganz sicher.
Mein Urgroßvater, Paul, stammt aus Liebengrün, erste Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts. Er besaß eine kleine Landwirtschaft, die er aber nicht bearbeitete, da er Sommer wie Winter in Pößneck zubrachte. Als Stadtstreicher. Manchmal besuchte er seine Frau, die die kleine Landwirtschaft versorgte. Paul war zwar kein Zwerg, aber doch unter mittelgroß und sehr kräftig, damit und als Spaßmacher hatte er es nicht nötig, zu betteln, sondern war beliebtes Stadtoriginal. Sein Partner hieß Molle, nach dem der Stadtturm genannt wurde. Die beiden sonnten sich gern auf der Altenburg, einer Erhebung nahe Pößneck (die Burg war nicht mehr auffindbar), von da aus konnte man schön auf Pößneck hinuntersehn. Dort, auf der Altenburg, schrieb Molle ein Gedicht, etwa so:
Wenn ich auf der Altenburg stehe — und auf mein Pößneck hinunter sehe — fällt mir der Stadtturm in den Blick — sehr hoch und rund und auch sehr dick.
Da Paul im Winter, statt zu Hause zu schlafen, mit seinem Kumpel in Pößneck bleiben wollte, schmissen sie eine Schaufensterscheibe ein und kamen ins warme Gefängnis. War der Winter lang, schmissen sie eben mehrere Scheiben ein. Bis der Gendarm sich mit ihnen anfreundete und sie auch ohne zertrümmerte Scheibe ins warme Gefängnis aufnahm.
Pauls Sohn Karl war nicht Stadtstreicher, sondern Landstreicher, ging aber auch nicht betteln, da er in allen deutschsprachigen Ländern Bilder und Bücher verkaufte, die er in einem Holzgestell auf dem Rücken trug. Er nannte sich Kolporteur. Er war streng gläubig, aber außerkirchlich. Er wollte, wie alle Branstners, keinen Menschen über sich haben. Er baute sich auf seinen Wegen Gebetsstätten. Ich habe nahe Müllershausen eine aufgefunden, er hatte aus großen Natursteinen einen Ring von etwa 4 Metern Durchmesser gebaut und in der Mitte ein großes Steinkreuz, das aber umgestürzt war. Als ich in dem Kreis stand, kam mich ein ganz merkwürdiges Gefühl an, und ich war zu Tränen gerührt.
Obwohl Karl selten nach Hause kam, hat er viele Kinder gezeugt. 5 Söhne und 4 oder 5 Töchter. Der älteste, Karl, hat sich als Schneidermeister in Jena niedergelassen. Christian, der Dekorationsmaler und ein fröhlicher Weiberheld war, ist früh gestorben. Hans, dem ab zehn Jahren die Beine nicht mehr wuchsen, aber der Oberkörper eines großen Mannes. Als im Zweiten Weltkrieg viele Techniker und Ingenieure gefallen waren, suchte das Zeisswerk Jena Ersatz und machte einen groß angelegten Intelligenztest. Hans war der beste von 200 Bewerbern, ging aber nicht hin, um den Arbeitsvertrag anzunehmen. Er blieb lieber Stadtstreicher und verkaufte Lose. Als ich in Jena studierte, haben wir uns oft getroffen, und meine Kommilitonen meinten, dass ich Spaß mache, wenn ich ihn Onkel Hans rief.
Dann fuhr ihn auf dem Weg zum Marktplatz ein Auto von hinten um, sodass seine Lose auf den Marktplatz flatterten und Hans tot liegen blieb.
„Frederick“, der endlich in Portland sesshaft wurde, war vor dem Ersten Weltkrieg nach Amerika ausgewandert. Fritz (Frederick) war der Lieblingsbruder meines Vaters und mein Vater der Lieblingsbruder von Fritz, weshalb er uns unbedingt nach Amerika holen wollte. Um uns zu locken, hat er uns ein riesiges Stück Land gekauft, halb so groß wie Thüringen. Es lag unmittelbar am größten Indianerreservat Amerikas, weshalb es spottbillig war. Mit 50 Jahren schrieb er uns, dass er noch immer auf dem Stuhl Handstand macht.
Der jüngste Bruder war mein Vater, Wilhelm, der nach dem Ersten Weltkrieg nach Blankenhain bei Weimar geriet und Anfang der zwanziger Jahre auch Landstreicher wurde. Als Straßenmusikant. Er spielte Mundharmonika, Fritz Illmer, der eine Schwester meines Vaters geheiratet hatte, spielte Geige, die er von meinem Vater hatte und der kleine Hans sang und sammelte mit dem Hut. Nach zwei Jahren ging das auseinander, und mein Vater strich noch ein halbes Jahr als Postkartenmaler durch die Lande, indem er mit Farbkreide örtliche Motive auf sie malte, wie die Kirche, das Rathaus, die Dorflinde, das Eingangstor zu einem großen Gutshof. Natürlich wurden ihm die Karten gern abgekauft, nur konnte er davon nicht leben und kam zurück nach Blankenhain.
(Zwei Fußnoten: Die Geige galt als echte Stradivari. Ich habe sie von einem Geigenbauer prüfen lassen. Der sagte mir, dass das eine ganz billige Schulgeige sei. Aber das Etikett wäre echt. Wie das in die Geige gekommen war, konnte ich natürlich nicht klären und warf die Geige, da sie einen Sprung hatte, weg. Später wurde mir aber bewusst, dass das Etikett ja auch einen hohen Wert hatte.
Die andere Fußnote: Noch vor wenigen Jahren hat eine Pößnecker Schreibwarenhandlung eine Ausstellung mit Erinnerungsstücken unserer beiden Stadtoriginale gemacht, unter anderem eine originelle, lustige Jacke von Molle.)
Zurück zu meinem Vater. Er war 8 Jahre arbeitslos, länger als nötig, da er größeres Vergnügen daran hatte, Waldläufer zu sein, so eine Art Trapper, 8 Jahre lang. Dabei war mein Vater sehr begabt. Er spielte Zither und war Porträtzeichner. Ich habe noch Originalbilder. Außerdem war er ein Kraftmax. Er konnte zwei Zentner in der Vorhebhalte tragen. Vor allem aber war er konsequenter Antifaschist. Als Pazifist verfasste und verteilte er illegal Flugblätter. Obwohl er schon als Bibelforscher gefährdet war, war er nicht im geringsten ängstlich. Das internationale Oberhaupt der Bibelforscher (Zeugen Jehovas) war ein Amerikaner, „Bruder Ruderforth“. Mein Vater wurde polizeilich überwacht und kam schließlich vor Gericht, wurde mangels Beweisen freigesprochen, wegen dauerndem ungebührlichen Verhaltens vor Gericht jedoch zu 6 Wochen Gefängnis verurteilt. Meine Mutter, Hedwig, war eine begabte Sängerin und wollte zur Oper.
Zu den Schwestern meines Vaters: Da kenne ich nicht alle. Die älteste war Marie, die einen Wunderlich heiratete und mit ihm nach Brasilen ging, wo sie eine Kaffeeplantage erwarben. Dann Lydia, die nach Jena heiratete und das Sippenoberhaupt darstellte. Danach Lene (Magdalena), die ebenfalls nach Jena heiratete, den schon erwähnten Fritz Illmer. Und schließlich Lonny, von der mein Vater schwärmte, die ich aber nicht einordnen kann. Sie starb wohl früh.
Jetzt etwas über die Branstners auf dieser Erde. In Amerika gibt es einen Verlag, der Weltfamilienbücher zusammenstellt. Das Branstnerbuch verzeichnet 180 Adressen unseres Namens, davon 60 in Deutschland und 120 in Amerika. Wir sind aber keine Familien, jedenfalls die Thüringer Branstner sind eine Sippe von 5 Familien, vor allem in Jena und Blankenhain ansässig, jetzt zusätzlich in Berlin. Die Jenaer und Blankenhainer waren eng verbunden und trafen sich regelmäßig. Wir gingen von beiden Seiten zur gleichen Zeit los, so konnten wir uns in der Mitte treffen, das war ein Hügel, sodass wir uns, kurz bevor wir uns trafen, nicht sehen aber hören konnten. Unser Sippenruf war Haalipp! Der lässt sich wunderbar rufen. Probier es mal. Wenn nun eine Seite rief und von der anderen kam die Antwort, gab es kein Halten mehr. Wir stürmten los, und auf der Kuppe trafen wir uns. Da war ein Jubeln und Umarmen und Lachen, ein Schwadronieren, laute Freudentränen, denn die Thüringer Branstnersippe war ein lustiges Volk. Wir verzogen uns auf den nahe der Straße gelegenen Rasen, und da ging das Lachen und Schwadronieren weiter. Und dann wurden alle möglichen Spiele gespielt, mit Ball und Wurfringen, und zwar alle drei Generationen miteinander, denn damals gab es die idiotische Trennung der Generationen noch nicht.
Nun zu mir. Wir waren zwei Brüder. Walter, mein 4 Jahre älterer Bruder, war Obermaler in einer Porzellanfabrik und ist vor einigen Jahren gestorben. Meine Frau Annemarie und ich gehen stark auf die Achtzig zu, sind aber gesünder als unsere Kinder (zwei Söhne und eine Tochter) und Enkelinnen (zwei Mädchen). Ich bin Theaterregisseur und Schriftsteller. Ich gebe eine philosophische Monatsschrift heraus unter dem Titel: www.DieHornisse.de. Ich habe über 60 Bücher geschrieben mit mehr als 30 Gattungen literarischer Art und der Begründung von 8 Wissenschaften, womit ich der mit Abstand universellste Schriftsteller aller Zeiten bin. Du siehst, ich setze die Landstreichertradition fort, aber nicht in der Geografie, sondern in der Welt des Geistes, der Fantasie. Unter anderem schreibe ich Anekdoten, so über Frederick, als er noch jugendlicher Abenteurer in Pößneck war und über meinen Vater, wie er die Nazis narrte. Jedenfalls habe ich den Namen Branstner in die Unsterblichkeit gepflanzt. Mit unserem Namen hat es seine besondere Bewandtnis. Der Name Branstner ist gar nicht so alt. Wenn Du schon nach meinem bisherigen Bericht keine interessantere Sippe als die unsere kennst, so wird es noch interessanter. Die Legende berichtet nämlich, dass Branstner ein Kunstname, ein Verlegenheitsname ist. Wir sind ursprünglich die von Brandenstein, Herren auf der Burg Ranis (nahe Pößneck).
Eine große, wunderschöne Burg. Als einer der Brandensteiner eine bürgerliche Frau heiraten wollte, musste er einen anderen Namen annehmen. Wir waren Herren von Ranis von 1465 bis 1571,was als die goldne Zeit galt, da wir, wie es sich für uns gehört, die lustigsten und gastfreundlichsten waren und unser Geld bei Trinkgelagen und Gastmahlen verpulverten, sodass wir endlich verarmt waren und die Burg verkaufen mussten. Das auf dem gegenüberliegenden Hügel erbaute Schloss heißt noch heute Schloss Brandenstein. Du könntest Dich also, wenn es nach der Legende geht, rechtens Mark Christian Ritter von Brandenstein nennen. Mein Vater jedenfalls wurde in der Schule vom Lehrer noch der Brandensteiner gerufen.
Ich nehme an, eine solche Ergänzung Deiner Forschungen hast Du nicht erwartet.
Ich grüße Dich ganz herzlich
Gerhard Doktor Branstner
Bevor ich dieses Kapitel schließe, noch ein Wort zu den Brandensteinern und der Burg.
Die Kartenskizze kann nicht die Schönheit dieser Gegend zeigen. Von Pößneck aus mit seinem prachtvollen Rathaus über Ziegenrück und der idyllischem Saale zur herrlichen Talsperre Hohenwarte. Liebengrün ist leider nicht mehr auf der Karte, es liegt südlich von Ziegenrück.
Zur Geschichte der Brandensteiner: Im Jahre seiner Vermählung mit Katharina vermachte Wilhelm III. Herr von Thüringen seiner „Gemahlin zu Ehren“ und sicher auf deren emsiges Betreiben hin „Ritter Heinrich von Brandenstein, ihren lieben edelsten Bruder, unsern lieben Schwager zur Erhöhung seines Standes“ Burg und Stadt Ranis mit allen ihren Dörfern, Weilern, Höfen, Vorwerken, Schäfereien, Äckern, Wiesen, Weiden, Weingärten, Holzmareken usw ... für sich und alle seine leiblichen Lehnerben männlichen Geschlechts zu einer rechten ewigen und unwiderruflichen Gabe. Heinrich nebst seinen Söhnen Eberhard und Haubold wurde in den Reichsfreiherrenstand erhoben, und allen Nachkommen wurde das Recht zuerkannt, sich Reichsfreiherren zu Ranis zu nennen.
Man sagt dieser Zeit nach, dass sie die glanzvollste der Burg gewesen sei. An anderer Stelle wird sie die goldene Zeit genannt.
Die Brandensteiner lebten „in Saus und Braus“. Sie verwirtschafteten ihren alten und neuen Besitz bis zum vollständigen finanziellen Ruin. Es hieß: Die Herrschaft der Brandensteiner hat sich in Wein aufgelöst. Das war, wenn auch stark übertrieben, ganz im Sinne eines meiner geistigen Ahnen, des Lehrers des Lebensgenusses Epikur. Ganz und gar nicht in irgendeinem meiner Sinne war die Kehrseite. Denn als Folge bekamen die Untertanen immer mehr Lasten aufgebürdet. Die Besitzperiode der Brandensteiner endete 1571 mit dem Konkurs. Käufer wurde für die Summe von 40 300 Gulden Ritter Melchiore von Breitenbauch (später ohne a).
Die Brandensteiner blieben in Ranis und halfen, da sie hochintelligente Menschen waren, bei der Abfassung von Gesetzen und Ortsstatuten. Meinen ersten Besuch stattete ich der Burg Ranis mit Frau und Kindern vor etwa vierzig Jahren ab. Es war wie im Märchen. Über dem Burgtor prangte das Wappen: Ein Fuchs mit einer Gans im Fang. Mit „... gib sie wieder her“ auf den Lippen traten wir ein. Zwar vermisste ich den roten Teppich, was bei dem endlichen Einzug der potenten Nachfahren wohl das Mindeste gewesen wäre. Da ich aber kein Übelnehmer bin, schritten wir guter Dinge über den sonnenüberfluteten Burghof und betraten die Burg, um direkt im Gefängnis zu landen. Die Zelle war mittelgroß, hatte vor dem Fenster eine steinerne Bank und man konnte, wenn man sich auf sie kniete, bequem durch das Fenster über das Würzgärtchen hin einen wunderbaren Blick weit in das Land haben. Begeistert rief ich aus: „Unsere Gefangenen hatten es aber gut!“ Außer uns war noch ein junges Pärchen im Raum. Was mögen die sich wohl gedacht haben? Nach Besichtigung des Bergfrieds und einiger anderer Räume gingen wir wieder ins Freie und zur Ilsenhöhle, die sich mitten im Burghof befindet. Wenn die Burg schon über tausend Jahre alt ist, so reichen die ersten Siedlungsspuren bis in das 2. Jahrtausend v. u. Z. zurück. Im Burgführer steht dazu: „Den Tieren als ihrer Jagdbeute folgten die eiszeitlichen Jägerhorden, dabei waren ihnen die Höhlen an den Berghängen willkommene Wohnplätze. Mit der Ausgrabung der Ilsenhöhle wurde eine solche bedeutende Wohnstätte der Menschen der Altsteinzeit erforscht.“ Eine der ältesten Wohnstätten Thüringens.
Da ich den Burgführer erst später erwarb, wussten wir nichts von dieser altehrwürdigen Eigenschaft der Ilsenhöhle, stiegen aber immerhin mit romantischen Gefühlen hinunter und zum Ausgang, der sich am oberen Berghang befand, wieder hinaus. Wir traten nicht nur nach der Finsternis in das nun besonders helle Sonnenlicht, sondern in das herrlichste Vogelgezwitscher, das ich je gehört hatte. Der Berghang war von blumengeschmückten Kleingärten bedeckt. Und in einem von ihnen befand sich eine große Voliere, in der eine unglaubliche Menge der verschiedensten Vogelarten umherschwirrte und um die Wette sang. Die Gärten voller Blumen, der herrlichste Vogelgesang, und über allem die wundermilde Sonne! Ab da weiß ich, wie es im Paradies ist. Ich ging wie benommen weiter. Erst als wir unten anlangten und den anderen Anstieg zum Schloss Brandenstein unter die Füße nahmen, wurde ich wieder nüchtern. Wir betraten das Gebäude und strebten gleich zur hinteren Seite des großen Raumes, um aus dem Fenster in einen von Nadelbäumen bestandenen Abhang zu blicken. Kein Sonnenstrahl fand dort hinein. Da wir aus dem hellen Licht kamen, wirkte das Dunkel geradezu unheimlich. Aber auch anheimelnd. Nach dem heiteren Märchen eben das grauslige.
Solch einen Tag hatte ich bis dahin nie erlebt. Und ich werde ihn auch nie wieder erleben. Hatte ihn ein guter Schutzengel statt des roten Teppichs vor mir ausgebreitet?
III. Sippe und Familie
Womöglich ist der Leser über den Schutzengel am Ende des vorigen Kapitels gestolpert. Schutzengel, so meint er, bringen doch nicht etwas Gutes, sondern bewahren uns vor etwas Schlechtem. Aber alles hat seine zwei Seiten, auch der Schutzengel. Wer will bezweifeln, dass er mich vor schlechtem Wetter bewahrt hat, vor Wind und schrägem Regen. Dann wäre das Paradies im Eimer gewesen.
Im Folgenden wimmelt es von Schutzengeln der verschiedensten Art, auch von leibhaftigen.
Mein bester Schutzengel jedoch bin ich selber. Und vor allem deshalb schreibe ich diese Biografie, denn sie ist ein Lehrbuch der Lebenskunst. Hilf dir selbst, dann brauchst du keinen Gott. Sich selber zu helfen aber ist die schwerste Kunst.
Zum Namen. Da er ein Kunstname, ein gebastelter Verlegenheitsname ist, hat er nur eine Entstehungsursache und daher nur wenige Personen, die ihn tragen. Die Branstners sind weltsüchtige Leute und haben schon weit vor hundert Jahren mit dem Davonlaufen begonnen. Aber wo du auch einen Menschen dieses Namens triffst, kannst du sicher sein, dass er mit mir verwandt ist.
Zur Sippe. Die engere Sippe bildeten die Jenaer und Blankenhainer Branstners.
Sozusagen als korrespondierendes Mitglied muss ich Onkel Fritz erwähnen, der zwar in Amerika lebte, aber mit Briefen und Päckchen ständig gegenwärtig war. Daher erst mal genaueres über Fritz und sein Verhältnis zu uns. Als erstes eine Anekdote über ihn, die ich nach der Erzählung meines Vaters geschrieben habe.
Wie Onkel Fritz den Teufel erschlug
Als Onkel Fritz noch ein junger Bursche und voller Tatenlust war (heute hat er einen Bauch und trägt eine Nickelbrille), hatte er sich ein Bett auf dem Dachboden aufgestellt und schlief nicht anders als mit einer selbst gefertigten Holzkeule unter der Bettstatt. Es hätte doch leicht sein können, dass ein nächtlicher Besuch kam und ihm nach dem Leben trachtete. Man schläft ja schließlich nicht für nichts und wieder nichts auf dem Dachboden. Auf diese Weise hatte der Jüngling schon manche Nacht mutig hinter sich gebracht; und es ist verständlich, dass ihn diese Art zu schlafen jeden Morgen mit einem Gefühl der Kühnheit die Treppe nach unten steigen ließ, womit der Tag für ihn stets einen guten Anfang hatte.
Eines Nachts jedoch schien sich außerhalb seiner Fantasie etwas abzuspielen. Er wurde durch ein seltsames Geräusch geweckt, ein Poltern und Rollen, als wenn sieben Teufel ihr Unwesen trieben. Onkel Fritz (der ja damals noch nicht Onkel war) sprang aus dem Bett, griff nach der Keule und starrte in die Finsternis. Ein Wesen, das dieses sonderbare Geräusch vollbrachte, war jedoch nicht zu sehen. Da kam das Poltern direkt auf ihn zu, Onkel Fritz strengte seine Augen an, konnte jedoch noch immer nichts ausmachen. Ihm wurde unheimlich zumute. Jetzt war das Lärmen unmittelbar vor ihm. Er sprang mit einem Satz ins Bett und riss die Decke über den Kopf. Da knallte es auch schon an seinen Bettpfosten. Onkel Fritz hielt unter der Decke die Keule parat. Dann warf er mit einem Ruck die Decke ab und hieb neben dem Bettpfosten auf den Boden, gewärtig, den Teufel oder wen auch immer auf den Fuß zu treffen. Stattdessen hörte er ein Splittern, und ein heller Pfiff drang ihm durch Mark und Bein. Dann war völlige Stille.
Nachdem eine geraume Zeit verstrichen war, wagte sich Onkel Fritz aus dem Bett. Beim ersten Tritt auf den Boden spürte er einen fürchterlichen Stich in den nackten Fuß. Er sprang verzweifelt nach der Treppe. Beim dritten oder vierten Schritt durchfuhr ihn wieder der peinigende Schmerz. Endlich hatte er die Treppe erreicht und stürzte hinab. Nach einer ganzen Weile kam er mit verbundenen Füßen wieder nach oben, eine Kerze in der linken, die Keule in der rechten Hand. Auf der Treppe fand er Blutspuren, die seine verletzten Füße hinterlassen hatten. Er stieg vorsichtig über umherliegende Glassplitter. Hatte er den Teufel in der Flasche erwischt! Doch da lag bloß eine Maus, allerdings tödlich getroffen. Nur ihr linkes Hinterbeinchen zuckte noch.
Sie war in die Flasche geraten und hatte bei den Versuchen, wieder herauszukommen, die Flasche über den Boden gerollt. Onkel Fritz, der damals ja noch nicht Onkel war (heute trägt er einen Bauch und hat eine Brille auf der Nase), Onkel Fritz fühlte sich erst jetzt wirklich verletzt. Er seufzte tief und legte sich für den Rest der Nacht ins Bett.
An dieser Geschichte sieht man, wie einer auch in unseren Breitengraden abenteuerliche Gefahren bestehen kann, wenn er nur auf dem Dachboden schläft und eine Keule unters Bett legt.
Der Dachboden reichte für Fritzens Abenteuerlust nicht aus, und er trampte noch vor dem Ersten Weltkrieg kreuz und quer durch Amerika, um es kennenzulernen. Vier Jahre war nichts von ihm zu hören. Dann kam ein langer Brief. Am Ende verkündete Fritz, nun Frederik, dass er Fabrikbesitzer sei. Er hatte sich bei Portland (Oregon) niedergelassen und eine Dachanstreicherfirma gegründet. Da waren nur ein paar Dollar „Gründungskapital“ nötig, nämlich ein Eimer Farbe, ein Schrubber und eine Leiter. Portland liegt in der Nähe von Kanada. Und die dort üblichen holzgedeckten Häuser waren auch bei Portland Mode und mussten regelmäßig gestrichen werden, um sie vor der Verwitterung zu schützen. Das Geschäft ging gut, und schon bald konnte Frederik an die 150 Arbeiter beschäftigen. Soweit fürs erste zu Onkel Fritz. Um 1936 kommt er wieder vor.
Zur Familie. Mein Vater war einerseits ein stiller und in sich gekehrter Mann, konnte aber andrerseits ungeheuer jähzornig werden. Beispielsweise wenn er sich mit meiner Mutter stritt, hängte er die Stubentür aus und stauchte sie wiederholt auf den Boden, dass es krachte. Auf die Art tobte er seine Wut aus, aber auch seine überschüssige Kraft. Schon als Lehrling in der Schokoladenfabrik „Berggold“ in Pößneck zeigte sich das. Er hatte gerade die Lehre als Zuckerpuppenmaler begonnen (diesen Beruf gab es tatsächlich), da war er auch schon wieder vor der Tür. Er war beim Rühren der Schokolade mit einer Eisenstange (eine Holzstange wäre in der zähen Masse zerbrochen) mit dem Meister in Streit geraten. Und als der davon ging, schmiss ihm mein Vater die Eisenstange ins Kreuz. Aus wars mit der Zuckerpuppenmalerei. 1893 geboren, wurde Wilhelm im Ersten Weltkrieg Soldat. Er hieß wie der Kaiser, konnte aber wie alle Branstners keinen über sich leiden, schon gar nicht einen Kaiser. Außerdem war er Pazifist, Also schoss er nur in die Luft, bekam aber ungerechterweise einen Schuss ab. Der traf zwar nur die Taschenuhr, die ihn vor Schlimmerem bewahrte. Aber einen Splitter bekam er in den Bauch. Seitdem gilt er als magenkrank. Die Uhr habe ich.
Meine Mutter überzeugte er bei einem Abendspaziergang, indem er ihr die Sternbilder erklärte und sie danach auf den Armen nach Hause trug. Das hatte sie völlig überzeugt. Aber kurz nach der Heirat, mein Bruder war gerade geboren, brach die Familientradition durch, und Wilhelm wurde, wie bereits berichtet, mit Bruder Hans und Schwager Fritz 2 Jahre Straßenmusikant. Als das auseinanderging, trieb er es noch ein halbes Jahr als Postkartenmaler. Dass er so was konnte, beweist die hier abgebildete Zeichnung seiner Lieblingsschwester Lonny.
Außerdem spielte er Zither, für die er auch kleine Kompositionen schrieb.
Dann stellte er sich mit dem Rücken zur Wand, schob das Instrument dazwischen und hielt es nur durchs Spielen, womit er die Leistung des Kandidaten bei Gottschalk weit übertraf, da der das Instrument festklemmte. Und schließlich unterrichtete Wilhelm Bibelforscherkinder im Singen. Wesentlicher ist jedoch seine Tätigkeit als konsequenter Antifaschist.
Hier einige meiner Kalendergeschichten, die für ihn charakteristisch sind.
Warum Wilhelm sich stets mit zwei Fingern an die Schläfe tippte
Wenn der magenkranke Straßenarbeiter Wilhelm jähzornig wurde, konnte er Türen aushängen und auf den Boden stauchen, aber er galt auch als ein großer Spaßvogel. Diese Eigenschaften passten nicht zusammen, aber eben das war Wilhelm. Bei ihm passte nichts zusammen. Und Antifaschist war er auch auf seine Art. Er grüßte statt mit Heil Hitler mit Drei Liter und legte zwei Finger unter dem Mützenschild an die Schläfe. „Drei Liter zu rufen ist ja nicht verboten“, sagte er. Und zwei Finger seien nicht einer. Mit einem zeige man einen Vogel. Antifaschist war er nicht nur, weil er in nichts reinpasste und nichts in ihn, er war es vor allem aus Überzeugung.
Die erste Wahl unter dem Nazi-Regime wurde in Wilhelms Heimatort mit hundert Prozent Ja-Stimmen gefeiert. Da Wilhelm und sein Schwager Willi mit Nein gestimmt hatten, ging Wilhelm zum Bürgermeister, der auch Wahlleiter war, und legte Protest gegen den Wahlschwindel ein. Wenn er den Mut habe, jetzt öffentlich Nein zu sagen, werde er den Mut, geheim Nein zu sagen, allemal gehabt haben. Dem konnte der Bürgermeister nichts entgegnen. Aber er ließ auf dem Marktplatz einen Schandpfahl aufstellen, auf dem Wilhelm und Willi gemeinsam gebrandmarkt wurden.
Da Wilhelm sehr belesen war und das Wahlgesetz in der Tasche hatte, lief er zum Ortschef der NSDAP, hielt ihm das Gesetz unter die Nase, worin die geheime Wahl verbürgt war, und brüllte den Naziboss an, sofort den Schandpfahl zu entfernen, wenn er nicht alle Türen einbüßen wolle. Da der Obernazi auch ein bisschen unterbemittelt war, ließ er sich einschüchtern und gab klein bei. Nun war aber der Willi von Beruf Fotograf. Er stellte sich mit Wilhelm hinter die Ecke des Marktplatzes und lauerte auf die Entfernung des Schandpfahls. Und tatsächlich nahten bald zwei Gemeindearbeiter, zogen den Pfahl heraus und trugen ihn auf der Schulter davon. Willi machte mehrere Bilder von dieser kuriosen Szene und verteilte sie an belustigte und beschämte Bürger.
Das machte beide im ganzen Ort bei Freund und Feind berühmt. Willi allerdings wurde von seinem Chef, der zwar kein Nazi, aber ziemlich ängstlich war, entlassen.
Als nach fast siebzig Jahren die Tochter von Willis Chef den Sohn Wilhelms traf, erinnerte sie sich an die Feigheit ihres Vaters und es war ihr sehr peinlich. Aber Wilhelms Sohn tröstete sie, er war nämlich ein weltweiser Philosoph geworden: strenger gegen den Faschismus, aber auch milder gegen die Wasserträger.
In schlimmen Zeiten werden schwache Menschen zu bösen, und Spaßvögel, wenn sie es bleiben, zu Helden. Aber sie machen sich nichts draus.
Wenn die Gefahr zunimmt, nimmt die Komik nicht ab; aber wer lacht da noch?
Der Kampf gegen den Faschismus hatte hin und wieder auch seine Komik. Im Folgenden wird von einem Bibelforscher berichtet, der allerdings mehr Antifaschist als Bibelforscher war, weshalb er sich mit seinen Glaubensbrüdern völlig zerstritten hatte. Er schrieb eigenhändig Flugblätter gegen die Kriegsvorbereitungen und steckte sie in der Dunkelheit an unterschiedlichen Orten in die Briefkästen. Das ging einige Zeit gut, doch dann geriet er in Verdacht und es wurde eine Hausdurchsuchung angeordnet. Zwei Kriminalbeamte klingelten an der Haustür, die Frau des Bibelforschers blickte aus dem Fenster und ahnte, was da kommen würde. Sie suchte die noch nicht verteilten Flugblätter in aller Eile zusammen, packte sie auf einen Stuhl und setzte sich darauf. Der Bibelforscher ließ die Beamten herein, die zeigten ihren schriftlichen Auftrag vor und machten sich an die Arbeit. Sie suchten überall, nur nicht unter dem Hintern der Frau. Sichtlich wütend verließen sie die Wohnung. Der Bibelforscher schloss die Tür hinter ihnen, wandte sich um und öffnete die Arme, um seine Frau triumphierend zu umfangen. Doch die blieb wie festgeklebt auf dem Stuhl sitzen. Der Bibelforscher glaubte, dass ihr nach der ausgestandenen Angst die Beine den Dienst versagten und wollte ihr aufhelfen. Sie wehrte sich stumm, aber entschieden. Als er von ihr abließ, sah sie ihn mit merkwürdig fragenden und zugleich um Verzeihung flehenden Augen an. Und gleich darauf stach ihm ein penetranter Geruch in die Nase. „Du hast doch nicht etwa ...?“ Sie nickte: „Drei Tage konnte ich nicht, und jetzt ist alles auf einmal ..." Sie blickte ihn noch immer mit Verzeihung flehenden Augen an, denn sie fürchtete, er würde sie wegen der verdorbenen Flugblätter schelten. Doch er sagte nur: „Ich habe es doch immer gewusst: die Nazis sind ein zuverlässiges Abführmittel!“ Die Polizei ließ jedoch nicht locker, und diesmal kam der Ortsgendarm mit einem Haftbefehl. Da der Bibelforscher sich weigerte, auch nur einen Schritt mit ihm zu gehen, wollte der Gendarm ihn am Ärmel fassen. Da streckte der Bibelforscher den Arm gen Himmel und rief mit schrecklicher Stimme: „In dem Augenblick, wo Sie mich berühren, wird das Schwert Gottes auf Sie niederfahren!“ Der Gendarm prallte erschrocken zurück. Er glaubte nicht an Gott, aber er begriff, dass er allein nichts ausrichten würde. Holte er aber Verstärkung, machte er sich lächerlich. Da gab ihm die Frau des Bibelforschers ein Zeichen, schob ihren Mann ins Nebenzimmer und kam nach wenigen Minuten zurück. „Mein Mann ist einverstanden, mit Ihnen zu gehen“, erklärte Sie, „aber Sie müssen fünf Schritte hinter ihm bleiben, und die Uniform müssen Sie auch vorher ausziehen.“ Der Gendarm verfügte sich wirklich nach Hause, um in Zivilkleidung wiederzukommen. Und die fünf Schritte Abstand ergaben sich ohnehin, denn der lange und dürre Bibelforscher stakte in seinem Zorn heftig davon, während der kleine und sehr dicke Gendarm japsend hinterdrein watschelte. Ein komisches Bild, zumindest, wenn man um das Zustandekommen weiß.
Die nächste Komik fand im Gerichtssaal statt. Die beiden Schriftsachverständigen hatten einige der in die Briefkästen gesteckten Flugblätter mit nachweisbar von der Hand des Bibelforschers stammenden Schriftstücken verglichen, konnten sich aber nicht auf eine Übereinstimmung einigen, sodass der Angeklagte der Herstellung und auch der Verteilung der Flugblätter nicht überführt werden konnte, aber er musste trotzdem sitzen. Er hatte die Verhandlung, noch bevor sie richtig begann, in eine Bibelstunde verwandelt, allerdings eine von ganz eigener Art. Die heilige Schrift aufgeschlagen in der Hand, donnerte er mit gewaltiger Stimme die schrecklichsten Verwünschungen und Beschimpfungen in den Saal. Keiner hatte bis dahin gewusst, dass die Bibel eine solche Masse von anstößigen Ausdrücken enthielt. Der Bibelforscher wurde von der ursprünglichen Anklage freigesprochen, bekam aber wegen dauernden ungebührlichen Benehmens vor Gericht sechs Wochen Haft.
Abschließend nur noch zwei Worte zu meinem Vater. Er betrieb mehrere Sportarten, unter anderen war er Kunstspringer. Seine Spezialität war der Kopfsprung vom Turm mit gestrecktem Salto und angelegten Armen, sozusagen mit den Händen an der Hosennaht.
Neben dem Türaushängen war seine andere Attraktion der sogenannte „Wilhelm“, nämlich mit der Faust Tischecken abzuschlagen. Als er wieder mal in der Porzellanfabrik, in der Massenmühle, arbeitete und die Gewerkschaft ihre Forderung nach 50 Mark Lohnerhöhung im Monat vom Direkter abgewiesen bekam, ging mein Vater zu dem Manne und verlangte die Lohnerhöhung mit erhobener Stimme. Eingeschüchtert sagte der Direktor meinem Vater die fünfzig Mark zu. Aber nur ihm. Dieser Bestechungsversuch war für meinen Vater zu viel. Er setzte seinen „Wilhelm“ an, doch die Platte war zu dick und widerstand. Also brüllte er: „Entweder für alle, oder ich schmeiße Sie aus dem Fenster!“ Der Direktor sagte die Lohnerhöhung zu, und Wilhelm zog von dannen. Nicht erhobenen Hauptes, das war nicht seine Art. Und den Kollegen sagte er auch nichts von dem Erfolg. Die wunderten sich nur, als sie den abgelehnten Fünfziger in der Lohntüte fanden.
Leider habe ich noch kein besseres Bild von meinem Vater als das im Kahn finden können. Das zeigt nicht, dass er eine schwarzhaarige Schönheit war.
Als Massenmüller bekam er Staublunge (über 70 Prozent), ist aber immerhin noch an die 70 Jahre alt geworden.
Nun zu meiner Mutter. Sie war, wie man so sagt, zu Höherem geboren. Sie war eine musikalische Begabung und sang wie eine Lerche. Ein Bekannter nahm sie mit nach Berlin zum Vorsingen. Aber woher sollte das Geld für die Ausbildung kommen? Und als sie meinen Vater heiratete, war der Traum vollends aus. Sie hatte als junges Mädchen Tennis gespielt, war auch kurze Zeit in der KPD, bis ihr die Genossen zu einfallslos wurden, pfiff wie Ilse Werner und tanzte, dass die Fetzen flogen. Und dann war sie auch noch ein bildschönes Weib. Auf dem Foto (im weißen Kleid) ist das nicht authentisch erkennbar. Es war vor allem ihr Temperament, das ihre Schönheit ausmachte.
Wer das Buch „Die beiden Alten“ von Helene Böhlau kennt, weiß, dass ein Talent, das nicht verwirklicht werden kann, sich nach innen kehrt und den Menschen komisch macht. Das war auch bei meinen Eltern zu beobachten. Andrerseits hatten sie jedoch genügend kreative Lebensenergie und Tatkraft. Meine Mutter war Hausfrau, Holzdrahtweberin (da der Vater 8 Jahre arbeitslos war) und ging am Wochenende als Näherin auf die Dörfer. Während der Vater die Schuhe reparierte, schneiderte und flickte sie unsere Sachen, sodass wir, mein älterer Bruder und ich, immer sauber und schick aussahen. Überdies war meine Mutter ungeheuer stolz. Daher gab es bei uns keine Margarine, das war nach ihrer Meinung was für arme Leute, sondern nur „gute Butter“. Und obwohl wir bettelarm waren, galten wir im Ort als bessere Leute.
Zu der Lebenstüchtigkeit meiner Mutter, wegen der ich sie bis zu ihrem letzten Atemzug verehrte, an anderer Stelle mehr.
Der Leser wird mir beistimmen, dass bei meiner Naturbegabung, alles Positive, alles Gute und Schöne aufzusaugen, diese Eltern es mir einfach unmöglich machten, ihren Reichtum an Talenten nicht zu nutzen. Noch dazu die biologische Vererbung so freundlich war, von beiden das Beste an mich weiterzugeben.
Zu den Vorfahren meiner Mutter. Ihr Urgroßvater war Schäfer. Er kam aus Böhmen. Das Haus, das am Beginn des nächsten Kapitels abgebildet ist, hat er ohne schriftlichen Vertrag gekauft, sondern per Handschlag. „Lieber Leser, denk mal darüber nach, was diese Zeiten für eine Moral hatten. Und welche wir nicht mehr haben.“
Sein Sohn, also der Großvater meiner Mutter war dem Trinken zugetan und betrat das Haus, wenn er nach Mitternacht heimkam, nicht durch die Vordertür, wo die Glocke anschlug und seine Frau auf den Plan rief, sondern über den Hof durch die Hintertür, neben der aber die Jauchengrube war. Im Taumeln geriet er auf die Abdeckung, die verrutschte und einen Spalt öffnete, durch den er hineinfiel. Am Morgen fand man ihn in der Grube. Er hatte sich totgesoffen.
Der Vater meiner Mutter hieß Richter, starb aber früh, sodass sie einen Stiefvater namens Dreßler bekam. Der starb auch vor meiner Geburt, sodass für mich nur eine Großmutter übrig blieb. Die Eltern meines Vaters waren auch vor meiner Geburt gestorben.
Traurig erging es Tante Else. Ihr Mann war im Ersten Weltkrieg gefallen und der Sohn im Zweiten Weltkrieg. Da die Schwiegertochter, eine Luise von Lindenlaub, mit ihren beiden Töchtern bald in die Nähe von Sonneberg und schließlich weiter westwärts zog, holte Else ihren Schwiegervater, Huts Hermann, nach Blankenhain.
Hermann war ein Unikum. Er setzte sich in einer Gaststätte nur an einen Tisch, der im Freien stand. Und da ging Folgendes vor sich: Keiner durfte sich setzen, bevor Hermann, mit dem Spazierstock in der Hand, über den Tisch gesprungen war. Damit war der Tisch geweiht. Ich erinnere mich noch wie heute, wie er in Saalborn (nahe Bad Berka) mit gut 60 Jahren im Vorgarten der Dorfgaststätte über den Tisch prang, Platz nahm, den Spazierstock zwischen die Beine stellte und einen „guten“ Bohnenkaffee bestellte. Mit doppelter Portion Zucker und einer „Messerspitze“ Salz. Das schmeckt wirklich interessant. „Probier es, lieber Leser.“ Ein letztes Wort zu Hermann. Im Krieg half er sich über die Tabaknot hinweg, indem er Brombeerblätter und anderes Laub trocknete und Zigarillos daraus wickelte.