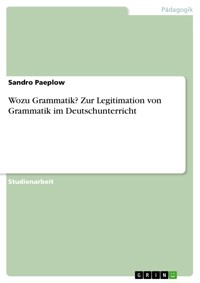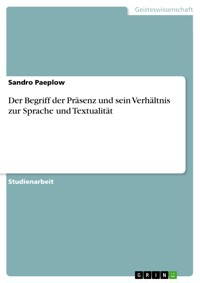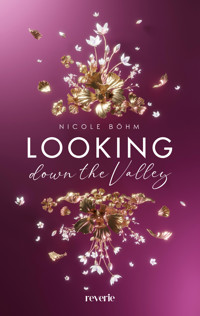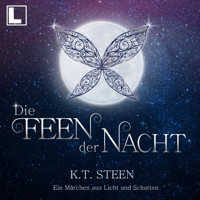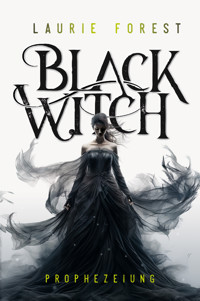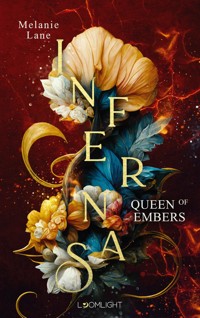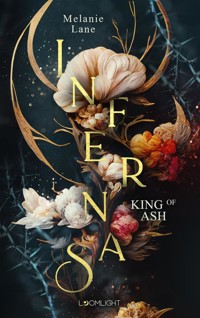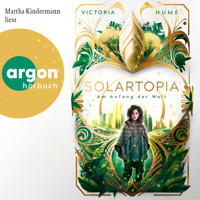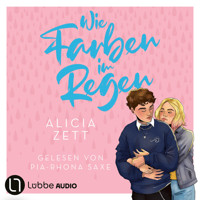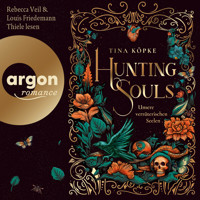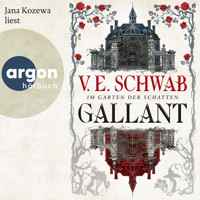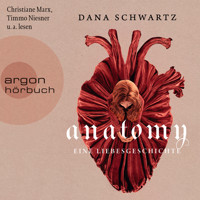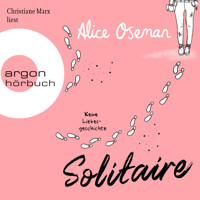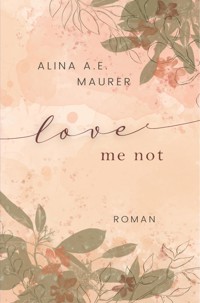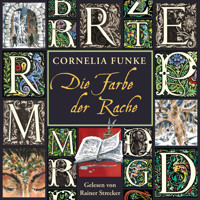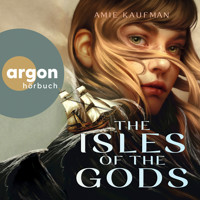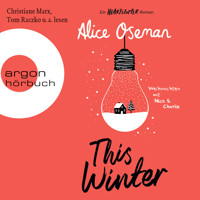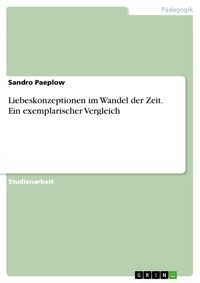
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich Didaktik für das Fach Deutsch - Pädagogik, Sprachwissenschaft, Note: 1,7, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (Deutsche Philologie), Veranstaltung: Liebeskommunikation: Textsorten- und Konzeptwandel, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Liebe findet sich in nahezu allen Medien der Gegenwart wieder, in den verschiedensten Konzepten. Wenn man beispielsweise bei der Internetsuchmaschine Google den Begriff Liebe eingibt, kriegt man über siebenundsechzig Millionen Links zur Verfügung gestellt. Dies spricht sowohl für die Wichtigkeit dieses Themas als auch für die inhärente Diversität. Diese Grenzenlosigkeit und Diversität bedeuten gleichzeitig, dass die Konzeption von Liebe nicht einseitig betrachtet werden darf. Vielmehr erfordert die Thematik eine Betrachtung und Untersuchung aus unterschiedlichen Perspektiven. Dafür werden im ersten Teil dieser Hausarbeit zwei Liebeskonzepte in ihren unterschiedlichen Semantiken betrachtet und in Beziehung gesetzt. In einem zweiten Teil wird die Analyse des gegenwärtigen Liebesbegriffs, anhand einer Umfrage und geeigneten Liebesliedern, im Zentrum stehen. Einmal wird das Lied "Ich lass für dich das Licht an" von der deutschen Band Revolverheld analysiert, auf der anderen Seite die Interpretation vom deutschen Sänger Gregor Meyle des Liedes "Keiner ist wie du".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhalt
1 Einleitung
2 Die Liebe in ihrer semantischen Ebene
2. 1 Liebe als Gefühl
2. 2 Liebe als Kommunikation
3 Liebeskonzeptionen der Gegenwart
3. 1 Analyse von aktuellen Liebesliedern
3. 1. 1 Ich lass' für dich das Licht an
3. 1. 2 Keine ist wie du
3. 2 Umfrageauswertung
Schlusswort
Quellen- und Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Die Liebe findet sich in nahezu allen Medien der Gegenwart wieder. Ob es die Musikcharts sind, Kinofilme, Bücher oder Videospiele: Die Liebe ist in unserem alltäglichen Leben nicht mehr wegzudenken.
Wenn man beispielsweise bei der Internetsuchmaschine Google den Begriff Liebe eingibt, kriegt man über siebenundsechzig Millionen Links zur Verfügung gestellt. Dies spricht sowohl für die Wichtigkeit dieses Themas als auch für die inhärente Diversität. Auch Richard David Precht, Philosoph und Autor der Gegenwart, ist der Meinung, dass der Begriff der Liebe grenzenlos zu sein scheint:
Liebe ist nicht alles im Leben; aber ohne Liebe ist alles nichts. Kaum etwas ist uns wichtiger als die Liebe. Sie ist die Zentralheizung unseres Universums, das Gefühl, das unsere Taten motiviert und ihnen Sinn gibt; Sie bestimmt unser soziales Handeln, sie spornt uns an und ermutigt uns, doch sie treibt uns auch in die Eifersucht, den Hass und in die Selbstzerstörung. […] Man kann seine Arbeit lieben, sein Vaterland, den lieben Gott, seinen Nächsten und sein Auto, man kann Tiere lieben, Melodien und Schokoflocken.Dem Wortsinn nach liebt der Philosoph die Weisheit, der Philologe die Sprachen, der Philatelist seine Briefmarken und Philipp die Pferde. Auch ein deutscher Fernsehsender ist ganz von Liebe erfüllt: We love to entertain you.[1]
Diese Grenzenlosigkeit und Diversität bedeuten gleichzeitig, dass die Konzeption von Liebe nicht einseitig betrachtet werden darf. Vielmehr erfordert die Thematik eine Betrachtung und Untersuchung aus unterschiedlichen Perspektiven. Dafür werde ich im ersten Teil dieser Hausarbeit zwei Liebeskonzepte in ihren unterschiedlichen Semantiken betrachten und in Beziehung setzen. In einem zweiten Teil wird die Analyse des gegenwärtigen Liebesbegriffs, anhand einer Umfrage und geeigneten Liebesliedern, im Zentrum stehen.
2 Die Liebe in ihrer semantischen Ebene
2. 1 Liebe als Gefühl
Die emotionale Liebe ist so alt wie die Menschheit. So ist es auch leicht begreiflich, dass sich schon die antike Philosophie mit diesem Thema auseinandersetzte – wird sie doch selbst als die „Liebe zur Weisheit“[2]bezeichnet. Hierbei prägte Platon den Liebesbegriff signifikant. Dieser ebnete mit seinem Symposion die Auffassung der Liebe als eine Emotion und bereitete den Weg für ein passioniertes Liebesbild, welches seine Blütezeit in der Romantik fand.
Platon gliedert sein Symposion in sieben zentrale Reden über den Eros: die des Phaidros, des Pausanias, des Eryximachos, des Aristophanes, des Agathon ,des Sokrates und die Lobrede des Alkibiades auf Sokrates. Schon in der Rede des Agathon wird deutlich, wie Platon seine Liebeskonzeption konstituiert:
Über die Tugend des Eros ist danach zu sprechen. Das Wichtigste ist, dass Eros Unrecht weder tut noch Unrecht erleidet, weder von einem Gott noch an einem Gott, weder von einem Menschen noch an einen Menschen. Denn weder leidet er selbst durch Gewalt (etwas), wenn er etwas erleidet – denn Gewalt rührt Eros nicht an – noch handelt er (gewaltsam), wenn er handelt - denn jeder dient dem Eros in jeder Hinsicht aus freien Stücken […].[3]
Dieser Ausschnitt wird verständlicher, sobald der Begriff des Eros geklärt wird. Er ist
„die Verkörperung der Liebe, insbesondere das die Liebe auszeichnende Streben und Verlangen nach dem Guten und Schönen.“[4]Die Liebe wird somit zu einer Tugend, die weder Unrecht noch Gewalt kennt und der jeder ausgeliefert ist, ganz gleich welchen Rang oder Geschlecht ein jeder innehat. An diesem Zitat wird die semantische Potenzierung der Liebe in eine nahezu unantastbare Höhe deutlich, die jedoch auch das Moment des Leids in sich trägt, auch wenn dieses nicht durch Gewalt ausgelöst wird. Dennoch scheint die Liebe durch den Aspekt des Leids und somit auch der Verletzlichkeit eine Hinwendung zu einer Emotion, die nach dem Schönen strebt und dabei trotzdem nicht vollkommen ist, zu erfahren.
Der Philosoph Wilhelm Weischedel (1998, S. 39) beschreibt die platonische Liebe als eine „Art von Liebe, in der nicht das sinnliche Begehren im Vordergrund steht, sondern die seelische Zuneigung, gegründet auf den Respekt vor der Person des Geliebten“.[5]
Des Weiteren verweist er auf die Rede des Alkibiades auf Sokrates, in welcher der hübsche Jüngling versucht, sich dem Sokrates über die körperliche Liebe zu Willen zu machen, damit er all das hören kann, was Sokrates weiß. Der Gelehrte jedoch verschmäht das Angebot, obwohl er jenen liebt. Vielmehr geht es Sokrates darum, das Schöne und das Beste für ihn und Alkibiades gemeinsam zu entscheiden und zu erfahren.[6]Weischedel hält hierbei fest:
Die Erfahrung, die Alkibiades mit Sokrates macht, läßt zunächst einsichtig werden: der philosophische Eros ist nicht die sinnliche Liebe. Diese wird zwar nicht schlechthin verworfen. Aber die erotische Beziehung bildet nur den Ausgangspunkt für eine andere Art von Liebe: für den Aufschwung nämlich, indem Platon das Wesen des Philosophierens erblickt. Damit dieser anheben kann, ist es notwendig, daß die sinnliche Liebe nicht in sich selber verharre oder gar als Ausschweifung sich verfestige; sie muß überwunden werden, und zwar eben in jenes Höhere hinein. [7]
Auch hier wird auf die Erhöhung der Liebe verwiesen, deren genuine Intention sich nicht in Körperlichkeiten äußert, sondern diese überwindet. Außerdem rekurriert Weischedel auf die Rede des Sokrates und das Gespräch mit Diotima:
Der Weg von der sinnlichen Liebe kommt ergreifend in der Schilderung des Aufschwunges zum Ausdruck, die Platon im >Symposion< den Sokrates geben läßt, der seinerseits behauptet, damit zu berichten, was er als geheime Kunde von Diotima, einer Seherin aus Mantinea, erfahren habe.
Die Ursachen der starren und problematischen Schulgrammatik ist aber keineswegs nur bei den Lehrkräften zu suchen: Die Kultusministerkonferenz hat 1982 ein Verzeichnis der grammatischen Fachausdrücke publiziert. Dieses distanziert sich vehement von den verschiedenen Grammatiken und Sprachtheorien der modernen Sprachwissenschaft und ist noch immer die verbindliche Grundlage für die Lehrpläne.[8]