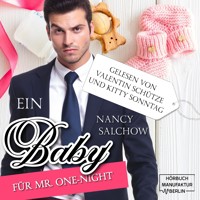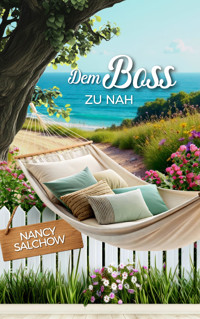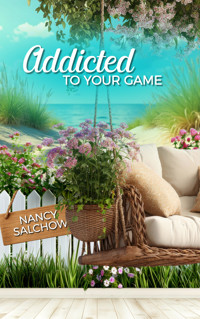5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Exklusiv im Summer-Bundle: 3 leidenschaftliche Liebesromane von der malerischen Ostsee zum ersten Mal zum Vorzugspreis.: Trust me, Boss | Milliardäre lieben keine Nannys | Millionäre ungeeignet ... weitere Ostsee-Sammelbände von der Autorin erhältlich ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Buch 1: Trust me, Boss
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Epilog
Buch 2: Milliardäre küssen keine Nannys
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Buch 3: Millionäre ungeeignet
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Epilog
Impressum
Nancy Salchow
___________________________
Liebesparadies an der Ostsee
Sammelband mit drei Ostsee-Liebesromanen
Roman
Buch 1: Trust me, Boss
Marlon
Als der erfolgreiche Unternehmer Marlon zufällig in die Lesung der aufstrebenden Autorin Emma gerät, hat er eine ungewöhnliche Idee: Mit ihrem Ehrgeiz und ihrer Lebensfreude scheint sie genau die Richtige zu sein, um seinem Vater – Bestsellerautor Constantin Fehn – aus seiner langanhaltenden Schreibblockade herauszuhelfen.
Es kostet Marlon viel Überzeugungsarbeit und ein äußerst lukratives Angebot, um Emma dazu zu bringen, eine Weile in seine Villa zu ihm und seinem Vater zu ziehen. Doch er denkt bei dem Angebot nicht nur an seinen Vater, sondern folgt unbewusst auch einem unerklärlichen Verlangen, das Emma vom ersten Moment an in ihm weckt ...
Emma
Als Emma auf Marlons Angebot eingeht, seinem Vater aus seiner Schreibblockade zu helfen, ahnt sie nicht, dass sie sich damit auf sehr viel mehr als nur einen Job eingelassen hat. Nicht nur die Tatsache, dass Marlon somit zu ihrem Boss wird, macht die Gefühle, die er in ihr weckt, umso verwirrender. Auch was die Schreibblockade seines Vaters betrifft, scheint er ihr nicht die ganze Wahrheit zu sagen. Die fragwürdige und doch anziehende Rätselhaftigkeit, die Marlon umgibt, macht den ungewöhnlichen Deal schon bald zu einem undurchschaubaren Spiel aus Verlangen, Geheimnissen und unbändiger Sehnsucht.
Dieses Buch enthält sehr eindeutige und leidenschaftliche Szenen.
In sich abgeschlossener Einzelroman. Keine Serie.
Prolog
Die Kornblumen kitzeln an meinen Waden, während ich tiefer ins Feld hineinlaufe. Vor ihm davonzurennen hat etwas seltsam Beflügelndes. Ein Gefühl, das aufregend und fremd zugleich ist.
In der Mitte des Weizenfeldes erreicht er mich endlich und umarmt mich von hinten.
„Hab ich dich!“, ruft er triumphierend, während wir uns lachend fallen lassen.
„Na warte.“ Ich strampele mit den Beinen. „So leicht werde ich es dir aber nicht machen.“
„Ach nein?“ Er betrachtet mich mit frechem Grinsen, während er sich halb über mich beugt.
„Nein.“ Mein Lachen weicht langsam einem ernsteren, beinahe verträumten Blick.
Auch sein Grinsen macht einem verklärten Ausdruck Platz. Sanft streicht er eine Strähne aus meinem Gesicht.
„Du bist wunderschön“, flüstert er. „Weißt du das eigentlich?“
Er berührt meine Lippen mit seiner Fingerspitze, dann küsst er mich so zärtlich und behutsam, dass ich für einen Moment vergesse, wo wir sind.
All meine Zweifel, all meine Fragen sind plötzlich wie weggewischt. Alles, was ich sehe, sind diese durchdringenden Augen, die mir bis ins Herz zu blicken scheinen.
„Bei dir fühlt sich alles so leicht an“, flüstert er.
„Vielleicht redest du dir das auch nur ein“, antworte ich leise.
Er lässt seine Hand langsam an meiner Taille hinabgleiten. Eine Berührung, die ich durch den hauchdünnen Stoff meines Kleides umso intensiver spüre. Als seine Finger meine Kniekehle erreichen und er mein Bein sanft anhebt, packt mich die süße Erregung. Ein Gefühl, gegen das mein Verstand machtlos ist.
„Ich will dich“, haucht er in meinen Nacken.
Spätestens in diesem Augenblick weiß ich, dass ich keine andere Wahl habe, als meine Vernunft auszublenden. Denn gegen ihn hat sie ohnehin nicht die geringste Chance.
Kapitel 1
Marlon
Der Buchladen ist an diesem Nachmittag ungewöhnlich voll. Während sich hier und da jemand an eines der Regale im vorderen Bereich verirrt, hat sich eine regelrechte Menschentraube an der hinteren Fensterseite des Geschäfts versammelt.
Ich kann nicht sehen, was der Grund für den Andrang ist, senke meinen Blick aber schon bald wieder auf den Buchrücken des Thrillers in meiner Hand.
Wieder frage ich mich, ob es klug oder ausgesprochen dumm von mir ist, Vater das Buch eines anderen Autors mitzubringen. Führt der Wunsch, dadurch seinen Schreibdrang zu wecken, am Ende nicht vielleicht sogar dazu, dass er noch frustrierter als vorher ist?
Seufzend schiebe ich das Buch zurück ins Regal.
Ich sollte gehen und die Dinge auf sich beruhen lassen. Nur er allein wird wissen, wann er wieder bereit ist zu schreiben. Nicht, dass er es nötig hätte. Finanziell könnte er nach den Riesenerfolgen der Vergangenheit problemlos ein paar Jahre ohne neuen Bestseller überstehen. Wie wichtig das Schreiben für sein inneres Gleichgewicht ist, steht allerdings auf einem anderen und sehr viel wichtigeren Blatt.
Etwas deplatziert stehe ich in der Mitte des Ladens, hin und hergerissen zwischen dem Drang, wieder zu gehen oder nachzuschauen, was es mit der Menschentraube auf sich hat.
Ich entscheide mich für Letzteres und nähere mich langsam dem neugierigen Publikum. Als ich mich etwas weiter rechts halte, kann ich endlich einen Blick auf den Grund ihres Interesses werfen. An einem kleinen Stehtisch ist eine junge Frau mit schulterlangem kupferfarbenem Haar und hübschem Lächeln dabei, Bücher zu signieren. Sie scheint eher zierlich, doch gleichzeitig selbstsicher und entspannt.
Mein Blick fällt auf den Pappaufsteller vor ihrem Tisch.
Poeler Bestseller-Autorin Emma Tomsen signiert ihren neuen Roman „Der Bastard, mein Herz und ich“
Emma Tomsen? Noch nie von ihr gehört. Aber wenn sie einen ganzen Laden mitten in der Innenstadt von Schwerin füllen kann, muss sie eine recht bekannte Autorin sein. Andererseits scheint ihr Roman eher aus dem Genre Liebesroman zu stammen. Vermutlich ist mir ihr Name deshalb unbekannt.
Doch die Signierstunde scheint mehr als das bloße Schreiben von Autogrammen zu sein. Vielmehr sieht es so aus, als habe sich ein spontaner Smalltalk daraus entwickelt. Immer wieder unterschreibt sie Bücher und beantwortet zwischendurch Fragen über das Mikrofon, das an ihrer Bluse befestigt ist oder unterhält die Besucher mit unterhaltsamen Anekdoten aus ihrem Autorinnenleben.
Ich schaue auf meine Armbanduhr. Kurz nach zwei. Eigentlich wollte ich um diese Zeit schon wieder im Büro sein. Doch als ich wieder aufschaue und in das strahlende Gesicht dieser gewissen Emma blicke, ertappe ich mich bei einem Anflug von Neugier.
Ihr Lächeln wirkt selbstsicher, aber trotzdem bodenständig. Die Art, in der sie die Fragen der Anwesenden beantwortet, ist geradezu erfrischend.
Gedankenverloren lehne ich mich gegen ein Bücherregal und lausche ihren Antworten.
„Wann haben Sie mit dem Schreiben angefangen?“
„Diese Frage wird mir oft gestellt. Und die Antwort ist: Ich weiß es nicht. Nein ehrlich, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe mir von klein auf an die wildesten Geschichten ausgedacht, schon im Kindergarten. Das war irgendwie schon immer ein Teil von mir. Genauso, wie es irgendwann selbstverständlich wurde, dass ich diese Fantasien auch zu Papier brachte. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es jemals eine Zeit gab, in der ich mir keine Geschichten ausgedacht habe.“
„Also haben Sie die Schreibwut sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen?“
„Kann man so sagen, ja.“
Lachend wirft sie ihr Haar in den Nacken. Ein Lachen, das pure Lebensfreude ausstrahlt. Kein Anflug von Genervtheit oder gestellter Freundlichkeit. Man kauft ihr die aufrichtige Freude am Schreiben sofort ab.
„Sie haben bereits 15 Romane veröffentlicht – und das, obwohl Sie gerade mal 28 sind. Woher nehmen Sie all Ihre Ideen?“
„Ich gehöre zu den Menschen, die das Hochsensibilitäts-Gen haben. Das bedeutet, dass ich alle Reize um mich herum sehr viel intensiver wahrnehme als andere. Das kann im Alltag sehr belastend sein, weil ich mich öfter zurückziehen muss, wenn ich zu lange lärmenden Situationen ausgeliefert bin ...“
„Sie meinen, Menschenansammlungen wie diese?“
„In etwa, ja. Aber für ein bis drei Stunden ist das kein Problem, zumal wir uns hier ja in einem überschaubaren Kreis befinden. Dann genieße ich diese Momente sehr, wie Sie hoffentlich merken. Aber wenn ich zum Beispiel einen ganzen Tag auf einer überfüllten Buchmesse sein muss, sieht es schon anders aus. Was ich aber sagen wollte: Diese Hochsensibilität kann im Alltag zwar nerven, aber für das Schreiben ist sie ein Segen, weil ich alle Geschichten und Schicksale, die mir so im wahren Leben begegnen, unbewusst aufsage. Alles, was ich sehe oder erlebe, nistet sich sofort in meinem Hinterkopf ein, oft ganz unbemerkt. Und genauso finden auch die Ideen zu meinen Büchern wie von selbst ihren Weg zu mir. Sie sind einfach da. Ich musste noch nie nach ihnen suchen. Vielleicht fällt mir das Schreiben deshalb so leicht.“
Meine Gedanken wandern zu Vater. Wie lange ist es her, dass ich ihn genauso euphorisch über das Schreiben habe reden hören? Zwei Jahre? Oder noch länger?
Das Lächeln, mit dem sie die Fragen beantwortet und zwischendurch immer mal wieder ein Buch signiert, fesselt mich auf eine Weise, die mich selbst überrascht. Allein die Tatsache, über das Schreiben zu reden, scheint sie so glücklich zu machen, als würde sie über eine Liebesaffäre sprechen. Als wäre es das größte Glück auf Erden, genau das zu tun, was sie tut.
„Haben Sie sich je in einem anderen Genre versucht?“
Dieses Mal ist es eine etwas ältere Frau, vielleicht Ende sechzig, die die Hand gehoben hat, um ihr eine Frage zu stellen.
Emma überlegt auch dieses Mal nicht lang, bevor sie antwortet: „Ich liebe Thriller und Serien über das Jagen von Serienmördern. Und ja, ich habe schon oft darüber nachgedacht, mich selbst an diesem Thema zu versuchen. Aber bisher musste ich leider immer wieder feststellen, dass mir das Schreiben solcher Bücher nicht so wirklich liegt. Ich denke dabei zu viel nach und schreibe weniger instinktiv, wie ich es von meinen Liebensromanen her kenne. Und ich glaube, dass es gerade meine Instinkte sind, die meinen Erfolg ausmachen. Würde ich meinen Kopf einschalten und alles von Anfang bis Ende durchtakten, ohne auch mal die Leine zu lockern und den Titelhelden selbst das Ruder zu überlassen, wären meine Romane wesentlich stumpfer und emotionsloser.“ Sie grinst. „Andere Autoren sind im Planen ihrer Handlungsstränge sehr viel geschickter, aber ich fahre einfach am besten, wenn ich auf mein Bauchgefühl höre. Das hat mich noch nie betrogen.“
Wieder legt ihr jemand ein Buch zum Unterschreiben vor, wieder breitet sich ein lebhaftes Gemurmel in der Menschenmenge aus.
Ohne groß darüber nachzudenken, ertappe ich mich plötzlich selbst, wie ich die Hand hebe. Sie entdeckt mich nicht sofort, aber als sich schließlich unsere Blicke treffen, ist es umso merkwürdiger. Beinahe scheint es, als würde sie sich wundern, eine Frage von einem Mann gestellt zu bekommen.
„Ja?“ Sie deutet mit einem Kopfnicken in meine Richtung.
„Ich habe mich nur gerade gefragt“, ich lasse meinen Arm wieder sinken und trete ein Stück vor, „ob Sie jemals auch mit Schreibblockaden zu kämpfen haben.“
Unweigerlich muss ich an meinen Vater denken.
„Schreibblockaden“, wiederholt sie gedankenverloren, während sie sich auf den Stuhl hinter dem Stehtisch setzt.
„Na ja“, entgegne ich, „so etwas passiert doch sicher jedem Autor mal, oder?“
Auf meine Frage hin wirft sie mir ein Lächeln zu, das ich nicht so wirklich einordnen kann.
„Um ehrlich zu sein“, beginnt sie schließlich, „kann ich mich nicht erinnern, jemals eine Blockade gehabt zu haben. Es ist wohl eher so, dass ich mich zwingen muss, auch mal eine Schreibpause einzulegen und mich bewusst zu entspannen.“ Sie kneift die Augen zusammen, als müsste sie erst nach den richtigen Worten suchen. „Vielleicht bin ich tatsächlich so etwas wie eine kleine Streberin, was das Schreiben angeht.“ Sie schaut mich direkt durch die Menschenmenge an und wirft mir ein herzliches Lachen zu. „Klingt das plausibel?“
Nun lache auch ich. „Aus Ihrem Mund schon.“
Eine Weile halten sich unsere Blicke fest. Nur kurz. Ein eigentlich unbedeutsamer Moment. Und doch überkommt mich dabei ein seltsam vertrautes Gefühl – und eine Frage, die so absurd scheint, dass ich sie sofort wieder verdränge.
Unweigerlich wende ich mich von der Menschenmenge ab, während sich im Hintergrund schon die nächste Besucherin mit einer Frage zu Wort meldet. Doch ich höre nicht mehr zu und widme mich stattdessen erneut dem Thriller-Regal.
Eigentlich müsste ich zurück ins Büro. Und überhaupt gäbe es tausend wichtigere Dinge zu tun, als tatenlos in einem Buchladen herumzulungern. Andererseits: Hat der Grund, der mich daran hindert, einfach zu gehen, tatsächlich etwas mit Tatenlosigkeit zu tun? Ist es nicht vielmehr so, dass die Idee, die mit jeder Minute, die ich hier verbringe, mehr und mehr an Form annimmt, die beste Idee seit Langem ist?
Wieder werfe ich einen flüchtigen Blick zu der Menschentraube. Irgendwo lacht jemand. Und auch Emmas Stimme erhebt sich über die der anderen.
Ja, die Glücksgefühle, die das Schreiben in ihr auslöst, scheinen tatsächlich echt zu sein. So echt, wie sie nur sein können.
Kapitel 2
Emma
Dass Clawsen, der Ladenbesitzer, die Runde offiziell für beendet erklärt hat, habe ich nur für ein paar Sekunden bedauert. Doch jetzt, wo sich die Leute langsam entfernen und ich zum ersten Mal seit Stunden durchatmen kann, spüre ich, wie gut mir die Ruhe tut.
Im Hinterzimmer des Ladens werfe ich einen flüchtigen Blick in den Spiegel.
Irgendwie sehe ich müde aus. Fast ein bisschen blass.
Ich sollte mir vor der Heimfahrt noch irgendwo einen Coffee to go besorgen, bevor ich auf dem Weg zur Insel noch einschlafe.
Ich kneife mir in die farblosen Wangen, atme ein letztes Mal tief durch und greife dann nach meiner Handtasche. Als ich die Tür hinter mir schließe und durch den Laden in Richtung Ausgang gehe, sehe ich ihn plötzlich.
Er steht vor dem Regal mit den Thrillern. Die Hände in den Hosentaschen, den Blick suchend in die Höhe gerichtet, als befände er sich auf der höchstwichtigen Suche nach einem ganz bestimmten Buch.
Etwas hindert mich für eine Sekunde daran weiterzugehen. Stattdessen verharre ich kurz und betrachte ihn von der Seite.
Ob sein Interesse an meiner Schreiberei aufrichtig war? Oder war er nur durch Zufall zur selben Zeit hier wie ich?
Er trägt das mokkabraune Haar kurz und doch lang genug, um ihm einen leicht zerzausten Look zu geben. Eine Unordnung, die gewollt zu sein scheint und ihm zusammen mit dem Bartansatz, der mit etwas Geduld zum Vollbart werden könnte, etwas besonders Geheimnisvolles gibt.
Sein himmelblaues Hemd sitzt locker in seiner Jeans und gibt den Blick auf den trainierten Rücken und einen Hintern frei, auf den ich einen Moment zu lang starre.
Erschrocken über mich selbst gehe ich schließlich weiter in Richtung Ausgang. „Wiedersehen“, sage ich mit freundlichem Nicken, als ich seinen Weg kreuze. Doch noch bevor ich die Tür erreicht habe, nehme ich seine Stimme hinter mir wahr.
„Warten Sie.“
Ich drehe mich zu ihm um. „Ja?“
„Emma, richtig?“ Er stellt ein Buch zurück ins Regal und kommt einen Schritt auf mich zu. „Ich bin Marlon.“
Etwas verunsichert erwidere ich sein Handschütteln. „Freut mich.“
Für den Bruchteil einer Sekunde verliere ich mich in seinen türkisblauen Augen. Scheiße, zum Teufel, was ist das bitteschön für eine Augenfarbe? Man wird ja regelrecht gezwungen, ihn anzustarren, ob man will oder nicht.
Ich atme lautstark aus.
„Ich hoffe, Sie halten mich nicht für aufdringlich, weil ich auf Sie gewartet habe“, beginnt er schließlich, „aber mein Anliegen ist doch etwas zu speziell. Ich wollte nicht so gern vor den anderen Leuten darüber sprechen.“
Meine Neugier ist geweckt. Vermutlich sollte ich besser skeptisch sein, denn Anfragen, die auf diese Weise anfangen, bedeuten selten etwas Gutes. Das letzte Mal, als jemand nach einer Lesung auf mich gewartet hat, wollte er, dass ich mit ihm zusammen ein Buch über seine nymphomanische Ehefrau schreibe.
Trotzdem, irgendetwas an diesem Marlon hindert mich daran, mich unter einem Vorwand aus dem Staub zu machen.
„Worum geht es denn?“, frage ich schließlich.
Er schaut sich um, als hätte er ein ziemlich heikles Thema mit mir zu besprechen.
„Um ehrlich zu sein ...“, murmelt er.
Ich neige den Kopf zur Seite. „Ist alles in Ordnung?“
„Ja.“ Er kratzt sich an der Schläfe. „Ich würde das nur gern an einem anderen Ort besprechen.“ Er schaut durch das Schaufenster auf die Stadtpromenade hinaus. „Darf ich Sie vielleicht auf einen Kaffee einladen? Gleich gegenüber ist ein kleines Café. Es dauert auch höchstens zwanzig Minuten. Danach können Sie selbst entscheiden, was Sie von meinem Angebot halten.“
Die Skepsis, die gerade noch nichts weiter als ein unscheinbares Gefühl war, wird langsam stärker.
Er ist ein Fremder. Und nur weil er gut aussieht und diesen Wahnsinnshintern hat, heißt das noch lange nicht, dass er kein perverser Irrer ist, der nur auf eine Gelegenheit wartet, mir in der nächsten Seitengasse die Kehle aufzuschlitzen.
Und doch ist da dieser unerklärliche Drang, mehr über sein Anliegen zu erfahren. Mehr über ihn.
Ich zögere.
„Blöde Idee?“ Er runzelt die Stirn. „Tut mir leid. Sie kennen mich ja gar nicht. Klar, dass sie erst mal misstrauisch sind.“
„Das ist es nicht“, lüge ich. „Zu Hause wartet nur mein Manuskript auf mich und ich ...“ Ich stocke. „Wissen Sie was? Das hat keine Eile.“ Ich straffe meine Schultern und blicke ihn freundlich an. „Von mir aus können wir gern einen Kaffee trinken gehen.“
Ich bin überrascht von meinem eigenen Übermut. Habe ich etwas zu lange in dieses unergründliche Türkisblau seiner Augen geschaut? Bin ich tatsächlich so leicht aus dem Konzept zu bringen?
„Das ist großartig.“ Ein Strahlen breitet sich auf seinem markanten Gesicht aus. „Ich werde auch versuchen, mich so kurz wie möglich zu fassen.“
„Worum auch immer es geht, Sie haben mich neugierig gemacht.“
„Das freut mich.“
Er geht voraus und hält mir die Tür auf. Als wir gemeinsam auf die Promenade hinaustreten und uns die Maisonne zum Blinzeln bringt, überkommt mich plötzlich ein rätselhaft warmes Gefühl. Ein Gefühl, das ich nicht beschreiben kann, das aber glücklicherweise überhaupt nicht zu der Vorstellung passt, jeden Augenblick in eine Seitengasse gezogen und aufgeschlitzt zu werden.
Kapitel 3
Marlon
Wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, habe ich nicht damit gerechnet, dass sie meine Einladung annehmen würde. Jetzt, wo ich ihr an diesem kleinen Fenstertisch gegenübersitze und an meinem Kaffee nippe, scheint es mir umso unglaublicher.
Habe ich wirklich vor, sie zu fragen? Und was lässt mich glauben, dass sie tatsächlich annehmen wird?
Nach einem kurzen Schluck von ihrem Chai Latte stellt sie die Tasse ab und schaut mich neugierig an.
„Also?“ Sie öffnet die Lippen leicht. „Was ist es, das Sie so dringend mit mir besprechen möchten?“
Erst jetzt fällt mir das Bernsteingold ihrer Augen auf. Was für ein faszinierender Farbton.
„Marlon?“, fragt sie, als mein Schweigen andauert.
„Oh.“ Ich räuspere mich. „Tut mir leid, ich war wohl in Gedanken.“
Die Tatsache, meinen Namen aus ihrem Mund zu hören, macht die Situation noch unwirklicher. Andererseits: Was habe ich schon zu verlieren? Und heißt es nicht immer, dass die spontanen Ideen die besten sind?
„Am besten komme ich gleich zur Sache.“ Ich schiebe meinen Kaffeebecher zur Seite und falte meine Hände ineinander.
Sie sieht mich voller Erwartung an.
„Wissen Sie“, beginne ich endlich, „es klingt zwar in der heutigen Zeit etwas seltsam, aber ich lebe mit meinem Vater zusammen.“
Diese Tatsache scheint sie nicht im Geringsten zu irritieren.
„Wir leben in einem recht großen Haus zusammen“, fahre ich fort. „Eigentlich ist es eher eine Villa. Jeder von uns hat zwar seinen eigenen Wohnbereich, aber trotzdem bekomme ich recht viel von seinem Alltag mit. Na ja, und dieser Alltag ist der Grund, warum ich Sie um dieses Treffen gebeten habe.“
„Ich verstehe nicht ganz.“
„Mein Vater ist Autor.“ Ich lächele flüchtig. „Genau wie Sie.“
„Oh.“ Sie neigt den Kopf ein Stück zur Seite. „Hat er bereits Bücher veröffentlicht? Kennt man ihn?“
Ich halte einen Augenblick lang inne.
Wäre es nicht ziemlich dumm, ihr seinen Namen zu nennen? Immerhin habe ich keine Ahnung, ob sie auf meinen Vorschlag eingehen wird. In dem Fall wüsste sie um seinen Zustand und könnte mit dieser Information hausieren gehen.
Blödsinn! So etwas würde sie nicht tun. Sie ist eine aufrichtige und reine Seele, das sieht doch ein Blinder.
Oder?
Ich senke den Blick auf meine Hände.
„Ist alles in Ordnung?“, fragt sie.
Ich zögere kurz.
„Ja.“ Ein Gefühl von Sicherheit breitet sich plötzlich in mir aus. „Es ist nur ...“
„Was?“ Sie nippt erneut an ihrem Chai Latte.
Ich schlucke die letzten Zweifel herunter.
„Sein Name ist Constantin“, sage ich schließlich. „Constantin Fehn.“
Überrascht stellt sie die Tasse ab. „Der Constantin Fehn?“
Ich schaue mich nervös um. Eine Tatsache, die sie sofort bemerkt.
„Tut mir leid.“ Sie senkt die Stimme. „Ich wollte nicht indiskret sein.“
„Schon gut. Niemand hat etwas gehört.“
„Ich war wohl einfach überrascht, seinen Namen zu hören.“ Sie beugt sich in verschwörerischem Unterton über den Tisch. „Ich meine, ihr Vater ist eine Koryphäe in der Autorenwelt. Jeder kennt ihn. Jeder bewundert ihn für seinen beispiellosen Erfolg. Eine solche Karriere über mehrere Jahrzehnte aufrechtzuerhalten, gelingt nicht vielen. Allein die Vorstellung, mit seinem Sohn an einem Tisch zu sitzen, macht mich gerade sprachlos, wenn ich ehrlich bin.“
Ihre Bewunderung für ihn weckt den altvertrauten Stolz in mir. Der Stolz auf das, was Vater bisher erreicht hat. Der Stolz, dieselben Gene in mir zu tragen.
„Dann wussten Sie gar nicht, dass er hier an der Ostsee lebt?“, frage ich.
„Na ja“, sie zuckt mit den Schultern, „dass er am Meer lebt, habe ich schon öfter gehört. Aber ich dachte da eher an so was wie Rügen. Ist doch eher die Gegend für Prominenz, oder?“
Dass sie ihn als prominent bezeichnet, ruft mir zum ersten Mal seit Langem in Erinnerung, wie berühmt er tatsächlich nach all den Jahren noch immer ist. Umso überraschter wären die Leute vermutlich, von seinem Zustand zu erfahren.
„Sie leben auf der Insel Poel, richtig?“ Ich schaue sie interessiert an.
„Ja, woher wissen Sie das?“
„Das Klappschild im Buchladen nannte Sie Poeler Autorin.“
„Stimmt.“ Sie lächelt beinahe verlegen. „Das hatte ich ganz vergessen.“
„Dann werden Sie sicher überrascht sein zu hören, dass wir praktisch Nachbarn sind. Wir leben am Rande von Wismar.“
„Tatsächlich?“ Ihre Augen weiten sich. „Das ist wirklich eine Überraschung.“
Die Art, wie sie mich anschaut, lässt mich für einen Moment den Grund für dieses Treffen vergessen. Ihr Blick scheint so unergründlich und doch strahlt sie eine Gutmütigkeit aus, die mich in meiner Entscheidung bestärkt.
„Na ja“, ich rutsche auf meinem Stuhl hin und her, während ich nach den richtigen Worten suche, „mein Vater ist wie gesagt der Grund, warum ich mit Ihnen reden wollte.“
„Gern. Worum geht es denn?“
„Wissen Sie ...“ Ich hole tief Luft. „Ich kann doch davon ausgehen, dass dieses Gespräch unter uns bleibt?“
„Selbstverständlich.“ Sie presst die Lippen zusammen.
„Na ja, mein Vater befindet sich seit weit über zwei Jahren in einer schweren Krise. Das Schreiben war immer sein Leben, nichts anderes erfüllte ihn mit so viel Stolz und Freude wie diese Leidenschaft.“ Ich seufze. „Aber irgendwie ist ihm diese Freude abhandengekommen. Er hat eine regelrechte Schreibblockade, was seine Stimmung wiederum noch schlechter werden lässt. Es ist sozusagen ein Teufelskreis.“
„Oh.“ In ihren Augen liegt echtes Bedauern. „Das tut mir sehr leid zu hören. Und es fällt mir schwer, mir vorzustellen, dass ausgerechnet ein so begnadeter Autor wie Ihr Vater vor so einem Problem stehen soll.“
„Er hätte das sicher selbst niemals für möglich gehalten. Sie hätten ihn erleben sollen, wie er früher war. Als meine Mutter noch lebte, waren wir viel am Strand. Selbst dort hatte er seine Notizbücher dabei, um zu arbeiten.“ Meine Erinnerungen schweifen ab. „Verstehen Sie mich nicht falsch: Er war auch damals ein toller Vater und hat sich immer Zeit für mich genommen. Aber sobald ich beschäftigt war oder schwimmen gegangen bin, hatte er sofort eines seiner Manuskripte griffbereit. Er liebte seine Arbeit einfach und sein Ideenreichtum war unerschöpflich.“
„Dann war es sicher der Tod Ihrer Mutter, der ihn diese Freude genommen hat?“ Sie erschrickt im selben Moment über ihre forsche Frage. „Tut mir leid. Ich wollte nicht so direkt sein.“
„Schon in Ordnung.“ Ich atme durch. „Sicher, Mutters Tod war sehr schwer für uns. Aber das ist mittlerweile 16 Jahre her. Damals war ich 13 und hatte hart damit zu kämpfen. Aber Vater gab sein Bestes, mir trotz allem eine schöne Kindheit zu bescheren. Und schon damals fand er im Schreiben sehr viel Trost. Man kann sogar sagen, dass seine Arbeit nach ihrem Tod noch mehr zum Teil von ihm wurde.“
Ihr Interesse für das Thema ist ihr deutlich anzusehen, trotzdem scheint sie sehr darum bemüht, keine unangemessenen Fragen zu stellen. Also greift sie schweigend nach ihrer Tasse und nimmt erneut einen Schluck.
„Mit jeder neuen Anfrage des Verlags wird Vater nur noch unglücklicher“, fahre ich fort. „Er kommt sich mehr und mehr wie ein Versager vor, hat aber irgendwie auch keine Kraft, aus diesem Loch herauszukommen. Manchmal sitzt er Stunden mit seinem Notizbuch auf der Terrasse und starrt schweigend auf den Rasen, ohne auch nur ein einziges Wort zu schreiben.“
„Das muss schrecklich für ihn sein.“
Ich nicke. „Manchmal, wenn wir zusammen frühstücken, ist da dieses Lächeln auf seinem Gesicht. Und dann ist er voller Tatendrang und erzählt von seinen Schreibplänen für den Tag. Aber abends ist er dann umso deprimierter, weil er wieder nichts zu Papier gebracht hat.“
„Vielleicht ist das Schreiben einfach nicht mehr das Richtige für ihn.“ Sie setzt die Tasse ab.
„Das habe ich auch schon oft zu ihm gesagt. Und ich habe ihm vorgeschlagen, diese Blockade einfach zu akzeptieren und stattdessen ein wenig in meinem Unternehmen mitzuarbeiten.“
„Sie leiten ein Unternehmen?“
„Es ist eine Kette von Souvenirshops an der Küste. Das hat sich im Laufe der Jahre mehr und mehr erweitert und würde im Prinzip vollkommen ausreichen, meinen Vater und mich zu ernähren. Mal abgesehen davon, dass seine alten Veröffentlichungen auch immer noch viel Profit abwerfen.“ Ich suche nach der richtigen Formulierung. „Aber darum geht es auch gar nicht. Es geht um die Aufgabe, die mein Vater einfach dringend in seinem Leben braucht. Eine Aufgabe, die ihn von seiner Lethargie befreit.“
„Und der Vorschlag, für Sie zu arbeiten?“
„Kommt für ihn leider ebenso wenig in Frage.“ Ich lasse die Schultern sinken. „Es gibt für ihn einfach keine Alternative zum Schreiben. Trotz seiner Blockade betrachtet er es weiterhin als festen Bestandteil seines Lebens, ohne den er nicht existieren kann und will.“
„Was ziemlich widersprüchlich ist, wenn er gar nicht schreibt.“
Ich verschiebe die Mundwinkel. „Sie sagen es.“
„Hat er denn schon mal therapeutische Hilfe in Anspruch genommen?“
„Das lehnt er leider kategorisch ab.“
Wieder packen mich die altvertrauten Schuldgefühle. Hätte ich all das verhindern können? Seinen Zustand voraussehen müssen?
„Das alles tut mir zwar sehr leid“, sagt sie schließlich, „aber mir ist noch immer nicht ganz klar, wie ich bei der Sache helfen kann.“
Ihr Blick strahlt noch immer aufrichtiges Interesse aus, trotzdem zögere ich einen Moment.
„Geht es Ihnen gut?“ Sie legt den Kopf schräg und sieht mich aufmerksam an.
„Ja.“ Ich räuspere mich. „Ja, natürlich. Ich habe mich nur gerade gefragt, wie ich meine Idee am besten rüberbringe, ohne Sie gleich zu schockieren.“
Sie lacht. „Sollte ich Angst haben?“
„Kommt darauf an.“ Ich lächele. „Zugegeben, mein Vorschlag ist schon ein bisschen ungewöhnlich, aber als ich gehört habe, mit wie viel Feuereifer Sie über das Schreiben reden, hatte ich einfach so ein Gefühl, dass es wirklich klappen könnte. Dass meine Idee wirklich was bringen kann.“
Sie hebt das Kinn. „Nun machen Sie es doch nicht so spannend.“
„Na ja, ich habe mich gefragt, was Sie davon halten, für ein paar Wochen zu uns zu ziehen und dort an Ihrem Manuskript zu arbeiten. Sie haben doch sicher wieder irgendein Projekt in der Pipeline, so oft, wie Sie veröffentlichen. Und ich denke, dass es meinem Vater wirklich guttun würde, wenn Sie in seiner Gegenwart schreiben würden. Dass es ihn anstecken und motivieren könnte. Dass er dadurch ...“
„Moment mal“, sie hebt die Hand und kneift ungläubig die Augen zusammen. „haben Sie mir gerade allen Ernstes vorgeschlagen, zu Ihnen zu ziehen?“
„Na ja, nur für ein paar Wochen. Und nur weil es die Dinge leichter machen würde. Zumindest von meinem Vater kenne ich es so, dass er besonders spätabends kreativ wird. Wenn es bei Ihnen ähnlich ist, bietet es sich doch an, dass Sie für die Dauer der Vereinbarung eines unserer Gästezimmer beziehen.“
Ihr Mund ist leicht geöffnet, in ihrem Gesicht steht die blanke Verwunderung.
Ich versuche, mich zu erinnern, ob ich etwas Falsches gesagt habe. War ich zu forsch? Ist meine Idee vielleicht noch absurder, als ich angenommen hatte?
„Also, das ist ...“ Sie lehnt sich zurück. „Ich kann mich nicht erinnern, jemals so ein Angebot bekommen zu haben.“
„Sie müssten es natürlich nicht umsonst tun“, antworte ich schnell. „Ich habe so an 10.000 gedacht. Aber der Preis ist selbstverständlich noch verhandelbar. Und verpflegt werden Sie natürlich zusätzlich. Wir haben eine tolle Köchin, die sehr gern auch auf Ihre Wünsche eingehen wird.“
Als ich ihr die Summe nenne, sagt sie eine Weile gar nichts. Habe ich sie damit möglicherweise nur noch mehr verschreckt? Hat dieser Betrag möglicherweise sogar etwas Anrüchiges?
Blödsinn! Jeder wäre froh, mal eben ohne viel Aufwand eine solche Summe zu verdienen.
Oder?
„Arbeiten Sie denn momentan an keinem Buch“, frage ich sie, als ihr Schweigen andauert.
„Ich arbeite eigentlich immer an einem Buch“, antwortet sie verwirrt.
„Na, dann passt das doch hervorragend, oder? Sie arbeiten an Ihrem Manuskript und versuchen ganz nebenbei, Ihren Ehrgeiz und Ihre Schreibfreude auf meinen Vater zu übertragen. Vielleicht wird es sogar schon reichen, dass Sie einfach nur da sind, um ihn seine Schreibblockade aus einem ganz anderen Blickwinkel zu betrachten.“
„Selbst, wenn ich mich auf Ihr Angebot einlassen würde, wer sagt Ihnen denn, dass das überhaupt klappen würde? Glauben Sie wirklich, dass er plötzlich wie von Zauberhand von seiner Krise befreit wird?“
„Ich glaube gar nichts, ich hoffe einfach nur. Und ehrlich gesagt bin ich mit meinem Latein langsam am Ende. Alles, was ich weiß, ist, dass es mir das Herz bricht, ihn so demotiviert zu erleben. Es zerfrisst ihn regelrecht.“
Sie schaut mich stumm an. Eine Sprachlosigkeit, die es mir schwermacht zu erkennen, was in ihr vor sich geht.
Hält sie mich für einen Verrückten? Habe ich sie mit meinem Angebot möglicherweise sogar gekränkt, ohne es zu merken? Weil ich sie gewissermaßen für käuflich halte?
Ich möchte ihre Zweifel zerschlagen, irgendetwas sagen, dass ihr die Unsicherheit nimmt, doch sie kommt mir zuvor.
„Tut mir wirklich leid, Marlon, aber ich glaube nicht, dass ich die Richtige für diesen Job bin. Allein die Verantwortung, der ich mich dadurch aussetzen würde, wäre viel zu groß. Erstens wissen wir gar nicht, ob Ihr Vater mit alldem einverstanden wäre und zweitens kann ich mir nicht vorstellen, dass allein meine Anwesenheit etwas an seinem Zustand ändern würde. Am Ende würde ich mich sicher schuldig fühlen, zumal es ja auch durchaus sein kann, dass ihn meine Schreibwut nur noch mehr deprimiert.“
„Wenn wir merken, dass sich sein Zustand unter Ihrer Anwesenheit verschlechtert, können wir das Ganze ja immer noch abbrechen“, entgegne ich. „Aber ich glaube wirklich, dass Sie Ihren Einfluss unterschätzen. Wenn Sie wüssten, wie positiv die Energie ist, die Sie ausstrahlen. Und wenn ich das schon bemerke, der keine Ahnung vom Schreiben hat, wie muss es da erst meinem Vater gehen? Ich bin mir sicher, dass Ihre Schreibfreude viele schöne Erinnerungen in ihm wecken wird.“
„Wie würden Sie ihm meine Anwesenheit denn überhaupt verkaufen wollen? Sagen Sie so was wie: Hey Paps, ich habe dir eine Schreib-Nanny besorgt, die in Zukunft auf dich aufpassen wird?“
„Ich habe Sie ja gerade erst kennengelernt“, antworte ich. „Die Idee ist praktisch noch ganz frisch. Was genau ich meinem Vater sagen würde, weiß ich nicht. Aber wie wäre es mit der Wahrheit? Dass ich mir Sorgen um ihn mache und dass ich das alles für eine gute Idee halte?“
„Und Sie glauben ernsthaft, dass er das gutheißen würde?“
„Er würde sich sicher freuen, Sie kennenzulernen. Außerdem käme es ja auch lediglich darauf an, wie ich ihm die Idee präsentieren würde.“ Ich halte einen Moment inne. „Bei Ihnen konnte ich das alles jetzt nicht groß planen. Deshalb habe ich Sie jetzt etwas überrollt. Aber denselben Fehler muss ich ja nicht auch bei meinem Vater machen.“
Sie greift erneut nach ihrer Tasse und leert sie mit einem großen Schluck. Als sie sie geräuschvoll zurückstellt, schiebt sie ihren Stuhl nach hinten und steht auf.
„Tut mir wirklich leid, aber ich glaube, es ist besser, wenn ich jetzt gehe.“ Ihr Lächeln wirkt gequält. „Ich wünsche Ihnen für Ihren Plan alles Gute. Ich bin mir sicher, dass Sie die richtige Person für dieses Vorhaben finden werden, aber ich eigne mich definitiv nicht dafür.“
„Warten Sie.“ Ich stehe ebenfalls auf und ziehe eine Visitenkarte aus meiner Hemdtasche. „Nehmen Sie wenigstens meine Karte mit. Nur für den Fall, dass Sie es sich doch noch anders überlegen.“
Seufzend nimmt sie die Karte entgegen und wirft sie achtlos in ihre Handtasche.
„Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht helfen kann“, ist alles, was sie sagt.
Frustriert schaue ich ihr nach, während ich mich wieder setze.
Wie dumm von mir zu glauben, dass es klappen könnte. Aber ist das ein Grund, einfach aufzuspringen und zu verschwinden? Habe ich sie denn wirklich so verwirrt? Ich habe sie ja schließlich nicht gefragt, ob sie einen Monat lang das Bett mit mir teilt.
Ich umklammere meinen Kaffeebecher und lehne mich seufzend zurück.
Dann lehnt sie eben ab! Scheißegal. Wenigstens hat sie mich auf die Idee gebracht, wie ich Vater vielleicht wirklich helfen kann. Und wenn sie mein Angebot nicht annimmt, dann eben jemand anderes.
Kapitel 4
Emma
„10.000 Euro?“ Conny, die ihr Rad neben mir über die Hafenpromenade schiebt, bleibt unweigerlich stehen. „Das ist nicht dein Ernst, oder?“
„Ich habe genauso geguckt wie du.“ Ich stelle mein Rad in den Fahrradständer vor dem Hafenbistro.
„Und du hast nicht angenommen?“
„Was denkst du denn? Ich kenne den Mann doch gar nicht.“
„Aber du kennst Constantin Fehn.“ Sie stellt ihr Rad neben meines.
„Ja, aber doch nicht persönlich. Ich kenne lediglich seine Bücher – und das ist ja wohl was völlig anderes.“
„Aber neugierig hat dich sein Vorschlag schon gemacht, oder?“
Ich schaue sie einen Moment lang schweigend an. Sie hat ihre Sonnenbrille in ihr kinnlanges, maisblondes Haar geschoben. Ihre Wangen haben den altvertrauten rosigen Hauch, der sie selbst früh am Morgen grundsätzlich wie das blühende Leben aussehen lässt.
„Kann schon sein.“ Ich zucke mit den Schultern. „Aber in erster Linie war ich einfach sprachlos. Ich meine, dieser Marlon kennt mich doch gar nicht. Wie viel ist schon von seinem Angebot zu halten, wenn er im Grunde gar nichts über mich weiß?“
„Und wenn schon. Du würdest eine Menge Kohle bekommen und gleichzeitig an deinem Manuskript weiterarbeiten können. Eine Win-Win-Situation, würde ich sagen.“
„Also, ich weiß nicht. Mir kam das alles eher ziemlich merkwürdig vor.“
Während wir uns dem Eingang des Bistros nähern, ist der alte Hennig gerade dabei, mit seinem Fischkutter anzulegen.
„Guten Morgen, die Damen“, ruft er uns zu, während er seine Fischermütze vom Kopf zieht und freundlich in unsere Richtung nickt.
„Morgen, Henning“, rufen wir einstimmig zu ihm herüber.
„Und Emma? Wann schreibst du endlich mal einen Roman mit einem feschen Fischer in der Hauptrolle?“ Er legt grinsend die Hände auf seinen stattlichen Bauch. „All die aalglatten Schönlinge kann doch niemand mehr sehen. Es wird höchste Zeit für ein bisschen Realität, findest du nicht auch?“
Ich lache. „Sollte dieses Buch jemals zustande kommen, ist schon jetzt klar, dass du das Vorbild für die Titelrolle sein wirst.“
„Darum möchte ich doch sehr bitten.“
Als Conny und ich das Bistro betreten, ist die Zahl der Gäste recht übersichtlich. Zufrieden stellen wir fest, dass unser Lieblingstisch am Fenster noch frei ist.
„Aber mal ehrlich“, beginnt Conny erneut, als wir uns setzen, „du willst die Sache doch jetzt nicht einfach auf sich beruhen lassen, oder? Ich meine, mal abgesehen vom Geld klingt das alles doch wahnsinnig spannend. Du könntest hinter die Kulissen des Alltags einer echten Autorenlegende schauen. Wer hat schon die Chance darauf?“
Wieder schleichen sich die Erinnerungen an das gestrige Gespräch in meinen Kopf. Und wieder frage ich mich, warum ich mich überhaupt mit diesem Mann getroffen habe. Habe ich mich für ein paar unüberlegte Augenblicke von seinem Charme blenden lassen?
„Ich weiß auch nicht.“ Seufzend greife ich nach der Karte. „Das alles hat mich einfach überrollt. Und ich muss zugeben, dass mich die Summe irgendwie auch ein bisschen beleidigt hat. So, wie er sie mir genannt hat, kam ich mir vor wie vor einem Drogen- oder Prostitutionsgeschäft. Als wäre ich einfach so käuflich.“ Ich schlage die Karte wieder zu. „Ich glaube, ich habe heute gar keinen Hunger.“
„Natürlich hast du Hunger. Ich bestell für uns, okay? Lass mich mal machen.“
Ich lehne mich demotiviert zurück. „Am besten ich verziehe mich für den Rest des Tages mit dem Laptop auf meine Terrasse und arbeite am nächsten Kapitel. Das wird mich auf andere Gedanken bringen.“
„Wieso denn auf andere Gedanken? Ich finde, du solltest viel lieber noch mal über das Angebot nachdenken. Ich meine, jetzt, wo du eine Nacht drüber geschlafen hast, bereust du es doch bestimmt, einfach abgelehnt zu haben, oder?“
Ich schaue hinaus auf die Hafenpromenade. Eine Möwe hat den Rest eines Fischbrötchens zum späten Frühstück auserkoren, doch die Klingel eines Fahrradfahrers scheucht sie auf.
„Ich bereue nichts“, antworte ich, doch insgeheim frage ich mich schon, ob ich vielleicht vorschnell entschieden habe.
„Was war er denn überhaupt für ein Typ?“, hakt Conny nach. „Und wie alt ist er?“
Dass ich ihn mittlerweile gegoogelt habe, behalte ich für mich.
„Ich glaube, 29 oder so“, gebe ich mich betont gleichgültig.
„Nun lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen.“ Sie rollt mit den Augen. „Wie sieht er aus?“
Ich greife erneut nach der Bistrokarte, lege sie aber sofort wieder zurück.
„Ganz okay“, antworte ich schließlich.
„Wusste ich’s doch.“ Sie betrachtet mich mit wissendem Grinsen. „Du wirst ja schon rot, wenn du nur an ihn denkst.“
„Blödsinn! Ich bin nur immer noch verwirrt, das ist alles.“
Die Kellnerin – kurzhaariges Feuerrot, um die Vierzig – kommt an unseren Tisch. „Und? Haben die Damen schon gewählt?“
„Wir nehmen zwei Milchkaffee und jeweils die Nummer 13.“ Conny nickt ihr freundlich zu.
Unter anderen Umständen würde ich protestieren, weil sie einfach für mich bestellt, heute jedoch bin ich zu durcheinander, um ein Gegenwort einzulegen.
„Gern.“ Die Kellnerin wendet sich wieder ab, woraufhin sich Conny mit geheimnisvollem Blick über den Tisch beugt.
„Mal ehrlich“, sagt sie, „gibt es keine Möglichkeit für dich, den Typen doch noch mal zu kontaktieren. Nur, um noch mehr über das Angebot zu erfahren.“
„Wenn ich mich bei ihm melden wollen würde, könnte ich das problemlos. Er hat mir seine Karte gegeben.“
„Echt? Na, dann ist doch alles super.“
„Glaub mir, Conny, dieser Deal ist mehr als fragwürdig. Dieser Marlon versucht, seinem Vater zu helfen, spricht aber vorher gar nicht mit ihm darüber. Ich meine, was, wenn ich da einfach auftauche und sein Vater total ausflippt, weil ihm eine Art Aufpasserin an die Seite gestellt wird?“
„Na, dann muss dieser Marlon eben vorher mit ihm reden und ihm alles erklären.“
„So einfach wird das nicht sein. Wer gibt schon gerne von sich zu, dass er Hilfe braucht, um wieder schreiben zu können? Und überhaupt, woher wissen wir, ob ihm diese seltsame Vereinbarung überhaupt was bringen wird?“
„Das ist ja nicht dein Problem, oder? Du nimmst das Geld und gibst dein Bestes. Mehr kannst du nicht tun.“
Ich lasse die Schultern sinken. „Aus deinem Mund klingt alles immer so einfach.“
„Tja, manchmal ist es ja nun mal einfach. Du musst den Dingen einfach nur ihren Lauf lassen.“
Eine Weile lasse ich ihre Worte auf mich wirken.
Was, wenn dieses Angebot eine Art Wink des Schicksals ist? Was, wenn ich dem berühmten Constantin Fehn wirklich helfen kann?
„Was hast du eigentlich gerade für uns bestellt?“, frage ich.
„Wirst du schon sehen.“ Sie zwinkert mir zu. „Lass dich überraschen.“
Und während mich tatsächlich ein leichtes Hungergefühl überkommt, nehmen die konfusen Gedanken in meinem Kopf nach und nach Kontur an.
Kapitel 5
Marlon
Lieber Marlon Fehn,
ich muss zugeben, dass mich die Eindrücke zu unserem gestrigen Gespräch nicht losgelassen haben.
Die Situation Ihres Vaters bedauere ich sehr und es wäre mir eine Freude, ihm helfen zu können. Allerdings hatte ich die ganze Zeit über das Gefühl, als würden wir dies gegen seinen Willen tun. Und ich würde wirklich ungern in einem Haus zu Gast sein, wenn ich nicht mit Sicherheit weiß, dort von JEDEM willkommen zu sein. Verstehen Sie, was ich meine? Immerhin geht es ja nun mal um Ihren Vater, mal abgesehen davon, dass ich noch immer meine Zweifel habe, ob ihm meine Anwesenheit wirklich von Nutzen sein kann.
Was ich eigentlich sagen wollte: Ich wäre bereit, noch einmal über Ihr Angebot nachzudenken, wenn Sie mir zusichern, dass auch Ihr Vater darüber Bescheid weiß und einverstanden ist. Das ist meine einzige Bedingung.
Mit lieben Grüßen von der Insel Poel
Emma Tomsen
Überrascht starre ich auf die Zeilen auf meinem Bildschirm. Wer hätte gedacht, dass sie sich tatsächlich noch einmal meldet?
Ich klappe den Laptop zu und strecke meine Beine auf dem kleinen Hocker vor mir aus. Die Sitzecke im Schatten des Kirschbaums ist auch an diesem sonnigen Spätnachmittag wie so oft zu meinem Zufluchtsort geworden.
Der kleine Bach, der sich plätschernd durch den weitläufigen Blumengarten schlängelt, ist die perfekte Geräuschkulisse für meine Gedanken.
Noch immer spukt diese Frau in meinem Kopf herum, auch wenn ich keine Ahnung habe, was genau es ist, das mich so nachhaltig an ihr beeindruckt hat. Ist es möglicherweise die Tatsache, dass sie mich hat abblitzen lassen?
Nein. Immerhin habe ich sie ja nicht angebaggert, sondern lediglich im Sinne meines Vaters gehandelt.
Ich wäre bereit, noch einmal über Ihr Angebot nachzudenken, wenn Sie mir zusichern, dass auch Ihr Vater darüber Bescheid weiß und einverstanden ist. Das ist meine einzige Bedingung.
Wie zum Teufel soll ich ihr etwas zusichern, von dem ich schon jetzt weiß, dass Vater es niemals zulassen würde? Allein der Gedanke, dass Emma nur hier ist, um ihm neuen Mut zu schenken, würde ihn zum Ausrasten bringen. Und ganz sicher wäre er tief in seinem Autorenstolz gekränkt.
Trotzdem spüre ich einfach, dass sie die Richtige für ihn wäre. Die Richtige, um ihn aus seinem Motivationsloch zu holen.
Ich meine: Wer, wenn nicht sie? Sie scheint doch das Paradebeispiel für positive Energie.
Der einzige Weg, das Ziel über ein paar Umwege zu erreichen, wird eine kleine Notlüge sein. Eine winzige Lüge sozusagen, die niemandem schadet.
Richtig?
Richtig!
Entschlossen klappe ich den Laptop auf dem hölzernen Gartentisch vor mir auf und beginne zu schreiben:
Liebe Emma,
ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr es mich gefreut hat, von Ihnen zu hören. Sie werden sehen, dass das die beste Entscheidung für uns alle ist – und schon jetzt bin ich mir sicher, dass Ihre Anwesenheit ein absoluter Segen für meinen Vater sein wird.
Keine Sorge: Ich habe mit ihm gesprochen und ihm von meinem Plan erzählt. Er war anfangs natürlich etwas skeptisch, aber letztendlich ist die Neugier, die aufstrebende und ehrgeizige junge Autorin kennenzulernen, von der ich ihm erzählt habe, einfach größer.
Von unserer Seite aus steht dem Deal also nichts mehr im Wege. Sagen Sie mir einfach, ab wann Sie Zeit haben, dann bereite ich alles für Sie vor.
Ich freue mich.
Marlon Fehn
P.S. Ich sollte vielleicht noch dazu sagen, dass mein Vater ein strikter Verweigerer des Siezens ist. Er duzt einfach jeden, egal ob in seinem Verlag, auf Lesungen oder im privaten Leben. Vermutlich wäre es also das Beste, wenn wir uns alle von Anfang an duzen. Ist das okay für Sie? Wenn ja: Hallo Emma, ich bin Marlon. :-)
Als ich die Mail abgeschickt habe, überkommt mich ein tiefes Gefühl von Zufriedenheit.
Dieser Plan kann nur gut ausgehen, das spüre ich einfach. Und überhaupt: Alles ist besser, als Vater auch nur einen weiteren Tag dabei zuzusehen, wie er sich in seinen Blumengarten verzieht und Rosen schneidet oder Unkraut zupft, anstatt seiner wahren Leidenschaft nachzugehen.
Plötzlich ploppt eine weitere Nachricht auf meinem Bildschirm auf.
Lieber Marlon,
dann übe ich das Duzen schon mal: Ich freue mich auch auf EUCH! :-) Und wo wir uns schon mal einig sind, sollten wir gar nicht lang herumfackeln. Ich würde morgen früh vorbeischauen. Die Privatadresse steht ja auf der Karte.
Ist um neun okay?
Ich bin gespannt auf dieses außergewöhnliche Projekt.
Liebe Grüße
Emma
*
Die Tür zu seinem Arbeitszimmer ist einen Spalt breit offen. Wie so oft überkommt mich ein Anflug von Hoffnung; vielleicht schreibt er ja heute ein wenig. Doch als ich nach einem kurzen Klopfen hineintrete, sitzt er wie in letzter Zeit so häufig mit einem Buch auf seinem Schwingsessel am Fenster.
„Störe ich?“ Ich bleibe in der Mitte des Raumes stehen.
„Hallo Junge.“ Er schaut über den Rand seiner Lesebrille zu mir herüber. „Alles in Ordnung? Habe dich heute noch gar nicht gesehen.“
„Ich hatte heute länger in der Firma zu tun.“
Er nimmt die Lesebrille ab. „Es ist schon nach neun. Du kommst sonst nie um die Zeit rüber.“
„Ich wollte kurz etwas mit dir besprechen.“ Ich setze mich auf die Truhenbank.
„Ich höre?“ Er nimmt die Brille ab und klappt sein Buch zu.
Er sieht müde aus. Die Schatten unter seinen Augen wirken an diesem Abend besonders dunkel.
„Weißt du, ich habe da diese Frau kennengelernt“, beginne ich.
„Oh“, er lächelt neugierig, „wird ja auch mal wieder Zeit. Ich dachte schon, du wärst zum Mönch geworden. Wie lange ist es her, dass du die Ärztin abserviert hast? Ein Jahr?“
„Erstens war sie Krankenschwester und keine Ärztin und zweitens war es eine einvernehmliche Trennung.“
„Wie auch immer.“ Er beugt sich ein Stück nach vorn und sieht mich aufmerksam an. „Erzähl mir von der Neuen.“
Sein plötzliches Interesse ist eine willkommene Abwechslung zu seiner üblichen Lethargie und Abgestumpftheit.
„Es ist nicht das, was du denkst“, sage ich schließlich.
„So? Was denke ich denn?“
„Na ja, ich bin nicht mit ihr liiert oder so. Ich habe sie zufällig in einem Buchladen kennengelernt, wo sie eine Signierstunde gegeben hat.“
„Oh. Eine Autorin?“
Ich nicke. „Irgendwie sind wir ins Gespräch gekommen. Sie ist eine wirklich interessante und sehr lebensfrohe Person.“
„Kenne ich sie denn?“
„Ihr Name ist Emma Tomsen.“
Er kratzt sich an der Stirn. „Welches Genre?“
„Liebesromane.“
„Verstehe. Dann kenne ich sie vermutlich deshalb nicht.“
„Sie stammt von der Insel Poel und kann schon einige Erfolge verbuchen.“
„Das ist schön für sie.“ Er neigt den Kopf nach links. „Aber was habe ich damit zu tun?“
„Na ja, ich wollte dir eigentlich nur erzählen, dass sie eine Weile an ihrem Buch arbeiten wird.“ Ich schlucke. „Bei uns.“
„Bei uns? Was soll das heißen, bei uns?“
„Hier bei uns im Haus, im Garten – wo auch immer die Muse sie küsst.“
„Und aus welchem Grund?“ Er schiebt die Augenbrauen zusammen.
„Na ja, sie hat mir davon erzählt, dass sie gern mal woanders als zu Hause schreiben möchte, um neue Impulse zu bekommen und dachte über einen Schreiburlaub in Dänemark oder so nach. Aber als wir dann darauf zu sprechen kamen, dass ich der Sohn von Constantin Fehn bin, brannte sie darauf, dich persönlich kennenzulernen.“ Ich überdenke meine Geschichte für ein paar Sekunden. „Und irgendwie kam dann eins zum anderen und ich machte ihr den Vorschlag, hier an ihrem aktuellen Manuskript zu arbeiten.“
Der Blick, mit dem er mich betrachtet, lässt keinerlei Deutung zu. Die altvertraute Gleichgültigkeit, die ihn in den letzten Monaten immer wieder überkommt und die auch in diesem Moment die Kontrolle übernimmt, ist nicht zu übersehen.
„Von mir aus“, sagt er schließlich und greift erneut nach seinem Buch, „solange es meinen Alltag nicht beeinflusst.“
Welchen Alltag?, möchte ich antworten.
Meinst du das Dahinvegetieren im Garten? Das stundenlange Zupfen von nicht mehr vorhandenem Unkraut? Das frustrierte Ins-Leere-Starren?
Wenn ich doch nur offen mit ihm darüber reden könnte, warum Emma wirklich zu uns kommt. Wenn er doch nur begreifen würde, wie sehr es mich schmerzt, ihn derart depressiv zu erleben und wie gern ich ihm helfen möchte, wieder sein altes Feuer wiederzufinden. Seine Lebensfreude, seinen Enthusiasmus.
„War sonst noch was?“, fragt er, ohne von seinem Buch aufzuschauen.
Ich zögere einen Moment.
„Sie kommt morgen früh“, antworte ich.
„Schön. Kann ich dann jetzt weiterlesen?“
Schweigend schaue ich ihm dabei zu, wie er sich mehr und mehr in den Zeilen seiner Lektüre verliert. Vielleicht ist es aber auch nur ein Vorwand, um den eigenen trüben Gedanken nachzuhängen. Wie gut erinnere ich mich daran, dass er früher keine zwei Seiten eines Buchs lesen konnte, ohne es schon kurz darauf wieder zur Seite zu legen, weil ihn der Impuls überkam, lieber an seinem eigenen Manuskript weiterzuarbeiten.
Bücher anderer Autoren zu lesen geht nie lange gut. Wenn ich lese, meldet sich sofort der Drang, lieber selbst zu schreiben.
Das war sein immer wiederkehrendes Motto. Aber wann genau hat es seine Gültigkeit verloren?
„Schlaf gut“, sage ich schließlich.
„Du auch“, murmelt er, ohne mich anzusehen.
Dann wende ich mich ab und verlasse das spärlich beleuchtete Zimmer.
Kapitel 6
Emma
Als ich die Wagentür hinter mir zuschlage und meine Reisetasche auf die Kieselsteine der riesigen Wendeschleife vor dem Haus stelle, komme ich mir für einen Moment deplatziert vor.
Der Gedanke, die nächsten vier Wochen hier zu verbringen, fühlt sich irgendwie merkwürdig an.
Die Fassade des breiten, zweistöckigen Hauses ist in einem sanften Butterblumengelb gehalten. Die Fenster, die mächtige Eingangstür und das Spitzdach in zartem Schneeweiß.
Rechts von der Eingangsfront mit der breiten Treppe führen liebevoll bepflanzte Blumenbeete durch mannshohe Hecken in einen Bereich des Grundstücks, den ich von hier aus nicht einsehen kann.
Ob ein Garten dahinterliegt? Ein Pool? Akkurat gepflegter Rasen mit breitflächigen Sitzmöglichkeiten?
Ich atme geräuschvoll aus.
Was soll schon groß passieren? Conny hat vollkommen recht: Ich kann an meinem Buch arbeiten und gleichzeitig eine Menge Geld auf einen Schlag verdienen. Wozu also die Zweifel? Ob die Vereinbarung auch für Constantin etwas bringen wird, ist am Ende schließlich nicht mein Problem.
Ich greife nach meiner Tasche, mache den Rücken gerade und gehe mit zielstrebigen Schritten auf das Anwesen zu. Erst, als ich näherkomme, fällt mir der Mann auf, der in einem der Blumenbeete neben der Treppe kniet.
„Hallo“, begrüße ich ihn freundlich, in der Annahme, den Gärtner vor mir zu haben.
Als er jedoch aufschaut, wird mir klar, dass ich Constantin Fehn höchstpersönlich gegenüberstehe. In seiner verwaschenen Latzhose und dem blassgrünen T-Shirt wirkt er beinahe unscheinbar. Er ist schlanker als auf den Fotos, die man von ihm kennt. Das Gesicht wirkt eingefallen. Das dunkle Haar mit den grauen Schläfen reicht ihm strukturlos bis zum Kinn, an dem ein graumelierter Vollbart prangt.
„Guten Morgen.“ Er hebt die Hand zum Gruß. „Du musst Emma sein.“
Augenblicklich erinnere ich mich an Marlons Hinweis über Constantins Siez-Allergie. Trotzdem fühlt es sich seltsam an, von einem der berühmtesten Autoren Deutschlands geduzt zu werden.
„Die bin ich.“ Ich spüre, wie meine Wangen warm werden.
„Freut mich.“ Er senkt den Blick wieder ins Blumenbeet und widmet sich einem besonders festsitzenden Löwenzahn. „Bitte entschuldige, dass ich dir nicht die Hand gebe, aber ich würde dich nur schmutzig machen.“
Eine Weile stehe ich einfach nur da, hin- und hergerissen zwischen dem Drang, auf eine weitere Reaktion von ihm zu warten oder einfach die Treppe hinaufzugehen, um zu schauen, ob Marlon zu Hause ist.
Genau in diesem Moment öffnet sich die Haustür und wie aufs Stichwort kommt er die breiten Stufen hinuntergelaufen.
„Emma.“ Er strahlt über das ganze Gesicht. „Da bist du ja endlich.“
Er scheint es eilig mit der Begrüßung zu haben. Eine Eile, die mich etwas irritiert.
„Schön, dass du da bist.“ Er zieht mich für eine flüchtige Umarmung zu sich heran, die mich nur noch mehr verwirrt.
„Meinen Vater hast du ja bereits kennengelernt, wie ich sehe.“ Er lächelt leicht verunsichert zu Constantin herüber, der allerdings noch immer keine Anstalten macht, sich aus dem Blumenbeet zu erheben.
„Ja.“ Ich ringe mir ein Lächeln ab, um meine Unsicherheit zu überspielen.
„Gut.“ Er legt die Hand an meine Schulter. „Wenn du nichts dagegen hast, würde ich dich gern kurz mit reinnehmen, um dir dein Zimmer zu zeigen.“ Er nimmt mir meine Tasche ab. „Alles andere klären wir dann später, okay?“
„Gern.“ Ich werfe erneut einen Blick zu Constantin, doch der scheint bereits vergessen zu haben, dass wir überhaupt da sind. Schließlich folge ich Marlon ins Haus, sorgsam darum bemüht, das negative Gefühl zu verdrängen, dass mich seit meiner Ankunft verfolgt.
Als er die Haustür hinter uns schließt, kann ich mich jedoch nicht zurückhalten.
„Und du bist dir sicher, dass dein Vater damit einverstanden ist, dass ich hier bin?“ Ich schaue ihn erwartungsvoll an.
„Also, was das angeht“, er stellt meine Tasche auf den Parkettboden, „wollte ich noch mit dir reden.“ Er kratzt sich an der Stirn, sichtlich darum bemüht, die richtigen Worte zu finden.
Ich lasse einen flüchtigen Blick durch den Eingangsbereich des Hauses wandern. Dunkle Holzverkleidungen an den Wänden, eine kleine Sitztruhe mit meerblauem Polster neben dem Treppensims.
„Weißt du, was meinen Vater betrifft, war ein bisschen ... na ja ... Erfindungsgeschick erforderlich.“
„Erfindungsgeschick?“
„Eine kleine Notlüge sozusagen.“ Er lächelt gequält.
Eine unangenehme Ahnung überkommt mich. „Was soll das heißen?“
„Du musst wissen, dass er sehr dickköpfig ist. Das war er auch früher schon, aber da machte das irgendwie auch seinen Charme aus. Aber seitdem er sich in dieser Schreibkrise befindet, ist es noch schwieriger, an ihn heranzukommen. Er will einfach keinerlei Hilfe annehmen und auch nicht wahrhaben, wie schlecht es ihm geht und wie sehr er sich verändert hat.“
„Und was genau hast du ihm nun über mich gesagt?“
„Na ja“, er zuckt mit den Schultern, „ich habe ihm gesagt, dass du beeindruckt von der Tatsache warst, dass ich sein Sohn bin. Dass du ihn bewunderst und ...“, er beißt sich auf die Unterlippe, „und dass du eigentlich einen Schreiburlaub in Dänemark buchen wolltest, um neue Impulse für dein aktuelles Manuskript zu finden. Aber stattdessen ...“ Er stockt.
„Stattdessen?“ Ich verschränke die Arme vor der Brust.
„Stattdessen habe ich dir vorgeschlagen, deinen Schreiburlaub hier zu verbringen. Auch, damit du meinen Vater persönlich kennenlernen kannst.“
„Das hast du ihm gesagt?“ Ich starre ihn mit offenem Mund an. „Aber du hast doch geschrieben, dass er Bescheid weiß und alles auch in seinem Sinne ist.“
„Ich weiß, aber ...“
„Aber was?“
„Na ja, ich war einfach so froh, dass du dich nun doch noch umentschieden hast. Da musste ich halt zu einem kleinen Trick greifen.“ Er hebt den Zeigefinger. „Ein Trick, der übrigens mit den besten Absichten geschah. Denn ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass du ihm wirklich helfen kannst.“
„Wie soll ich jemandem helfen, der meine Hilfe gar nicht will?“ Wütend trete ich einen Schritt näher. „Das ist doch absolut unlogisch.“
„Ich weiß, es ist nicht optimal, aber wenn wir nur ein bisschen ...“
„Nicht optimal?“ Ich lache zynisch auf. „Na, das ist aber noch stark untertrieben.“ Ich gehe zu meiner Tasche. „Ich glaube, unter diesen Umständen ist es echt besser, wenn ich wieder gehe. Hat ja doch alles keinen Sinn.“
„Nein, nicht!“ Er legt die Hand um meine, um mir die Tasche wieder abzunehmen.
Für den Bruchteil einer Sekunde senke ich den Blick auf seine Finger, die meine umschließen. Ein seltsamer Moment, der mich kurz vergessen lässt, worüber ich mich eben gerade noch geärgert habe. Doch die Wut braucht nicht lange, um sich wieder in mir auszubreiten.
„Wirklich, Marlon, wenn wir schon mit einer Lüge anfangen, kann das alles nur schiefgehen.“
„Ich bin ja auch dafür, sich möglichst an die Wahrheit zu halten, aber in diesem Fall ...“ Endlich gelingt es ihm, mir die Tasche abzunehmen. „Na schön. Du willst die Wahrheit wissen?“
„Das wäre zur Abwechslung mal ganz nett, ja.“ Ich stemme die Hände in die Hüften.
Er holt tief Luft. „Die Wahrheit ist, dass ich mir große Sorgen um meinen Vater mache. Sehr große. Er blockt jede Hilfe, jede Therapie ab und verkriecht sich von Tag zu Tag mehr in seinem eigenen imaginären Schneckenhaus. Er ist gerade mal Mitte Fünfzig und für den Ruhestand ist es viel zu früh, jedenfalls für einen leidenschaftlichen Menschen wie ihn. Er geht kaputt an der Lethargie, das merke ich jeden Tag aufs Neue.“
„Das tut mir sehr leid, aber so traurig es auch ist, man kann ihn zu nichts zwingen. Und ich schon gar nicht, immerhin bin ich eine vollkommen Fremde für ihn.“
„Aber genau das ist es ja: Ich glaube, dass eine außenstehende Person vielleicht genau die richtige für das Problem ist.“ In seiner Stimme liegt ein Hauch von Verzweiflung. „Ich habe einfach Angst, dass er irgendwann so tief in seinem Seelentief steckt, dass er nicht wieder herauskommt. Wann immer ich denke, dass er sich mal ernsthaft für etwas interessiert oder an etwas erfreuen kann, verlieren seine Augen nur wenig später wieder ihren Glanz. Es ist so ... so ...“, er lässt die Arme sinken, „...frustrierend.“
Die Mutlosigkeit ist ihm deutlich anzumerken.
„Du scheinst dich sehr für ihn verantwortlich zu fühlen“, stelle ich in mitfühlendem Tonfall fest.
„Na ja, seit Mutters Tod damals stehen wir uns noch näher als vorher. Wir sind eine Familie und ich will nur, dass er glücklich ist.“ Er setzt sich auf die Sitztruhe neben der Treppe. „Ich meine, wenn ich wüsste, dass ihn die Gartenarbeit und das stundenlange Ins-Leere-Starren glücklich machen würde, wäre es vollkommen okay für mich. Dann wäre das eben sein neues Ich. Aber ich spüre ja, wie unglücklich er über seine eigene Unfähigkeit ist, das zu tun, was er über alles liebt.“
„Und du hast keine Ahnung, was ihn in diesen Zustand gebracht hat?“
Meine Frage scheint ihn aus dem Konzept zu bringen. Täusche ich mich oder ist er gerade zusammengezuckt? War meine Frage zu indiskret?
*
Marlon
Ihre Frage trifft mich unerwartet. Wie von selbst wandern meine Gedanken zu Amelie und bescheren mir die altvertraute Schwermut.
Warum habe ich das alles damals nicht kommen sehen? Wie konnte ich die Lage nur so falsch einschätzen?
„Alles in Ordnung?“, fragt sie.
„Ja.“ Ich lege die Hände in den Schoß. „Alles in Ordnung.“
„Ich wollte keine indiskrete Frage stellen“, erklärt sie.
„Schon okay.“ Ich mache eine wegwerfende Handbewegung. „Die Wahrheit ist, dass ich es nicht weiß.“ Ich bemühe mich um einen möglichst unverfänglichen Gesichtsausdruck. „Ich habe mich oft gefragt, wie es so weit kommen konnte, aber egal, wie ich es drehe und wende, ich komme immer wieder zu demselben Schluss: Dass das Schreiben das Einzige ist, das meinen Vater wieder glücklich machen kann.“
Meine Worte lassen sie offensichtlich nicht unberührt.
Nach einem kurzen Zögern setzt sie sich neben mich.
„Das alles tut mir wirklich sehr leid“, sagt sie. „Aber wie gesagt, ich kann niemandem helfen, der meine Hilfe gar nicht will. Das ... das ergibt einfach keinen Sinn.“
Für einen Moment sehen wir uns auf eine Weise an, die sich nur schwer in Worte fassen lässt. Irgendetwas liegt in ihren Augen, das mich für eine Weile vergessen lässt, worüber wir gerade eben noch gesprochen haben.
„Du strahlst so viel Lebensfreude aus“, sage ich schließlich. „Schon allein, mit wie viel Begeisterung du über deinen Job sprichst. Ich glaube einfach, dass du meinem Vater guttun würdest. Ganz allein durch deine Anwesenheit.“
„Selbst, wenn es so wäre“, sie seufzt schwermütig, „sobald er die Wahrheit erfahren würde, hätte sich das alles doch sowieso erledigt.“
„Aber muss er die Wahrheit denn überhaupt erfahren?“ Ich werfe ihr einen unschuldigen Blick zu. „Ich meine, wenn du nur ein klein wenig mitspielen würdest, könnten wir ...“
„Vergiss es, okay?“ Sie hebt die Hände. „Ich werde einen Mann wie Constantin Fehn ganz sicher nicht verarschen.“
„Aber wir verarschen ihn doch gar nicht. Wir versuchen einfach nur, ihm zu helfen. Und wenn es nur auf diese Weise geht, dann muss man eben Kompromisse machen. Mir gefällt das genauso wenig, aber wenn das Ergebnis am Ende stimmt, nehme ich das gern in Kauf.“
„Das mag für dich in Ordnung sein, aber ich bin eine ehrliche Haut.“ Sie steht auf. „Abgesehen davon kann ich sowieso nicht lügen.“