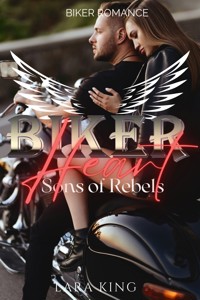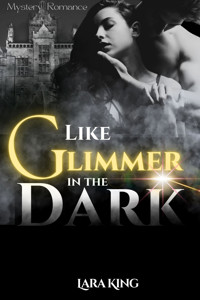
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dunkle Geheimnisse. Verlorene Erinnerungen. Eine Wahrheit, die alles verändert ...
„Im zarten Alter von acht Jahren habe ich meinen Vater getötet. So sagt man es mir. So glaube ich es selbst. Doch tief in mir spüre ich, dass etwas nicht stimmt ...“
Seit sechzehn Jahren lebt die Bailey mit der Schuld, in jener Nacht ihren Vater getötet zu haben. Ihre Erinnerungen sind lückenhaft, verdrängt – doch die Schatten der Vergangenheit lassen sie nie los. Als sie vor ihrem gewalttätigen Ex-Freund flieht, scheint eine mysteriöse Einladung ins Château de Vil die perfekte Gelegenheit, unterzutauchen.
Doch in dem alten Schloss lauern mehr als nur die Gespenster der Vergangenheit. Lucien L’Enfer, der geheimnisvolle Hausherr, beobachtet Bailey mit einer Intensität, die ihr eiskalte Schauer über den Rücken jagt. Und dann begegnet sie ihm – Mathis.
Den Mann, den sie einst über alles geliebt hat.
Den sie verlassen hat.
Und sich geschworen hat, ihn nie wiederzusehen, koste es, was es wolle.
Und es hat sie verdammt viel gekostet.
Doch Mathis ist anders. Fremd. Unnahbar. Als ob ein Teil von ihm nicht mehr existiert. Mit jeder Nacht, die Bailey im Schloss verbringt, beginnen sich die Fäden der Realität aufzulösen. Und während sie verzweifelt nach der Wahrheit sucht, droht sie eine Entdeckung zu machen, die sie nie für möglich gehalten hätte.
Ist ein Schimmer Licht genug, um die Dunkelheit zu durchbrechen? Oder wird sie selbst darin verschwinden?
Ein fesselnder Mystery-Romance-Thriller voller düsterer Geheimnisse, unerwarteter Wendungen und einer Liebe, die selbst das Unmögliche herausfordert.
In sich abgeschlossen – ohne Cliffhanger, aber mit einem außergewöhnlichen Happy End!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
LIKE GLIMMER IN THE DARK
Thriller Romance mit Mystery Vibes
Lara King
Impressum
LIKE GLIMMER IN THE DARK
Copyright © Lara King, 2024
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung der Verfasserin weitergegeben werden.
Verfasserin:
S. Bauer, Schönblickstraße 12, 97286 Sommerhausen
Direktkontakt: [email protected]
Die in diesem Buch dargestellten Figuren und Ereignisse sind fiktiv. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder toten realen Personen ist zufällige, sowie eine unbeabsichtigte Gemeinsamkeit mit existierenden Geschichten nicht vom Autor gewollt oder bewusst erzielt!
Die Macht der Worte ...
Eine unglaubliche Magie, die schimmernde Fäden auswirft, um Leser und Autoren zu vereinen.
Eine Kraft, die Geschichten zum Leben erweckt, weil sie in Welten entführt, in denen Gefühle wie Hoffnung, Liebe und die Macht der Freundschaft uns atemlos machen und uns Herzklopfen bescheren ...
DEEP LOVE – DARK PASSION – HOT ROMANCE
Wir alle suchen nach dem Einen.
Dem einen Menschen, der unser Herz berührt, unseren Atem raubt, unsere geheime Lust befeuert und uns auffängt, wenn wir dabei sind zu zersplittern. Wenn das Schicksal uns nur nicht immer einen Strich durch die Rechnung machen würde ...
Meine Geschichten sollen eine kleine Flucht aus dem Alltag sein.
Eine kurze Zeit werden wir zusammen Hand in Hand auf eine verträumte Reise gehen und ich freue mich über jeden Einzelnen, der mich dabei begleitet. Über jemanden, der sich entführen lässt, um sich nach dieser Auszeit wieder gestärkt in den Alltag zu stürzen.
Ohne all die Geschichten über die große, bedingungslose Liebe wäre unser Leben öde. Und hinter jeden Ecke könnte DER oder DIE eine auf uns warten.
Ich jedenfalls glaube fest daran!
Love,
Lara
~Inhalt~
Im zarten Mädchenalter von acht Jahren habe ich meinen Vater getötet.
Kaum jemand kennt mittlerweile noch meinen echten Namen. Und das ist gut so. Denn ich bin auf der Flucht. Auf der Flucht nicht nur vor meinem brutalen Ex Gregor Medschew, sondern auch vor dem, was ich als Kind einst getan habe. Denn ich habe meinen Vater nicht nur getötet. Sonder zerfetzt. Mit einem Messer.
Angeblich in Notwehr, doch tief in meinem Inneren, gut versteckt in undurchdringlicher Dunkelheit, bewacht von grauenhaften Monstern, weiß ich es besser.
Jetzt hoffe ich, ich kann mich kurz ausruhen. Wäre wenigstens ein Wochenende lang in Sicherheit und würde Inspirationen sammeln für einen neuen Roman, um mich weiterhin über Wasser halten zu können. Hier in diesem seltsamen Chấteau de Vil, wohin ich mich aufgrund der mysteriösen Einladung zu einem Autorenseminar flüchte, soll meine Schreibblockade ein Ende finden.
Doch Monster lauern überall. Vor allem in einem selbst.
Und dort auf dem Schloss beginnt ein Albtraum, der mich tief in meine Vergangenheit schleudert. Und nach und nach ein viel schrecklicheres Geheimnis offenbart, als meine Erinnerung an diese grauenvolle Nacht vor 16 Jahren.
Etwas so Unglaubliches, dass ich bereit bin, den allerletzten Schritt in die Dunkelheit zu gehen und mich meinem Vermächtnis zu stellen.
Wäre da nicht Mathis ...
Aber ist ein Schimmer genug, um das Verhängnis zu brechen und das Böse zu besiegen?
Inhaltsverzeichnis
Impressum
~Prolog~
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Weitere Romane von Lara King
~Prolog~
~Wenn die Masken fallen sollen, sei bereit, tief in die Dunkelheit zu gehen ...~
Die plötzliche Stille dröhnt in meinen Ohren.
Das Licht des Vollmonds hüllt unser Wohnzimmer in fahle Schatten. Grau in Grau. Dunkles Schwarz lauert dahinter. Wartet nur darauf, dass ich die Monster darin anerkenne, doch mein starrer Blick reißt sich endlich los und wandert nach oben. Ich sehe zwei meiner Geburtstagsballons, die sanft an der Decke schweben. Alle anderen sind zerplatzt, doch diese beiden, diese letzten, drehen sich im Luftzug des halb geöffneten Fensters. Wiegen sich sanft hin und her und der Clown auf dem einen von ihnen grinst mich fröhlich an.
Einen kurzen Augenblick nur kann ich der Fratze standhalten, dann sehe ich schnell zurück auf den Boden. Mein zerfetztes Höschen hebt sich hell von dem dunklen Holzboden ab. Fest presse ich meinen Rücken an die Wand hinter mir.Happy Birthday, Lyciella Morgana. Alles Gute zum achten Geburtstag.
Der Blick meines Vaters brennt sich in mich. Im letzten Kampf sehen seine Augen mich an. Eine Anklage darin, ein Tadel, der mir den Atem raubt. Mein Herz klopft hart. So hart wie das große Messer, das ich immer noch fest umklammert in meiner Hand halte. Kalt. Mir ist so kalt. Und obwohl ich erst acht Jahre alt bin, weiß ich, dass nichts mehr meinen Vater retten kann. Dafür beißt sich der kupfrige Geruch von Blut, vermischt mit Schlimmeren, zu sehr in meine Nase.
„Oh, mein Gott!“
Den angstvollen Schrei meiner Mutter höre ich, doch er erreicht mich nicht. Vollkommen versteinert bleibe ich dort im Mondlicht auf dem Boden sitzen. Mein kleiner Körper weigert sich, irgendeine Regung zu zeigen.
„Lyciella? Lyciella Morgana! Was ist passiert?“ Sie kniet sich vor mich. Nur ein weiterer dunkler Schatten, der mich verschlingen will und innerlich weiche ich voller Panik zurück, auch wenn mein Körper sich wie eine steinerne Statue weigert, meinem Instinkt zu folgen, stur und starr einfach sitzen bleibt und in die Augen meines Vaters sieht, die langsam trüb werden. So viel Schmerz steht in ihnen. So viel Dunkelheit. Und beides kriecht wie schwarze Spinnen in mich hinein.
Die Hände meiner Mutter umfassen mein Gesicht. Liebevolle Hände, und doch will ich schreien. So laut schreien, weil es sich anfühlt, als würden aus ihren Fingern noch mehr dieser kleinen Spinnen krabbeln, die sich in meine Haut beißen.
Mit einem heftigen Ruck hebe ich das Messer. Es stoppt kurz vor ihrer Kehle und mit einem angstvollen Keuchen wirft sich meine Mutter zurück. Sie stolpert rückwärts, fällt hin und presst panisch eine Hand vor ihren Mund. In ihren Augen ein Grauen, das sich längst tief in mich eingegraben hat. Meine Hand fällt kraftlos nach unten, das Messer, glitschig von all dem Blut, kullert endlich mit einem leisen Poltern auf den Holzboden.
Schwer wie klebriger Teer höre ich die letzten angestrengten Atemzüge meines Vaters, den meine Mutter noch nicht entdeckt hat. Entsetzt sieht sie stattdessen mich an. Zögernd streckt sie eine Hand nach mir aus. Scheint jetzt erst zu registrieren, was an ihrer eigenen Hand klebt, weil sie mein Gesicht umfasst hat. Das, was sich immer noch wie blutige Tränen über meine Wangen zieht. Dunkel ist es, was sich über ihre bleichen Finger gelegt hat. Im Licht des Vollmonds sieht es schwarz aus.
Rot wie Blut, schwarz wie Ebenholz ..., denke ich, weil mein Vater mir erst heute Abend auf mein Drängen das Schneewittchenmärchen vorgelesen hat, während meine Mutter sich auf den Weg zu ihrem Job als Putzfrau in irgendeinem Bürokomplex machte.
Happy Birthday, Lyciella Morgana. Alles Gute zum achten Geburtstag ...
Die Worte Rot wie Blut Rotwieblutrotwieblut drehen sich schneller und schneller und schneller in meinem Kopf. Werden mit jeder Drehung dunkler und dunkler, bis ein Strudel entsteht, der mich endgültig in einen bodenlosen Abgrund zu zerren scheint. Hart. So hart meine Arme. Meine Beine. Es fühlt sich an, als würde mein kleiner Körper jeden Moment zerspringen. Und ich will nichts mehr, wünsche mir mit aller Kraft nichts mehr als dieses Zerspringen, damit es endlich aufhört. Denn es ist nichts im Vergleich zu dem, was gerade in mir tobt. Dem, was ich nicht beschreiben, nicht fassen kann.
Ich will meine Mutter nicht ansehen. Kann nicht anders, als in die Augen meines sterbenden Vaters zu sehen, dessen Körper voller Blut ist. Wie bleiche Würmer haben sich seine Gedärme über dem dunklen Boden ausgebreitet und ich will meine Hände waschen. Will sie waschen und schrubben, will all das nur wegwaschen, was passiert ist, und kann mich dennoch nicht rühren, weil ich tief in meinem Inneren einfach weiß, dass es sinnlos ist. Mein Nachthemd ist zerrissen. Blut, überall ist Blut und doch ist das, was in mir tobt, so gewaltig, dass es jeden körperlichen Schmerz überkreischt. Der körperliche Schmerz ist mir sowieso egal. Die Augen meines Vaters, die sich mit letzter Kraft in mich brennen, sind mir nicht egal.
Meine Mutter schiebt sich vorsichtig zurück. Grenzenloser Horror steht auf ihrem Gesicht und sie weicht vor mir zurück, überlässt mich der Dunkelheit, die ihre trügerischen Klauen in mich schlägt. Und stolpert dabei über den Körper meines Vaters.
Ich habe Angst. Große Angst. So große Angst, dass mein Herz schlottert. Zittert und leise weint, weil diese Dunkelheit mir Angst macht. Meine Mutter mir Angst macht. Der zerfetzte Körper meines Vaters, dessen totgeweihte Augen mich anstarren, mich anklagen, mir Angst macht. Weil es meine Schuld ist.
„Ben? NEIN!“ Der Schrei meiner Mutter, als sie sich von mir abwendet, weinend und voll entsetzter Verzweiflung über meinen sterbenden Vater zusammenbricht, klingelt in meinen Ohren.
Nein!Neinneinneinneinneinnein, wiederholen meine Gedanken und die Worte drehen sich schneller und schneller und schneller in meinem Kopf. Vermischen sich mit dem Rot wie Blut, schwarz wie Ebenholz bis der Wirbel so schnell und dunkel ist, dass mir übel wird. Mir ist kalt. Eisigkalt.
Meine Hände tasten wie von selbst nach der Puppe, die ich aus meinem Zimmer mitgenommen habe. Ich will mich nur festhalten in diesem schlimmen, finsteren, kalten Strudel. Will mich festkrallen an diesem Spielzeug, das mir Halt gibt. Meine Mutter hat mir die Puppe genäht. Hat sie mit derselben liebevollen Art genäht, wie sie mir jeden Morgen die Haare kämmt. Mit einer Zärtlichkeit, die mich innerlich zurückschrecken lässt, weil sie sich nicht echt anfühlt, sondern seltsam. Seltsam verhalten, aber ich kenne meine Mutter nicht anders. Glaubte, es wäre normal. Schließlich hat sie mich immer in den Arm genommen. Mich geherzt. Und dennoch spürte ich immer eine leichte Zurückhaltung in ihr. Es fühlte sich einfach nicht echt an. Vielleicht hat sie schon immer gewusst, dass ein Monster in mir schlummert. Ein Monster, das sich jetzt befreit hat.
Fest presse ich Tinka, meine Puppe, an meine Brust. Ich möchte weinen. Will es so sehr, will diesen messerscharfen Schmerz in mir mit Tränen wegspülen, denn dann wird alles wieder gut, oder? Doch jeder Atemzug schmerzt und nur diese Dunkelheit in meinen Gedanken lindert langsam die Pein. Aus Tinkas Rücken quillt weiche Watte hervor. Genauso, wie diese vernichtende Panik aus jeder Faser meines Körpers herausquellen will. Mir ist, als würde nichts mehr mich zusammenhalten. Meine Zähne klappern derart hart, dass ich das Gefühl habe, auch sie würden jeden Moment einfach zerbersten.
Ich drücke Tinka so fest an meine Brust, wie meine Zähne aufeinanderschlagen. Spüre etwas Hartes in ihr und einen winzigen Augenblick lang fühle ich mich getröstet, denn dieses Harte fühle ich auch in mir.
Langsam beginne ich, mich vor und zurück zu wiegen. Will Tinka wiegen, das Harte in ihr beruhigen, das wie ein Orkan in mir selbst tobt. Vor und zurück, vor und zurück wiege ich mich, vor und zurück.
Die röchelnden Atemzüge meines Papas übertönen sogar das Weinen meiner Mutter.
„Hure!“, stößt er mit letzter Kraft hervor. Seine Hand krallt sich um das Handgelenk meiner Mutter und er zieht sie zu sich herunter. „Hure des Teufels!“
Ich höre sein Flüstern genau, obwohl ich so laut schreien will, dass einfach alles explodiert. Mich genauso entzweireißt, wie die Welt um mich herum. Doch kein Laut verlässt meinen Mund. Stattdessen starre ich in die jetzt toten Augen meines Vaters, die anklagend auf mich gerichtet sind, und wiege mich vor und zurück. Heiße die Dunkelheit willkommen, die sich wie düstere Zuckerwatte über den Orkan in meinem Inneren legt und mir verspricht, dass ich all das, was in dieser Nacht passiert ist, tief in der Dunkelheit vergraben kann. Ich wiege mich vor und zurück. Presse Tinka fest an mich, damit sie mir in dieser wirbelnden, grauenvollen Dunkelheit Halt gibt. Ich reiße meinen Blick von dem meines Papas los und sehe nach oben. Auf meine Geburtstagsballons. Die grinsende Fratze des Clowns ist immer noch da, doch jetzt dreht sich auch tanzend der andere, während meine Mutter schreit und weint.
Ein goldener Schmetterling ist auf den anderen Ballon gedruckt und ich träume, dass er seine Flügel ausbreitet und mich einfach aus diesem Grauen herausträgt. Mich befreit. Mich mit sich nimmt. Doch er dreht sich weg und ich will ihm zurufen, dass er hierbleiben soll, aber alles, was mir bleibt, ist die Realität in dem Entsetzen meiner Mutter.
„Lyciella! Was hast du getan?“
Mein Name ist Lyciella Morgana Schwarz. Ich bin acht Jahre alt. Und ich habe gerade meinen Vater getötet.
***
„Körperlich geht es ihr unter diesen Umständen gut. Sie hat ein paar schlimme Prellungen. Quetschungen, die darauf hinweisen ...“ Die männliche Stimme verklingt. Ich sitze im Schneidersitz auf der Untersuchungsliege und starre aus dem Fenster. Strahlender Sonnenschein lässt die dichtbelaubten Bäume vor dem Fenster der Arztpraxis glänzen. Ein helles, einladendes Grün.
Vor und zurück, vor und zurück wiege ich mich. Tinka fest an die Brust meines kleinen Körpers gepresst. Mir ist kalt. So kalt.
„Worauf weist was hin?“, hakt meine Mutter mit schriller Stimme nach. „Wollen Sie etwa sagen, dass mein Mann, ihr Vater, sie ...“ Sie bricht ab. Ihre Worte gleiten an mir vorbei.
„Dazu kam es wohl zum Glück nicht.“ Ich spüre den Blick des Arztes auf mir.
Nicht hinsehen, nur nicht hinsehen. Manche Menschen werden zu Monstern, wenn man ihnen zu lange in die Augen sieht!, flüstert die Dunkelheit in mir, bis sie sich wieder an den Rand meines Bewusstseins zurückzieht.
Vor und zurück, vor und zurück wiege ich mich. Halte Tinka fest im Arm und beschütze meine kleine Puppe. Spüre, dass es das Einzige, das Letzte ist, das mich hält. Tinka beschützen. Alles, was ich will, ist, Tinka beschützen. Ein tiefer Seufzer des Arztes, den ich ebenfalls ausblende.
„Ihre Tochter hat starke Hämatome an der Innenseite ihrer Oberschenkel. Mehrere Prellungen am ganzen Körper. Vor allem an den Handgelenken.“
Meine Ohren registrieren das Rascheln von Papier. „Eine Frage noch, Frau Schwarz. Hat ihr Mann an diesem Abend Handschuhe getragen?“
„Wie bitte?“
„Handschuhe. Tut mir leid, aber die Abdrücke ihrer Verletzungen sind relativ unspezifisch.“
„Warum - ? Ich verstehe nicht. Warum fragen Sie Lyciella nicht selbst?“
Die Blätter dort draußen wiegen sich im Wind. Tanzen wie zu einer sanften Melodie und ich konzentriere mich darauf diesem Lied, zu dem sie wirbeln, zu lauschen.
„Sie steht noch unter Schock. Aber so wie es aussieht, hat sie in Notwehr gehandelt.“
„Sie ist acht Jahre alt! Und hat ihren eigenen Vater regelrecht ...“ Ihre Stimme bebt, bricht ab, ohne den Satz zu vollenden. Ich will die Augen schließen, weiß aber, dass ich dann nur erneut herausquellende Därme aus dem einst warmen Körper meines Papas sehen werde. Blut überall Blut. Schwarz im Schein des Mondlichts. Die Blätter dort draußen sind schön. Der Sonnenschein blendet mich.
Ich bin acht Jahre alt. Erst seit kurzem. Und ich spüre noch immer das glitschige Blut auf mir.
Vor und zurück, vor und zurück wiege ich mich.
Tinkas weicher Körper spendet mir eine Wärme, an der ich mich festhalte. Mit den Daumen drücke ich auf das kleine harte Etwas in ihr und es beruhigt mich ein wenig. Ebenso wie die Dunkelheit, die sich wie Zuckerwatte über all das gelegt hat, was an diesem Abend passiert ist.
„Ist es denn bewiesen, dass sie es getan hat?“ Der Arzt hat eine schöne, ruhige Stimme, doch Stimmen können lügen.
„Es befanden sich nur ihre Fingerabdrücke auf dem Messer.“ Die Stimme meiner Mutter ist auch schön. Aber etwas Schrilles schwingt darin und die Blätter der Bäume stocken in ihrem Tanz.
„Wird sie jemals wieder – normal?“, flüstert meine Mutter. Ihre Worte dröhnen in meinen Ohren.
Normalnormalnormalnormal, wirbeln meine Gedanken. Rot wie Blut, schwarz wie Ebenholz ... neinneinneinneinnein!!!
„Was hat sie denn vorher gerne gemacht? Irgendetwas, woran sie Spaß hatte? Ich bin kein Psychologe, Frau Schwarz, aber vielleicht sollten Sie Ihrer Tochter eine Beschäftigung geben, die sie kennt und liebt? Etwas, dem sie vertraut.“
„Sie hat gerne getanzt. Und sie liebt klassische Musik.“ Ich spüre den verhaltenen Blick meiner Mutter.
„Dann bringen Sie sie zum Ballett, sobald es ihr etwas besser geht. Wenn es möglich ist, lassen Sie sie Stunden nehmen. Ich werden Ihnen auch einen Psychologen empfehlen, der sich sowieso Ihrer Tochter annehmen sollte.“
Ich konzentriere mich weiter auf die Blätter der Bäume vor dem Fenster. Höre die Melodie des Windes und wiege mich mit ihnen.
Tanztanztantztanztanz ...
Ich spüre, dass meine Mutter das Untersuchungszimmer verlassen hat. Und versteife mich innerlich, als der Arzt zu mir tritt und mich anspricht. „Lyciella?“
Vor und zurück, vor und zurück tanze ich ...
Meinen Blick fest auf die Bäume gerichtet, bis sich aus ihnen eine dämonische Fratze bildet, deren Anblick ich nie vergessen werde. Meine Finger krallen sich in Tinka.
„Ich will dir nur etwas schenken, Lyciella.“ Die Stimme ist leise. Dunkel und beruhigend. „Es ist nur ein Block. Nicht mehr als ein Heft, aber manchmal ...“ Er zögert. „Manchmal ist es ganz gut die Dinge, die sich in einem abspielen aufzuschreiben. Oder zu malen.“
Ich presse Tinka noch fester an mich. Neinneinneinnein!
„Man kann sich auch schöne Geschichten ausdenken. Geschichten, die die Fantasie beflügeln und einem eine Zeitlang ein warmes, hoffnungsvolles Gefühl geben. Es liegt ganz allein bei dir.“
Ich höre die Tür zuklappen, als auch er das Zimmer verlässt. Und sehe auf den kleinen Spiralblock, den er in meine Nähe gelegt hat. Ich schnappe ihn mir und presse ihn dann zusammen mit Tinka an meine Brust. Warm und hoffnungsvoll klingt besser als das, was mit dämonischen Fratzen in mir tanzt.
Kapitel 1
Regel Nummer 1:
Nimm dich vor der Dunkelheit in Acht, denn ihr Schutz ist nur eine Lüge ...
~16 Jahre später~
Seit Stunden regnet es schon. Das schnelle Wischen der Scheibenwischer, mit dem Geräusch eines hypnotisierenden Metronoms, vermischt sich mit dem monotonen Prasseln auf das Wagendach und verstärkt meine Müdigkeit. Obwohl ich so langsam fahre, dass ein Lastwagen hinter mir hupt, um meinen kleinen, alten Twingo dann mit Schwung zu überholen, erkenne ich nichts von der Landschaft rings um mich. Der eisige Regen ist so dicht, dass meine Augen brennen. Wie durch einen nebelhaften Schleier kann ich gerade noch so das graue, endlos wirkende Band der Straße erahnen, die mich geradewegs ins Nirgendwo führt.
Riva, meine Golden Retriever Mischlingshündin hat sich auf dem Beifahrersitz zusammengerollt und schläft. Wenigstens eine von uns, die eine entspannte Fahrt genießt.
„Verräterin!“, murmle ich, dann starre ich wieder durch die angelaufene Windschutzscheibe in der Hoffnung, nicht mehr allzu lange durchhalten zu müssen.
„Fuck. Ist das schon wieder ein Kreisverkehr? Den hat die Navi-App gar nicht angezeigt!“
Gereizt, weil ich übermüdet bin, weil ich über 14 Stunden nur mit kurzen Pausen fast durchgefahren bin, streiche ich mit einer Hand meine kinnlangen, dunklen Haare zurück. Selbst nach drei Monaten bin ich immer noch jedes Mal überrascht, wie kurz sie jetzt sind. Wie schnell meine Finger durch Leere streifen, weil meine Haare vorher länger waren. Viel länger.
Und jetzt?
Auf der einsamen Landstraße bin ich allein unterwegs. Der Lastwagen hat sich trotz des strömenden Regens längst davongemacht und hier ist weit und breit nichts. Ein nasses, trostloses, eiskaltes, einsames, unheimliches, düsteres Nichts.
Mit einem Seufzen lenke ich meinen Wagen an den Straßenrand und halte an, um nach meinem Handy zu kramen und nachzusehen, ob ich mich nicht bereits heillos verfahren habe.
Der Bildschirm leuchtet auf. Anscheinend befinde ich mich kurz vor meinem Ziel, doch bevor ich mir die restliche Strecke genauer ansehen kann, erlischt der Screen. Mein Handy ist tot.
„Gott!“ Frustriert lasse ich meinen Kopf gegen die Nackenstütze fallen. Lausche einen Moment dem nervigen Klacken der Autoheizung, die sich gegen die eisignasse Kälte nicht durchsetzen kann, und starre durch die laufenden Scheibenwischer nach draußen.
Häuser? Sind das Häuser da vorne? Ein Dorf vielleicht?
Nur schemenhaft sehe ich dunkle Umrisse und schöpfe neue Hoffnung. Ohne Anleitung finde ich das Schloss nie. Mir bleibt nichts anderes übrig, als meine spärlichen Französischkenntnisse aus den Tiefen meines Gedächtnisses zu graben, um jemanden nach dem Weg zu fragen.
Kurze Zeit später parke ich vor eine Bäckerei. Boulangerie steht in schön geschwungenen Buchstaben über dem warm erleuchteten Schaufenster des rustikalen Steinhauses. Luftige Baisers, bunte Macarons und sahnige Eclairs springen mich durch die Scheibe regelrecht an und lassen meinen Magen laut knurren.
„Du spielst jetzt Wachhund, Riva!“, erkläre ich meiner Hündin, die sich gerade aufrichtet und aussieht, als würde sie sich am liebsten verwundert die Augen reiben. „Bewache unseren Besitz, oh holde Wächterin!“
Riva sieht mich an und ich schwöre, sie zieht eine Augenbraue hoch, als wolle sie mir zu verstehen geben:
Welchen Besitz? Diese alte Schrottkarre? Ok, dein Laptop ist dein Heiligtum, aber vor was oder vor wem soll ich das schützen? Hier ist nichts und niemand!
Bevor ich nach meiner dicken Jacke schnappe, sehe ich durch die Windschutzscheibe nach draußen. Mir graust vor der schemenhaften Düsternis, die über diesen Ort liegt und die bald in die Finsternis der Nacht übergehen wird.
Ich spüre einen leichten Anflug von Panik, deshalb kraule ich kurz eines von Rivas Schlappohren. Ihre Wärme, ihr seidiges Fell drängen Kälte und Angst zurück. Schließlich schlüpfe ich in die dicke Daunenjacke, stülpe die Kapuze über den Kopf, atme tief durch und steige aus.
Obwohl es kurz vor Mittag ist, gleicht die Helligkeit dem fahlen Licht eines Mondes. Liegt über dem kleinen Ort wie eine kratzige, fadenscheinige Decke. Es ist Winter und eiskalt. Der graue Himmel sorgt nicht gerade für eine gemütliche Wohlfühlstimmung, selbst wenn das kleine französische Dorf mit den malerischen, alten Häusern mit Sicherheit jeden Touristen im Sommer in Entzückungsrufe ausbrechen lässt. Die Hauptstraße, auf der ich mich befinde, ist eher eine breite Gasse. Vom Regen glänzendes Kopfsteinpflaster, eingefasst von steinernen Trögen, die eine altertümliche Begrenzung zu den zwei Parkplätzen vor der Bäckerei bilden. Hier und da blinkt mir Weihnachtsbeleuchtung von Eingangstüren oder Fensterläden entgegen, versuchen das düstere Grau des Winters zu vertreiben, doch diese Lichter sind auch alles, was vermittelt, dass hier wirklich Menschen wohnen. Das und das einladende Schaufenster der Bäckerei. Ansonsten wirkt alles wie ausgestorben. Wenigstens lässt der Regen nach, der sich anfühlt, als bohrten sich eisige Nadelspitzen in alles, das es wagt, dem Wetter zu trotzen.
Ich renne den kurzen Weg zum Eingang der Bäckerei mit eingezogenem Kopf. Eine kleine messingfarbene Türglocke kündigt mein Eintreten in den menschenleeren Verkaufsraum an. Der warme, heimelige Geruch von Brot, Kuchen und frischem Kaffee empfängt mich und sofort fühle ich mich besser. Hungrig trete ich an den Tresen. Habe kaum Augen dafür, dass der Laden aussieht, als stamme er aus dem letzten Jahrhundert. Altes, wurmlöchriges Holz überall. Handgeflochtene Körbe, in denen Baguettes, Brötchen und dunkles Landbrot liegen.
In Gedanken überschlage ich mein spärliches Budget. Essen ist etwas, das in meinem momentanen Leben die geringste Rolle spielt. Lieber besorge ich Riva eine Dose Hundefutter, als mein Geld für dieses schokoladenüberzogene Eclair mit der Vanillepuddingfüllung auszugeben. An manchen Tagen gönne ich mir einen der billigen Tetra-Pack Weine aus dem Discounter. Um mich der Dunkelheit nicht stellen zu müssen. Um die Monster darin nicht anzusehen.
Wie lange ist es her, dass ich so eine Köstlichkeit wie diesen kleinen Kuchen genießen konnte?
Mein Magen knurrt. Laut. Genau in dem Moment als ein älterer Mann aus der Backstube nach vorne an den Tresen tritt. Eindrucksvolle, buschige Augenbrauen über den dunklen Augen. Struppige, graubraune Haare, die aussehen, als würde er sein Fell sträuben. Mein Herz setzt einen Schlag aus. Einen Augenblick lang erinnert er mich an meinen Vater und ich trete unbewusst einen Schritt vor. Möchte mich in seine Arme werfen, will, dass er mich festhält und mir versichert, dass mein ganzes Leben von diesem einen Tag an nur ein schrecklicher Albtraum war. Ich habe meinen Vater geliebt. Und tue es immer noch, wie mir gerade schmerzlich bewusst wird.
Ein Kloß setzt sich in meinem Hals fest und schwillt an. Ich habe Mühe, die Tränen zu unterdrücken, die haltlos in mir aufsteigen, nur weil ich diesem fremden Mann in vertraut wirkende Augen sehe.
„Bonjour, Mademoiselle!“
Das verstehe ich. Doch der schnelle Schwall Französisch, der daraufhin von ihm folgt, lässt mich verwirrt den Kopf schütteln. Fest, so fest balle ich meine Hände zu Fäusten, dass die Fingernägel sich in meine Handflächen graben. Der leichte Schmerz lenkt mich ab. Hilft mir, mich zusammenzureißen. Einen derart intensiven Flashback hatte ich noch nie.
Du bist übermüdet. In einem fremden Land. In einem Dorf, das leicht unheimlich wirkt mit all dem eisigen Regen und dem fahlen Licht. Mehr ist da nicht.
Tief atme ich durch. Unterdrücke das Beben in mir mit aller Macht und finde Trost in der Logik meiner Gedanken. Der alte Mann mustert mich einen Augenblick, dann wirft er einen Blick aus dem Fenster. Auf mein Auto, das frontal zu seiner Bäckerei steht.
„Aaaah, ich verstehe. Sie kommen aus Deutschland?“
Erleichtert nicke ich. „Ja. Sie sprechen deutsch?“
Ziemlich gut sogar.
„Mein Vater war Deutscher. Kam hierher, als die Krieg fast fertig. Und ist geblieben“, erklärt er mit einem einladenden Lächeln.
Automatisch lächle ich zurück. Verhaltener als er, denn auch, wenn der Bäcker vertrauenerweckend wirkt, bin ich noch damit beschäftigt, mich zusammenzureißen.
Außerdem weiß ich, dass Gregor Medschew, mein Ex, vor dem ich auf der Flucht bin, Mittel und Wege hat, mich überall zu finden. Meine einzige Chance, ihm weiterhin zu entkommen, ist, so unauffällig wie möglich zu sein. Niemandem im Gedächtnis zu bleiben. Schon den alten Mann nach dem Weg zu fragen, kann meinen Ex auf meine Spur bringen. Meine seltsame Reaktion auf ihn, erst Recht.
Ich habe keine andere Wahl, versuche ich mich zu beruhigen.
„Ich suche das Schloss“, erkläre ich deshalb schnell. „Können Sie mir den Weg dahin zeigen?“
Das Lächeln erlischt, als hätte man es ausgeknipst. Die dichten Augenbrauen ziehen sich zusammen. „Das Schloss?“
„Ja, das Château de Vil.“
Der alte Mann dreht sich um und sortiert langsam und konzentriert die langen Baguettes. Legt sie, ordentlich wie Zinnsoldaten, in reih und Glied.
„Warum? Sind Sie Reporterin?“ Als er sich zurück zu mir dreht, lächelt er wieder, doch seine Stimme klingt brüchig. Als laste jedes einzelne Lebensjahrzehnt wie eine schwere Last auf seinen kräftigen Schultern.
„Nein.“
In diesem Moment komme ich mir lächerlich vor, dass ich nur aufgrund einer geheimnisvollen Einladung den langen Weg in ein französisches Nirgendwo gemacht habe. Ansonsten weiß ich nichts, außer, dass es sich um die Einladung zu einem Autoreninspirationsseminar handelt, dessen Kosten voll übernommen werden. Und dass ich hungrig und müde bin. Kaum noch Geld habe, dringend eine Dusche benötige und einmal wieder in einem Bett schlafen will. Hätte meine Freundin Lili nicht dieselbe ominöse Aufforderung erhalten und hätte sie, sowie ein paar ander Autoren, die sie kennt, nicht zugesagt, wäre ich nicht hier. Niemals.
Dennoch habe ich es dringend nötig, mich wenigstens für kurze Zeit etwas zu entspannen. Mich sicher zu fühlen. Hier würde Gregor mich niemals finden.
„Touristen haben keinen Zutritt zum Château“, erklärt der Alte jetzt mürrisch.
Etwas, was mich in Hinblick auf Gregor erst Recht beruhigt.
„Ich habe eine Einladung“, werfe ich ein. Hastig suche ich in meiner Jacke nach der ausgedruckten Email.
„Von wem?“
„Von einem Lucien L`Enfer. Einen Moment, ich hatte sie doch -“
„Ich will Ihre Einladung nicht sehen“, wehrt der Bäcker energisch ab. Kurz fuchtelt er mit einer Hand durch die Luft. „Zeigen Sie sie niemandem.“
Verwundert halte ich inne und starre ihn an, doch er blickt aus dem Fenster hinaus in die Düsternis, die um diese Jahreszeit den frühen Tag überschattet wie einen Fluch.
„Die Raunächte. Der Teufel tanzt nicht gern allein in dieser Zeit“, murmelt der Alte bitter.
„Wie bitte?“
„Nichts.“ Er lächelt wieder, als er sich zu mir umdreht. „Hören Sie nicht auf das Geschwätz eines alten Mannes, Mademoiselle. Wenn Sie eine Einladung bekommen haben ...“ Seine Stimme wird leiser und verklingt mit einem Seufzen. Dann strafft er sich. „Es wird dem Dorf zugute kommen.“
„Was wird dem Dorf zugute kommen?“, hake ich misstrauisch nach. Ein kleiner, unruhiger Ball knüllt sich in meinem Magen zusammen.
„Fahren Sie die Hauptstraße weiter, immer weiter am letzten Haus vorbei. Dort biegt ein schmaler Weg nach links. Diesen fahren Sie hoch, er führt direkt ans Ziel. Über die Pont Abîme gelangen Sie ins Schloss.“
„Danke.“ Ich nicke zum Abschied und gehe zur Tür. Der Appetit auf all die Köstlichkeiten ist mir vergangen. Vielleicht liegt es daran, dass in dem Laden ein unterschwelliger Geruch nach schimmeligen Moder liegt, der nur in den ersten Augenblicken von dem Duft nach frischgebackenem Brot überdeckt wird.
Die Tür bereits aufgezogen, drehe ich mich noch einmal um. Der Bäcker steht mit verschränkten Armen hinter dem Tresen und seine Augen liegen so intensiv auf mir, dass ich schaudere. Nervös schlucke ich, doch das, was mir durch den Kopf geschossen ist, lässt mir keine Ruhe.
„Eine Frage noch: Pont Abîme – hat der Name eine Bedeutung?“ Die Art, wie er es ausgesprochen hat, irritiert mich. Wie eine Warnung. Vielleicht auch wie eine Drohung.
Einen Moment lang, der sich bis zur Ewigkeit dehnt, sieht der alte Mann mich nur an. Eine seltsame Trauer trübt seinen Blick.
„Abgrund sagt man auf Deutsch. Aber ... Es ist das und noch viel mehr, Mademoiselle. Passen Sie gut auf sich auf!“
Kapitel 2
Regel Nummer 2:
Bleibe im Hier und Jetzt, denn in der Dunkelheit sind alle Schatten gleich ...
„Was für ein seltsamer alter Mann, Riva.“ Ich schnaube genervt um mich den unheimlichen Gefühlen in mir nicht stellen zu müssen, und meine Hündin sieht mich kurz an. Ein verhaltenes, zustimmendes Wedeln mit dem Schwanz, bevor sie ihre Aufmerksamkeit wieder aus dem Autofenster richtet. Was ich ebenfalls tun sollte, denn gerade sind wir am letzten Haus des Dorfes vorbeigefahren. Der Regen wird zum Glück immer spärlicher, bis er ganz aufhört. Angestrengt blicke ich nach links.
„Ein schmaler Weg hat er gesagt“, murmle ich, in der Hoffnung diese Straße damit schneller zu finden. Und tatsächlich. Eingerahmt von meterhohem Unkraut, das jetzt im Winter schwarz und tot aussieht, sehe ich eine Art Schneise. Das muss es sein!
Langsam lenke ich meinen Twingo in die enge Zufahrt. Verwundert. Die Fahrt zu einem Schloss, dem Wahrzeichen eines kleinen Dorfs, habe ich mir anders vorgestellt.
„Wenigstens verziehen sich die düsteren Wolken ein wenig“, sage ich zu Riva. Erleichtert, denn die Scheinwerfer meines kleinen Wagens spenden nicht wirklich viel Licht.
Je weiter ich fahre, desto heller wird es. Die Straße selbst ist zwar nicht besonders breit und sollte hier Gegenverkehr herrschen, bin ich aufgeschmissen. Aber es befinden sich kaum Risse oder Schlaglöcher in dem Asphalt, was gut ist. Die hätten den ächzenden Stoßdämpfern meines klapprigen Autos den Rest gegeben.
Über weitgezogene Serpentinen geht es bergauf. Immer steiler. Ab und an wird die Straße von einem Waldstück eingefasst, dann wieder sehe ich weite Wiesen, mit sanft geschwungenen Hügeln.
„Du kannst es kaum erwarten hier herumzutanzen, oder?“ Ich greife zu Riva und kraule kurz ihr dichtes Fell.
Der Teufel tanzt nicht gern alleine ... Die Worte des alten Mannes kommen mir erneut in den Sinn. Ebenso wie Gregor.
Auch mein Ex hat eine „Tanzpartnerin“ gebraucht, ein Spielzeug, das er nach seinem Gutdünken formen konnte.
... „Tanz für mich, Prinzessin.“
Die Musik, die Gregor anstellte, war nicht nach meinem Geschmack, dennoch setzte ich mich Bewegung. Beinahe automatisch. Mechanisch. Einst hatte ich Tänzerin werden wollen und all meinen Ehrgeiz darin gesetzt, meinen Traum zu verwirklichen.
Alles in mir war kalt. Eiskalt. Mein Körper drehte sich in den vertrauten Bewegungen, doch in mir war alles erstarrt. Nach einer Pirouette sank ich erschöpft zu Boden.
„Du siehst nicht sehr enthusiastisch aus, Prinzessin. Das konntest du schon mal besser.“
„Ich kann es nicht mehr“, flüsterte ich zurück und verdrängte die Tränen. Nichts zeigte mir deutlicher, wie sehr ich ein Nichts geworden war, als dieser eine, kurze Tanz.
Gregor kam gemächlich näher und blickte zu mir runter.
„Kannst du nicht oder willst du nicht?“
„Ich kann nicht – bitte!“ Mein Herz setzte aus, als ich den Ausdruck in seinem Gesicht sah. Ich wollte hochspringen, wollte weg, nur weg, doch Panik lähmte mich.
„Lügnerin!“, raunte Gregor.
Der Schmerz, als er mir mit einem wuchtigen Tritt den Knöchel brach, war so allumfassend, dass ich erst schrie, um dann gegen eine Ohnmacht anzukämpfen.
„Ich hasse Lügen, Prinzessin. Jetzt allerdings – jetzt ist es wahr, dass du nicht mehr tanzen kannst!“ ...
Mein Fuß rutscht vom Gaspedal, Schmerz schießt durch den einst mehrfach gebrochenen Knöchel, und ich beiße die Zähne zusammen. Sollte Gregor mich jemals finden, wird er mehr brechen, als nur meinen Knöchel.
Riva bellt. Kurz und scharf fährt sie mich an, weil das Auto schlingert. Hastig reiße ich mich zusammen und bringe den Wagen wieder auf die Spur.
„Du hast Recht, Süße.“ Meine Stimme klingt rau. Erschöpft. Kurz davor das Lenkrad einfach herumzureißen, um uns in die Schlucht zu stürzen, die jetzt auf der rechten Seite auftaucht.
Riva winselt und legt sich hin. Ihr seidiger Kopf ruht auf meinen Schenkeln und ihre Wärme springt auf mich über. Dieser Hund war mein Rettungsanker gewesen. Aus ihr habe ich meine letzte Kraft und Stärke gezogen. Vor allem die, den Teufel endlich zu verlassen, auch, wenn das bedeutet, dass ich damit mein Leben riskiere und seitdem auf der Flucht bin. Doch Riva ist das wert. Und schließlich flüchte ich schon mein Leben lang vor mir selbst.
Ich schiebe die dunklen Gedanken energisch zur Seite. Der Twingo tuckert um eine Kurve und mit einem Mal bricht die Sonne durch die Wolken. Mit einem Mal sehe ich das Schloss. Die spitzen Türme, die sich einem Märchenschloss gleich der Sonne entgegenstrecken, und der Anblick gleicht einem wohligen Traum. Ich kann mich kaum sattsehen an all der Pracht und seufze erleichtert. Vertreibe endgültig die unheimlichen Worte des alten Mannes. Die steinernen Mauern strahlen im warmen Licht und ich bin einfach nur erleichtert, endlich angekommen zu sein. Auch Riva wird eine Pause von der ständigen Herumreiserei guttun.
Langsam fahre ich über die Pont Abîme. Unter der Brücke ist kein Abgrund, wie ich vermutet habe. Nur ein dunkelschimmernder Wassergraben, wie beinahe jede Burg, jedes Schloss von einem solchen umgeben wird und der in einen malerisch anmutenden See übergeht, was die märchenhafte Kulisse abrundet.
Ich muss zugeben, dass alles hier sehr idyllisch, einladend und inspirationsfördernd wirkt. Unbedingt muss ich wieder schreiben, war allerdings die letzten Monate wie blockiert. Aber jetzt muss ich wieder veröffentlichen, um mein rasend schnell schrumpfendes Budget aufzustocken.
Als wir endlich in den weitläufigen, gekiesten Vorhof des Schlosses einfahren, bin ich zuversichtlicher als in den letzten Jahren. Die Zeit bei Gregor hat mich verändert. Die Flucht hat mich verändert, aber schon jetzt spüre ich den Sog, das Kribbeln in den Fingerspitzen, die ungeduldig über die Tastatur tanzen wollen, um simple Worte zu magischen Welten in den Köpfen der Leser zu formen.
Der Motor des Twingo erstirbt mit einem Ächzen. Einen kurzen Moment lausche ich der plötzlichen, abwartenden Stille. Meine Augen schweifen über die Frontseite des eindrucksvollen Schlosses. Ich kann kaum glauben, dass ich tatsächlich hier bin.
„Wir sind da, Riva“, murmle ich, obwohl es unnötig ist. Riva hat sich längst angespannt auf dem Beifahrersitz aufgerichtet und knurrt leise.
„Keine Angst, hier sind wir in Sicherheit. Hier wird unsere Zukunft beginnen“, beruhige ich sie, obwohl sich in meinem Bauch ein kleines, warnendes Kribbeln ausbreitet.
Ich ziehe Riva auf meinen Schoß. Ihre Wärme tut gut. Darauf konzentriere ich mich. Das Gefühl, endlich angekommen zu sein, tut gut. So gut, dass ich meinen Kopf gegen die Nackenstütze lehne, Rivas warmen, schweren Körper als tröstliches Gewicht auf meinen Schenkeln nachspüre und kurz die müden, brennenden Augen schließe.
Finger tanzten über meine nackte Haut. Genau einen Monat nach meinem eigentlichen Geburtstag. Mathis hatte beschlossen, dass wir an einem anderen Tag feierten, als an dem, der in meinem Pass steht. Dem Tag, der mein ganzes Leben bestimmte und den ich seitdem in die Dunkelheit verbannt hatte. Dorthin, wo ich niemals sein will. Zwanzig bin ich geworden und Mathis hatte mehr als gebührend mit mir gefeiert.
Kurz nur sah ich in seine goldfunkelnden Augen, fühlte nichts als Glück und Liebe und mit einem leisen Stöhnen schloss ich die Augen und spürte dem Lauf der Fingerspitzen nach. Sacht umkreisten sie meine Brustwarzen, die sich mit einem leichten aufregenden Stechen zusammenzogen. Die raue Hand wanderte sofort nach oben, als hätte sie nur darauf gewartet, mir diesen kurzen Genuss zukommen zu lassen.
Über mein Dekolleté glitt sie. Streichelte über den harten Knochen meines Schlüsselbeins, was mich erneut zum Schaudern brachte. So viel Lust, so viel Gefühl lag in dieser einfachen Berührung, dass ich nicht genug davon bekommen konnte.
Doch auch hier verweilten die Finger nicht lange, sondern spielten mit der Kette, die er mir geschenkt hatte. Ich bäumte mich ihm entgegen, als er zu meinem Hals fuhr. Federleichte Spuren hinterließ. Prickelnde Gänsehaut hervorrief.
Berühre mich! Halt mich! Liebe mich! Nimm mich!
Meine Gedanken verschwammen, doch mein aufblühender Körper und mein flatterndes Herz wussten genau, was sie wollten. Und sie wollten mehr! So viel mehr, obwohl ich noch das sanfte Nachglühen des eben Erlebten in mir spürte.
„Wir zwei, Babe. Für immer und ewig ...“
Ganz weich wurde ich in seinen Armen.
„Und wenn wir erst auf unserem Hausboot auf dem Mississippi herumtuckern, werde ich dich vögeln, bis ans Ende unserer Tage.“ An meinem Mund spürte ich, wie seine Lippen sich zu dem Grinsen verzogen, das mich immer mit einem Glücksgefühl beschenkte. Dann rollte er mich herum.
„Nur mein Rücken ...“ Er seufzte leidvoll. „Wir sollten dringend darüber reden, wo du dich festhälst, wenn ich dich ficke.“
Kurz zog er meine Unterlippe zwischen seine Zähne, bevor seine Lippen meinen Mund verließen und an meinem Kiefer entlangstrichen.
„Wir sollten dringend ficken, anstatt zu reden!“, bettelte ich und biss in seinen Hals, der sich mir so verführerisch anbot.
Mathis stöhnte leise, dann drang er in mich ein und ich bäumte mich ihm entgegen. Gut, so gut fühlte es sich an, ihm so nahe zu sein. Eins mit ihm zu sein.
„Wir zwei. Für immer und ewig“, flüsterte ich an seinen Lippen und öffnete die Augen. Mein Herz quoll über vor Liebe, mein Körper vor Lust. Sein strahlender Blick bohrte sich in meinen, tausend Sterne tanzten darin und ich wirbelte und lachte und spürte dieses unfassbare Glück, diese seligmachende Schwerelosigkeit, diese allumfassende Sorglosigkeit, welche nur der einzig wahren Liebe zu eigen sind, mit jeder Faser meines Seins ...
Ich muss eingeschlafen sein. Übermüdung und Erschöpfung haben ihren Tribut gefordert.
Als ich die Augen aufschlage, sitze ich immer noch im Auto. Meine Wangen sind nass. Ob vor Tränen oder Rivas eifriger Zunge – ich weiß es nicht. Wahrscheinlich beides, denn es dauert, bis sich mein verschwommener Blick klärt.
So lange habe ich nicht mehr an Mathis gedacht. Wir beide waren jung damals, viel zu jung. So streng, wie ich meine täglichen Ballett-Trainingseinheiten abgehalten habe, so rigoros verbannte ich ihn aus meinen Gedanken, aus meinem Herzen, als ich ihn verließ, dass die Erinnerung an ihn jetzt umso mehr schmerzt.
Mehr peinigt als die Erinnerung an Gregor. Das Vermächtnis Gregors ist mit Angst und Schmerz verbunden. Das an Mathis mit -
„Ich will nicht weiter darüber nachdenken, Riva! Ich will überhaupt nie mehr an ihn denken! So etwas wie die unendliche, wahre Liebe gibt es nicht.“ Ich schiebe die Hündin rigoros zur Seite. So lange habe ich es geschafft, ihn aus meinem Gedächtnis zu streichen, dass ich unangemessen gereizt reagiere. „Lass uns endlich reingehen! Hier wird alles besser.“
Der kalte Klumpen in meinem Magen bleibt allerdings. Trotz aller Zuversicht.
Kapitel 3
Regel Nummer 3:
Falle nicht auf und sieh nicht in die Dunkelheit, denn jedes Monster hat einen Namen ...
Kalter Marmor auf dem Boden der eindrucksvollen Eingangshalle des Schlosses. Edel verlegt, so dass jede dunkle Linie, die die weißglänzenden Steine durchzieht, in die nächste Fliese übergeht und ein Bild entsteht, das wie ein Jackson-Pollock-Kunstwerk ins Auge fällt und sich dennoch nicht sofort erschließt. Ich entscheide mit einem tiefen Atemzug, es erst gar nicht zu versuchen, denn die Halle ist riesig und die Linien verschwinden in der Ferne.
Riva drängt sich unsicher gegen meine Beine. Unsicher und ungläubig, dass sie es gewagt hat, mit Hundepfoten diesen edlen Boden zu betreten.
Mein Blick schweift nach oben. Jeder Besucher eines Schlosses sieht automatisch nach oben, oder nicht? Stuck an der Decke, darunter scheint eine alte Deckenmalerei durchzublitzen und ich verziehe das Gesicht.