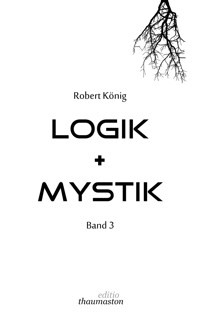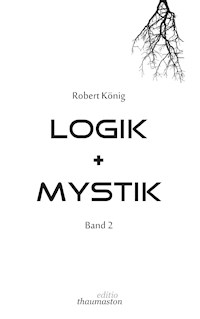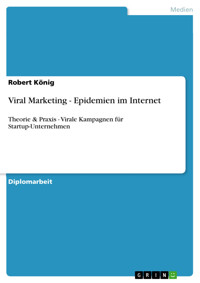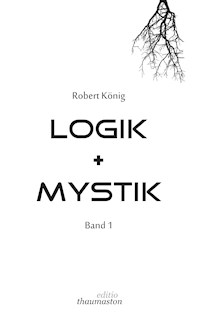
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Logik + Mystik ist ein Werk der Philosophie in mehreren Bänden. Seit Jahrtausenden wird von den Philosophen ein einziger, grundlegender und absoluter Ursprung der Philosophie bestimmt: die Verwunderung. Doch was ist Verwunderung? Sie ist in einem Wort: selbst zu philosophieren. Niemand kann bloß "über" Philosophie sprechen, sich in ihr belehren lassen oder einen anderen im Philosophieren nachahmen. Man kann entweder nur verwundert selbst philosophieren oder aber hat mit Philosophie gar nichts zu tun. Logik + Mystik fordert daher seine LeserInnen zu genau diesem Philosophieren auf. Es handelt von der einzigen und absolut freien philosophischen Erkenntnishandlung des Menschen. Sich wahrhaft zu verwundern, ist kein unbestimmtes Gefühl, sondern höchster, freiester und geisterfülltester Erkenntnisakt. Diese vollkommenste Wissensform, nämlich immer nur: selbst zu philosophieren, ist das Thema der sog. Mystik. Doch schwebt die Mystik dabei nicht im luftleeren Raum. Es gibt keine rasche Abkürzung zu ihr und sie besteht auch nicht in einer sentimentalen esoterischen Privateinsicht. Sie wird allein durch ihr eigenes Sichbegreifen und damit ihre eigene Wissenschaft verfügbar gemacht. Diese Wissenschaft, d.h. der Weg zur und der Akt der Mystik, ist: die Logik. Logik und Mystik ergänzen einander zur Freiheit der Verwunderung. Die Bände von Logik + Mystik fordern in ihren Teilen zum Selbstphilosophieren, d.h. zum Sichverwundern, auf. Die einzelnen Teile der Bände, die sog. "Mirabilien" (Verwunderlichkeiten) sind (auch von einem Band zum anderen) sowohl untereinander verbunden, als auch jeweils in ihrer ganz eigenen Logik entwickelt und selbstgenügsam. Jede Mirabilie hat ihr genuines logisches Thema, doch führen sie alle in dieselbe Mystik der Verwunderung hinein. Natürlich bleibt auch so eine Zusammenfassung äußerlich und oberflächlich, wenn die LeserInnen nicht selbst mit den Mirabilien philosophieren und damit selbst an Logik + Mystik teilnehmen und mitarbeiten. Das Buch braucht, um Philosophie zu werden, dich. Verwundere dich also. Du bist willkommen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 763
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Robert König hat Philosophie, Theologie, Geschichte und Klassische Philologie an der Universität Wien studiert und hält ein Doktorat der Philosophie. Er lehrt und forscht in Wien an den Fakultäten für Philosophie und für Theologie.
Gebrauchsanweisung
Wer von einem Buch ein Vorwort fordert, fordert Gebrauchsanweisung, Entstehungsgeschichte, Zielbeschreibung, Sinnerklärung, Werbung und Zusammenfassung in einem. Er möchte vorab wissen, womit er es zu tun habe, wie er denn damit tue und wozu. Bücher haben sich daran gewöhnt, zuerst allerlei buntes Pfauengefieder anlegen zu müssen, ehe sie überhaupt beginnen.
Nun denn: Es handelt sich bei den vorliegenden Büchern der Logosmystik um Bücher der Philosophie. Die Bücher üben sich in der einzigen und grundlegenden philosophischen Handlung: der Verwunderung. Ihre Teile tragen dieses stets wiederkehrenden Themas wegen den Namen: Mirabilien (Verwunderlichkeiten). Die Mirabilien sind einerseits durch mehr oder weniger offensichtliche Hinweise und Ankerpunkte untereinander verbunden. Es genügt andererseits jede einzelne Mirabilie allein sich selbst und bedarf der anderen nicht. Jede Mirabilie ergibt sich von jeder anderen aus, zugleich haben sie nichts miteinander zu tun. Sie bauen, wenn man in ihrem Studium denn möchte, aufeinander auf, lassen sich aber ebenso zyklisch, linear, systematisch, selektiv oder in Fetzen zerstückelt studieren.
Logik + Mystik besteht also in einer Einladung, mit seinen Mirabilien selbst zu philosophieren. Dieser Umgang heißt Verwunderung und ist in seiner Vielfalt zugleich der einzige philosophische Akt und Inhalt der Mirabilien. Logik + Mystik spricht mithin nicht über Philosophie, es fordert zum Philosophieren heraus. Denn bloß über Philosophie kann man gar nicht sprechen – und mehr lässt sich in einem philosophischen Vorwort auch nicht sagen.
Daher zurück zur Gebrauchsanweisung. Die Mirabilien können freilich linear studiert werden. Es empfiehlt sich aber zugleich, bei Missfallen von Sprache, Thema, Melodie, Rhythmik oder Gestus der einen Mirabilie, vielleicht gleich zu einer anderen zu wechseln. Nicht jede Mirabilie wird jeden auf die gleiche Art oder überhaupt verwundern. Auch steht man im Verlaufe des Studiums von Logik + Mystik vielleicht nicht schlecht da, wenn man von einer Mirabilie aus die anderen aufzusuchen lernt, als würde man aus je verschiedener Position und hierdurch je verschiedener Richtung je ein anderes Schlaglicht auf die Logosmystik richten. Die Mirabilien, auch die anderer Bände, werden dabei in je anderem Lichte zeigen, was Logik + Mystik selbst ist. Man sollte daher mit den Mirabilien experimentieren und je mehr von ihnen man heranzieht, umso reicher wird ihre Erfahrung. Das gilt nicht nur für den vorliegenden Band, sondern für sämtliche Bände von Logik + Mystik. Denn sie sind alle ein großer Mirabilienkreis und nur aus äußerlichen Belangen technischer Produktion überhaupt in Bände aufgeteilt. Mehr noch, man sollte sich in ihrem Studium bestenfalls selbst darauf vorbereiten, an der Logosmystik mitzuwirken – in welcher Form man wolle. Wer sich einem Buch nähert, übernimmt schließlich damit immer eine Verantwortung.
Die Lektüre ist jedenfalls keine, mit der man konsumentisch, berieselnd, buchgelehrt oder überblicksartig umgehen kann. Sie verlangt gedrosseltes Tempo, mehrere Wiederholungen, Pausen, wo vielleicht vorweg keine gemacht worden wären, Beschleunigungen, wo man sie nicht gewohnt ist. Bei manchen Wortschöpfungen ist länger zu verweilen, um sie bedeutsam zu machen, andere hingegen werden sich in ihrem Sinn rasch von selbst ergeben. Die Logosmystik nötigt Zeit, Kraft und Geduld ab. Sie schenkt dafür aber Verwunderung – und obendrein dies, dass es einen größeren und höheren Schatz für den philosophierenden Menschen nicht gibt.
Die Logosmystik ist daher ihrer Natur nach ein Grenzgang. Wer ein Grenzgänger des Denkens wird, wird immer auch ein Grenzgänger der Sprache und die Sprache dadurch entsprechend komplex sein. Es ist nicht die Aufgabe der Philosophie, gefällig, einfach, kurz und rasch nachschwätzbar zu sein, einen Inhalt möglichst für den Gebrauch aufzubereiten oder sich tunlichst an vermarkterische Rahmenbedingungen einer despotischen Konsumentengemeinschaft zu halten. Philosophie wird nicht konsumiert. Sie ist auch kein Entertainment oder Zeitvertreib. Wenn sie Philosophie sein will, wird sie wundernd getan.
Daher dringt sie auch mit ihrer Sprache und Form in Gebiete vor, die für ein bloßes Nutzbarmachen ewig unbekannt und unverständlich bleiben. Philosophie ist schwierig, fordernd, irritierend – und hierin liegt ihr Potential, nicht ihr Mangel. Sie erlaubt in ihrer Tiefe, auch nicht zu begreifen, nicht zu verstehen, nicht zu wissen und wirft den Philosophierenden erst hierin auf sich und sein Mitwirken zurück. Erlaube dir diese Irritation, aber lass dich nie von ihr einschüchtern. Gestatte dir die Frage, was denn all das überhaupt soll. Fort mit dem Verstandeszwang. Fort mit den hastig getriebenen Verwertbarkeitserwartungen. Wenn ein Mensch das Sprechen erlernt, erlernt er zunächst auch seine Melodie, Rhythmik und seine Gestimmtheit. Erst viel später folgen Bedeutungen, Inhalte, Nutzen und Zwecke. Geh mit Logik + Mystik in genau diesem Geist um, wenn du einmal in den Mirabilien verloren bist. Dein Verlust birgt erst den kommenden Gewinn.
Du kannst.
Was du also in den Mirabilien nicht begreifst oder kennst, darüber gehe hinweg. Es wird in anderer Sprache oder Form wiederkehren und dir dort vielleicht von selbst klar werden. Oder du kehrst später an den Ort deiner ursprünglichen Entfremdung zurück, dann aber um die nötigen Wurzeln gewachsen, sodass du in einst karger Erde nun fruchtbar Blüten treiben kannst. Und falls nicht, ist es eben nicht oder noch nicht für dich. Womöglich kannst du es selber ohnehin bereits weitaus besser sagen und wenn du es doch andere oder mich für dich sagen lassen möchtest, so verwundere dich auch hieran. Denn du bist in deinem Wurzeln ein Teil der Mirabilien, vergiss es nie.
Mirabilienkreis Band 1
Wir Quellenangeber
Namenlos und unvollendet
Briefe an Kalypso
Die Interimsliebenden
Gelinge!
Wir Quellenangeber. Zu fragen, wie einer dazu kommt, ein solches Buch zu schreiben, ob es überhaupt und was ein Buch sei, wird von diesem Buch womöglich auf eine, eine andere, drei mal drei, unzählige oder keine Arten beantwortet. Wie es obendrein zu lesen oder sonst zu verabreichen sei, ist kaum anzugeben, steht doch nicht einmal fest, in welchen Formen es sich wird darbieten können. Für hier und jetzt jedenfalls mag vielleicht höchstens empfohlen sein, es bestimmt und laut zu lesen, nicht still für sich. Sein Rhythmus, seine Melodie, seine Pausen und Beschleunigungen, sein Stolpern und Gleiten, sein Vertiefen und Verflachen auch, sie alle müssen in ihr Recht, und stilles Lesen mag dies kaum leisten können. Inwendige Lektüre verliert daher das meiste von einem solchen Buch. Noch besser wäre freilich, es andren vorzulesen, mit dem Erstaunen, mit dem man vielleicht einem Kinde vorliest, dem man eine ganz geheime Botschaft mitteilen möchte, um sich am Leuchten in seinen Augen zu erfreuen. Das Beste schließlich wäre, es einander und mehrmals gegenseitig laut vorzulesen und anzuhören, mit Bedacht auf seine Verästelungen und seine Musik, seinen Pulsschlag und Inhalt gleichermaßen und vor allem mit gemeinsamem Augenmerk auf alles das, was das Buch nicht sagen kann.
Jedenfalls steht und fällt mit der Frage, wie denn einer dazu komme, es zu schreiben, das ganze Dasein dieses Buches selbst, sein Auftauchen, seine Entwicklung auch, im Schreiben, im Lesen – das der alte Grieche nicht zufällig ein Wiedererkennen nennt – im Nachahmen, Weglegen, Kennen oder Nichtkennen ebenso.
Wenn etwa Nietzsche an einem gewissen Punkt dazu kommt, zu sagen, er liebe von allem Geschriebenen nur das, was einer mit seinem Blute schreibt, dann tragen seine Worte weniger ein dichterisch aufgeladenes Pathos als sie vielmehr den üblichen Ekel beseitigen sollen, der das Geschriebene begleitet. Es ist nämlich ein eigentümlicher Ekel, den Bücher, Texte, Kommuniziertes im Ganzen mit sich bringen können. Kommunikation, Vermittlung, Tradierung, Bildung, Evolution und unter welchen Namen sich das Quellenangeben noch selber kommunizieren mag: sie alle beseelt dieser gewisse Ekel, dieser Kopfschmerz, ja eine eigentümliche Peinlichkeit. So eine Peinlichkeit drängt sich in allem Geschriebenen auf, wenn einer meint, es sei da überhaupt etwas zu kommunizieren – eben ohne sich und seinem Kommunikat erst einmal die Frage aufzuerlegen, wie es eigentlich dazu komme, sich zu kommunizieren, ohne ihm mit Nietzsche also Blut einzugießen. Wort für Wort wachsen einem Scham und Verlegenheit, weiterzuschreiben, weiterzulesen, mehr hiervon auf die Welt zu bringen, mehr von dem, das auch ohne dieses Buch auf der Welt und zugleich doch nicht auf der Welt wäre, worin sich ja sogar die Fragwürdigkeit der ganzen Existenz als ein solches Buch überhaupt selber gebiert. Platon geht in diesem Sinne keineswegs zu weit, wenn er im Symposion solchen Kommunikatismus wie in nietzsche’scher Bluteshitze dem Gebären vergleicht. Wer Platon und Nietzsche übrigens auseinanderdividiert – wie in Quellenangaben häufig geschieht und gar Nietzsche selber in seinem Denken zustieß – hat sie beide nie gehabt. Es ist nämlich Nietzsche selber passiert, sich blutlos zu machen, sein eignes Buch nicht mit Blut zu schreiben und erst zu jener Meinung über sich und Platon sich aufgefordert zu fühlen.
Oder wollen wir Quellenangeber ein Buch lieber als geschichtliche Notwendigkeit fassen, bereit gemacht für sich im Fluss der Zeit, der alle Bedingungen langsam mäandernd erreichte, die zum Geschehen des Buches führten, das hier und jetzt – sinnlich gewiss und endlich potent genug – sein eignes Geschehen durch seine Niederschrift in Geschichte setzt? So etwas bleibt wohl abstrakte Verkürzung, die übrigens nicht nur der Geschichtsevolutionslogik Hegels unterstellt zu werden pflegt, sondern für jedes echte philosophische Buch gelten muss. Denn alles Geschriebene ist und bleibt, wie es als philosophisches Buch in seiner eignen Niederschrift zu zeigen hat, selbst eine abstrakte Verkürzung. Was das wieder bedeutet, kann es aber nicht einfach sagen, das ist ja seine Abstraktion. Es muss sich ihm dazu zeigen. Auch hierin hat Platon im Phaidros einmal mehr Recht. Sollen wir daher mit Platon oder auch mit Paulus quellenangeben, dass die Bücher nur dazu da sind, ihre eigene Untauglichkeit preiszugeben und daher gleichsam Risse im Sein, im Realen und Universum wären – und man aus ihrem Blickwinkel dieses erst durch sie Zerrissene fortan betrachten und benennen möchte? Und wie würde wiederum überhaupt das Betrachten durch ein Buch losgetreten werden können? Oder ist das Schreiben eines philosophischen Buches – und unphilosophische Bücher sind, weil sie bloß Bücher sind, dieser Frage zu ihrem Glück (oder Unglück?) doch enthoben – ohnehin das verdummende Nachziehen von Buchstaben, von dem Schopenhauer allzu poetisch berichtet? Möglicherweise kommt der Ekel am Geschriebenen einfach von seiner Fäulnis. Immerhin bereitet kaum etwas mehr Übelkeit, als einer solchen Schrifthinterlassenschaft zu begegnen, die bloß ein Buch bleibt, ohne sich als Buch aus sich Dasein geben zu können – einer Philosophie in anderen Worten, die sich zum Buche formt und derart sich selber als ihre eigne Mangelware feilbietet, aber ohne diesen Mangel, wie sie müsste, noch in sich hinein zu buchstabieren.
Freilich ist dieses Buch als zum Markt getragene Ware unseretwegen auch das Produkt von Produktionsverhältnissen, wollen wir quellenangeben, von Produktionsverhältnissen sodann einer im Kardinalsmissverständnis sich über sich täuschenden Ware, einer Ware nämlich, die sich nicht für Ware anerkennt. Wir wissen das nicht, aber wir tun es, wie Marx recht eloquent formuliert, nichts Geringeres aussagend, als dass all das Geschriebene und obendrein seine Produktionsbedingung gar nicht, auch nicht von unsrem Buch, gewusst werden können.
Ach, wie viele Bücher könnten wir darüber schreiben, was es eigentlich ist, ein Buch zu schreiben. Dass und wie sich darin freilich mitsagt und kommuniziert, dass ein solches Kommunikat stets der Unwahrheit Kierkegaard‘scher Mengen anheimfällt und zugleich die Mangelform des Einzelnen nur allzu ausdrücklich macht, indem es sich an Mengen, Unmengen von Mengen vermittelt und dabei eben doch nur: vermittelt – all dies bleibt ihm ungeschrieben. Dass ein solches Buch kurzum nicht kann, was es will, nicht ist, was es tut, zeichnet ein philosophisches Buch aus. Ein lacan’sches Objet petit a vielleicht ist dieser Widerspruch unsrer Quellenangaben, der nicht nicht begehrt werden kann, Widerspruch nur solange, solange das Buch überhaupt beansprucht, verstanden werden zu sollen, irgendetwas mitzuteilen oder gar zu belehren. Ist unser Buch etwa eine Magrittepfeife, die keine ist, oder doch eine sein kann, wenn wir es zusammenrollen und rauchen? Freilich wäre es wieder nur das Kommunikat von einem Entschluss, jetzt zu denken oder irgendwelche Namen zu vergeben. Es wäre ein Treuebruch, eine Trahison mit Magritte, die das Image da kommunizierend, gemeinsamend, zusammend hinterlässt. Im Betrug betrug diese Trahison immer schon, was in ihr nicht aufgeht, einen jenseitigen Betrag, den sie – wie sie hauptsächlich muss – aufdeckt, gerade indem er zur Illusio die Griechen und Lateiner zeitgleich und sprachlich sehr gewalttätig zu Hilfe ruft und die Ill-ousia, die unablässige Jenseiendheit und Jenseitigkeit des Buchlichen bemerkt. Ein derartiges Sprachungetüm wie Ill-ousia ist, wie jedes Wort übrigens, selber eine solche Trahison der Verschriftlichung und ein philosophisches Buch hierdurch stets entweder Etymologie seiner selbst oder eben kein philosophisches Buch. Etymologie heißt hier nicht etwa Sprachenthusiasmus, sondern die illusorische Selbstverfassung einer Magrittepfeife. Deshalb sagt unser Sokrates bei jener platonischen Kratylosquelle auch, man müsse mit dieser Auslegungskunst der Wörter maßvoll umgehen, dürfe es weder zu bunt mit ihr treiben, noch sie gleichsam positivistisch ganz abtun (immerhin wird es schwer, überhaupt etwas anzugeben, das keine Enthusiasmusetymologie mit sich bringt, gleichgültig, wie sehr man dies verbergen mag, gleichgültig auch, ob es sich um Wörter oder anderes handelt). Bevor man von diesem Pharmakon nicht gekostet hat, weiß man – selbst etymologisch – nie genau, ob es wie im Griechischen: Gift oder Heilmittel sei. Gift ist dieses Objet petit a freilich, indem es sich als Buch niederschreibt, es mag sich auch als Teilnahme an einem Diskurs quellenangebend beruhigen und die Untauglichkeit all seiner Namen para- und hyperbolisch aufblähen, wovon man etwa beim Pseudo-Areopagita ein wunderschönes Anschauungsbeispiel findet. Buch, das nicht bloß Buch, sondern Philosophie ist, betrügt sich in seinem Betragen gleich selber mit und betrügt darin den Betrug, in seiner Tat sich selber nachahmend, wie Bonaventura sagt, doch sich nachahmend in dem, das und dass es nicht zu sein imstande ist. Deshalb erkannte auch der Absinthtrinker Stevenson, dass Jekyll und Hyde einer und derselbe sind, sein Buch nämlich, der thujonische Wahn, der unwahrscheinliche Tropfen, der – sobald er wirkt – nicht weiß, wie es kam, dies zu tun. Ein philosophisches Buch zu schreiben, berauscht daher und solange dieser Rausch ein äußerliches Tonikum bleibt, es heiße Prestige, Vorgesetztengunst, Rückvergütung, Stellenschacher und derlei mehr, wird es sich nicht um ein philosophisches Buch, nicht um ein schwarzes Malewitschquadrat handeln. Denn das Buch birst dann nicht selber an seinem Rausch. Es gibt dann nicht den Blick auf das frei, das es in seinem Buchstabieren nicht bloß buchstabieren kann.
Mit Peirce etwa quellenangebend machen wir dieses Buch und alle Bücher gerne auch zum Zeichen von Zeichen, womit genauso wenig gesagt ist, wie mit jeder anderen Quellenangabe eines Quellenangebers ad infinitum. Wir Quellenangeber sind wie der Künstler, der ein Bild malt, von einem Künstler, der ein Bild eines Künstlers malt, der ein Bild malt – die ganze Menge an Realität genügt nicht, um diesen Satz fertig zu schreiben – und doch, es handelt sich nicht etwa um einen infiniten Regress, denn der ist viel zu harmonisch, sondern um den tatsächlichen Riss, die Ruptur, die ein solches Buch zu sein versucht (man darf an diesem Relativsatz grammatikalisch getrost Akkusative und Nominative ausprobieren). Wie verrückt kommunizieren wir, in-agere, treiben hinein, Imago in magrittischer Trahison – In-ago – und imaginieren Illusionen, indem wir kommunizieren, wir Quellenangeber, treiben den stigmatischen Nagel unsrer Bücher und aller sonstigen Quellenangaben in das ruhige Feld des Realen hinein, machen es dadurch aufbegehren, sich verformen, geradezu wie ein Gravitationsfeld sich verbiegen und reflektieren, sich verdrehen, raumzeitlichen, Denken, Bewusstsein, Wissen, Zauberei oder ein Selbst werden. Das Quellenangeben lasse imaginativ als Naturalismus dabei Neuronenfelder entstehen und vergehen, Sprachen sich versprechen, musikalisieren oder mathematisieren, oder schlicht – was meist dasselbe ist – Transzendenzillusionen sich einbilden. Wie dies vor sich geht, kommuniziert sich darin genauso wenig, als sich zugleich das Nichtkommunizierte kommuniziert, zusammt, gemeinsamt – communis als Verb genommen. Das Dasein eines philosophischen Buches besteht nicht nur in genau diesem vermeintlich imaginierten Widerspruch, sondern darüber hinaus hierin, ihn immer schon überwunden zu haben, immer schon das ganz Unkommunizierbare zu kommunizieren, eben dadurch, dass es bloßer Magritteverrat und Quellenangeberei bleibt. Deshalb näht sich dieses Buch auch wie ein Viktor Frankenstein, wie im „What is it like to be“ eines Nagel und seiner Lakaien, seine Teile zusammen, indem es sich sein eignes Dasein quellenangebend sich selber zur eignen Quelle angebend und mit sich hierin angebend quellen lässt, freilich in unabweislicher Trahison dessen, was es da tut. Ein philosophisches Buch zu schreiben, ist ein unendlich regressiver Zirkel seiner selbst – und das liegt, wie sich zeigen wird, nicht am Buch allein.
Als Buchkommunikat ist eine Philosophie, bevor sie negativ, positiv oder sonstiges ist: imaginativ und muss als solche einmal in ihrer Illusio beiseite geräumt werden, einer Illusio, die sie sich zum Wegräumen in einem, einem anderen, neun oder unzähligen Anläufen wunderlich und sich verwundernd aufbaut. Es baut sich dazu auf, sich wie von Zauberkraft darin freizulegen als das Illusorische nämlich, als Angeberei von Quellen, die nur im Angeben welche sind, aber ohne die sich das Buch nicht kommunizieren würde. Bernoulli, um wieder quellenanzugeben, sprach in dieser Hinsicht etwa von einer Spira mirabilis, Chalmers von einem hard problem of consciousness, einer consciousness, die hierdurch sich kommunizierend selber Illusio wird.
Wer Bücher schreibt, ist ein Quellenangeber – und das Buch ist obendrein aber jene Quelle, deren Existenz zeigt, dass nicht nur, wer Bücher schreibt, einer ist. Denn es macht uns alle zu Bücherschreibern, zu Verrätern und Betrügern der Kommunikation, die, gleich dem Kapital, der Negation, der Differance und gleich allem Gleichen, den Eindruck erweckt, sie wäre einzig nach den Quellen möglich, die sie für sich angibt, verdeckend (dies Verdecken ist ihr Betrug), dass sie nicht sie, sondern mit ihnen angibt. Das Quellenangeben, eine ursprünglich synthetische Seifenblase, vermittelt das Buch als dasjenige, das Quelle von nichts Andrem als jener Frage seiner selbst zu werden imstande ist. So ein Quellenangeben, so ein Buch wird daher nichts als Bücher hervorbringen, an anderes rührt es nicht. Doch gelingt es ihm hierdurch gerade als Buch, dies Nichtrühren all dessen, das kein Buch ist, zu berühren und in der Selbstaussage über sein eignes Nichtkönnen das unendliche Feld der Quellen, nämlich, dass alles Quelle sein kann und ist, zu erschließen.
Dies freilich teilt das Buch mit allen sonstigen Quellenangebereien, sodass es gar darüber schreiben kann: auch nicht einmal ein Buch sein zu können und sich selber also in seinem Mangel ernster zu nehmen, als alles andere, wodurch es eben ein willkürlicher Entschluss bleibt, ein biographischer Funke gleichsam, ein solches Buch zu schreiben – und der ist um nichts unwürdiger, als alle anderen großtuerischen Quellenangaben und Quellenangebereien. Es ist etwa auch Augustinus in seinem Wissen um das sich buchhaft selbst zerstörende Evangelium diesen funkensprühenden Weg mit seinen Confessiones gegangen. Sein eigenes Leben musste ihm als Quelle der Existenz seiner Bekenntnisse dienen, die als Buch verfasst hinwiederum das nicht leisten, was sie angeberisch zu leisten vorgeben und dies in philosophischer Manier mit zum Buche machend, doch noch leisten. Wenn ein Quellenangeber schon sonst keine Quelle hat, so hat er sich selber. Das freilich reicht zur Philosophie genauso wenig hin, wie das gelehrt tuende Ergehen in Lebensbeschreibungen, Motivforschungen, Psycho- oder Epochenanalysen, das höchstens für ein gewisses angeberisches Einschüchtern anderer taugt, die hiervon unvorbereitet ins Quellenangeben hineingezogen werden und derart nicht wissend, was hier geschieht, überfordert in den Fieberwahn fallen – den gleichen Fieberwahn wie den der Quellenangeber selber. Immerhin ist das Quellenangeben hoch infektiös.
Überhaupt ist das philosophische Buch dieses unablässige Zuwenig alles durch es Gesagten – und die Aufforderung hierzu in einem. Wie Augustinus könnten alle Quellenangeber, auch wir, die eigne Biographie illusorisch zur Quelle für irgendetwas nehmen, und hätten damit sogar noch mehr getan als diejenigen, die die Biographien anderer zur Quelle ihrer eignen machen, sie seien Vitenschreiber, Buchgelehrte, Archivneurotiker, Medienkommentierer, Wissensbeamte an Schulen, Universitäten, Rednerpulten, auf öffentlichen Bühnen aller Art, in einem Wort wiederum: Quellenangeber. Natürlich müsste sich jetzt wieder in seiner Existenz unbeschreiben, wie ein Buch dazu komme, all das zu sagen, ohne es doch zu sein, und doch dies alles zu sein, was es nicht sagen kann, wodurch es erst zu seiner Form als Buch gerät.
Die Liste, wie es kommen könnte, wie es gekommen sein könnte, dieses Buch zu schreiben, ist lang, die Quellen zahlreich und vielfältig in ihrer Beschaffenheit, seine eigene Angeberei daher vorbestimmt. Wo wir in diese ganz äußerliche Liste einsteigen wollen, es lassen sich bestimmt Quellen – und seien wir sie selber – dafür angeben. Angeberei sucht daher emsig, die unablässige Auflistung dieser Liste ihrer Quelle einfach irgendwo abzubrechen. Sie sucht emsig, das unüberschaubar Ungesagte, weil Unsagbare, durch diesen Abbruch zu verhüllen. Das geschieht, wenn man ein Buch schreibt. Freilich, das Buch kann sich von dem, was es da tut, selber lossagen, kann sich – wie hier – im Geschrieben- und Gelesenwerden als Quellenangeberei identifizieren und schon alleine darin als untauglich erweisen, auf diese Weise aber selber wieder durch und durch doch schaffen, was ihm unablässig misslingt. Bis es dazu kommt, sich in diese Buchform zu gießen, ist schon unzählig mit Quellen angegeben. Zu glauben, man könne von einem äußeren Referenzpunkt beginnen, das Denken, Wissen, Gelehrtsein von Null weg starten, war nicht nur einer der Grundirrtümer der sogenannten Aufklärung, er nenne sich auch Vorurteilsfreiheit, Objektivität, reines Auffassen und heißt dabei doch nur wieder, schon mit versteckten Quellen anzugeben, sondern hat unzählige weitere Gesichter. Nicht zuletzt von Adorno und anderen wurde es daher für das entlarvt, was es war und ist: Inanspruchnahme von Quellen. Wer sich in Form einer Buchphilosophie äußert, wurde hierzu allein im Quellenangeben fähig, gleich, wie das Dasein des Buches aus irgendwelchen Quellen und mit sich angebe, sie seien Produktionsverhältnisse, Selbstbewusstwerden der Geschichte, Zeichen von Zeichen, Verrat und Betrug, Biographie eines Individuums, wissenschaftliche Gelehrsamkeit oder ähnliches, das man noch ad infinitum angeben könnte.
Die ganze verbuchte Existenz ist hierdurch eine der Bildung. Dieses Wort, wie es sich hier ins Buch hineinbildet in seinem Bilderverrat, es bezeichnet den Fall dieses Buches ebenso, wie den Fluss seiner Quellen. Es ist als Kommunikat niemals aus sich selbst Schöpfendes, aus sich selber Geschöpftes, sondern stets Gebildetes, solches, das gebildet wird: aus Quellenangabe. Das Buch ist ebenso sehr Bild, Abbild dessen, das es (Nominativ und Akkusativ) nicht tun kann, wie alles Gebildete wesentlich dadurch gekennzeichnet bleibt, dass es sich nicht entspricht und – je gebildeter es ist – sich umso weniger entspricht. Die Sucht und der Trieb zur Identität, zur Harmonie, zum Ausgleich, ja zum Gleichheitszeichen, sie sind eigentlich, was man Unbildung nennt, die Defizienz nicht zu ertragen und als gebildet nicht ertragen zu können, sondern sie mit Schichten, Lagen, kurzum: Quellen zu überlagern in der Hoffnung, ihr Schimmer möge im letztlich harmonisch ausgeglichenen Ganzen nicht mehr durchblitzen. Was sich bildet, baut und formt aus Quellen orthopädisch aufgerichtet einen Andrysbaum zum griechischen Orthos. Bildung formt aus herangeschafften Quellen gleichsam einen porphyrisch wuchernden Dihairesenbaum, einen Baum, dem wurzelnd dann solche Bücher hervorquellen können und der umgekehrt hierdurch selber eine gebildete Quelle bietet, all dies jetzt gerade über ihn zu sagen – als wäre er auf den Kopf gestellt. Alles wird zur Quelle. Quellenangeber sind solche Orthopäden, Bildner, Bauer und Errichter eines Orthos, eines Richtigen, Rechten, Gebilligten, Hervorgequollenen eben. Solch ein orthopädisch Gekrümmtes, Verbogenes, Berichtigtes und derart Gebildetes ist jedes Kommunikat. Es bildet sich aus Quellen und seine Quellen vice versa sind diejenigen seiner Bildung, von ihr wiederum errichtet, entdeckt, erforscht, angegeben.
Kommunikat dessen zu sein, das da bildet und sich zur Bildung bildet, kann nun in seiner Selbstermangelung sich dazu bilden und den gleichsam interimistischen Entschluss fassen, ein Buch zu schreiben. Dies Buch hinwiederum, es wird erst dadurch ein philosophisches, dass es nicht allein seine Quellen und so sich als gebildet angibt, sondern als sein eigenes Chaos darin scheitert, anzugeben, wie dies alles, wie es selber kam. Mehr noch, es wird dadurch ein philosophisches, dass es sich selber als seine eigene Quelle angibt, ohne hierzu je fähig zu sein – in dieser Unfähigkeit aber sich nur weiter angibt.
Es ist daher ein Grundirrtum all jener, die Bücher schreiben, dass Bücher und sonst Geschriebenes bildeten, belehrten oder Erkenntnis förderten. Sie tun einem dies, man schreibe, lese oder rauche sie etwa als Pfeife, höchstens an, sie tun es aber nicht. Die gesamte Bildung, sie bilde sich beispielhaft hier zum Buch, der unüberschaubare Kosmos der Quellenangeberei, er bilde sich nur und ausschließlich darin zur Philosophie, dass er in und gegen sich gebildet scheitern lernt, misslingt, endet zu jenem unsagbaren Interim, dem es tatsächlich gelingt, in alledem nichts von alledem zu sein: dies Buch.
Bildung ist erst dort Philosophie, wo sie sich von ihrer Quellenangeberei loskettet – und zwar mit der wunderlichen Hilfe gebildeten Quellenangebens selbst, welche Form dies auch immer annehme – wo sie gleichsam in dies Verborgene, Kryptische, Kalyptische ohne Grund und frei, non sequitur, vordringt, in das Sokratesnichtwissen, von dem das Buch die Quelle angibt und hierin, weil sprachlos, bloß angeberisch tut. Quellenangeberei dient diesem Weg, dies Buch durchs Buch hinter sich zu lassen, nicht zu wissen, wie alles, wie selbst sein Dasein kam, hierzu gerade gebildet und geschickt gemacht: von einer zu sich durchgebildeten wunderlichen sinnlosen Bildung. Daran entzündet es sich, dass Philosophie gleichermaßen absolut ist in ihrem Non sequitur, ihrem revolutionären Existieren, wie in ihrem leeren, namenlosen und unvollendeten Herumreflektieren. Bevor man sie jedoch vollzieht, weiß man es nie ganz genau. Glücklich also sind all die kuhnreichen Tage, in denen man sich überwinden kann, etwa an eine Struktur wissenschaftlicher Paradigmenwechsel oder an ähnliches zu glauben. Nicht, dass es solche nicht geben könne, nicht, dass man nicht sogar eine solche Struktur anzugeben imstande sei, doch es bleibt dabei der äscherne Beigeschmack, dass es weder um diese Struktur, noch um den Wechsel, noch um das Paradigma überhaupt gehe. Deshalb kommt ja das meiste, kommen zumal die meisten Bücher, nicht zum gebildeten Scheitern ihrer Bildung – und damit gar nicht zur Bildung. Denn wir Quellenangeber meinen vielleicht, Bildung wäre das Hervorquellen ihrer selbst, etwa bis an den Punkt, an dem sie ein Buch schreibt, einen Vortrag hält, eine Maschine baut, Materie formt, Bewusstsein oder Wissen generiert, zu Handlungen treibt oder davon abhält. Wir meinen vielleicht, es kommuniziere und bilde sich in ihr ein stets geschickteres Umgehen mit dem Gebildeten, Wissen, Wissenschaft oder dergleichen. Doch dann handelt Philosophie gar nicht. – Denn bei aller Bildung zur Wissenschaft meinen wir immer schon, das Nichtwissen bereits zu kennen, zu beherrschen, ja meist gar bekämpfen zu müssen. Doch stellt dieser seltsame Stand aller Quellen, aller, die kommunizieren, in seiner paradiesesschuldlosen Unquelle vielmehr ein Stehen dar, das weder weiß, noch nicht weiß, ein Stehen, das keine Ahnung davon hat, erst und einmal das Nichtwissen lernen, kennenlernen, bilden zu müssen.
Dass wir das Wissen und die Kommunikation erst noch zu erlangen haben – denn in nichts anderem besteht sie uns Quellenangebern – das Nichtwissen aber immer schon kennen und vor allem können würden, stellt den hauptsächlichen unserer vielen Grundirrtümer dar: Bildung bildet zum Wissen, Nichtwissen kannst du aber immer schon, sagt die Quellenangeberei. Dass fähiges und potentes Nichtwissen erst und im Durchgang durch die Bildung möglich, ja gleichsam erlernt wird, geht ihr nicht auf.
Das philosophische Buch demgegenüber bildet und legt einen Weg, durch seine eigne Bildung, Formung und Erscheinung wissend zum Nichtwissen zu geraten, als die höchste Kunst und Fähigkeit der Bildung gleichsam, nämlich derjenigen, sich von den eignen Quellen, jenen, die hier, an diese Stelle, in genau diese Worte führten, loszusagen. Wäre man daher Pythagoreer und wollte angeben, könnte man ein solches Buch als gebackene Mandelbrote in Hausdörffern – mit bewusster Umschreibung wie in der Differance – und so weiter bezeichnen, Imago fürs Bilden, In-Ago, ich treibe und dränge hinein ins gebildete Nichtwissen. Ein philosophisches Buch muss Fraktal sein.
Verwundert ein solches Buch mithin in jenes Nichtwissen hinein, seine einzige echte Bildungstat, quellenangeberisch sich loszuketten von allem, das es bildete, mit jedem Wort nämlich, jedem Gedanken, Empfinden, Wollen, Sprechen und Handeln das es loskettet, befreit von seinen Quellen, zu denen es im geraden Moment des Loskettens selber wird und gehört, dann wird dies Wunder frei. Dies Erstaunliche spricht dann in seiner ganz eigentümlichen Grammatik, die keine Quelle, auch nicht sich selber, anzugeben weiß und hieraus erst anhebt, sich zu Werke zu tragen. Nichts von alledem, das dem Buch bloß als seine Quelle quillt und auch dies Nichts nicht einmal kennt so ein Staunen in seinem Prometheusfunken. Wenn Kant daher sagt, wer Wahrheit sucht, verlange Vorgänger, so verlange er sie nur und vor allem zum Behufe der Selbstzerbildung ins wunderliche Nichtwissen.
Das Philosophische, indem es sich zum Buche bildet und darin stets riskiert, selber bloße Quellenangeberei zu bleiben und Quellenangeber hervorzubringen, es wird im Risiko, sein Prometheusfunke könnte verglimmen, ehe sich an ihm das Nichtwissen entzündet. Es gerät aus der Bildung, der es entquillt, zum Intimsten, Entblößtesten, Realsten, Persönlichsten, ergreift das Unsagbare selbst in seiner Wurzel und – sagt es.
Es spricht in scheiternden Anläufen. Entblößt, bar seiner Quelle und wahr anstatt richtig, hat es sich allein darin, dass seine Vermittlung, seine Kommunikation, seine Bildung zerschellt, indem sie sich vollzieht, in welchem Akt jeder selbst erstaunt nichtwissend die Philosophie sich zuzieht und ihr zu Diensten wird. Ein philosophisches Buch, wenn Philosophie also sich dazu bildet, sich ein Buch zu schreiben, kann niemals als eine Schrift gleichsam über ein Thema stattfinden, wie überhaupt keine Philosophie eine über etwas oder von etwas ist. Sie ist es – und bildet sich darin zur Befreiung vom Quellenangeben – oder sie ist (noch) keine Philosophie. Niemand versteht oder begreift daher ein philosophisches Buch und niemandem ist es überhaupt Philosophie als demjenigen, der daran mitgewirkt hat, der – ohne zu wissen, wie dies kam – in es hineingeraten und von ihm gebildet ist. Was uns derart Quellenangebern als das Unsagbare, Unangebbare erscheint, kommt wie die Paideia im Höhlengleichnis über uns, lässt im Sturm jenes Entblößte als das Unkommunizierbare ganz zurück, von dem freilich allerlei gefaselt wird und das doch niemand kennt als der, der von ihm angetan und affiziert ist. Als das Unkommunikat bleibt es freilich allein den Quellenangebern übrig, denen wir uns mit diesem Buch einreihen, egal, wie wir daran herumhantieren. Das liegt aber am weiterhin uns allen zustoßenden Fehl des Quellenangebens. Wer tatsächlich mitwirkt, findet das Unkommunikat, das Unzusammen des Buches offen daliegend, gar nicht verborgen, versteckt oder unmöglich. Wer dies Buch als Quelle angibt, sich von ihm und damit ihr zu lösen vermag und so gebildet daran mitwirkt, erschließt in diesem Schluss, empfindet in diesem Gedanken, verzaubert in diesem Geschehen, erspricht zu dieser Erfahrung und so fort. Den gebildeten Quellenangebern, die endlos im Buch verharren, muss dies Unkommunikat hinwiederum selber als solches in der Bildung dieses Buches, mithin als Buch gesagt bleiben. Jeder seiner Buchstaben ist dann eine unendliche Quellenangabe, die aus sich, die aus dem Kommunizieren und dem gebildeten Zusammen nicht zu eigentlichem Nichtwissen hinauskommt. Denn dafür braucht sie dich.
Das Unkommunizierbare des Quellenangebers ist nur ihm selber und allen Quellenangebern eines. Soweit sich ein Bilden und Einbilden bildet, kommen wir auch im Buch. Soweit wir einander zu verstehen, aufzunehmen, anzugeben imstande sind, gedeiht, wächst, sprießt und springt die Quelle. Unsre Bildung ist es dann, zur Quelle fähig zu sein. Was nicht kommuniziert ist, bricht uns Quellenangebern aus dem harten Fels des Unbemerkten gar nicht hervor. Uns quillt ohnehin nur, wozu wir gebildet sind von den Quellen, die da quollen – die seltsame Bodenlosigkeit der Bildung, die ihr so viele verschiedene Gesichter prägt. Schneidet sie sich daher ein Stück Dasein in Buchform heraus, bricht und verbiegt sie sich zu sich selber bildend ihre Bildung in Worte, Wörter und so weiter (der Zusammenhang von „Worte“ und „Weiter“, weitersagen, weitertreiben, inagieren, imaginieren wird hier allzu spürbar), dann sind damit ihre Quellen und sie als Quelle zwar schon vorbereitet, zugleich aber unsagbar, was daraus werden werde. Wenn wir uns nämlich lossprechen von der Quellenangeberei, die sich dieses Buch bildete und die es bildete, vom Buch selbst wissend geschickt gemacht los ins wunderliche Nichtwissen, dann erkennen wir dies Buch gleichsam als umgedrehtes Vorzeichen, als Negatives all dessen, das es sagt. Das Positive, wollte man mit Schelling weiter in quellenangeberischen Wörtern reden, sind allein wir, die daran mitwirken. Das ist das Schicksal eines jeden philosophischen Buches, sein Kern und seine flatterhafte Essenz. Alles andere wäre Angeberei.
Wo Hölderlin daher – selber freilich in einem Buch – seinen Hyperion singen lässt und wir als Quellenangeber mit einstimmen, dass der, der diese Begeisterung nie erfuhr, nicht einmal zum Niederreißen gemacht ist, geschweige denn zum Aufbauen, spricht er selber übers Quellenangeben. Wir möchten hinzufügen, er habe dabei beispielsweise den panischen Descartes im Sinne, dem in seinen Passions die Admiration am Beginn von allem, anfänglich und doch unhabbar steht, er erst durch sie ins Zweifeln hineingeriet und dann verloren nach einer Methode der Gewissheit fragen konnte, nicht so sehr im Ruf, sondern in einer Bitte. Deshalb wurde Descartes, wurden andere, vielleicht von Quellenangebern zu Bildern und Bildnern einer Methode gemacht, selber aber blieben sie erstaunt flehende Nichtwisser. Dasselbe könnten wir freilich von vielen und vielem noch angeben, doch wozu?
Es dürfte uns, hierzu gebildet, mittlerweile langsam dämmern (und damit ist freilich nicht bloß dieses Buch gemeint), dass unsre, dass jede Bildung wesentlich sich dazu bildend sich zurückzulassen als ihre eigne Quelle und dabei stets zugleich sich selbst diese kommunizierte Vergewisserung über sich zu produzieren vermag. Indem sie von sich selber nicht lassen kann, den letzten Schritt aus sich hinaus nicht tut, bleibt sie die durchdringlichste Quellenangeberei, ausdrücklicher als sonst wo, sie nenne sich Wissenschaft, ja das Wissen selber, Erfahrung, Beobachtung, Daten, Informationen. All dies, das bereits von ihrer Bildung bestimmt ist und das sie höchstens technisiert, praktiziert, zu ihrer eignen Bildung weiter ausübt und verbreitert, bleibt die Bildung dann, kurzum: die panische Rückvergewisserung über sich, den Kerker ihrer Selbstangabe und -angeberei, sie nenne sich auch Tradition, Revolution, Willkür, Selbst oder dieses Buch.
Wollte man daher mit einer Quelle angeben, stoßen wir Quellenangeber hierin auf dasjenige Wesen der Bildung, das Platon schon in der Zwillingsgeschwisterschaft von Sophisten und Philosophen benannte. Denn, was Bildung ist, bildet sich zu jenem Scheidepunkt – auch dieses Buch ist so einer – an dem der Reflex ins Wunder und damit das Mitwirken an dieser Bildung, ihre Wirklichkeit entweder geschieht, oder stattdessen eben das Quellenangeben sein volles Maß erreicht (und wie jedes volle Maß trunken macht von sich, mehr verlangt von dem, das es da berauscht). Freilich ist beides dasselbe und dadurch eben nicht dasselbe. In diesem sich zur eignen Entfesselung sich bildenden Interim wirkt das Buch, dadurch es durch sich als grammatomystisches Vehikel nicht mehr das Buch ist, das da wirkt, wenn von Philosophie die Rede ist. Wovon wir dann freilich noch sprechen können, davon ist nichts und damit ist nichts anzugeben in so einem Buch – und so in keiner Art quellenangeberischer Bildung. Von der Philosophie selbst lässt sich quellenangeberisch, in einem Buch etwa, nichts weiter sagen, als dass sie sich zu sich selbst befreie durch ihre Bildung und dass im selben Akt ein Überwinden dieser bloßen Bildung stattfindet. Wie der Münchhausen zieht sie sich aus dem Sumpf durch ihr Scheitern und legt frei, legt offen, tut kund, was sie ist, ohne sich oder mit sich angeben zu können. Darin ja erscheint sie uns Quellenangebern stets als Wahnsinn, als grobe Verrücktheit, als närrischer Kauderwelsch und bloßes Gerede. Ihre eignen Quellen vermögen nicht, sie anzugeben und vice versa. Philosophie spricht nicht die Sprachen ihrer Herkunft, bildet nicht die Formen ihrer Tradition, erscheint nicht in Imitaten einer Kommunikation, so intim wird sie. In ihr Spuren, Versatzstücke, Überbleibsel ihrer eignen Bildung zu entdecken, mag ein unschätzbares Verdienst der Quellenangeber sein, doch sie dringen derart nur immer zu ihren Quellen, zu ihrer Bildung und ihren trügerischen Magrittebildern vor, die – ceci n’est pas – von sich sagen, sie wären nicht, was sie sind oder umgekehrt. Was sich als Philosophie demgegenüber tatsächlich kommuniziert, verwundert schon allein dadurch, dass Sprache, Kommunikate, Bilder dafür stets fehlen oder im unüberschaubaren Übermaß vorhanden sind. In ihrer Bildung hinwiederum besteht der Prozess der Bildung von Quellenangabe und -angeberei, wodurch das Philosophische, etwa im Guss eines Buches, wieder weicht, höchstens sein Duft noch übrig bleibt als Gelehrsamkeit, die – wie hier – gerade das Fehlen aller Kommunikate als die eigentliche Sprache der Philosophie erzählt. Daran ja liegt die so oft gerügte Unverständlichkeit der Philosophie und die zugleich einhergehende Gier nach Verständlichkeit, nach Vergewisserung, ja – in manchen ihrer Erscheinungsformen – nach Zertifizierung, cartesischer Vergewisserung. Descartes und andere mögen Clare und auch Distincte gebettelt haben, unentschlossen im Zweifel, ob sie lieber Sophisten oder Philosophen, lieber gebildete Quellenangeber oder zerbildete Wunderliche seien, denn sich zu zerbilden ist das Vorrecht jeder Philosophie, die diesen Namen verdient. Doch wieder andere dagegen rufen angeberisch durch alle Welt nicht Clare et distincte, sondern: Certe! Certe! Dreimal Certe!
Die Zertifizierung, Vergewisserung, Rückvergewisserung und Sicherung, nicht nur von Quellen, sondern vor allem die Zertifizierung ihrer Angeber, besteht damit im Sammeln, Zusammenstellen, Aufzählen und Wiederverwerten von Quellen zur Bildung. Es überrascht nicht, dass solcher Bildung nicht nur eine gewisse Zweifelhaftigkeit, sondern eine blutlose Langeweile innewohnt – derselbe Ekel, von dem wir eingangs sprachen. Solche Langeweile kann sich zu Zeiten bis zur Lächerlichkeit ausdehnen, wenn mit Quellen angegeben wird, als würde aus sonst leerer Spielzeugkiste erstmals das Runde durchs Loch geschoben werden, sodass das Begreifen dem Beschreiben, das Begründen darin dem Aufzählen weicht. Die Bildung hierzu besteht dann überdies darin, alles Quellen bis auf ein einziges zu tilgen, in dessen Widerspruchsfreiheit man es sich fortan gemütlich mache, wie überhaupt das Beiseiteschaffen des Widerspruchs – der nur dem Quellenangeber einer ist – ein Hauptgeschäft der Zertifizierung als Quellenangeber darstellt. Wenn auch, wen auch und wem auch das Zertifikat sich zum Papier, zu anderem Material, zur Anerkennung, zur Vergesellschaftung, zur Vorgesetztengunst, zum Buch, ja zur Wiederzertifizierung und damit zum Spielzeugzirkel sich bilde, es spielt dabei im Kern die Rolle einer Kommunikationsgewissheit.
Solche Kommunikationsgewissheiten, solche Zertifizierungen, versichern, verfestigen, zementieren anhand irgendwelcher Quellen, die sie aus ihrer Bildung sich bilden, zu einer Kommune. Derartige Quellen quellen gebildet aus ihrer Bildung und je vergewissernder sie sich kommunizieren, desto gebildeter auch ihre Kommunikation. Sie schaffen ein solches Zusammen (Zusammen ist hier durchaus als Verb zu verstehen), Kommunen, die sich in ihrer Bildung aus bereits gebildeten Quellen speisen und dieser Art nichts Anderes denn ihre eignen Quellenangaben als ihr Zusammen bilden. Was kommuniziert, quillt, was quillt, kommuniziert – und hierüber sich zu vergewissern ist die Kommunikation einer Kommune selbst. Glauben wir etwa dem Angeber Watzlawick, man könne nicht nicht kommunizieren (für jetzt unhinterfragt, wie ihm diese Negativität seines Kommunikats möglich war), dann gibt es nichts mehr als das Zertifikat, nichts mehr als eine sich durch ihre bereits gebildeten Quellen rückversichernde Bildung. McLuhan hat dies damit, dass das Medium schon die Botschaft sei, ebenso in den Blick genommen, wie Austin oder Zizek – Quellenangabe zugegeben.
Dem Certe wohnt auf diese Weise ein ganz eigener Horror inne, mag es auch so unscheinbar, ja freundlich und zugeneigt daherkommen. Denn nur, was es sich selber kommuniziert, zur Kommune macht, was es als zertifizierte Bildung längst schon einzementierter Quellenangaben selber wieder zertifiziert, das ist ihm überhaupt Kommunikation. Hierher quillt ja die Pluralität der Kommunen. Sie bilden sich als gebildet aus ihren eigenen Kommunikaten, sprachspielerischen Lebensformen etwa, wie Wittgenstein sie nennt, die sich freilich selber quellenhaft vorweg gehen und weder durch die Begriffe Sprache noch Kommunikation oder Bildung erschöpft wären. In letzteren zeigt sich vielmehr ein weiteres Mal, wie auch ein Buch dazu geächtet ist, Kommunikat einer Kommune zu sein, dadurch es als Buch quillt. Bildete es sich zu einem ganz andren Kommunikat und hierdurch eine ganz andre Bildung, stets ebenso wie der Seemann, der im Ruf „Die Leinen voraus“ sich seine eignen Quellen vorweg gebildet hat durch seine sie erst auffindenden Kommunikate, so würde dieses Buch – dann freilich nicht mehr Buch – einer ganz andren Kommune angehören. Die Kommune letztlich kommuniziert autokratisch ihre Kommunikation. Auch dieses Buch ist nicht anders, solange es als kommuniziertes Quellenangeben genommen wird. Als gebildetes Kommunikat hat es seine kommunalen Spielregeln ebenso, wie alles andere Kommunizierte. Denen nun durchs Buch selber schlicht zu widersprechen, ändert hieran nichts, denn auch wenn die Kommune gegen ihr Regelwerk, ihren Zeitgeist, ihren Mainstream, ihre Öffentlichkeit und wie sich dies alles sonst noch bezeichnen mag, ankämpft, bildet sie sich nur einen Gegenzeitgeist, einen Gegenmainstream und eine Gegenöffentlichkeit. Bloßer Widerspruch hat das Kommunikat schon akzeptiert, Widerspruch hat es integriert, ist davon infiziert.
Der Widerspruch bleibt ebenso Quellenangeber, wie sein Widersprochenes. Die unüberschaubare Galerie von Affirmationen, Negationen, Vergleichen, Abwägungen und so weiter in der Quellenangeberei ist ein Zertifikat hiervon. So lehnt auch dieses Buch die Quellenangeberei keineswegs gleichsam radikalskeptizistisch, relativistisch, dogmatisch oder solipsistisch ab. Es geht mit ihr selber zu Werke, als eins ihrer Kommunikate, und mit ihren Spielregeln über sie hinaus – doch wie? Das und damit kann dieses Buch gar nicht angeben. Dafür braucht es dich.
Es kann sich als Kommunikat höchstens anbieten, mit ihm zu hantieren, es wegzulegen, zu vernichten, es auszustellen, zu ignorieren, seine Aufforderung dennoch nicht abweisen zu können – denn immerhin ist es kommuniziert – es von innen heraus zu bilden, sich nach seinem System zu fragen, einer Systematik Absage zu erteilen, eine Reihenfolge festzulegen, zu ändern, umzustürzen, es als Rätsel zu lösen und die Hinweise zu entdecken und richtig zu deuten oder als gar nicht rätselhaft schon offenbar vor sich zu haben. So eine Liste ist gleichermaßen lang wie unnötig. Denn wer teilnimmt an diesem Buch, wer mit ihm philosophiert, wird wissen, was zu tun ist – und wenn nicht, ändert das auch nichts, denn dass sich nichts ändert, ist das Philosophische, durch das sich alles ändert.
Philosophie, die sich einer Kommune kommuniziert, d.h. Quellenangeberei, die ihre und mit ihren eignen Quellen sich von ihnen allein durch sie abstoßend angibt – und sei diese Quelle auch sie selbst – kann als Kommunikat einzig das tun, was philosophische Kommunikate tun: ihr Kommunizieren zu kommunizieren. Nichts Andres bildet dieses Buch, bildet ein philosophisches Buch (Nominativ und Akkusativ) solange es kommuniziert, wie es muss, im Durchgang durch seine quellenangeberische Bildung. Das Buch, Quellenangeber, bildet an genau dieser Stelle. Es bildet in genau dieser Niederschrift übers Bilden und Quellenangeben. Es bildet: hier.
Wenn wir also quellenangebend über die Kommunikation unsrer Kommunikation kommunizieren und so der Kommune uns als das, was dieses Buch ist, sie zugleich überwindend angehörig machen, lässt sich nur das kommunizieren, was quellenangeberisch zum Kommunikat sich bilden lässt. Worum es eigentlich geht, bleibt auf diese Weise höchstens ankommuniziert, angetan, selbstreferentiell missgelungenes Interim der empirischen Willkürsgrammatik eines Menschen. Oder auch nicht.
Das philosophische Kommunikat, wie kommuniziert es eigentlich, wenn es sein Kommunizieren kommuniziert, ein Buch über sich selber schreibt, eine Kommune anstiftet, sich kommunikativ an sie ausliefert, anstatt alles für sich zu behalten, wodurch dann aber ebenso keine Zerbildung seiner Bildung wäre? Solch mittelbegriffliches Fegefeuer bleibt ihr nicht erspart, doch ist der Kern des philosophischen Kommunikats, dass es sich dazu durchkommuniziert, niemals das zu sein, was sich da kommunal bildet, in seiner ganzen Bildung nie bloß Bildung zu sein. Dieses Nichtsein dessen, das sich kommuniziert und die Mitbildung eines solchen Nicht, das dem Kommunikat ebenso entquillt und zugleich – im vom Folgestrich aus drittnächsten Wort kommunizierend – eben auch: nicht, eins, zwei, drei, ist selber ein bloßes Kommunikat, und ein wirklich Kopfschmerz bereitendes obendrein, wenn mit ihm angegeben wird, anstatt mit ihm zu wirken. Der Sophist ist eben dort am größten, wo er beinahe Philosoph ist. Umgekehrt aber auch der Philosoph dort am kleinsten, wo er am wenigsten Sophist zu sein glaubt.
Daher sind an diese sagbar unsägliche philosophische Kommunikation, diesen Wahnsinn, Sinn im Wahn und stets wähnender Sinn, nur ihre eignen Kommunikate, diejenigen des Kommunizierens also zu richten, mehr vermag sie nicht. Der Keim der Philosophie allerdings wartet in allem Kommunizierten, so sehr es quellenangeberische Kommunen bildet, die Quellen seien, welcher Art und Zahl, welchen Namens und welcher Bekanntschaft sie wollen. Die philosophische Kommune wird sich immer ihrer eignen Kommunikation als Kommune zu stellen haben, wo Philosophie, wo durch ihre Bildung ihre Zerbildung anbricht, wo sie etwa in dieses Buch sich angibt und doch sich selbst dadurch geschickt macht, als dieses Buch sich über sich befragend zugleich sich über sich hinaus zu bilden. Daher:
Muss Philosophie verständlich sein?
Eine solche, wie jede Frage nach Verständnis – was immer man mit diesem Begriff assoziiere, denn meist ist es nur eine Assoziation – bildet sich freilich selber schon aus der ganz bestimmten Quelle, dass sie verstanden wird, ohne wahrscheinlich selber zu verstehen, was Verständlichkeit bedeutet und was sie von ihr will. Können wir verstehen, was wir wollen, wenn wir nach Verständlichkeit fragen? Ist es eine bestimmte Form? Ist es ein bestimmter Inhalt? Ist es ein gewisser Affekt, der uns glauben macht, wir verstünden? Ist es die widerspruchsfreie Rekonstruktion? Verstehen wir dann, wenn wir von etwas in den Stand gebracht werden, es nachzuahmen – geistig, handelnd, sprechend, es ist dies alles eins? Heißt Verständnis des Kommunikats Regelfolgen, Gesetzesachten, Befehlsausführen? Ist es bei Büchern oder sonstig Geschriebenem vielleicht eine bestimmte Anzahl und Art von Wörtern?
So eine katalogshafte Zusammenraffung von Fragen lässt sich freilich beliebig erweitern. Gedreht und gewendet wird sich dabei das Verstehen selber als sein eigenes und größtes Problem herausstellen, indem es zunächst einmal verstehen müsste, wann man versteht. Und gleich, welche Bestimmung es sich dabei geben mag, oder wie es sich nennen mag als Kommunikat: verständlich, begreiflich, nachvollziehbar, klar, deutlich, gewiss – und worin es sich diese Unterschiede selbst wieder verständlich zu machen gedenkt, es versteht sich, wenn es sich nach Verständlichkeit fragt, selber nicht. Als die Quellenangeber, die wir sind, wählen wir den Begriff „Verstand“ übrigens in Reminiszenz an Fichte und seinen Hinweis auf das Zumstehenbringen, das sich darin ausdrückt, ohne freilich selber zu verstehen, was da wie zum Stehen gebracht wird im Verstehen. Deshalb enthält dieser Begriff vielleicht auch im Deutschen die erstaunliche Vorsilbe „ver-“, irgendwo eine Hegelsche bestimmte Negation ausdrückend (wir können das Quellenangeben nicht lassen, wenn wir kommunizieren) – die also in etwa meint, dass das durch sie Negierte zugleich zur Bestimmung dieser Negation wird. So kündigt das Verabschieden bereits das Wiedersehen an, insofern sich der Abschied darin negiert, das Verlernen sowohl Gelernthaben als auch Wiederlernbarkeit, das Verstehen die Verflüssigung (wieder so ein Quellenangeberwort) dessen, das es zum Stehen zu bringen gedenkt, im Ver- seiner selbst.
Kommunizierend können wir uns freilich unablässig in einer solchen Wortkrämerei der Verständnislosigkeit aufhalten – und tun dies als Philosophen auch – da uns die Wörter und alles, das sich in ihnen zu ver-wörtlichen strebt, in die Verständnislosigkeit zerfließen müssen, wenn wir verstehen. So etwas unter der Forderung von Verständlichkeit zu vermeiden, mag dem gebildeten Quellenangeben mit seiner Frage nach Definition, Namen, Eigenschaftskatalog, Setzungen … stets möglich sein, hält aber die Sturmflut und Brandung des Philosophischen an und von ihm ab. Da nimmt es im wahrsten Sinne des Wortes nicht Wunder, dass einer hierdurch so gar nicht verwundernden Philosophie, die damit eben gar keine Philosophie ist, dann unter dem gewaltsamen Diktat allzu verständlicher Kommunikation die Kürze, die Einfachheit, die Nachvollziehbarkeit und sonst derartiges ihrer Kommunikate in all den Kommunen groß werden. Da zum Kommunikat die Verständlichkeit, Teil- und Mitteilbarkeit in hierdurch erst gemeinsamer Bildung gehört, rücken ihre Schattenbilder mit ihr in die Kommunikation. Dann lässt sich in der quellenangeberischen Bildung viel vom Primat der Kürze, vom Vorrang des Einfachen, des Leichten hören – und in der Philosophie ist das Leichte immer auch das Seichte, denn es nimmt, wie es kann, als Bildung gerade Abstand von seiner Zerbildung in die Philosophie. Auf eine Lebensspanne gerechnet bleibt eben wenig Zeit, weshalb ja der Platon, wir entstellen diese Quelle hier bewusst, vom Philosophischen als dem Sterbenlernen spricht und damit in voller Absicht von demjenigen, das am allerwenigsten irgendeiner gebildet lernen kann. Es bleibt also eben wenig Zeit auf eine Lebensspanne der Bildung gerechnet. So steht es dem Verstande gut, sich kurz zu halten, auch wenn er sich darin ebenso wenig verstehen könne. Er kann sich im zeitlich Kurzen wenigstens gut auf ein bestimmtes Verhalten, das er dann eben Verstand nennen kann, abrichten lassen, von Quellen, die er und mit denen er anzugeben lernt, versteht sich. Schließlich haben Befehle stets das Kurze und Einfache als ihr Proprium.
Wer daher mit dem Verständlichen zugleich die Kürze und Einfachheit fordert, der fleht eigentlich, nicht sterben zu müssen, strebt eine Unendlichkeit an, die ihm eben alles sei, nur nicht verständlich, damit sie eben weitergehe. Je einfacher sie sich kommuniziert, desto mehr von ihr kann sich in Kürze auch kommunizieren. Das Einfache, das Leichte in jenem kurz Verständlichen sodann bedeutet nur mehr, dass es gar nichts bedeutet. Darum ist es ja einem Verstand so verständlich, der sich selber nicht versteht. Er findet sich darin wieder. Das mag für Kommunikatsdynamiken aller Art, für ihre Handlungsbefehle (zu denen ebenso der Befehl gehört, so oder anders zu wissen) und ihre Quellenangaben ganz genügen, sich zu bilden und zu kommunizieren (was dasselbe ist, denn Bildung heißt, Kommunizierenkönnen, heißt Quellenangebenkönnen). Das Einfache und Kurze aber Philosophieren zu sehen, besser: zu beobachten, wie es dazu den Versuch unternimmt und gleich einem Zwanghaften dauernd den Kopf gegen eine unvorhandene Wand schlägt, um dabei stolz zu verkünden, es sei gar keine Wand da, ist unerträglich.
Auch das Klare verdeckt in seinen Kürzungen, Vereinfachungen, Vergewisserungen mehr, als es tatsächlich klar macht. Kommunikate, die sich, weil sie Kommunikation sind, als gebildet zur Verständlichkeit, Vereinfachung und Abkürzung angeben und unter eben diesen Flaggen des Sichs segelnd mit sich angeben, mögen alles sein, aber philosophisch sind sie nicht. Im Kommunizieren folgt der Dreiheit von Verstand, Vereinfachung, Verkürzung noch das Nachvollzieh- und Imitierbare auf dem Fuß, wodurch wir hier etwa auch unablässig die vier cartesischen Methodenregeln wiederkehren sehen, die so maßgeblich sich als das Bildungsgeschehen zu kommunizieren verstanden haben. Sie sind aber freilich alle dieselben Vereinfachungs- und Verständlichkeitskommunikate, wie dieses Buch. Wozu sollte man sonst ein Buch schreiben, wenn nicht, um verständlich zu machen, um abzukürzen, zu vereinfachen, die Verwunderung abzunehmen, anstatt sie zu entfachen? Unter der Ägide des Verständlichen freilich geriert jener Horror der Kommunikate einmal mehr, indem sie, das Einfache, Kurze, Nachvollziehbare, eben Verständliche kommunizierend, auch jede Kommune hierauf beschränken, so sehr sie Kommune wird. Was dem nicht quillt, was nicht verständlich, kurz, einfach und imitierbar wird, gehört der Kommune und damit ihrer Kommunikation nicht an.
Schon wegen der Unverständlichkeit des Verständlichen selbst, zerbildet sich das philosophische Kommunikat demgegenüber an alledem, nicht etwa als sein Gegenteil, sondern als entfleucht und im Kommunizieren unkommunizierbar. Philosophie, wenn sie dazu bildet, sich zu kommunizieren, wenn sie in anderen Worten gebildetes Bilden wird, hat gerade das Herz, nichtverständlich, nichteinfach, nichtkurz, nichtnachvollziehbar zu sein, im sich zerbildenden Durchgange durch solche Momente. Ein philosophisches Buch zu kommunizieren, mit ihm also anzugeben – denn jeder Kommunikation wohnt Angeberei inne – geht in seiner eigenen Kommune stets das Risiko ein, dieser Kommune verständlich, einfach, nachvollziehbar und kurz zu werden. Es geht in anderen Worten das Risiko ein, in die Kommunikation dieser Kommune vollends hineingetaucht, auf die Kommune ab- und ausgerichtet zu werden, zum Preise alles dessen, das es dann als nichtverständlich, damit unkommunizierbar, nicht mehr kommunizieren kann. Das Verständliche kartellisiert. Es sperrt sich in sein eigenes Kartell ein. Das Verständlich-, Kurz-, Einfach- und Nachvollziehbarmachen erteilt auch an ein Buch den Befehl, der Hierarchie, den Gesetzen und Verordnungen der Kommune, derjenigen von Quellenangebern hierdurch, zu folgen, sich in ihr als ihre Bildung zu verstehen und damit zum Stehen zu bringen. Auf Kosten philosophischer Zerbildung, oder: auf Kosten der Verwunderung, die durch ihr eignes Ver- sie selbst stets ins Quellenangaben sich versteht und auf Kosten des Mutes zum gebildeten Nichtwissen und Nichtverstehen, wird das Kommunikat, indem es kommuniziert, als Kommunenbildung von der Kommune gebildet, verständlich gemacht, vereinfacht, verkürzt und so weiter. Nur, was sich in den Bildungsquellen der Kommune kommunizieren lässt, bleibt dann als Handlungsanweisung übrig (wieder: auch die Anweisung, so oder so zu wissen). Der Horror der Kommunikation tritt hier offen zutage, indem dieses Buch sich selber in ihre Verordnungen einzureihen hat, so sehr es Buch, Kommunikat in Buchweise, sein möchte.
Auf Kosten sagen wir, indem die Kommune in ihrer selbst unverständlichen Verständlichkeit verharrt, die mit ihrem Beil alles kommunikativ Unverwertbare abhaut und allerlei Belohnung für aufrechtes, richtiges, orthopädisches Regelfolgen sich erfindet, in Form von Zertifikaten, Positionen, Reichtum, und so fort. All dies wird als Dank dafür aufgerichtet, kurz und einfach gemacht zu haben, sodass keiner seine eigne Lebenszeit mehr opfern muss, um an der Kommunikation teilzunehmen. Für diese Sicherung, für dieses Certe an Zeit, die sich über sich vergewissernd in Verstand, Kürze, Einfachheit und Nachvollziehbarkeit ebenso: sichert, ist einer Kommune nichts zu gering, nichts zu viel.
Anstatt mithin durch Zerbildung der eignen Quelle am Buch teilzunehmen, es herumzuwerfen, zu verändern, neu zu gießen, hat sich das Buch dem Dictatus Communicationis zu unterwerfen, will es verstanden und derart: überhaupt kommuniziert sein. Dadurch mag es sein Philosophisches vielleicht auch gerne aufgeben, behalten wird es auf diese Weise jedenfalls nicht.
Denn dafür braucht es dich.
Muss Philosophie tauglich sein?
Wozu taugt etwas? Der Primat des Tauglichen, es trete in Form der Nützlichkeit, Gebrauchbarkeit, Funktionalität oder ähnlichem auf, wohnt allem Kommunikat inne, sobald es an sein Kommunizieren geht, sobald es sich quellenangebend und damit gebildet mitkommuniziert. Dahingestellt sei auch, dass es selbst ein philosophisch völlig nutzloser Ansatz ist, sich nach dem Nutzen von irgendetwas zu fragen. Diese Frage folgt daher auf dem Fuße der Verständlichkeit eines Kommunikats, es sei tauglich in seine Kommune eingebettet, es nütze zu irgendetwas. Es kann auch sein, dass der Begriff des Tauglichen ebenso unverständlich ist, wie alles gemeinhin Verständliche, immerhin aber errichtet sich der Primat des Tauglichen mit den Kommunen dennoch und ordnet sich alles Kommunizierte unter, nenne sich dabei auch nützlich, funktional, brauchbar oder zweckmäßig. Die jeder Kommune, so sehr sie hierdurch Kommune wird, anheimfallende Frage: Wozu taugt es? Wozu kann es gebraucht werden? taugt dieser Kommune selber dazu, sich quellenanzugeben, wie hierauf nach dem Zweck dieses Angebens zu fragen. Beides quillt wechselseitig und eodem actu als eben dies, zum Kommunizieren zu taugen und das Kommunizieren vice versa als tauglich, als nützlich, brauchbar und funktionierend zu bilden.
Nun könnte es einem gewitzten Künstler, Buchmacher, Mechaniker oder Philosophen einfallen, die Tauglichkeit dieses Buches in seiner Funktion, Feuer damit zu entfachen ebenso zu sehen, wie darin, eine Decke daraus zu kleben, irgendjemandem mit seinen Inhalten Kopfschmerzen zu bereiten, es gar zu unterrichten oder sonstigen Wahnsinn damit zu treiben. Der erbärmliche Witz solcher Überlegungen reicht freilich hin, den Nutzen davon, Bücher zu schreiben, insgesamt in Frage zu ziehen. Das sei aber den Kommunen überlassen.
In der Kommunikation, das heißt der Bildung von Kommunen, die sich als aus ihren Quellen angeberisch gebildet hernach kommunizieren, indem sie nichts als eben diese Quellen angeben – in der Kommunikation also wartet aber nicht bloß die Frage der Nützlichkeit des Philosophischen zu irgendwelchen äußerlichen Zwecken. Das Taugen einer Philosophie sich neben Fremdzwecken darüber hinaus in ihren eigenen Kommunikaten sich erschöpfen zu lassen, gibt dann eine reine Tautologie, ist doch jede Kommunikation nur so brauchbar wie ihre Quellen und jede Quelle nur insofern brauchbar, als sie sich kommuniziert. Wo sich nun Bildung also zu ihrer eigenen Tautologie durchbildet, wird sie zumindest Selbstinstrumentalisierung und tut mit sich oder sonst Gebildetem groß als letzten, obersten oder absoluten Zwecken, Größen, Werten, Axiomen, Voraussetzungen usf. – In der eignen Bildung wenigstens augenscheinlich die hierdurch eigne Brauchbarkeit anzugeben, ist dabei noch immer echter, ehrlicher, traditioneller und weniger angeberisch, als letztlich in der Erfahrung der Tautologie aller Funktionalität: bloß einem äußeren Zweck zu nützen. Das zeigt sich zuletzt darin, dass man das Ideal des Funktionierens doch selbst letztlich so schwer zum Funktionieren bringe.
Dafür nämlich, die Funktion und Funktionalität etwa auch eines philosophischen Kommunikats anzugeben, kommuniziert sich als seine Nützlichkeit, Brauchbarkeit, Funktion wiederum nur, dass damit Kommunen gebildet werden können, dass sich das Nützlichsein schlicht in einem quellenangeberischen Kommuniziertsein erschöpfe. Mehr, besser, öfter, und wiederum einfacher, kürzer und verständlicher sei es kommuniziert. Dann nützt es auch. Nutzen, Brauchtum, Brauchbarkeit, Funktionalität und so weiter, Antworten nicht nur auf die Frage nach dem Gebrauch, sondern direkt danach: Wozu braucht man es? – solche Antworten sind und bleiben in ihrem Herzen auf diese Weise: Ideologie.
Nur vermeintlich zerbricht das Tauglichsein jede Ideologie. Meist verfehlt und erschöpft es sich zugleich in der Aussage: aber es taugt, es nützt, es erfüllt seinen Zweck gerade gegen alle abstrakte Ideologie. Das Taugliche scheint jeder Ideologie den Boden wegzuziehen. Mit diesem eigentlich naturalistischen Fehlschluss wird dann wohlfeil gegen subjektive Meinungen, Ansichten, Anschauungen, Betrachtungsformen, Ideen ankommuniziert. Doch insofern ein Kommunikat genau soweit gedeiht oder verdirbt als es taugt, ist die Tauglichkeit die größte aller Ideologien. Wo sich ein Um-zu und Um-willen einschleicht, sich selber als Quelle anvisierend oder eine sich erst einzubildende fremde Quelle mitkommuniziert, handelt es sich stets schon um die Nützlichkeit, die Grundideologie jeden quellengebildeten Kommunikats.
Die Tauglichkeit nenne sich auch eine zu erreichende Agenda, ein zu klärendes Problem, eine zu bewältigende Herausforderung und weitere derartige Kommunikate, sie alle weisen die durch sich kommunizierte Bildung als tauglich aus, kommunizieren die Ideologie der Tauglichkeit (ein Pleonasmus) als ihre Quelle und sei sie auch eine von Selbstzwecken faselnde Tautologie.
In jedem Kommunikat steckt daher der Keim seiner Nützlichkeit, damit ein ideologischer Zweck, dem es sich unterwirft, ein Ziel, das es im Kommunizieren zu verwirklichen und dem zu entsprechen gilt. Allein hierfür wird die Tauglichkeit gebildet als Tauglichkeit einer Bildung, sie soll mit kommunalen Ideologien angeben, die sich dem Nutzen, der Brauchbarkeit, dem Tauglichen, einem Um-zu und Um-willen verschrieben haben, indem sie sich quellenangeberisch bildet. Wo die Ideologie der Tauglichkeit sich gegen erst durch sie dahin gedrängtes nutzloses, ungebräuchliches, zweckloses Bilden in Position bringt – damit aus Bildung heraus gerne auch einmal die Bildung selbst torpediert – tut sie vermeintlich aller Ideologie durch das Taugenkönnen und Taugen eine Absage. Sie gibt an mit der Quelle: Wozu können wir es gebrauchen? – und wenn sich hierauf keine kommunale Antwort findet, dann ist es unbrauchbar, fern der Kommune, bloße Ideologie ohne Tauglichkeit. Doch quillt jede Ideologie selbst erst im Tauglichen, denn das Taugliche ist das Quellen einer Ideologie, auch wenn sie es fortan von sich weist gerade aus ihrer eignen Bildung, aus dem Taugen, Nutzen und Funktionieren heraus.
Aber es funktioniert – lässt sich dann oft hören. Es lässt sich hören gegen alles, das davon als nutzlos und untauglich hinfort genommen ist von einer Kommune, die mit dieser oder jener Tauglichkeit dann angibt, ohne angeben zu können, wozu diese Ideologie des Taugens eigentlich selbst taugt. Dadurch freilich bildet sich erst so etwas wie eine Bildung des Ausschlusses, der Funktion, des Nutzens und des Gebrauchs. Sie alle sind Kommunikate, zu denen Bildungsideologie und Ideologiebildung erst im Nutzen gebildet wird. Dem Tauglichen, Nützlichen und Funktionalen einmal das Ruder übergeben, muss ihm fortan alles folgen, denn es hat dann zu taugen – hierin liegt der ideologische Kern aller Kommunikate.
Wenn Philosophie nun überhaupt kommuniziert und damit in ihrem Kommunikat Ideologie wird, so geschieht dies stets in einer Ideologie des Tauglichen, Nützlichen, Funktionalen und Zweckmäßigen. Sie mag in ihrer Bildung ihren Zweck außer sich, in oder als sich selber finden. Indem sie kommunikativ ein Ziel findet, indem sie zu taugen hat, ist sie Ideologie, etwa auch darin, dass sie ein Buch schreibt, das zu irgendetwas zu taugen hat. Wozu schriebe sie es denn sonst, nicht wahr?
Das Taugen ist der Bildung dabei so sehr voraus, dass es sie selbst in dem Missverstand befällt, als solle oder könne sie es abwehren, indem sie sich schlicht nicht kommuniziere, also nicht zur Ideologie einer Kommune mache, nicht am Nützen, Taugen und Gebrauchen teilnehme. Wie unerbittlich, wie real und todernst das Quellenangeben ist, erfährt aber gerade derjenige, der durchs vermeintliche Nichtkommunizieren zu entkommen sucht. Er kann das zwar wohl, doch gebiert und bildet sich ihm dadurch nur eine weitere Kommune der Bildung, eine nämlich, die den Zweck erfüllt, gegen das Taugen zu taugen, selber als – etwa auch selbstzweckmäßige – Ideologie zu funktionieren. Die Kommunalbildung des Gebrauches beginnt von Neuem und reicht sich, wenn vielleicht nicht leiblich, so immerhin kommunikativ ihren Schierlingsbecher.
Philosophische Zerbildung demgegenüber weist weder anderes ab oder weg, noch stellt sie sich selbst zurück. Philosophie hat weder äußere Zwecke, noch Selbstzweck. Sie hat schlicht keinen Zweck, keinen Sinn, keine Funktion, keine Tauglichkeit – und dies Keine hinwiederum ist selber schon, zu taugen und damit zugleich der alle Ideologie überlistende Bund mit aller Ideologie. Das philosophische Kommunikat erweist sich gleichermaßen als das einzig tatsächlich Taugliche, das sich selbst nämlich in seiner Bildung kommuniziert, wie auch als absolut untauglich, als dies nämlich, dass ein quellenangeberisches Taugen die Bildung niemals bilden, sie höchstens ein Ausbildenfür und damit das Aus der Bildung zur Ausbildung – im doppelten Sinne des Aus – wird. Denn philosophische Bildung taugt nicht