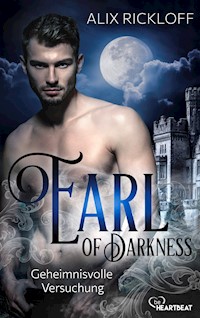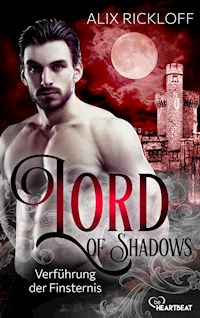
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Erben von Kilronan - Paranormal Regency
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Ist die Liebe stark genug, um den Kampf gegen die Finsternis zu gewinnen?
Sabrina Douglas lebt zurückgezogen an der irischen Küste. Dort lernt sie im Verborgenen ihre magischen Kräfte einzusetzen. Es gibt kaum etwas, das ihre ruhigen Tage stört - bis ein verletzter Mann am Strand gefunden wird. Er hat sein Gedächtnis verloren, aber sie beide spüren, dass zwischen ihnen eine geheimnisvolle Verbindung besteht. Eine Verbindung, die ihre Herzen erschüttert und ihre Leidenschaft auflodern lässt - und die ihnen den Zugang zu einer dunklen Magie eröffnet, die alles Leben zerstören könnte ...
"Die Leser werden vor Zufriedenheit seufzen." ROMANTIC TIMES
Wild, romantisch und ungezähmt: ein magischer Liebesroman vor der Kulisse Irlands im 19. Jahrhundert. Alix Rickloff entführt ihre Fans in eine Welt voller Magie und Leidenschaft - der perfekte Mix aus BRIDGERTON und Christine Feehan.
Earl of Darkness - Geheimnisvolle Versuchung
Lord of Shadows - Verführung der Finsternis
Son of Danger - Verlockendes Dunkel
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 535
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Widmung
Danksagungen
Kapitel Eins
Kapitel Zwei
Kapitel Drei
Kapitel Vier
Kapitel Fünf
Kapitel Sechs
Kapitel Sieben
Kapitel Acht
Kapitel Neun
Kapitel Zehn
Kapitel Elf
Kapitel Zwölf
Kapitel Dreizehn
Kapitel Vierzehn
Kapitel Fünfzehn
Kapitel Sechzehn
Kapitel Siebzehn
Kapitel Achtzehn
Kapitel Neunzehn
Kapitel Zwanzig
Kapitel Einundzwanzig
Kapitel Zweiundzwanzig
Kapitel Dreiundzwanzig
Kapitel Vierundzwanzig
Kapitel Fünfundzwanzig
Kapitel Sechsundzwanzig
Kapitel Siebenundzwanzig
Kapitel Achtundzwanzig
Über die Autorin
Weitere Titel der Autorin
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an: be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Über dieses Buch
Ist die Liebe stark genug, um den Kampf gegen die Finsternis zu gewinnen?
Sabrina Douglas lebt zurückgezogen an der irischen Küste. Dort lernt sie im Verborgenen ihre magischen Kräfte einzusetzen. Es gibt kaum etwas, das ihre ruhigen Tage stört – bis ein verletzter Mann am Strand gefunden wird. Er hat sein Gedächtnis verloren, aber sie beide spüren, dass zwischen ihnen eine geheimnisvolle Verbindung besteht. Eine Verbindung, die ihre Herzen erschüttert und ihre Leidenschaft auflodern lässt – und die ihnen den Zugang zu einer dunklen Magie eröffnet, die alles Leben zerstören könnte …
eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.
ALIX RICKLOFF
EARL OFDARKNESS
Verführungder Finsternis
Aus dem amerikanischen Englisch vonUlrike Moreno
Danksagungen
Mein aufrichtigster Dank all jenen, die dieses Buch von leeren Seiten zu einem »Ende« gebracht haben.
Meinen entschlossenen Autorenkolleginnen Maggie und Do, den besten Freundinnen und Kritikerinnen, die eine Autorin haben kann. Sie fragen, antworten, inspirieren und drängen gleichermaßen. Danke für das Popcorn, den Martini Bianco und das Lachen. Ohne euch wäre dieses Buch sehr viel schwerer zu schreiben gewesen.
Kevan Lyon und Megan McKeever, die dem fertigen Manuskript den letzten Schliff gegeben haben.
Bethan Davies, die Daigh half, sein Walisisch zu finden.
Den Mitgliedern des Beau Monde und ihrem grenzenlosen Wissen zur Epoche des Regency.
Und wie immer meiner wundervollen Familie, die weiß, dass sie auf sich allein gestellt ist, wenn die Tür geschlossen ist.
Kapitel Eins
Vor der südwestlichen Küste IrlandsNovember 1815
Er hatte gebetet, dass der Sturm ihn töten möge. Um einen kräftigen Blitzschlag, der seinen Körper in so viele Teile zersplittern würde, dass keine noch so starke Magie ihn je wieder zusammensetzen könnte.
Doch seine Gebete waren vergeblich gewesen. Er war weit hinaus über die Reichweite göttlicher Hilfe.
Die schäumenden Sturmwellen hatten sich zu einer schwarzen, nur noch leicht dahinrollenden Dünung gelegt, die gerade noch Übelkeit herbeiführen konnte, aber nicht den Tod. Die sich nach Osten verziehenden Wolken nahmen ihre Blitze mit und hinterließen einen von eisigen Sternen glitzernden Himmel mit einem tief am Horizont hängenden vollen Mond. Ein malerischer Anblick, doch seine Stimmung verlangte nach der Zerstörungswut eines Zyklons, die besser zu dem dunklen Wahnsinn passen würde, der ihm das Gehirn vergiftete.
Der Sturm hatte sie vom Kurs abgetrieben. Er hatte das Fluchen der Seemänner gehört und das Stirnrunzeln des Kapitäns gesehen, als er auf dem Hinterdeck des Schiffes herumgestrichen war. Sie lagen hinter ihrem Zeitplan zurück, das Schiff war angeschlagen und reparaturbedürftig und der Hafen von Cobh noch anderthalb Tage entfernt, vorausgesetzt, der Wind hielt sich.
Da die Götter ihn also offenbar im Stich gelassen hatten, blieb es ihm selbst überlassen, sich Erlösung zu verschaffen.
Ein blitzschneller, schmerzloser Untergang war ihm versagt geblieben, doch es gab noch andere Wege nach Annwn. Versteckte dunkle Wege, die genauso sicher in das Land der Toten führten.
Er musste sie nur entdecken.
An die Reling gelehnt, ließ er den Blick über die See schweifen, wo er die Antwort auf jeder Welle geschrieben fand. Aber konnte es ihm gelingen? Würden sich die Schutzzauber, die ihn am Leben erhielten und unantastbar machten, im nassen, kalten Reich des Seegotts Lir auflösen und den Trost bringen, den er sich ersehnte? Oder würde der Versuch zu endlosem Leiden einer anderen Art im unerbittlichen Sog der Ozeangezeiten führen?
Die Sterne, die sich silbern und golden auf der Wasseroberfläche widerspiegelten, kringelten und wellten sich, als zeichnete eine Hand Gebilde aus Licht und Wasser, und verwandelten das Mondlicht in die blassen Züge einer Frau. Der Schaum des Ozeans trieb über ihr Gesicht wie ein Schleier dunklen Haares. Aber sie sandte ihre Liebe durch diesen trennenden Schleier aus und leuchtete hell in einer von Schatten überdeckten Welt.
War sie seinen dürftigen Erinnerungen entsprungen, oder war sie nur ein Traum? Für ihn unmöglich zu erkennen. Namen und Gesichter geisterten durch sein Bewusstsein wie Gespenster, manchmal so lebhaft wie die Existenz, in der er gefangen war. Bisweilen stießen seine beharrlichen Bemühungen, sich zu erinnern, jedoch nur auf Leere, und es blieb ihm allein überlassen, die dämonische Wut zu bekämpfen, die wie Säure in ihm brannte. Den Zorn der Verdammten.
Er erwartete, dass die Frau sich jede Sekunde wieder auflösen würde in den Wellen, doch sie blieb. Ihre Augen waren blau wie Kornblumen, ihr Lächeln entschärfte für einen Moment die Hoffnungslosigkeit, die ihm das Herz zusammenkrampfte, und er erkannte, dass er hier und jetzt den angebotenen Weg beschreiten musste. Bevor sie verschwand, bevor sie von der heulenden Bösartigkeit vertrieben wurde und er wieder einmal, seiner Erinnerungen oder auch nur des Trostes seiner Erinnerungen beraubt, zurückgelassen wurde. Zumindest würde er sich so der Ungewissheit des Todes nicht allein stellen müssen.
Entschlossen hob er ein Bein über die Reling und blickte sich um, um sicherzugehen, dass er nicht beobachtet wurde. Aber an Deck blieb alles still. Eine bessere Chance würde er nicht bekommen.
Um sich außer Reichweite des Schiffes zu bringen, stürzte er sich mit einem harten Stoß gegen die Bordwand ins Wasser und stieß wie ein Pfeil bis tief unter die Wellen.
Das Wasser machte ihn schlagartig hellwach. Die eisige Kälte traf ihn wie ein Faustschlag in den Magen und war wie Tausende scharfer Stiche, die jeden einzelnen Nerv durchbohrten. Während er in einer Wolke aus Blasen den Atem ausstieß, sank er tiefer. Seine Lunge brannte, und seine Muskeln verkrampften sich, als er gegen den instinktiven Drang zu atmen – und zu leben – ankämpfte.
Er wehrte sich gegen den klaustrophobischen Druck des Wassers, aber die betäubende Kälte der See machte jede Bewegung zur Qual und letztendlich unmöglich.
Das Lächeln der Frau zog ihn in die Tiefe.
Wasser füllte seine Lunge. Sein Körper gab auf, und der Tod kam wie eine Geliebte.
Er erwiderte ihr Lächeln. Und als er durch den Schleier zwischen ihnen trat, konnte er sie endlich in die Arme nehmen.
»Sabrina! Wo stecken Sie schon wieder? Antworten Sie, oder die Götter mögen Ihnen beistehen …«
Normalerweise hätte eine solche Drohung Lady Sabrina Douglas aus ihrem Versteck herausschießen lassen wie eine Kugel aus einer Waffe. Aber heute nicht. Heute war es anders. Es war der Sechzehnte des Monats, und heute vor sieben Jahren war ihre Welt aus den Fugen geraten, und seitdem war nichts je wieder wie zuvor gewesen.
Normalerweise vergeudete sie nicht viel Zeit damit, Erinnerungen an die Vergangenheit nachzuhängen. Die Priorin der Schwestern des Hohen Danu sagte, es sei sinnlos, sich mit Fragen nach dem Was-wäre-wenn auseinanderzusetzen. Man könne sich so in den unendlichen Möglichkeiten von Ursache und Wirkung verstricken, dass die Wirklichkeit gefährlich lebensfern wurde. Selbst zum Wahnsinn könnten solche Ratespiele führen, meinte sie.
Doch heute forderte Sabrina diesen Wahnsinn geradezu heraus. Sie hatte sich dazu gezwungen, sich alles, was an jenem lang zurückliegenden Novembertag geschehen war, vom Anfang bis zum Ende in Erinnerung zu rufen und es in hektischem Gekritzel aus ihrem Kopf in ihr Tagebuch einfließen zu lassen. Bei Schwester Brighs erstem Ruf war sie mit ihren Aufzeichnungen jedoch gerade erst bis zur Mittagszeit jenes unheilvollen Tages gekommen.
»Sie undankbare, undisziplinierte Range! Kommen Sie sofort heraus!«
Wenn Schwester Brigh schimpfte, kam Sabrina sich nicht wie die zweiundzwanzigjährige Frau vor, die sie war, sondern eher wie eine ungehorsame Zehnjährige. Aber andererseits betrachtete Schwester Brigh ja jeden, der jünger als sie selbst war, als aufsässiges Kind, was beinahe die gesamte bandraoi-Gemeinschaft mit einschloss. Schwester Brigh war hundert Jahre alt, wenn nicht sogar noch älter. Nur Schwester Ainnir kam ihr altersmäßig gleich. Die beiden waren wie vermooste Überbleibsel aus vergangenen Jahrhunderten.
»Sabrina Douglas! Ich weiß, dass Sie mich hören können!«
Schwester Brigh war die weitaus Vermoostere der beiden – und die Lautere.
Sabrina seufzte und steckte den Stift ins Tagebuch, um die Stelle zu markieren.
Der sechzehnte November 1808 würde warten müssen, weil der sechzehnte November 1815 rief.
Die Rufe der Priesterin verklangen, als sie die Scheune verließ, um ihre Suche auf Außengebäude wie Molkerei, Wäscherei und Gärtnerschuppen auszudehnen. Das Kloster war groß. Die Prinzipalin der Novizinnen würde Jahre brauchen, um überall nachzusehen.
Sabrina erhob sich aus ihrem Versteck hinter den Strohballen und Getreidesäcken, klopfte den Staub von ihren Röcken und zupfte Schürze und Kopftuch zurecht, bevor sie zu der Geschäftigkeit des Klosterlebens zurückeilte. Und geradewegs in Schwester Brighs Hinterhalt geriet.
»Erwischt!« Brighs Fingernägel bohrten sich in die dicke Wolle von Sabrinas Ärmel und drückten fest genug zu, um ihr die Tränen in die Augen zu treiben. »Ard-siúr hat mich über eine Stunde nach Ihnen suchen lassen. Und hier stecken Sie und verbergen sich, als gäbe es keine vernünftige Arbeit zu erledigen.« Verärgert riss sie Sabrina das Tagebuch aus der Hand. »Kritzeln Sie schon wieder in diesem dummen Buch herum? Sie sind mehr als einmal verwarnt worden, dass Sie Ihre Zeit nicht mit unsinnigem Zeug vergeuden sollen.«
Sabrina versteifte sich und bedachte Schwester Brigh mit einem vernichtenden Blick. »Ich habe meine Zeit nicht vergeudet. Und ich hatte mich auch nicht versteckt.«
Der Einwand wurde ignoriert. »Hmmpf. Kommen Sie! Sie haben Ard-siúr lange genug warten lassen.«
Als sie durch den geschützten Kreuzgang gingen, versammelte sich eine Gruppe an den Außentoren. Überraschte und verwirrte Stimmen wurden laut, die sogar Schwester Brighs entschlossenen Blick von seinem Ziel ablenkten.
Sabrina verrenkte sich den Hals, um über die Menge hinwegsehen zu können. »Was geht da vor?«
»Ein Haufen Unsinn zweifelsohne«, antwortete Schwester Brigh und schnaubte verächtlich. »Zu meiner Zeit wäre das nicht passiert, da können Sie sicher sein.«
Womit sie vermutlich irgendwann während der letzten Eiszeit meinte. Schwester Brigh in Tierfelle gehüllt und mit einem Knüppel in der Hand. Bei der Vorstellung musste Sabrina sich ein Grinsen verkneifen.
Aber schon umklammerte die Schwester ihren Arm noch fester und verdoppelte ihr Tempo. Sie marschierte die Treppe hinauf, öffnete mit einem kaum zu hörenden Wort die Tür und schlug sie mit einem ebenso wirkungsvollen Flüstern wieder zu.
Am Verstand der alten Priesterin konnte man seine Zweifel hegen, aber ihre Magie war unangreifbar.
Die Temperatur fiel, sobald sie drinnen und aus der schwachen Nachmittagssonne heraus waren. Frost hing in dem Gang, der zu Ard-siúrs Arbeitszimmer führte, und bewirkte, dass Sabrinas nervöser Atem kleine Wölkchen in der kalten Luft erzeugte. Die Kälte drang sogar durch die dicken Strümpfe und zwei Unterröcke, die sie unter ihrem Wollkleid trug.
Es war noch nicht einmal Winter, und schon sehnte Sabrina sich nach dem Frühling, nach Sonne und der Erlösung von kratziger Unterwäsche, Frostbeulen und Schniefnase, früher Dunkelheit und zugigen Gängen. Im Moment würde sie ihre Seele verkaufen für Wärme, Licht und … etwas anderes.
So wenig veränderte sich innerhalb des Ordens, dass jede Abwechslung, selbst der allmähliche Wechsel der Jahreszeiten, ein Abenteuer zu sein schien. Vielleicht war das aber auch nur so, weil die wahre Veränderung, die Sabrina sich ersehnte, die Ernennung zur Priesterin, ihr noch versagt blieb und es auch bleiben würde, falls die unausstehliche Schwester Brigh ihren Willen durchsetzte.
Als sie durch das Vorzimmer zu Ard-siúrs Arbeitszimmer gingen, winkte Schwester Anne ihnen fröhlich zu, was ihr den mürrischen Blick einer Bulldogge von Schwester Brigh und ein schwaches Lächeln von Sabrina eintrug.
Verglichen mit der Kälte auf dem Gang, war Ard-siúrs Büro ein tropisches Paradies. Ein kleiner Ofen gab genügend Hitze ab, um den Raum angenehm warm zu halten, und die dicken Teppiche und farbenfrohen Wandbehänge belebten den nackten, naturfarbenen Stein. Fügte man zu alldem noch Ard-siúrs überfüllten Schreibtisch samt ihrer schnurrenden Katze und das leise Ticken einer hohen Standuhr in der Ecke hinzu, war es kein Wunder, dass sich Sabrinas angespannte Nerven zu beruhigen begannen.
Auf Schwester Brigh schien die Atmosphäre allerdings genau die gegenteilige Wirkung zu haben. Ihr Blick huschte mit unverhohlener Missbilligung durch das Zimmer, während sie eine leidgeprüfte Haltung einnahm und jetzt erst ihren eisernen Griff um Sabrinas Arm löste.
Ard-siúr hob abwehrend eine Hand, um einen Gedanken zu Ende zu führen, und biss sich auf die Lippe wie ein kleines Mädchen, während ihr Stift über die Seite vor ihr flog.
Die Priorin der Schwestern des Hohen Danu wirkte so zeitlos wie die uralten Megalithen oder »stehenden Steine«, die eine nahe gelegene Wiese am Klippenrand bewachten. Groß. Breit. Ein vom Alter gezeichnetes Gesicht, aber Augen, die klar, wach und humorvoll geblieben waren. Ihre Mächte als bandraoi-Priesterin und Zauberin, doch auch ihre majestätische Haltung und unerschütterliche Contenance schienen es mit der der Feen aufnehmen zu können. Sabrina wusste jedoch, dass es all ihre Kräfte erforderte, die angeborenen wie erlernten, eine Ordensgemeinschaft von Anderen zu leiten und gleichzeitig deren wahre Natur vor der misstrauischen Welt der Menschen zu verbergen. Dies war nötig zum Schutz der Anderen, Männer und Frauen, die sowohl das Blut von Magiern als auch das von Menschen in sich hatten.
Für alle außerhalb der Klostermauern waren sie lediglich ein weltabgewandter Orden kontemplativer Nonnen. Es fiel Ard-siúr zu, dafür zu sorgen, dass es so blieb. Keine beneidenswerte Aufgabe. Auch wenn es bei genauerer Überlegung doch sehr wohl jemanden gab, der Ard-siúr beneidete, sehr sogar.
Schwester Brigh schnaufte und atmete so schwer durch die Nase wie ein Dampf ablassender Kessel.
Schließlich legte Ard-siúr die Feder auf die Ablage, streute Sand auf das Schriftstück, schüttelte ihn wieder ab und faltete das Blatt. Erst dann richtete sie den durchdringenden Blick auf die beiden Frauen, die schweigend vor ihr standen.
»Danke, Schwester Brigh, dass Sie Sabrina hergebracht haben!«
Ihr Dank an die Prinzipalin der Novizinnen war als eindeutige Aufforderung gemeint, sie allein zu lassen.
Statt zu gehen, begann Schwester Brigh jedoch, eine ganze Liste von Beschwerden vorzutragen, die ihr so leicht von den Lippen kamen, als hätte sie sie schon im Vorfeld vorbereitet. »Dreimal in drei Tagen, Ard-siúr! Dreimal habe ich sie mit dem Kopf in den Wolken erwischt, als sie bei der Arbeit hätte sein sollen. Entweder das, oder sie kritzelt in ihrem Tagebuch herum. Sie können das nicht länger unter den Teppich kehren. Es bestärkt sie nur in dem Gefühl, über den Regeln zu stehen. Immer noch das Töchterchen des adligen Herrn zu sein, das sie einmal war, statt der das Priesterinnenamt anstrebenden Novizin, als die sie sich fühlen sollte.«
Sabrina reagierte gereizt auf die spöttische Betonung, die Schwester Brigh auf das Wort »anstrebend« legte, aber ein Blick von Ard-siúr, und sie verzichtete darauf, ihrem Ärger Luft zu machen.
»Ist das wahr, Sabrina? Glauben Sie, dass Sie über unseren Regeln stehen? Dass die gesellschaftliche Position Ihrer Familie Sie zu besonderer Rücksichtnahme berechtigt?«
»Nein, natürlich nicht, aber …«
Schwester Brigh knallte das Tagebuch auf Ard-siúrs Schreibtisch, was die Katze fauchend herunterspringen und in Deckung gehen ließ. »Sabrinas mangelnde Hingabe und ihr Unvermögen, sich an unsere Lebensart zu halten, schwächt ihre Anwartschaft. Und ich für meinen Teil bin der Ansicht, dass es besser für sie wäre, den Orden zu verlassen und zu ihrer Familie zurückzukehren.«
Ard-siúr richtete den Blick wieder auf Sabrina. »Das sind ernste Vorwürfe, die Schwester Brigh erhebt. Könnte es sein, dass Sie ein Leben in unserer Gemeinschaft gar nicht so sehr erstreben, wie Sie glauben? Dass Sie sich nach der Zukunft zu sehnen beginnen, die Sie ohne die tragischen Umstände hätten haben könnten?«
Sabrina blinzelte erstaunt. Hatte Ard-siúr das ganz bewusst erwähnt? Wusste sie, was Sabrina in ihr Tagebuch geschrieben hatte? Oder war es nur Zufall, dass sie dieses Thema angeschnitten hatte? Das war immer schwer zu sagen bei der Priorin ihres Ordens, die über die Gabe zu verfügen schien, alles Mögliche wahrzunehmen. Besonders die Dinge, die man nicht bekannt werden lassen wollte.
Vielleicht war es doch keine so gute Idee gewesen, sich zu zwingen, an jenen lange zurückliegenden Novembertag zurückzudenken. Sabrina hatte eisern verdrängte Erinnerungen ausgegraben und vergessen, wie weh sie taten.
»Ich bin mehr als bereit, meine Pflichten als bandraoi-Priesterin zu übernehmen«, sagte sie mit einem gekränkten Blick zu Schwester Brigh. »Und ich wollte Sie nicht warten lassen, Ard-siúr. Ich versuchte nur … Wissen Sie, es ist heute vor sieben Jahren geschehen, Ard-siúr, und … ich hatte das Gefühl, als müsste ich es mir noch einmal deutlich in Erinnerung rufen, bevor es mir entglitt.«
Ard-siúr nickte bedächtig. »Ah ja, der Tod Ihres Vaters.«
»Der Mord an ihm«, verdeutlichte Sabrina. »Es ist heute sieben Jahre her, dass mein Vater von den Amhas-draoi angegriffen und getötet wurde.«
»Und aus gutem Grund, wenn auch nur die Hälfte der Gerüchte stimmt«, brummte Schwester Brigh. »Ard-siúr, selbst wenn es für Sie nicht schlimm genug ist, dass Sabrina sich ihren Pflichten entzieht und sich aufführt, als wäre sie hier die Hausherrin, müssen Sie doch erkennen, dass ihre Anwesenheit dem Orden unerwünschte Aufmerksamkeit einbringt. Noch nie zuvor in unserer Geschichte wurde eine unserer Priesterinnen von den Amhas-draoi verhört.«
»Es war nicht meine Schuld, dass sie mit mir sprechen wollten. Ich habe ihnen nichts erzählt.«
»Also auch noch Geheimnisse vor der Bruderschaft, die geschworen hat, uns zu beschützen, indem sie die Grenze zwischen den Anderen und den Menschen hütet? Das wird ja immer schlimmer.«
»Das war es nicht, was ich meinte. Sie verdrehen mir das Wort im Mund.«
»Das genügt!« Ard-siúr hob eine Hand.
Aber Schwester Brigh, die in Fahrt gekommen war, ließ sich davon nicht aufhalten. »Ein Vater, der sich der schwarzen Magie bedient. Ein Bruder, der vor den Amhas-draoi auf der Flucht ist. Die Familie Douglas ist verflucht. Und je eher diese junge Frau von hier verschwindet, desto besser für den Orden.«
Sabrina warf der alten Nonne einen bösen Blick zu.
»Ich sagte, das genügt!« Ard-siúrs scharfe Stimme brachte Schwester Brigh endlich zum Schweigen, obwohl ihr Gesicht noch immer rot vor Zorn war und ihre Augen funkelten. »Dies ist weder der richtige Moment noch der passende Ort. Falls Sie stichhaltige Argumente vorzubringen haben, Schwester, tun Sie es bei einer anderen Gelegenheit, dann werden wir darüber sprechen.«
Darauf wandte Ard-siúr sich Sabrina zu und lächelte sie an. »Ich habe Sie nur hergebeten, meine Liebe, um Ihnen einen Brief zu geben, der von einem Boten für Sie überbracht wurde.«
Wie konnte ein einziger Satz ihr den Magen zusammenkrampfen und sie wünschen lassen, sie könnte sich in einem Mauseloch verkriechen? Sabrinas Erfahrung nach verhießen Briefe niemals etwas Gutes. Sie waren wie eine noch nicht explodierte Bombe in der Hand.
Die Tür sprang auf, und die sehr aufgeregte Schwester Anne trat einen Schritt ins Zimmer. »Ard-siúr, Sabrina wird sofort auf der Krankenstation gebraucht. Ein Mann wurde hergebracht, der halb ertrunken am Strand unterhalb des Dorfes gefunden worden ist.«
»Darf ich gehen?«, fragte Sabrina mit einem bittenden Blick zu Ard-siúr.
Schwester Brigh verzog das Gesicht, als bisse sie in etwas Saures, aber die Priorin des Ordens entließ Sabrina mit einer gebieterischen Handbewegung. »Gehen Sie! Schwester Ainnir benötigt Ihr Geschick. Der Brief kann bis zu Ihrer Rückkehr warten.«
Sabrina raffte mit einer Hand die Röcke und eilte aus dem Zimmer und hinter Schwester Anne her. Sie hätte den Unglückseligen, der sie buchstäblich im letzten Augenblick gerettet hatte, küssen können.
Da war es nur fair, die Gefälligkeit zu erwidern.
»Lenken Sie die magische Energie, als führten Sie ein chirurgisches Instrument! Präzise, konzentriert«, flüsterte Schwester Ainnir über der reglosen Gestalt des Mannes, der zwischen ihnen lag.
Sabrina bemühte sich, die Magie, die in ihrem Blut schwelte und in ihren Knochen kribbelte, zu bremsen, weil sie im Moment weniger die Genauigkeit eines Stiletts als vielmehr die Stumpfheit einer Streitaxt hatte. Ließe sie diese Macht jetzt frei, würde sie den Pechvogel vor sich zu Asche verbrennen.
»Geben Sie acht, Sabrina! Ihr Kopf ist nicht bei der Sache.«
Nein, ihr Kopf kochte noch immer vor Empörung über Schwester Brighs Beschuldigungen. Mangelnde Hingabe. Über den Regeln stehen. Zeit vergeuden. Wenn Sabrina nicht auf der Hut war, würde die Prinzipalin der Novizinnen sie in eine Kutsche nach Belfoyle setzen lassen, bevor das Jahr beendet war. Was für eine bösartige Kuh!
»Sabrina! Seien Sie vorsichtig!«
In einem atemberaubenden Lichtbogen aus Rot und Gold, Korallenfarben und blassem Grün loderte die Magie auf und erleuchtete Sabrinas Inneres, bis sie das Dröhnen in ihren Ohren spürte, dessen Schwingungen die Härchen an ihren Armen aufrichtete und ihr die Brust zusammenschnürte wie ein Korsett aus Fischbeinstäbchen.
Der Mann verkrampfte sich und rang verzweifelt nach Atem, den er nicht finden konnte. Wellen des Zorns und der Verzweiflung, Furcht und Panik gingen von ihm aus.
Die Emotionen tobten durch Sabrinas Schädel wie Tiere durch einen Käfig. Sie taumelte unter dem Pochen hinter ihren Lidern und den Punkten und Feuerrädern, die vor ihren Augen explodierten wie Feuerwerke.
Die Kehle des Mannes verengte sich, als er aus seiner Lunge, die voller Wasser und somit nutzlos war, ein Rinnsal Seewasser erbrach. Dann stieß er plötzlich mit der Faust um sich, was Sabrina schnell zurückspringen ließ.
Frustration, Enttäuschung, Wut – all das empfing sie von ihm, und es genügte, um ihr Schwindel zu verursachen. Sie errichtete schnell all ihre geistigen Barrikaden, und dennoch kämpfte sich das Echo seiner Qual hindurch, um sich wie messerscharfe Krallen in ihr Gehirn zu graben.
»Nicht aufhören!«, mahnte Schwester Ainnir. »Verlieren Sie nicht die Konzentration! Es ist noch zu früh.«
Die Fäden ihrer Feenmagie tanzten an Sabrinas Haut entlang wie die prickelnde Spannung in der Luft vor einem herannahenden Gewitter. Ein schimmerndes Irrlicht geisterte in ihrem Augenwinkel und wisperte in ihrem Kopf wie eine Brise oder ein Echo oder das Rauschen von Wasser über Steinen.
Sie vertiefte sich in ihre Sinneseindrücke, und der überwältigende Andrang mitfühlender Empfindungen verringerte sich auf ein erträgliches Niveau. Oder zumindest so weit, dass sie nicht mehr Gefahr lief, das Bewusstsein zu verlieren.
Sabrina nahm das heilende Feuer zusammen, gewann die verlorene Konzentration zurück und benutzte ihren anhaltenden Ärger, um ihre Entschlossenheit zu skalpellartiger Vollkommenheit zu schärfen. Erst dann kehrte sie zum Bett des Mannes zurück, um Schwester Ainnir zu unterstützen, deren Kräfte nach Stunden des Ringens mit der Unterwelt um die Seele des verirrten Seemannes schwanden.
»So ist es gut. Spüren Sie, wie es sich Ihrem Willen beugt! Vorsicht. Erzwingen Sie es nicht!« Die Siechenmeisterin nahm Sabrinas Hand und führte sie zu einer Stelle über dem linken Lungenflügel des Mannes. Seine Haut war eisig kalt und, bis auf das Gewirr von silbern angehauchten Narben, von einem milchigen Blau. »So. Sehen Sie? Spüren Sie, wie das Leben dort noch flattert?«
Sabrina konzentrierte sich auf das Auf und Ab seiner stockenden Atemzüge und ließ bei jedem Aus- und Einatmen ihre heilende Magie in das Muster einfließen. Ruhig. Zielstrebig. Unfehlbar. Aber nein, Moment … irgendetwas war hier nicht in Ordnung. Nicht so, wie es sein müsste. Zu ihrem Erstaunen vereinten und verknoteten sich unbekannte Stränge in diesem Fremden und verbanden sich ohne ihre Hilfe oder ihre Kräfte miteinander. Das war ein völlig neues Muster. Ein ihr fremdes Verweben von Leben und einer Magie mit einer durch nichts zu erschütternden Dunkelheit in ihrem Kern. Hinzu kam ein leichtes, kaum merkliches Anrühren ihres Bewusstseins, während sie bei der Arbeit war.
Dann nichts mehr. Die unbekannte Magie verschwand auf die gleiche subtile Weise, wie sie erschienen war.
Sabrina konzentrierte sich noch mehr, doch nach einer ruckartigen Kopfbewegung des Mannes fiel er aus der Bewusstlosigkeit in einen tiefen Schlaf. Der Tod zog sich zurück.
»Schwester Ainnir, haben Sie das gespürt?«, fragte Sabrina mit einem langen, nachdenklichen Blick auf den Patienten.
Der Mann atmete, und auch seine Haut bekam schon wieder Farbe, ein mattes Goldbraun, wo er gerade noch kreidebleich gewesen war. Aber waren es ihre und Schwester Ainnirs Bemühungen gewesen, die das bewirkt hatten? Für den Bruchteil einer Sekunde hatte sie fast gedacht …
»Das ist Leben, Sabrina.« Schwester Ainnir, deren Gesicht so wächsern war wie die tropfenden Kerzen hinter ihnen, ließ sich auf einen Stuhl sinken. »Auf den hier wird das Todesreich Annwn noch warten müssen.«
Sabrinas Gefühl, dass irgendetwas nicht in Ordnung war, wich im Nachglanz des Erfolges. Dieser Mann hatte auf nichts mehr reagiert, ja war praktisch schon tot gewesen, als er im Kloster eingetroffen war, doch ihre Fähigkeiten hatten ihn gerettet. Dies war etwas, worin sie, Sabrina, gut war. Ein Können, das kein Mangel an Reichtum, Schönheit oder eleganten gesellschaftlichen Manieren schmälern konnte.
Sie zog die Decke über den Fremden und ließ den Blick einen Moment über die harten Züge und grimmigen Linien seines Gesichts gleiten. Selbst schlafend sah er aus, als wäre er bereit zu morden. Ein harter Zug lag um sein Kinn, seine Lippen waren zusammengepresst zu einem schmalen Strich.
Was für Missgeschicke hatten ihn, die Lunge voller Seewasser, an einen Felsenstrand gespült?
Seine Emotionen sprachen von Gewalt und Kampf, sein Körper trug die Spuren davon. Die stahlharten Muskeln, das Gewirr der Narben, die beängstigende Intensität seines Gesichtsausdrucks …
Ganz leicht nur, wie ein Streicheln, rührte Sabrina an sein Bewusstsein, in der Hoffnung, ihm Frieden, Sicherheit, die Wärme eines weichen Bettes und die Ruhe eines stillen Zimmers zu vermitteln. Aber selbst diese flüchtige Berührung brachte einen Querschläger von Emotionen zurück. Nicht mehr die verheerende Wut des Zyklons, sondern Trauer, Qual und eine solch niederschmetternde Verzweiflung, dass sie Sabrina die Tränen in die Augen trieb.
Sie schnappte nach Luft, fuhr sich mit dem Ärmel über die brennenden Wangen und zog sich schnell wieder in sich selbst zurück. Zwang sich, ihren Blick und ihre Gedanken von ihm abzuwenden, obwohl sie seine Gegenwart wie ein Messer im Rücken spürte und sein bedrohliches Schweigen wie sich nähernde Gewitterwolken an einem schmutzig gelben Himmel.
Und sie las eindeutig zu viele Romane, wenn sie sich solch melodramatischen Vorstellungen von einem halb ertrunkenen Piraten hingab.
Sie schüttelte die unsinnigen Fantasien ab, um sich auf Schwester Ainnir zu konzentrieren, die sie fast benommen vor Erschöpfung ansah. Großer Gott! Da dachte sie sich Geschichten aus, während sie sich um die arme Schwester Ainnir kümmern müsste.
Sie waren Stunden hier gewesen, die Zeit des Abendessens war gekommen und gegangen, und die abendliche Dämmerung hatte sich längst zu Dunkelheit vertieft. War es für die betagte Priesterin zu viel gewesen? Hatte sie mehr von ihrer Kraft verbraucht, als gut für sie war?
»Erlauben Sie mir, Sie zu Ihrem Zimmer zu begleiten.« Sabrina hielt der alten Frau den Arm hin, damit sie sich darauf stützen konnte, als sie sich mühsam von ihrem Stuhl erhob.
»Und der Herr?«, entgegnete Schwester Ainnir seufzend. »Vielleicht sollte eine von uns bei ihm bleiben.«
»Ich habe heute Nachtdienst«, erwiderte Sabrina mit einem Blick zurück zu dem Fremden, der sie erschaudern ließ – und nicht aus Aufregung. »Schwester Noreen ist jetzt hier. Ich kann Sie zu Ihrem Zimmer begleiten und wieder zurück sein, bevor sie dienstfrei hat.«
»Dann nehme ich Ihre Hilfe dankend an, Sabrina. Dieser alte Körper ist nicht mehr so rege, wie er einmal war. Und ich habe festgestellt, dass ich mein Bett viel mehr zu schätzen weiß als früher.«
Die beiden machten sich langsam auf den Weg über den Gang der Krankenstation. »Sie sind überaus begabt, mein Kind«, bemerkte Schwester Ainnir. »Lassen Sie sich von niemandem etwas anderes sagen.«
Nun, da der Notfall vorbei war, erwachte Sabrinas Verbitterung wieder. »Schwester Brigh ist da anderer Meinung. Ich bin eine erwachsene Frau, aber sie behandelt mich wie ein Kind.«
Schwester Ainnir blieb stehen, um Sabrina anzusehen. »Schwester Brigh fürchtet alles, was das empfindliche Gleichgewicht der Welt der Anderen, die wir uns geschaffen haben, stören könnte. Sie glaubt, unser Überleben hinge davon ab, uns von den nicht magisch begabten Duinedon fernzuhalten und keine Aufmerksamkeit auf uns zu lenken. Ihre Familie, Sabrina – oder vielmehr Ihr Vater –, glaubte das genaue Gegenteil. Ob Schwester Brigh nun recht hat oder nicht, in ihrer Denkweise macht Sie das zu einer Gefahr für uns.«
»Wenn dem so ist, wie kann ich sie dann jemals dazu bringen, über die Sünden meines Vaters hinwegzusehen? Sie wird niemals meiner endgültigen Aufnahme in den Orden zustimmen.«
Schwester Ainnir setzte sich wieder in Bewegung und zog Sabrina mit. »Brigh ist nicht die Einzige, die in solchen Angelegenheiten etwas zu sagen hat. Sie haben viele Verbündete in unserer Gemeinschaft, die Ihr Potenzial erkennen.« Die alte Nonne lachte. »Sehen Sie sich um! Glauben Sie nicht, ich wüsste nicht, wer diesen Ort am Laufen hält. Ich bin zu alt, um mit dem Tod zu kämpfen.«
»Sie sind nicht alt, Schwester«, entgegnete Sabrina diplomatisch.
»Und Sie sind eine miserable Lügnerin, mein Kind. Ich weiß sehr gut, wie alt ich bin. Ich spüre jedes meiner Jahre, besonders an Abenden wie diesem. Nein, es liegt bei Ihnen, diese Krankenstation zu übernehmen.«
Bei ihr? Wollte Schwester Ainnir damit sagen, was Sabrina zu verstehen glaubte? »Ich bin noch keine Priesterin.«
»Noch nicht, aber wer könnte Ihnen nach der heutigen Arbeit Ihre Befähigung absprechen?«
Also hatte sie doch richtig verstanden. Eine so überwältigende Freude sprudelte in Sabrina auf, dass sie die Lippen zusammenpressen musste, um den Jubel zu ersticken, der ihr auf der Zunge lag. Freudenschreie wären höchst unangebracht für eine würdevolle bandraoi-Priesterin. Außerdem konnte sie die Kranken heilen, die Toten ins Leben zurückholen und gewöhnliche Erkältungen kurieren, und Schwester Brigh würde immer noch einen Grund finden, ihr die letzten Riten zu versagen. Und wahrscheinlich würde sie Sabrina neben all ihren anderen Vergehen auch noch der Eitelkeit beschuldigen.
Nachdem sie die Krankenstation verlassen hatten, durchquerten sie die Eingangshalle und traten in die Nacht hinaus, wo der Wind an ihren Röcken zerrte und silbern umrandete Wolken über den Himmel zogen. Der blasse Mond, der hoch am Himmel stand, spiegelte sich in den schmutzigen Pfützen auf dem Hof wider.
»Sie verfügen über ein angeborenes Talent und haben gelernt, es ebenso gut zu nutzen wie jede offiziell ernannte Siechenmeisterin.« Schwester Ainnirs dünne, angestrengte Stimme zitterte in der feuchten Kälte. »Was kann Ard-siúr dagegen sagen?«
»Sie kann sagen: ›Vielen Dank, aber rechnen Sie nicht damit!‹ Ich bin eine Douglas, schon vergessen?«
»Nein, natürlich nicht. Doch das allein schon sollte Ihr Schicksal als bandraoi besiegeln, denn die Douglas sind alle bekannt dafür gewesen, eine ungewöhnliche Feenkraft in sich zu tragen.«
»Und der Fluch, der auf meiner Familie liegt?« Sabrina bemühte sich vergeblich, den Groll aus ihrer Stimme fernzuhalten.
»Bah! Fluch! Solches Geschwätz lässt uns nur wie eine Herde alter, abergläubischer Weiber klingen.«
Sabrina, die Schwester Ainnir stützte, bemerkte an diesem Abend zum ersten Mal Ainnirs Gebrechlichkeit, die knochigen, mit Altersflecken bedeckten Hände und die Schwäche ihres Griffs. War die heutige Arbeit zu viel für sie gewesen? Oder war sie schon länger so geschwächt, und Sabrina hatte es nur nicht sehen wollen?
»Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, mein Kind.«
Sie klang so sicher, so überzeugt. Und warum sollte sie es auch nicht sein? Schwester Ainnir war vermutlich schon hier gewesen, als der erste Stein gelegt worden war, oder zumindest erweckte sie diesen Eindruck. Sie strahlte unfehlbare Weisheit aus und unermüdliche Kraft. Schwester Ainnir hatte schon immer existiert und würde auch weiter leben. Wie alles hier. Die Gebäude. Die grau gewandeten Schwestern. Die Kapelle. Das langsame Geläut der volltönenden Glocken.
Das war es, was Sabrina an dem Orden liebte. Das Gefühl der Ewigkeit in den mit Mörtel zusammengefügten Steinen, der immer gleichbleibenden Ewigkeit, als wäre die Zeit innerhalb der Mauern des Klosters stehen geblieben. Als könnte nichts die Heiligkeit und Sicherheit dieses Ortes durchdringen. Gerade diese Aura von Unvergänglichkeit war es, die Sabrina an einem Leben als bandraoi-Priesterin gereizt hatte.
Als die Veränderung wie eine Sturmwelle über Sabrinas wohlgeordnete Welt hereingebrochen war und alle, die sie gekannt und geliebt hatte, in einer Flut von Blut und Tränen untergegangen waren, waren die Schwestern des Hohen Danu zu einem Hafen vor dem Sturm geworden, zu einer Quelle der Ruhe, Beständigkeit und Sicherheit.
Erst vor Kurzem hatte Sabrina das immer gleichbleibende Fortschreiten der Zeit bisweilen als monoton und die starren Ordensregeln als frustrierend zu empfinden begonnen. Doch diese Empfindungen waren selten und wurden gleich verdrängt, sobald sie sich bemerkbar machten. Sabrina wusste, wohin sie gehörte. Und das war kein anderer Ort als dieses Kloster.
Sie stiegen die Treppe hinauf zu Schwester Ainnirs Zimmer, aus dem ihnen ein Hauch angenehm duftender Luft und die Wärme eines munter brennenden Kaminfeuers entgegenschlugen.
»Von hier aus schaffe ich es allein. Sie können wieder gehen, Sabrina. Versuchen Sie, sich ein wenig auszuruhen. Wir können heute Nacht nichts weiter für ihn tun, als bei ihm zu wachen«, sagte Schwester Ainnir.
Sabrina lächelte. »Danke, Schwester! Für alles.«
Die Priesterin bedeckte Sabrinas Hand mit ihrer. Die Klarheit ihrer grauen Augen verriet nichts von ihrer körperlichen Schwäche, sondern höchstens eine unermüdliche, eiserne Energie, die durch Sabrinas Haut in ihre Knochen, Sehnen und Muskeln drang und ihre Kraft erneuerte, obwohl das Einzige, was ihr Körper sich im Augenblick ersehnte, Schlaf war.
»Ihre Gründe, zu uns zu kommen, mögen ihren Ursprung in dem Bedürfnis haben, einer schmerzlichen Vergangenheit zu entfliehen, doch haben Sie hier nicht auch ein Heim gefunden?«, fragte Schwester Ainnir. »Eine Schwesternschaft in allem bis auf den offiziellen Titel?«
»Ja, das habe ich. Dieses Leben ist alles, was ich jemals wollte. Ich habe mich hier immer wohler gefühlt als bei dem gezierten, wichtigtuerischen Gehabe der gesellschaftlichen Elite. Hier kann ich sein, wie ich bin, und muss nicht versuchen, in jemand anderes Form zu passen.«
»Was kümmern Sie denn dann noch die Brighs dieser Welt?«
Sabrina lachte. »Sie lassen es so einfach klingen.«
Die alte Frau gab Sabrina einen Stups unters Kinn, als wäre sie ein Kind. »Wenn es einfach wäre, würden Scharen junger Frauen an unserer Tür anklopfen, um hereinzukommen. Es ist gerade das Schwierige des Lebens hier, was das Gesindel fernhält.«
Wo war Lazarus? Ein versäumtes Treffen und nicht einmal ein erklärender Brief. Kein einziger aufschlussreicher Hinweis, wo er stecken könnte.
Máelodor versuchte, ihn auf geistigem Wege zu erreichen, eine telepathische Verbindung zu ihm aufzubauen, aber seine suchenden Gedanken fanden nichts, so weit er sie auch auszustrecken wagte. Nur eine leere, widerhallende Stille, einen eisigen, endlosen Abgrund, der immer weiter abfiel, bis Máelodor schon fast der Schädel platzte von dem Druck. Schließlich ergab er sich der Schwäche seines Körpers und beschloss, etwas zu essen, sich auszuruhen und die Suche nach seinem durch Magie erzeugten Domnuathi am nächsten Morgen wieder aufzunehmen. Er mochte Tod am anderen Ende ihrer kaum noch bestehenden Verbindung spüren, aber das war irreführend. Denn solange Máelodor lebte, blieb auch Lazarus am Leben.
Und Máelodor würde ihn finden. Es war nur eine Frage der Zeit.
Die ganz und gar auf seiner Seite war.
Er wuchtete sich aus dem Sessel hoch, um mühsam zum Fenster hinüberzuhumpeln. Seine Prothese scheuerte am Stumpf seines verbliebenen Beins, und die Kälte nagte an Knochen, die brüchig und krumm geworden waren, aber er wollte nicht eine Sekunde länger in seinem Sessel sitzen bleiben.
Die Dunkelheit trat früh ein in den Bergen, doch der Widerschein des Mondes auf dem Schnee warf ein gespenstisches Licht über die bewaldeten Hänge. Genügend Licht, um den Mann, der gleich erscheinen würde, um sich Anweisungen zu holen, sehen und einschätzen zu können. Auf der anderen Seite des Tals flackerten die Lichter einiger verstreut liegender Gehöfte wie eine Kette schimmernder Juwelen vor der kargen Abgeschiedenheit des Waliser Hochlandes.
Die Vorfahren dieser Menschen hatten mit einer Wildheit und Schläue gekämpft, derentwegen sie ewig lange frei geblieben waren. Römer, Wikinger, Sachsen, Normannen – sie alle hatten versucht, die wilde keltische Natur zu zähmen. Alle waren an ihrer Küste eingefallen und vertrieben worden.
Aber in all den Zeitaltern von Königen, Kriegsherren und Prinzen, die in der Geschichte aufgetreten waren, gab es nur einen, an den man sich mit der Leidenschaft seiner ihm treu Ergebenen erinnerte. Einer, der höher stand, der heller strahlte und noch Anhänger sammelte, als schon lange nichts als Knochen von diesem Helden zurückgeblieben waren.
König Artus.
Diejenigen, die das volle Wissen besaßen, hatten ihre Träume jedoch nicht von seinem Ableben beeinträchtigen lassen. Die Neun, die an seiner Wiederauferweckung gearbeitet hatten, und alle, die ihnen treu ergeben waren, wussten, dass der Tod etwas Vorübergehendes war, Macht dagegen etwas Unvergängliches. Und falls Artus zurückkehrte, würde es immer Männer und Frauen geben, die seinem Banner folgen würden. Mit Máelodor als Ratgeber und seiner eigenen charismatischen Ausstrahlung würde der Hochkönig am Kopf einer Armee marschieren, und eine von Anderen beherrschte Welt würde wieder in greifbarer Nähe liegen. Statt der Schande des Armesünderkarrens oder pechgetränkten Galgens für die mit magischen Kräften Geborenen, würden sie die Kontrolle haben, die Befehlsgewalt und Überlegenheit.
Ein neues goldenes Zeitalter würde anbrechen.
König Artus war der Schlüssel zum Erfolg … Und einen Schritt näher daran, wiedererweckt zu werden.
Auf dem Schreibtisch hinter Máelodor lag sein erster Sieg. Das Kilronan-Tagebuch des toten Earls befand sich endlich in seinem Besitz, und nach Monaten geduldigen Decodierens waren seine Geheimnisse enthüllt. Der einzige Fehlschlag inmitten all dieser Erfolge war das Überleben dieses jämmerlichen Welpen von einem Erben namens Aidan Douglas.
Lazarus hatte teuer dafür bezahlt, dass er den Mann am Leben gelassen hatte.
Der Domnuathi würde solche Skrupel nie mehr aufkommen lassen. Nicht, nachdem er schmerzlich daran erinnert worden war, wer am längeren Hebel saß.
Nicht, dass das eine große Rolle spielte, denn Máelodor hatte es geschafft, die von Aidan Douglas ausgehende Bedrohung abzuwenden. Er war als gestört befunden worden und ebenso in Misskredit geraten wie sein hingerichteter Vater. Seine Behauptungen bezüglich Máelodors Existenz als Oberhaupt eines Netzwerks unzufriedener Anderer waren als das verrückte Gerede eines Mannes hingestellt worden, der verzweifelt bemüht war, seinen machthungrigen jüngeren Bruder Brendan zu entlasten.
Sieben Jahre nachdem die letzten der Neun ausgelöscht worden waren, befand sich Brendan Douglas immer noch auf freiem Fuß. Aber nicht mehr lange. Die Amhas-draoi, Soldaten der Kriegsgöttin Scathach und Hüter der Trennung zwischen Sterblichen und Magiern, verfolgten ihn mit ungebrochener Entschlossenheit. Und sie waren nicht die Einzigen, die den skrupellosen Anderen jagten. Wenn Máelodor den jüngsten Erben von Kilronan endlich schnappte, würde der ihn anflehen, sterben zu dürfen, lange bevor es mit ihm zu Ende ging.
Ein Klopfen riss Máelodor aus seinen maliziösen Fantasien.
»Herein!«
Ein Mann betrat unter Verbeugungen den Raum – aalglatt, lächelnd, aber finster wie ein Schurke. »Sie haben mich kommen lassen?«
Máelodor straffte sich und drückte die krummen Schultern durch. »Lazarus wird vermisst. Er sollte einen Mann in Cork kontaktieren, doch dieses Treffen hat nie stattgefunden.«
Der Besucher lehnte sich an einen Tisch und suchte sich dreist ein Stück Obst aus einer Schale aus, als befände er sich unter seinesgleichen statt in Gesellschaft seines Vorgesetzten. »Vielleicht hat er eine Kleine gefunden und beschlossen, ein bisschen herumzutändeln.«
Máelodors Gehstock zerbrach fast unter seinem immer festeren Griff. »Ein Soldat von Domnu, eine einzig aus meiner Magie geborene und an meinen Willen gebundene Kreatur, tändelt nicht herum. Er gehorcht meinem Befehl. Ohne zu fragen oder nachzudenken.«
Der Mann richtete sich gerader auf. »Worum geht es also bei dem Auftrag? Sie wollen, dass ich Ihren ungeratenen Sklaven aufspüre? Ihm sage, dass Mummy sich Sorgen macht?«
Mit einem Fingerschnippen belegte Máelodor den unverschämten Kerl mit einem Fluch und beobachtete mit Genugtuung, wie das Gesicht des Mannes augenblicklich grau wurde. Wie entsetzt er die Augen aufriss, als ihm die Luft abgeschnürt wurde, und wie er gegen den Tisch taumelte, bevor er auf die Knie fiel und der stibitzte Apfel über den Boden rollte.
Máelodor humpelte zu diesem erbärmlichen Exemplar eines Menschen hinüber. »Da Sie noch neu unter uns sind, werde ich es so einfach wie möglich ausdrücken. Sie werden Lazarus’ Aufgabe übernehmen. Stehlen Sie die Rywlkoth Tapisserie, und bringen Sie sie mir!«
Der Mann nickte, und seine blauen Lippen verzerrten sich, als er sich mit beiden Händen an die Kehle griff.
Mit einem zweiten Fingerschnippen nahm Máelodor den Fluch zurück. Einen Moment überließ er den Mann seinem lautlosen Weinen, bevor er einen knochigen Finger unter dessen Schalkrawatte schob und ihn daran auf die Beine zog. »Sie fragen nicht, wohin Sie geschickt werden?«
Die furchtsamen Augen des Mannes wichen denen des Magiers aus, aber Máelodor war sehr zufrieden mit den Auswirkungen seiner dunklen Kräfte. »Sie lernen rasch. Und da Sie so schnell von Begriff sind, werde ich die Frage beantworten, die Sie nicht zu stellen wagen«, sagte er und blickte sich nach dem verbrannten Einband des Tagebuches um. Die Seiten waren ebenfalls versengt und voller Risse, aber von Zaubern geschützt, die sie unentzifferbar für jeden anderen machten als die Neun. »Sie fahren nach Irland und zum Orden der Schwestern des Hohen Danu.«
Erdrückende Dunkelheit. Muskeln, die schrien vor Schmerz. Ein Schädel, der in Flammen stand. Und wie immer die scharfzahnigen Kiefer, die Schlangenaugen und zusammengerollte Präsenz, die am Rande seines Bewusstseins lauerte.
Während er tiefer und tiefer in den schwarzen Abgrund fiel, streckte er die Hände nach der Frau aus, aber sie berührten nichts als Wasser oder pfeilschnell hin und her schießende Fische. Er war zu der falschen Annahme verleitet worden, dass sie hier warten würde. Doch statt ihrer hatte er nur den Schmerz einer fernen Erinnerung gefunden, die völlig nutzlos war gegen sein derzeitiges Leiden.
Licht durchbrach die Dunkelheit des Ozeans und gelangte bis in die tödlichen Tiefen, wo er gelähmt vor Kälte und blind dahintrieb. Die mit ihm dahingleitende Präsenz verzog sich und richtete ihre suchenden Reptilienaugen woandershin.
Er war allein.
Zum ersten Mal seit längerer Zeit, als er sich erinnern konnte, war er vollkommen allein.
Kapitel Zwei
Zuckungen durchliefen ihn, die seine Zähne zum Klappern brachten und seine Finger zittrig und gefühllos machten. Außerdem quälten ihn unerträgliche Kopfschmerzen. Er versuchte zu schlucken, aber seine Kehle war wund, seine Zunge geschwollen und nutzlos. Als er die Augen öffnen wollte, blinzelte er gegen ein solch grelles Licht, als stünde er in der Sonne. Das blendende goldene Licht sandte neue Schmerzwellen durch sein benommenes, verwirrtes Hirn.
Ganz langsam nur gewöhnten sich seine Augen an die Helligkeit. Was er sah, verband sich zu einem zellenähnlichen Raum mit Schränken an den Wänden und einem niedrigen, rundherum verlaufenden Regal. In einer Ecke befand sich eine Art Waschbecken mit einer Pumpe, in einer anderen die Pritsche, auf der er lag. Neben ihm stand eine kleine Bank mit einem Krug, einer Schüssel und drei verkorkten Flaschen. Ein Korbstuhl war an das Bett herangezogen worden. Durch ein hohes Fenster fiel Sonnenlicht herein, und in der Mitte des Raumes stand ein dreibeiniges Kohlenbecken, von dem ein dünner Rauchfaden aufstieg und das gerade genug Wärme abgab, um ihn vor dem Erfrieren zu bewahren.
In dem vergeblichen Versuch, sich aufzuwärmen, vergrub er sich noch tiefer unter den Decken. Sosehr er sich auch anstrengte, er konnte sich nicht erinnern, wer er war und wie er hierhergekommen war.
Das wenige, was ihm noch in Erinnerung war, waren grenzenlose Finsternis, ein vernichtender Druck und eine solch intensive Kälte, dass sie ihn schier auseinanderriss. Als er jedoch nach den Gründen für diese Empfindungen suchte, stieß er gegen eine Barriere – eine Wand, hinter der eine endlose Leere lag.
Er bemühte sich noch mehr, aber die Leere erstreckte sich in alle Richtungen. Jeder Versuch, sich zu konzentrieren, verschlimmerte noch seine Kopfschmerzen. Trotzdem strengte er sich an, doch Panik ersetzte nun seine Verwirrung, bis das Zittern, das seinen Körper schüttelte, weniger mit der Kälte und viel mehr mit purer Angst zu tun hatte. Die einzige Erinnerung, die er seinem gequälten Hirn abringen konnte, war das Gesicht einer Frau, von der er jedoch nicht wusste, wer sie war.
Vielleicht würde es helfen, wenn er aufstand und ein paar Schritte ging. Also kämpfte er sich auf die Beine, die ihm jedoch schon nach wenigen Sekunden den Dienst versagten. Das Zimmer schwankte und schlingerte wie ein Schiff in einem Sturm, und sein Magen rebellierte. Ein solch fürchterliches Würgen packte ihn, dass er sich krümmte und nach Atem rang.
Er legte sich wieder auf die klumpige Strohmatratze, starrte zu dem abblätternden Gips an der Decke auf und umklammerte die dünne Wolle seiner Decken. Um ein Aufstöhnen purer animalischer Angst zu unterdrücken, biss er die Zähne zusammen.
Jemand würde kommen. Sie würden ihm sagen, was geschehen war und warum er hier war.
Wer er war.
Und tatsächlich bewegte sich der Riegel an der Tür, und sie schwang auf, um eine vom schwachen Licht des Korridors umnebelte Gestalt zu offenbaren, die eintrat und dann wieder stehen blieb.
Und ihm stockte der Atem.
Dort stand die Frau, die einzige Erinnerung, die ihm geblieben war.
Ihr Name war … Schon wieder war sein Kopf wie leer gefegt.
»Bitte, wie heißen Sie?«, fragte er mit krächzender Stimme und hoffte, dass sie nicht gekränkt sein würde, weil er sich nicht erinnern konnte.
Aber sie lächelte ihn an, was ihrem ernsten Gesicht ein Strahlen gab, und kam zu ihm, um sich neben ihn zu setzen und das mitgebrachte Tablett auf die kleine Bank zu stellen. »Ich bin Sabrina. Doch eigentlich hatte ich gehofft, dass Sie mir Ihren Namen nennen würden.«
Oje, sie kannte ihn nicht! Sie konnte die Lücken nicht füllen. Diese Erkenntnis zerstreute die letzte Hoffnung, an die er sich geklammert hatte. Er war allein und auf sich gestellt. Ohne die leiseste Ahnung, wer er war.
Und sie sah ihn mit schräg gelegtem Kopf erwartungsvoll und eifrig an.
Er hasste es, sie enttäuschen zu müssen, als er den Kopf schüttelte, hasste die Übelkeit erregende, fürchterliche Angst, die ihn jetzt ebenso deprimierte wie das Vergessen, das ihr vorangegangen war. »Ich erinnere mich nicht.«
Im schwachen Schein des Mondes untersuchte er sich wie einen Fremden, angefangen bei Einzelheiten wie seinen großen, schwieligen Händen, einem Muttermal gleich unter seinem Schulterknochen und der fehlenden Spitze seines linken Ringfingers.
Als nichts von alldem eine Erinnerung wachrief, erweiterte er die Untersuchung auf allgemeinere Dinge wie die Kraft, die er in sich spürte, und seinen schlanken, aber muskulösen Körperbau. Die langen Beine und starken Arme. War er Soldat? Seemann? Ein irischer Bauer? Was für ein Leben würde eine solch robuste Zähigkeit zur Folge haben?
Schließlich gelangte er zu dem, was ihn am neugierigsten machte, ihn jedoch auch am meisten abstieß – zu dem Gewirr von Narben, das seinen ganzen Körper überzog. Was für ein furchtbarer Unfall mochte sie verursacht haben? Oder waren sie gar nicht das Ergebnis eines Unfalls? Vielleicht waren es ja vorsätzliche Entstellungen. Was für Kämpfe hatte er ausgefochten, um sich derartige Wunden zuzuziehen? Oder was für Verbrechen hatte er begangen, um solche Bestrafungen herbeizuführen? Oder hatte er sich gar nichts zuschulden kommen lassen und war zu Unrecht so misshandelt worden? Und war der Verursacher dieser Verletzungen noch immer auf der Jagd nach ihm?
Frustriert kniff er die Augen zusammen und schlug sich gegen die Stirn, um wenigstens das kleinste Bild aus seinem Gehirn herauszuschütteln, das so inhaltsvoll war wie reingewaschener Sand an einem Strand.
Aber alles war vergeblich.
Wenn seine Anstrengungen also nichts als Kopfschmerzen erbrachten, begann er wohl besser mit dem einzigen noch vorhandenen Bild.
Mit dem Gesicht der Frau.
Lange, nachdem sie wieder gegangen war, sah er sie noch vor sich – schlank wie eine Weidenrute und mit Bewegungen von einer Geschmeidigkeit und Anmut, die noch so viele triste Kleidungsstücke nicht verbergen konnten. Ihr dunkles Haar war ordentlich gescheitelt und zum größten Teil unter einem weißen Tuch verborgen, ihre Augen waren blau, und sie hatte eine entzückende kleine Stupsnase, einen Mund, der ein wenig zu groß für ihr Gesicht war, und ein weiches, rundes Kinn, in dem ein Grübchen erschien, wenn sie lächelte oder lachte.
Er kannte dieses Gesicht, hatte es in seinen Träumen gesehen, und trotzdem sah sie ihn wie einen Fremden an.
Warum? Weshalb log sie und gab nicht zu, dass sie ihn kannte? Oder sah er nur Gespenster? Hungerte er so sehr nach einer Vergangenheit, dass er nach jedem noch so dünnen Strohhalm griff?
Die Fragen gingen ihm endlos im Kopf herum, erbrachten aber keine Antworten, sondern nur noch mehr Fragen. Sein brennender Blick glitt über das Labyrinth von Narben an seinen Armen, über die langen, hässlichen Schnitte, die seinen Oberkörper verunzierten, und er schloss angewidert die Augen.
Nein, diese Sabrina war der Schlüssel zu seiner vergessenen Vergangenheit. Trotz aller Ungewissheiten wusste er das mit absoluter Sicherheit. Aber welche Tür würde sie öffnen? Und wollte er wirklich wissen, was dahinterlag?
»Powea raga korgh. Krea raga brya.«
Über die geistige Verbindung zu ihrer Patientin vermittelte Sabrina ihr Ruhe, Frieden und Gesundheit. Auf die gleiche Weise entspannte sie die Muskeln der Kranken und löste den Schleim in ihrer Brust. Es dauerte nur wenige Momente, bis der Zauber die verheerenden Hustenanfälle linderte, die die gebrechliche Priesterin quälten, und ihren Atem zu einem ruhigen, gleichmäßigen Rhythmus verlangsamte.
Zufrieden unterbrach Sabrina die hauchdünne Verbindung und zog Schwester Moira die Decke bis unter das Kinn. Es würden Stunden vergehen, bevor die verschleimten Lungen der alten Frau sie wieder zu quälen begannen. Bis dahin würde sie ruhig schlafen.
Sie war die Letzte auf Sabrinas Liste. Schwester Netta schlief, ihr hohes Fieber ging langsam zurück. Und Schwester Clea musste nur wieder zu Bett gebracht werden, falls sie sich erhob und nach ihrem Bruder Paul fragte. Er war Fischer gewesen und seit etwa fünfzig Jahren auf See verschollen, doch in ihren Wahnvorstellungen blieb Clea zwölf Jahre alt, und die Jahrzehnte waren kaum mehr als ein Traum für ihr verwirrtes Hirn.
Würde es auch bei dem Mann so sein, der halb ertrunken am Strand gefunden worden war? Sie hatten ihm das Leben zurückgegeben, aber nicht seine Erinnerungen. Die blieben verloren. Für Tage? Wochen? Für immer? Das war unmöglich vorauszusagen, und als Sabrina es ihm erklärt hatte, war sein Gesicht bei jedem ihrer Worte grauer geworden, und Leere und Verzweiflung hatten sich in seine schwarzen Augen eingeschlichen.
Er hatte sich alle Mühe gegeben, ruhig zu bleiben in ihrer Gegenwart, doch seine innere Anspannung hatte die Luft zum Knistern gebracht wie ein Gewitter und seine Furcht den ganzen Raum zwischen ihnen vibrieren lassen. Sabrina litt mit ihm, so wie die Hilflosigkeit anderer sie immer schmerzte. Sie hasste es, nicht mehr für ihn tun zu können. Sie brauchte das Gefühl, die Dinge in Ordnung zu bringen oder zumindest doch zu bessern. Aber die Krankheit dieses Mannes war etwas, was sie nicht heilen konnte. Nicht einmal mit all ihren Anderen-Talenten.
Ihre Gedanken führten sie zu seiner Tür zurück. Oder, richtiger gesagt, zu der Tür zu einem der Ruheräume, die abseits der Zimmer der bejahrten Schwestern lagen und getrennt von den wenigen Patienten, die sich auf der Hauptstation des Hospitals erholten.
Sabrina drückte ihr Ohr an die massive Holztür, aber kein Laut kam aus dem Zimmer dahinter. Schlief er ruhig? Oder wälzte er sich im Bett herum und kämpfte gegen den Verrat seines geschwächten Verstandes? Eigentlich sollte er ruhen. Machte er gerade all ihre Arbeit zunichte?
Leise drehte Sabrina den Schlüssel um und öffnete einen Spalt die Tür.
Ein grauer Lichtstrahl, der aus dem hohen Fenster auf die Pritsche des Mannes fiel, erzeugte einen starken Kontrast zwischen seinen grobknochigen Gesichtszügen und den Augenhöhlen, verlieh seinem schwarzen Haar einen blauen Schimmer und versilberte das Gewirr seiner unzähligen Narben.
Alte und neue. Ältere, verblasste Linien und gerötete, noch stark hervortretende Narben. Es war, als hätte jemand jeden grausamen und bösartigen Impuls am Körper dieses Fremden ausgelassen. Sein Oberkörper hatte das Schlimmste abbekommen – ein Netz von Gewalttätigkeiten verunzierte die harten, ausgeprägten Muskeln –, aber auch kein anderer seiner Körperteile war verschont geblieben.
Irgendwann einmal war er die Zielscheibe brutalster Mordversuche gewesen. Wieso war er also nicht gestorben? Diese vielen schweren Verletzungen hätten sich doch eigentlich als fatal erweisen müssen. Noch eine Frage, auf die er vermutlich keine Antwort wüsste, wenn sie sie ihm stellen würde.
Er bewegte sich und riss die Hand hoch, als wollte er einen Schlag abwehren. Sein Gesicht verzerrte sich vor Schmerz, er biss die Zähne zusammen, und seine Brust hob und senkte sich, als er nach Atem rang. »Mae gormod ohonynt. Tynnwch nol. Gwarchoda Tywysog Hywel. Amddiffyna’r tywysog.«
Seltsam. Das war weder Englisch noch Gälisch, sondern eine ihr völlig unbekannte Sprache. Da sie es jedoch nicht über sich brachte, sich zurückzuziehen, trat sie leise näher. Vielleicht konnte sie einfach die Tür abschließen, damit niemand merkte, dass sie sich von ihrer Neugier an sein Bett hatte ziehen lassen. Wenn sie blieb, würde sie vielleicht mehr hören. Vielleicht würde er sich im Schlaf erinnern und ihr irgendwelche Hinweise auf seine Vergangenheit geben. Und am Morgen könnte sie ihm dann alles erzählen, was sie erfahren hatte. Ihm vielleicht eine einzige Erinnerung entlocken und den Rest ganz von allein kommen lassen. Als Heilerin hatte sie gelernt, dass alle Geschöpfe Hilfe verdienten. Sie würde nur ihrer Berufung folgen.
Nicht einmal Schwester Brigh könnte das bekritteln.
So hatte sie keinerlei schlechtes Gewissen, als sie sich hinsetzte und wie die personifizierte Geduld die Hände auf dem Schoß verschränkte.
Sie war gut darin, sich still zu verhalten und abzuwarten. Sich unsichtbar zu machen. Das war schon immer so gewesen, selbst in ihrer Kindheit. Als Jüngste der Familie hatte sie dieses Talent zu ihrem Vorteil eingesetzt. Ihre Brüder Aidan und Brendan pflegten ihre Anwesenheit bei ihren privaten Spielen oder Unterhaltungen zu vergessen und ihre Eltern, dass sie noch nicht zu Bett geschickt worden war, sondern sich mit einem Buch in einer stillen Ecke zusammengerollt hatte. Auch ihre Kinderschwester neigte dazu, ihre Existenz zu vergessen, weil sie viel zu sehr mit dem Dienstmädchenklatsch beschäftigt war, um sich um ein ruhiges Kind zu sorgen, das wenig Aufmerksamkeit erforderte. Besonders im Vergleich zu den sehr viel unbesonneneren Brüdern.
Der Fremde drehte sich um, mit einem Arm vor dem Gesicht und sichtlich steifem Nacken, an dem ein Muskel zuckte. »Dwi’n dy garu di.«
Sabrina schnippte in Gedanken mit den Fingern. Walisisch! Sie erkannte jetzt das Wort für »Liebe«, weil sie einmal eine Gouvernante gehabt hatte, die aus Cardiff stammte. Eres Jones-Abercrombie war eine sauertöpfische Frau mit scharfer Zunge und schnell zuschlagender Hand gewesen. Sabrina war nie glücklicher gewesen als an dem Tag, an dem die Frau Belfoyle verlassen hatte, um eine Stellung in Lord Markhams Haushalt anzutreten.
Dieser Mann war also Waliser. Und er liebte jemanden. Irgendwo da draußen gab es jemanden, der ihn vermisste und um ihn trauerte. Umso mehr Grund, bei ihm zu bleiben und herauszufinden, so viel sie konnte.
Er zuckte zusammen und stieß die Faust in die Luft. Tiefe Furchen gruben sich in seine Wangen, und seine Armmuskeln spannten sich an wie gegen einen unsichtbaren Feind. »Das Tagebuch! Sofort.«
Diesmal sprach er Englisch. So knapp, dass es fast wie ein Knurren klang, aber mit einem singenden Tonfall, der wohl von dem Walisisch, das er gerade noch gesprochen hatte, zurückgeblieben war. Autorität schwang in seiner knappen Forderung mit. Dies war ein Mann, der von Menschen Gehorsam erwartete. Ein Schiffskapitän, der über Bord gespült worden war? Ein Opfer einer Meuterei? Aber wie passte das Tagebuch dazu? War er ein Spion, der hinter feindlichen Geheimnissen her war? Ein Ehemann, dem Unrecht zugefügt worden war? Das könnte zu dem Wort für »Liebe« passen, das er verwendet hatte. Vielleicht war er hintergangen worden, und der Beweis dafür stand in dem Tagebuch, das seine Frau führte?
Sabrinas Fantasie ließ sich ein Szenario nach dem anderen einfallen, jedes noch aufregender und reißerischer als das vorhergehende. Sie wünschte nur, sie hätte einen Stift und ihr eigenes Tagebuch, um die verschiedenen Vermutungen darin festzuhalten, bevor sie ihr wieder entglitten.
»Wie du willst.« Trauer schwang in diesen Worten mit, die so leise gesprochen waren, dass Sabrina sie nur hörte, weil sie noch näher gerückt war und ihr Ohr schon fast an seinem Mund hatte.
Mit angehaltenem Atem wartete sie, aber es kam nichts mehr.
Plötzlich warf er sich herum und erwischte mit dem Handrücken ihr Kinn. Der Schlag war so hart, dass Sabrina Sterne sah. Die Augen des Mannes waren trübe und sein Blick verschwommen, als er erwachte. »Geh nicht! Komm zurück!«, sagte er mit solcher Sehnsucht in der Stimme, dass Sabrina von Herzen wünschte, sie wäre diese Frau, die er sich so verzweifelt herbeiwünschte.
»Es ist alles gut«, antwortete sie und rieb sich das Kinn. »Sie sind in Sicherheit. Es war nur ein Traum.«
Er richtete seinen Blick auf sie, der jetzt schon wacher wirkte, und setzte sich mit einer Grimasse auf. »Ich dachte … doch …«
»Sie haben jemanden gerufen. Eine Geliebte? Eine Gemahlin?«, hakte sie nach, weil sie glaubte, eine Erinnerung hervorrufen zu können, solange er noch halb benommen war.
Er schüttelte den Kopf, als versuchte er, Klarheit zu erlangen. »Sie sind das. Es ist Ihr Gesicht, von dem ich träumte.«
»Aber ich bin es nicht. Ich bin …«
»Sabrina.« Er verschlang sie buchstäblich mit den schwarzen Augen. »Sie heißen Sabrina. Ich erinnere mich an Sie.«
Diesmal empfand sie seine Sehnsucht wie ein Kribbeln auf der Haut, und zum ersten Mal in ihrem Leben pfiff sie auf den Heilereid, raffte ihre Röcke und ergriff die Flucht.
Kapitel Drei
Raus aus den Federn, Schlafmütze! Die Schwestern rufen uns zum Frühstück.« Sabrina öffnete die Augen und gewahrte einen grau heraufdämmernden Morgen, den ein dunstiger Nieselregen noch kühler, feuchter und unfreundlicher erscheinen ließ.
»Geh weg! Ich bin müde.« Sie drehte sich auf die andere Seite, verbarg den Kopf unter dem Kissen und gab vor, die unerträglich muntere Aufforderung ihrer Freundin nicht gehört zu haben. Jane machte es viel zu großen Spaß, Sabrina zu nerven.
Ihr Kissen wurde weggezogen. »Schwester Brigh wird gleich mit dem Eiswasser hier sein, wenn du dich nicht beeilst.«
Sabrina erschauderte, aber nicht einmal diese Drohung trieb sie aus dem Bett. Sie hatte bis zwei Uhr morgens auf der Krankenstation gearbeitet und die stillen Stunden danach genutzt, um ihren unvollständigen Tagebucheintrag zu Ende zu bringen. Als sie das Buch dann endlich geschlossen hatte, hatten fürchterliche Kopfschmerzen sie gequält, und ihr Herz war schwer wie Blei gewesen.
So viel von dem, was sie über jene Tage vergessen hatte, war unter ihrer Feder wiedergekehrt. Ihr anfänglicher Schock und Schrecken. Das Geschrei und Gefluche, das dann folgte. Das schreckliche, verzweifelte Weinen ihrer Mutter und der stille Verrat der Dienerschaft, die sich wie Ratten von einem sinkenden Schiff aus einem Haus und von einer Familie davonstahl, die als verflucht hingestellt worden war. Sabrina hatte nicht gewusst, dass es noch schlimmer werden konnte, bis es so weit war.
Der Kummer ihrer Mutter wich bald einem Gram, der sie nur noch mit leeren Augen vor sich hin starren ließ und sie schließlich in das Grab neben dem ihres Ehemannes brachte. Sabrinas Bruder Aidan – der neue Earl of Kilronan –, zog sich in mürrischem Schweigen hinter die geschlossenen Türen des Arbeitszimmers zurück, und Brendan, der Bruder, den Sabrina mit sklavischer Ergebenheit liebte, verschwand ganz einfach ohne ein Wort der Erklärung. Niemand wusste, wohin, obwohl jeder etwas über das Warum zu wissen schien.
Danach wurde das Kloster der Schwestern des Hohen Danu zu einem Ort der Sicherheit, zu einem Zufluchtsort für sie. Zu einem Zuhause.
Sabrina war zufrieden gewesen und hatte nie ein Leben außerhalb der Gemeinschaft der bandraoi in Betracht gezogen. Nicht bis zu dieser endlosen letzten Saison, die überall Veränderungen mit sich brachte, nur nicht hier. Aidans unerwartete Heirat. Der Brief ihrer Kindheitsfreundin und Nachbarin Elizabeth Fitzgerald, in dem sie ihre kürzliche Verlobung bekanntgab. Selbst Jane würde Sabrina verlassen, wenn sie beim nächsten Fest zur Priesterin erhoben wurde. Nur Sabrina blieb in einer frustrierenden Schwebe hängen.
Unzufriedenheit durchdrang ihre Barrieren und nistete sich hartnäckig und unbequem in ihr ein.
»Hörst du mir überhaupt zu?«
Sabrina zog sich die Decken über den Kopf. »Sag ihnen, ich wäre krank!«
»Du bist nicht krank.«
»Dann behaupte, ich wäre tot! Was auch immer. Ich brauche Schlaf.«
»Du hast stundenlang geschlafen.«
»Und möchte es auch weiter tun, falls es dir nichts ausmacht«, brummte sie.
Sie mochte es nicht, wenn Jane in dieser quirligen, mütterlichen Stimmung war. Zumal ihre Freundin mit ein paar Nickerchen hier und da auskam und nicht verstand, warum Sabrina das nicht auch konnte.
»Kann ich mir ein paar saubere Strümpfe borgen? Meine haben ein großes Loch im Zeh.« Jane hatte Sabrina aufgegeben und wandte sich an die dritte Bewohnerin des Zimmers. Privatsphäre stand nicht gerade ganz oben auf der Liste der Notwendigkeiten der Schwestern.