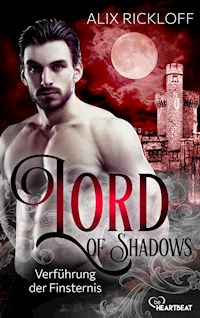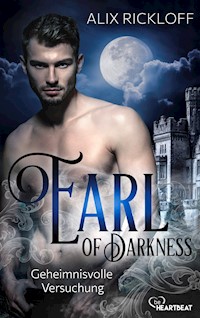4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Erben von Kilronan - Paranormal Regency
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Dunkle Magie, alte Legenden und glühende Leidenschaft.
Irland, 1816: Sieben Jahre sind vergangen, seit Elisabeth von ihrer Jugendliebe Brendan Douglas vor dem Altar sitzen gelassen wurde. Nun ist sie wieder verlobt und endlich bereit, ein neues Leben zu beginnen - bis sie Brendan unter ihren Hochzeitsgästen entdeckt. Doch das ist nur der erste Schock von vielen, denn der verführerische Halunke weckt nicht nur Gefühle in ihr, die sie längst vergessen glaubte, er trägt auch magisches Feenblut in sich ...
"Dunkel, sinnlich und bezaubernd, ein Fest für Freunde des paranormalen Liebesromans." ROMANTIC TIMES
Wild, romantisch und ungezähmt: ein magischer Liebesroman vor der Kulisse Irlands im 19. Jahrhundert. Alix Rickloff entführt ihre Fans in eine Welt voller Magie und Leidenschaft - der perfekte Mix aus BRIDGERTON und Christine Feehan.
Earl of Darkness - Geheimnisvolle Versuchung
Lord of Shadows - Verführung der Finsternis
Son of Danger - Verlockendes Dunkel
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 564
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Widmung
Danksagungen
Kapitel Eins
Kapitel Zwei
Kapitel Drei
Kapitel Vier
Kapitel Fünf
Kapitel Sechs
Kapitel Sieben
Kapitel Acht
Kapitel Neun
Kapitel Zehn
Kapitel Elf
Kapitel Zwölf
Kapitel Dreizehn
Kapitel Vierzehn
Kapitel Fünfzehn
Kapitel Sechzehn
Kapitel Siebzehn
Kapitel Achtzehn
Kapitel Neunzehn
Kapitel Zwanzig
Kapitel Einundzwanzig
Kapitel Zweiundzwanzig
Kapitel Dreiundzwanzig
Kapitel Vierundzwanzig
Kapitel Fünfundzwanzig
Kapitel Sechsundzwanzig
Kapitel Siebenundzwanzig
Über die Autorin
Weitere Titel der Autorin
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an: be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Über dieses Buch
Dunkle Magie, alte Legenden und glühende Leidenschaft!
Irland, 1816: Sieben Jahre sind vergangen, seit Elisabeth von ihrer Jugendliebe Brendan Douglas vor dem Altar sitzen gelassen wurde. Nun ist sie wieder verlobt und endlich bereit, ein neues Leben zu beginnen – bis sie Brendan unter ihren Hochzeitsgästen entdeckt. Doch das ist nur der erste Schock von vielen, denn der verführerische Halunke weckt nicht nur Gefühle in ihr, die sie längst vergessen glaubte, er trägt auch magisches Feenblut in sich …
eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.
ALIX RICKLOFF
SONOF DANGER
VerlockendesDunkel
Aus dem amerikanischen Englisch vonUlrike Moreno
Für Jane, Georgette, Rosamunde und Mary
Danksagungen
Wieder einmal möchte ich einer Vielzahl von Menschen danken, die mir bei der Entstehung eines weiteren Buches geholfen haben.
Meinem Agenten Kevan Lyon, der sich die größte Mühe gibt, mir das Geschäftliche zu erklären. Und ich hoffe immer noch, dass ich all das eines Tages auch verstehen werde.
Meiner Redakteurin Megan McKeever und all den wundervollen Menschen bei Pocket, die solch großartige Arbeit bei dieser Serie geleistet haben. Es war vom Anfang bis zum Ende ein Vergnügen, mit euch zu arbeiten.
Maggie und Do, die immer da sind, wenn die nachlassende Spannung in der Mitte zu einer unüberwindlichen Mauer wird. Diese hat mich fast geschafft, Ladys.
Helen McCarthy Goode und Pat Doody für das Nachprüfen meiner irischen Ausdrücke. Alle Fehler in dieser Sprache sind ganz allein die meinen.
Den fabelhaften Autoren von The Beau Monde, die mich niemals hängen lassen, wenn ich in letzter Minute eine Antwort suche, und die immer gern und großzügig ihre Zeit und ihre Fachkenntnisse teilen.
Und Küsse und Umarmungen an meine wunderbare Familie, die mir den Weg ebnet und mich bei Verstand hält – selbst wenn sie mich manchmal auf die Palme treibt. Ich liebe euch alle!
Kapitel Eins
Cornwall,April 1816
König Artus’ Grab lag tief in einem uralten Wald versteckt. Seit unzähligen Jahrhunderten breiteten die Bäume darüber schützend ihre Äste aus, erneuerten sich und verrotteten. Inzwischen war kaum noch ein Stein geblieben, der auf das Vorhandensein der Grabstätte hingedeutet hätte.
Eine Hand auf die Schulter seines Gehilfen, die andere auf seinen Stock gestützt, hinkte Máelodor die letzten Meter durch das dichte Unterholz, um vor der eingestürzten Grabstätte stehen zu bleiben. Allein die Anstrengung, von der Kutsche bis hierher zu gehen, hatte ihn sehr viel Kraft gekostet. Das Hemd klebte unangenehm feucht an seinem gebeugten Rücken, ein Beinstumpf rieb sich an seiner Prothese, und Blutstropfen durchdrangen seine Hose. Jeder rasselnde Atemzug brannte in seiner müden Lunge.
»Das ist es«, keuchte er, den Blick auf die moosbewachsenen Grabplatten gerichtet. »Ich fühle es.«
Er war sich so sicher, dass er sich nicht einmal damit aufhielt, sich Gewissheit zu verschaffen. Wozu auch? Sowie der Rywlkoth-Wandteppich, den Máelodor den Schwestern des Hohen Danu gestohlen hatte, entschlüsselt worden war, war er aufschlussreich genug gewesen. Die darauf gefundenen Hinweise hatten ihn mit untrüglicher Sicherheit zu diesem vergessenen Wäldchen in Cornwall und zu diesem Grab geführt.
Erregung zischelte über seine beschädigten Nerven und lahmen Glieder, Verletzungen, die alle Folgen seines unerbittlichen Strebens waren. Die Ziele der Neun waren wagemutig gewesen, oh ja, doch schon lange, bevor die Amhas-draoi, die Soldaten der Kriegsgöttin Scathach und Hüter der Trennung zwischen Sterblichen und Magiern, wie ein wütender Krähenschwarm über den Kreis der Neun hereingebrochen waren, hatte Máelodor gewusst, was nötig war, um Erfolg zu haben: Einem einzelnen Mann musste Autorität verliehen werden – einem Meistermagier, der bereit war, alles zu opfern und sich nicht von Gefühlsduseleien beeinflussen zu lassen. Alle verfügbaren Mittel einzusetzen, um ein neues Zeitalter der Vorherrschaft der Anderen herbeizuführen.
Und dieser Mann war er.
Während er seine fortgesetzte Existenz, von der kein Anderer etwas wissen durfte, unter einem Tarnzauber der Unsichtbaren verbarg, hatte er von ihren dunklen Kräften Gebrauch gemacht, um Leben neu zu erschaffen, und einen uralten walisischen Krieger als Domnuathi wiederauferstehen lassen. Als einen Soldaten von Domnu, der seinem Meister hörig und erfüllt von all den finsteren Kräften war, die seine Wiedergeburt bewirkt hatten.
Dieser erste Versuch war jedoch gescheitert, weil die Kreatur sich Máelodors Kontrolle entzogen hatte.
Doch der Meistermagier hatte aus seinen Fehlern gelernt. Ein zweites Mal würde das nicht passieren. War Artus erst einmal wiedergeboren, würde der auferstandene Hochkönig dem Mann dienen, der ihm sein Leben und seine Krone wiedergegeben hatte. Er würde dem Magier gehorchen, der ein Heer von Unsichtbaren-Dämonen hervorbrachte, die für seine Sache kämpfen würden. Und er würde seinen Herrn fürchten, wie es sich für einen Sklaven gehörte.
In der feuchten grünen Luft flirrte Magie, die jeder, der zufällig in diesen Teil des Waldes kam, mit Staubgeflimmer im Sonnenlicht verwechseln würde. Máelodor genoss das Spiel dieser Energie auf seiner Haut, bevor sie in seinen Blutstrom eindrang und sich mit seinen eigenen magischen Kräften vermischte. So machtvoll war der Rausch, der sich in ihm verbindenden Magie, dass eine prickelnde Erregung ihn erfasste. Die gleiche unkontrollierte Erregung, die er gewöhnlich im Schlafzimmer oder in der Folterkammer suchte.
Máelodors Hand krallte sich in die Schulter seines Begleiters, bis er dessen Knochen unter seinem Griff nachgeben fühlte. Der Mann schrie jedoch bei dieser brutalen Behandlung weder auf noch zuckte er zusammen. Oss war ebenso sehr seiner rohen Kraft wie seiner geschlitzten Zunge wegen erwählt worden, die ihm das Sprechen unmöglich machte. Máelodors Körper zuckte und erschauerte, als er von Wogen purer Lust durchflutet wurde. Und schließlich war er es, der auf dem Höhepunkt seiner Ekstase stöhnte und einen rauen Schrei ausstieß.
Befriedigt winkte er Oss weiter und bewegte sich mit ihm im Schneckentempo über den unebenen Boden, bis er am Rand des umgekippten Grabsteins stand, nahe genug, um seine Hand auf den Granit zu legen. Die Magie loderte auf und ließ ihn schwanken, als sie diesen Eindringling zu verstehen versuchte und sich forschend durch ihn hindurchbewegte.
Artus’ Gebeine waren nur noch durch eine bloße Grabplatte von ihm entfernt. Sowie Máelodor den Sh’vad Tual, den magischen Stein, den er zur Öffnung des Grabes brauchte, in den Händen hielt, würde er alles haben, um die Schutzzauber der Grabstätte unwirksam zu machen. Endlich würde er seinen großen Triumph erleben können, denn wer war noch geblieben, um ihn aufzuhalten?
Die Amhas-draoi gingen schon lange davon aus, dass er hingerichtet worden war. Der gewiefte Magier-Krieger St. John war sehr darum bemüht, die Aufmerksamkeit von Scathachs Bruderschaft auf einen anderen zu lenken und alle Gerüchte, dass Máelodor noch lebte, zu entkräften.
Die Beute der Amhas-draoi war Brendan Douglas. Dieser treulose Hund konnte nur hoffen, dass sie ihn fanden, bevor Máelodor ihn aufspürte. Denn sobald Douglas ihm ins Netz ging, würde er auch den Sh’vad Tual in den Händen halten. Der eine würde die Grabstätte entsichern, der andere monatelang Máelodors sündhafte Begierden stillen.
Es war faszinierend, wie lange man Schmerz in die Länge ziehen konnte. Ein tief eingeführter Draht zum Beispiel, an dem man nur hin und wieder ziehen musste, konnte unerträgliche Qualen verursachen, während der Tod jedoch gerade immer unerreichbar blieb. So würde es für Brendan Douglas sein. Der Mann, der den Kreis der Neun zu Fall gebracht hatte, würde für seinen Verrat bezahlen, ehe er seinem Vater und den anderen in Annwns tiefsten Abgrund folgte und nie mehr aus dem Totenreich zurückkehrte.
Bevor Máelodors Domnuathi ihm entkommen war, hatte er Lord Kilronans Tagebuch an sich gebracht.
Máelodor selbst hatte die Rywlkoth-Tapisserie stehlen lassen.
Und Brendan Douglas, Lord Kilronans illoyaler Sohn, würde ihm den Stein übergeben, während er um sein Leben bettelte.
»Wir sind nahe dran, Oss. Die Rasse der Anderen wird nicht länger im Verborgenen leben und die sterblichen Duinedon fürchten müssen. Es wird wieder unsere Zeit sein, und das werden wir uns nicht mehr so leicht nehmen lassen.«
Sein bärenstarker Begleiter nickte ohne die geringste Regung in den leeren Augen. Er stand nur mit leicht gespreizten Beinen da und ließ die Arme hängen wie ein Affe.
»Hilf mir zur Kutsche zurück! Ich erwarte Neuigkeiten über Douglas.«
Schweigend wandten sich der alte Krüppel und der stumme Albino von der Grabstätte ab und stolperten durch das dichte Unterholz zurück.
Bevor die Grabsteine jedoch wieder mit dem Schutz des Waldes verschmolzen, drehte Máelodor sich noch einmal um und flüsterte die Worte, die den Zugang öffnen würden: »Mebyoa Uther hath Ygraine. Studhyesk esh Merlinus. Flogsk esh na est Erelth. Pila-vyghterneask. Klywea mest hath igosk agesha daresha.«
Die Bäume schwankten, als Vögel sich in einer wild schnatternden schwarzen Wolke in die Luft erhoben. Die Sonne trübte sich und tauchte das Wäldchen in jähe Dunkelheit. Ein kalter Windstoß trug ein leises Geläut herbei, und die Zurückweisung schmerzte wie ein Dolchstoß in Máelodors Brust. Die Antwort ließ nicht auf sich warten …
Nein.
Dun EyreGrafschaft Clare in Irland
»Halt still, Elisabeth! Die Schneiderin kann nicht arbeiten, wenn du herumhüpfst wie ein Kreisel.«
Mit einem leidgeprüften Seufzer befolgte Elisabeth Tante Fitz’ Worte und versuchte, die brennenden Muskeln in ihren Armen und die von ihren Fingerspitzen heraufwandernde Taubheit zu ignorieren. Ihre Tante hatte gut reden. Sie war ja auch nicht gezwungen, mit ausgebreiteten Armen und in ihre Taille piksenden Nadeln dazustehen, während jegliches Gefühl aus ihren Gliedern wich. In der Hoffnung, wenigstens den verkrampften Nacken zu lockern, ließ sie die Schultern rollen.
»Hör auf zu zappeln! Wenn du nicht ständig zwischen den Mahlzeiten naschen würdest, müsste Miss Havisham jetzt nicht das Kleid umändern.«
Die Schneiderin blickte auf. »Mm … phnmp«, murmelte sie mit einem Mund voller Stecknadeln.
»Und das ist sehr freundlich von Ihnen, Miss Havisham. Aber es wäre mir lieber, wenn meine Nichte auf zusätzliche Desserts und spätabendlichen Tee und Kekse verzichten würde.«
Durch den großen Drehspiegel warf Elisabeth ihrer Tante einen gereizten Blick zu. Ihre Nascherei war ein ständiger Streitpunkt zwischen ihnen. Tante Fitz, die selbst spindeldürr war, hatte die üppige Figur ihrer Nichte stets missfallen. Oder vielleicht hatte sie Elisabeth auch darum beneidet. Wie dem auch sei, Besuche bei der Schneiderin endeten jedenfalls stets in schlechter Stimmung und anhaltendem Schweigen. Und lösten das unwiderstehliche Bedürfnis bei Elisabeth aus, aus purem Trotz etwas Süßes zu essen.
Sie riskierte es, mit einer Hand über die Biegung ihrer Hüfte zu streichen und sich an dem Gefühl der kühlen hellen Seide unter ihren Fingern zu erfreuen. »Vielleicht solltest du mir einfach einen Sack überwerfen und uns die Mühe ersparen.«
»Sei nicht vorlaut, Liebes!«, war die Antwort ihrer Tante, die sich in einem Lehnstuhl am Feuer niederließ und in einer müden Geste ihre Schläfen rieb.
Miss Havisham richtete sich mit einem zuvorkommenden Lächeln auf. »So, Miss Fitzgerald. Sie können das Kleid jetzt wieder ausziehen.«
Mithilfe ihrer Zofe und der Schneiderin wand Elisabeth sich aus der Seidenrobe.
»Die Änderungen werden bis morgen fertig sein. Oh, es wird bezaubernd sein, das Kleid. Sie werden traumhaft schön darin aussehen. Mr. Shaw wird denken, dass er einen Engel heiratet.«
Elisabeth blickte sich im Spiegel an und bezweifelte, dass selbst die teure und exklusive Dubliner Modistin eine solche Verwandlung bewirken konnte. Aber es war ein erfreulicher Gedanke, Bewunderung in Gordons Augen aufblitzen zu sehen, wenn er sie in der cremefarbenen Spitzen- und Seidenkreation erblickte.
Miss Havisham plauderte weiter, während sie ihre Sachen packte. »Gott, wie aufregend das sein muss! Mit all Ihren Angehörigen um sich und der Vorfreude, ein neues Leben mit einem so angesehenen und gut aussehenden jungen Mann zu beginnen.«
»Aufregend war es beim ersten Mal«, nörgelte Tante Fitz. »Diesmal ist es nur noch strapaziös.«
Elisabeth spürte, wie ihr das Blut in Nacken und Wangen stieg. Bei anderen mochten die Augen der Spiegel der Seele sein, in ihrem Fall jedoch offenbarten sich alle Gedanken und Gefühle durch rote Flecken in ihrem Gesicht. Was kein schönes Bild war in Verbindung mit ihrem leuchtend roten Haar. »Du hättest ja auch nicht so viel Aufhebens um die Hochzeit machen müssen. Eigentlich wäre es mir sogar lieber gewesen, wenn du es gelassen hättest.«
Die Lippen ihrer Tante verzogen sich zu einem verständnisvollen Lächeln. »Ich weiß, Kind, aber das hätte Tante Pheeney uns nie verziehen. Du weißt, wie sehr sie großes Trara liebt. Lass uns nur hoffen, dass diese Hochzeit problemlos abläuft. Ich habe nicht die Kraft für eine dritte. Und weder du noch ich werden jünger. In diesem Sommer wirst du sechsundzwanzig. Die meisten deiner Freundinnen sind längst verheiratet und haben volle Kinderzimmer.«
Elisabeth hielt still, als ihre Zofe die Bänder ihres Kleides befestigte. »Danke, dass du mich an meine nahende Altersschwäche erinnerst.«
»Ich sage nur, dass es für eine Frau ab einem gewissen Alter schwieriger wird, die Männer zu …«
»Ich weiß, was du meinst, Tante Fitz. Und du hast ja auch recht. Ich habe eben nur lange gebraucht, um einen passenden Mann zu finden. Jemanden, den ich genügend respektieren kann, um ein gemeinsames Leben mit ihm aufzubauen. Und Gordon Shaw ist dieser Mann.«
»Das hoffe ich doch sehr, denn sonst hätten wir uns die ganze Mühe umsonst gemacht – schon wieder«, murmelte Tante Fitz, ehe sie beim Anblick von Elisabeths Stirnrunzeln ein fröhliches Lächeln aufsetzte. »Nein, du hast schon recht, Lissa. Er ist ein feiner Mensch und passender Ehemann.«
Lissa. Warum benutzte ihre Tante diesen albernen Kosenamen aus ihrer Kindheit? Wollte sie sie ausgerechnet jetzt, da sie dringend Selbstvertrauen brauchte, durcheinanderbringen? Oder war es nur ein Versprecher gewesen nach einem endlosen Tag von Hochzeitsvorbereitungen?
Nur ein einziger anderer Mensch hatte es je gewagt, sie nach ihrem zehnten Geburtstag noch Lissa zu nennen. Ein unerträglicher, unverschämter, gewissenloser, elender Schuft.
Der gar nicht so ehrenwerte Brendan Douglas.
Musik erreichte sie. Selbst in Elisabeths Schlafzimmer, weit entfernt von dem Licht, den Farben und der Heiterkeit im Salon unten, umtanzten sie Klänge von Mozart wie Gespenster. Ausgerechnet der zweite Satz seines Klavierkonzertes No. 27, das sie einmal für ihr Lieblingsstück gehalten hatte. Aber das war vor vielen Jahren gewesen; heute ging es ihr nur noch auf die Nerven, die vertrauten Töne zu hören.
Zuerst Tante Fitz, die sie Lissa genannt hatte, und jetzt das. Erinnerungen hingen heute Abend schwerer in der Luft als seit vielen Jahren. Wie ein Nebel, der in ihrer Kehle klebte und ihr den Atem aus der Lunge presste. Aber das könnte natürlich auch ihr Mieder sein. Schwer zu sagen …
Sie gab ein Tröpfchen Parfum hinter jedes Ohr und an ihren Halsansatz und steckte eine widerspenstige Haarsträhne fest, die sich gelöst hatte. Banale kleine Dinge, die ihr jedoch einen Vorwand lieferten, in der Sicherheit ihres Zimmers zu bleiben, während unten diese fürchterliche, nicht enden wollende Melodie gespielt wurde.
Ganz zuletzt berührte sie noch einmal das Kollier, das Gordon ihr beim Dinner überreicht hatte. Unter einem Chor von Ahs und Ohs weiblicher Verwandtschaft und der Männer, die ihn gnadenlos mit seiner Verliebtheit aufzogen, hatte Gordon ihr das auffallend und kostspielige Saphirkollier umgelegt. Sie hatte sich an ihn gelehnt, aber er war mit einem ausgesprochen un-liebevollen Klaps auf ihre Schulter einen Schritt zurückgetreten.
Das Kollier war hinreißend. Sagenhaft. Ein regelrechtes Kunstwerk. Und absolut nicht nach ihrem Geschmack.
Kurz entschlossen griff sie hinter sich, um den Verschluss zu lösen, und legte den protzigen Halsschmuck in seine Schatulle zurück. Die Musik schwoll an, als Elisabeth ihr Schmuckkästchen öffnete und etwas anderes heraussuchte. Eine schlichte goldene Kette mit einem ebenso schlichten Anhänger – einem Stein, der atemberaubender war als alle, die sie je gesehen hatte.
Groß wie die Faust eines Babys und kaum bearbeitet, als wäre er gerade erst abgebaut worden, war der milchig durchscheinende Kristall mit silbernen, goldenen, perlrosa und pechschwarzen Adern durchzogen. Je nach Beschaffenheit des Lichts konnte er mit flammenartiger Helligkeit aufleuchten oder wie glühende Kohlen glimmen. Heute Abend lag er in der Mulde zwischen ihren Brüsten. Die Unaufdringlichkeit seiner Farben betonte ihre honigfarbene Haut und zauberte ein goldenes Funkeln in ihre Augen.
Würde Gordon verstehen, oder würde er bei einem Blick auf ihren Hals nur ihre Weigerung sehen, sein kostspieliges Geschenk zu tragen? Vielleicht war es heute Abend wohl doch besser, die Saphire zu tragen.
Elisabeth nestelte gerade wieder an dem Verschluss, als die Tür aufflog und die mädchenhaft runden Gesichtszüge von Tante Pheeney offenbarten.
»Trödelst du immer noch hier oben herum? Allmählich denken alle, du hättest kalte Füße bekommen, meine Liebe. Sogar Gordon ist besorgt. Du weißt, was man über das Rad der Zeit sagt …«
»Ich brauche nur noch einen Moment.«
Aber Tante Pheeney ließ sich nicht länger hinhalten und zog Elisabeth aus dem Sessel hoch. »Schluss mit dem Verstecken hier oben! Was heute stattfinden soll, ist eine Feier, keine Totenwache.«
»Ich weiß, ich muss nur noch …«
»Keine Ausreden mehr, junge Dame!« Die Tante hatte sie schon halbwegs bis zur Tür geschoben. »Du kommst jetzt mit hinunter.« Ihre sonst so heiteren Züge verzogen sich zu einem Ausdruck, der bei Tante Pheeney als strenge Miene durchgehen könnte. »Das ist ein Befehl.«
»Ja, Ma’am.« Elisabeth ließ sich von ihr hinausführen, und Gordons Saphire blieben vergessen auf der Frisierkommode liegen.
Als sie die Treppe hinuntergingen, wechselte die Musik zu einem regelrechten Contredanse. Die Herren führten ihre Partnerinnen in den für den Abend leer geräumten Salon, dessen Türen zur Eingangshalle weit geöffnet waren, um einen riesigen, festlich geschmückten, von fröhlichem Gelächter erfüllten Saal zu bilden.
Elisabeth ließ den Blick über das Meer von Gästen gleiten. Die meisten waren Familienangehörige, aber auch Nachbarn und Freunde waren gekommen, einige sogar aus dem fernen Dublin, um an den Hochzeitsfeierlichkeiten teilzunehmen. Die Heirat der Fitzgerald’schen Erbin hatte so lange auf sich warten lassen, dass alle dabei sein und sie miterleben wollten. Oder, flüsterte ihr eine zynische Stimme zu, um sagen zu können, sie seien dabei gewesen waren, als Elisabeth Fitzgerald ein zweites Mal sitzen gelassen wurde.
Tante Fitz und Lord Taverner unterhielten sich in einer stilleren Ecke. Elisabeths Vormund sprach zweifellos über Eheverträge, Mitgiftgüter und Landtreuhänderschaften. Tante Fitz nickte nachdenklich, aber ihr Blick war scharf und ihre Stirn gerunzelt.
Elisabeths Cousin Rolf, der sehr schneidig aussah in seiner scharlachroten Uniform, und ihre schöne, ganz in Weiß und Gold gekleidete Cousine Francis wirbelten über die Tanzfläche, während Cousine Fanny und Sir James von den herumgereichten Platten naschten.
Onkel McCafferty war in ein Gespräch mit einem Herrn vertieft, den Elisabeth nicht kannte. Wahrscheinlich handelte es sich dabei um einen der Dubliner, die von der gutmütigen Tante Pheeney eingeladen worden waren, weil sie glaubte, jeder, mit dem sie auch nur ein paar Worte wechselte, verdiene eine Einladung.
Gordon und sein Halbbruder Marcus standen bei einer Gruppe solide gekleideter Begleiter. Gordons gutes Aussehen und seine athletische Gestalt zogen wie immer die Blicke aller Frauen im Raum auf sich. Elisabeth straffte die Schultern und setzte ein Lächeln auf. In ein paar Tagen würde dieses absurde Theater vorbei sein – und sie eine verheiratete Frau.
»Komm, Elisabeth! Alle warten schon auf dich«, drängte Tante Pheeney. »Seht her, hier kommt die Braut.«
Die Musik verstummte, aber nur für einen Moment, bevor das Quietschen der Violinen erneut begann. Jetzt tanzten andere Paare, nur an den Tanzschritten selbst änderte sich nichts.
Elisabeth hielt sich zurück, da sie ein bisschen außer Atem war und ein komisches Gefühl im Magen hatte. »Lass mir einen Moment, damit ich mich sammeln kann! Dann komme ich.« Auf den skeptischen Blick ihrer Tante fügte sie hinzu: »Versprochen«, und küsste die alte Dame auf die weiche, trockene Wange.
Tante Pheeney tätschelte ihr die Hand. »Na schön, mein Kind. Aber nur einen Moment.«
Elisabeth betrachtete die Szene, die sich ihr bot, wie ein kleines Mädchen, das sich aus dem Kinderzimmer geschlichen hatte, um einen Blick auf die Mutter und den Vater unter all den geröteten, lachenden Gesichtern zu erhaschen.
Noch lange, nachdem ihre Eltern im Ausland verstorben waren und Tante Fitz und Tante Pheeney die aufwendigen Bälle und fröhlichen Gesellschaften gegeben hatten, war Elisabeths Blick stets über das lebende Bild vor ihr geglitten, als könnte sie das tizianrote Haar ihrer Mutter oder den breiten Rücken ihres Vaters in der Menge sehen.
Mit einem tiefen Atemzug trat sie aus den schützenden Schatten der Halle in das Licht von tausend Kerzen. Sofort hob Gordon ein Monokel an sein Auge und musterte sie einen langen Moment, bevor er es mit einem fragenden Funkeln in den Augen wieder sinken ließ.
Elisabeth versuchte, entschuldigend zu lächeln, aber nach einem kumpelhaften Schulterklopfen seiner Freunde hatte er sich ihnen schon wieder zugewandt und stimmte in ihr ausgelassenes Gelächter ein.
Ein anderer musste jedoch erst noch wegsehen. Der Fremde, der bei Onkel McCafferty stand, maß sie mit einem derart intensiven Blick, dass ihr die Röte in die Wangen stieg – bis sie merkte, dass es nicht ihr Gesicht war, das er anstarrte, sondern ihre Brust. Und obwohl er nicht der erste Mann war, der sich so etwas erlaubte, ärgerte es sie trotzdem. Soll er doch glotzen!, dachte sie. Was kümmerte sie das? Und dennoch hob sie das Kinn, um seinen festen Blick mit einem ebenso festen zu erwidern.
Er war um einiges größer als ihr Onkel, vielleicht sogar so groß wie Gordon. Doch während ihr Verlobter wie ein Ringer gebaut war, zeugte die durchtrainierte Schlankheit dieses Mannes von Beweglichkeit und Finesse. Er kämpfte mit dem Schwert und nicht mit seinen Fäusten.
Seine Augen verengten sich, als er sich ein wenig vorbeugte, um an seinem Wein zu nippen und ein paar Worte an Onkel McCafferty zu richten. Aber selbst dabei wandte er nicht den Blick von ihr. Er hatte etwas an sich, das Elisabeth bekannt vorkam. Seine Haltung vielleicht? Oder die dichten, dunklen Augenbrauen? Als er den Blick endlich von ihren Brüsten zu ihrem Gesicht erhob, spielte ein freches, anzügliches Lächeln um seinen Mund. Die Hitze, die Elisabeth erfasste, drohte sie schier zu versengen. Nein, so einen unverfrorenen, respektlosen Mann wollte sie gewiss nicht kennen!
Hocherhobenen Hauptes raffte sie ihre Röcke und stürzte sich ins Getümmel.
Die Stunden vergingen in einem Dunst von Gesprächen und Musik. Elisabeth ließ kaum einen Tanz aus und wechselte von Partner zu Partner, da jeder Mann ihr Komplimente zu ihrem Aussehen machen und ihr zur Hochzeit gratulieren wollte. Gordon bat natürlich um den ersten Tanz. Als er sie zur Tanzfläche führte, hielt er ihre Hand so fest, als könnte sie versuchen zu entkommen. Zur Wahl ihres Halsschmuckes bemerkte er nur: »Tut mir leid, dass mein Geschenk dir nicht gefällt. Wenn du möchtest, können wir etwas anderes aussuchen, das eher deinem Geschmack entspricht.«
Ein jähes Schuldbewusstsein beschlich Elisabeth, das sie strahlender lächeln ließ, als sie es normalerweise täte. »Ich würde es für nichts auf der Welt umtauschen.« Gordon zog nur eine Augenbraue hoch, worauf sie hastig weitersprach. »Doch die Saphire passten nicht zu meinem Kleid, weißt du. Morgen Abend werde ich sie tragen. Versprochen. Ich habe ein neues Kleid, zu dem sie wunderbar aussehen werden.« Sie ging sogar so weit, ihm spielerisch mit ihrem Fächer auf den Arm zu schlagen.
Gordon antwortete mit einem gequälten Lächeln. »Zieh nur ruhig dein Talmi an, Elisabeth! Für diese Art Gesellschaft ist er schön genug.«
»Was soll das denn heißen?«
»Du brauchst nicht gleich in die Luft zu gehen, Liebling. Ich meinte nur, dass ich dich in allem, was du trägst, untadelig finde.«
Ein wenig besänftigt durch seine Antwort, blickte sie in einer unverkennbaren Aufforderung zu ihm auf. Sie könnten für ein paar Minuten entwischen, ohne dass es jemand merken würde. Es gab jede Menge stille Eckchen in der Nähe. Und in ein paar Tagen würden sie ohnehin verheiratet sein.
Leider trat Gordon jedoch im selben Augenblick zurück, in dem sie sich vorbeugte, und brachte sie damit beinahe aus dem Gleichgewicht. Er räusperte sich und setzte eine reservierte Miene auf. »Vorsicht, Elisabeth! Deine Großtante Charity durchbohrt uns geradezu mit ihren Blicken.«
Elisabeth straffte sich, strich ihre Röcke glatt und warf ein Lächeln in die Menge, als wäre es Absicht gewesen, dass sie beinahe hingefallen wäre. »Pah!«, flüsterte sie. »Ich pfeife auf Tante Charity. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Wenn auch nur die Hälfte der Geschichten über sie stimmen …«
»Sei still, Liebes! Es wäre nicht gut, sie unnötigerweise zu verärgern. Ich möchte nicht, dass sie mich für einen Wüstling hält.«
»Und wenn ich Wüstlinge mag?«
»Was bist du doch für ein Schelm, Liebste!«, sagte er und beantwortete eine ungeduldige Geste seines Bruders mit einem Nicken. »Marcus braucht einen vierten Spieler für eine Partie, mein Herz. Wirst du allein zurechtkommen?« Er lächelte. »Was für eine dumme Frage! Natürlich wirst du das. Du hast eine natürliche Begabung für diese Art gesellschaftlicher Plaudereien. Und schließlich sind diese Leute deine Familie und nicht ein Haufen Fremder, was?« Er kniff sie ins Kinn, als wäre sie ein Kind, und verschwand dann ohne einen Blick zurück.
Elisabeth nutzte die Atempause, um sich ein Häppchen und ein Glas Wein von einem der angebotenen Tabletts zu nehmen. Während sie an ihrem Pastetchen knabberte, beobachtete sie die in allen Papageienfarben schillernden Damen und schneidigen Herren an ihrer Seite. Sie lachten, tanzten, tranken, und hin und wieder sangen sie sogar. Laut und manchmal ein bisschen derb, aber immer gutmütig und fröhlich.
Für diese Art Gesellschaft … Was hatte Gordon damit sagen wollen? Und warum hatte sie das Gefühl, heruntergeputzt worden zu sein wie ein Kind? Mit einem schnellen Klicken ihres Fächers und einem Seufzen verdrängte sie die Fragen wieder.
»Auf Ihrem eigenen Fest im Stich gelassen?«, ertönte eine tiefe, weiche Männerstimme hinter ihr. Eindeutig nicht Großtante Charitys, die einen Kasernenhofton an sich hatte.
Oh nein. Elisabeth kannte diese Stimme und diesen anmaßenden Ton.
Sie fuhr herum und prallte buchstäblich gegen eine harte Brust. Ihr Glas Wein ergoss sich über seinen Rock und färbte seine Hemdbrust dunkelrot. Mit einem unterdrückten Fluch trat er zurück, und der Moment zerplatzte wie eine Wasserblase. Es war der Mann von vorhin. Ein Fremder. Nicht er. Absolut nicht er. Was war nur los mit ihr, dass sie bereits Gespenster sah?
»Verzeihung«, murmelte sie schnell und betupfte seine Hemdbrust mit ihrer Serviette.
»Erlauben Sie?« Er nahm ihr die Serviette aus der Hand, woraufhin ihr etwas verspätet die unangebrachte Vertrautheit ihrer Handlungsweise zu Bewusstsein kam.
»Ich … Ach, du liebe Güte! Sie denken doch nicht … O Gott!«, plapperte sie.
Er betupfte den Fleck, bevor er die Serviette zerknüllte und einsteckte. »Aber nein. Zumindest ist es dieses Mal kein Blut.«
Was um Himmels willen wollte er damit sagen?
Er hob den Kopf und richtete endlich seinen Blick auf ihren. Seine Augen leuchteten golden wie zwei Sonnen, und die Iris war von tiefstem Schwarz umringt.
Elisabeth schlug eine Hand vor ihren Mund, um den Aufschrei zu ersticken, der aus ihrem tiefsten Inneren aufstieg.
Seine Lippen zuckten vor unterdrückter Belustigung – als wäre irgendetwas daran komisch! Welterschütternd ja wohl eher. »Hallo, Lissa.«
Kapitel Zwei
Hatte irgendjemand etwas mitbekommen? Wusste jemand was? Ein solches Ereignis müsste eigentlich von einem Donnerschlag begleitet werden und die Erde sich wie wild um ihre Achse drehen. Aber nichts geschah. Gordon blieb bei seinen Karten spielenden Freunden; Tante Fitz und Tante Pheeney plauderten mit dem Vikar und seiner Frau, und die anderen Gäste waren auch weiterhin mit ihren eigenen Amüsements beschäftigt. Alles war so, wie es einen Moment zuvor gewesen war, als sie sich der Katastrophe, die in ihrer Mitte lauerte, zum Glück noch nicht bewusst gewesen war. Doch jetzt bräuchte es nur ein neugieriges Familienmitglied oder einen lästigen Gratulanten, um vergangene traurige Berühmtheit in neue Anschuldigungen, Anspielungen und Spekulationen zu verwandeln.
Miss Elisabeth Fitzgerald: von der sitzen gelassenen alten Jungfer im Bruchteil von Sekunden zu einer jungen Frau mit einem Überschuss an Bräutigamen.
»Sie entschuldigen mich … Sir.« Das Pochen hinter ihren Augen nahm zu, bis ihr Kopf schmerzte und ihre Beine so stark zitterten, dass sie kaum noch laufen konnte.
Aber statt sie in Würde gehen zu lassen, begleitete Brendan Douglas sie in die Eingangshalle. Und dort fand sich ihre Hand dann irgendwie in seiner wieder. Der feste Druck und die schwielige Innenfläche seiner Hand standen in seltsamem Kontrast zu seinem eleganten Äußeren, als er sie zu einem kleinen Salon hinüberführte.
An der Tür drehte er sich um, um sie zu schließen, und Elisabeth konnte sehen, wie straff sein Rock sich über seinen breiten Schultern spannte. Und als er sich ihr wieder zuwandte, bemerkte sie zum ersten Mal einen rasch vernähten Saum und eine abgetragene Manschette. Er war also eher geschickt zusammengeflickt als elegant und hatte sich keineswegs so sehr verändert, wie sie zunächst angenommen hatte.
»Was hast du mit dir angestellt?«, fragte sie.
Dies hätte wahrscheinlich nicht ihre erste Frage sein sollen, doch es war alles, was sie herausbrachte, als sie ihr Leben blitzartig vor ihren Augen vorüberziehen sah.
»Das?« Er fuhr sich mit der Hand über das Gesicht, als streifte er eine Maske ab, und ein Kribbeln in der Luft bewirkte, dass sich ihr die Härchen an den Armen und im Nacken sträubten. Sofort begannen seine Züge zu flimmern und zu verschwimmen, bevor sie sich jäh wieder schärften. »Nur ein kleiner fith-fath-Zauber, um nicht erkannt zu werden. Weil ich sonst bestimmt nicht mit offenen Armen wieder aufgenommen worden wäre.«
»Lass das!«, fauchte sie.
Sooft sie sich auch sagte, dass nichts Schlimmes an den magischen Kräften der Anderen war, schreckte sie doch immer noch vor dem beiläufigen Gebrauch einer Magie zurück, die wie etwas aus einem Märchen zu sein schien. Ihre Großmutter war eine Andere gewesen. Elisabeth hatte sie als verträumte alte Dame in Erinnerung, die jeden wachen Moment in ihren Gärten verbrachte, wo sie über die Wege schlenderte und zu Blumen und Bäumen sprach, als begrüßte sie gute alte Freunde.
Die Nachbarn hatten sie als verrückt bezeichnet, doch Elisabeth hatte es besser gewusst, auch wenn sie den Mund gehalten hatte. Niemand durfte wissen, was die alte Dame wirklich war. Es war besser, für exzentrisch gehalten zu werden als für eine Magierin. Und obwohl Elisabeth nichts von den magischen Kräften ihrer Großmutter geerbt hatte, war sie in dem Wissen erzogen worden, dass es neben der normalen Welt der Duinedon oder Sterblichen, in der sie lebte, noch eine andere gab. Eine gefährliche, schöne, erstaunliche Welt, in der alles möglich sein konnte und das Leben größere Wunder, aber auch schlimmere Übel enthielt, als sie sich vorstellen konnte.
Brendan grinste. »Ich hatte schon vergessen, wie sehr du Magie fürchtest.«
»Ich fürchte sie nicht.«
Sichtlich ungläubig zog er die Brauen hoch. »Dann bist du also nur neidisch?«
»Ich bin auch nicht neidisch. Ich pfeife auf deine lächerliche …«
Er grinste noch breiter. Oh, wenn sie doch nur dieses irritierende Lächeln von seinem verwirrenden Gesicht wegwischen könnte! Ein Gesicht, das selbst ungetarnt kaum wiederzuerkennen war. Der Brendan aus ihren Erinnerungen war ein schlaksiger, etwas linkischer Bücherwurm mit Händen voller Tintenflecke und mädchenhaft hübschen Zügen unter einer dichten Mähne dunkelbraunen Haares gewesen, das immer einen Haarschnitt hätte brauchen können. Brillant, ungeduldig, sarkastisch und sehr von sich eingenommen war er gewesen.
Und sie bis über beide Ohren in ihn verliebt … was er allerdings nie mitbekommen hatte.
Fast keine Spur dieser engelhaften Schönheit war in dieser härteren Version von Brendan noch zu sehen. Stattdessen wirkten seine Züge genauso ungeschliffen und scharfkantig wie der Stein, den sie um den Hals trug, als wären beide mit zu schneller Hand gemeißelt worden, und sein einst so schmaler Körper war zu einem erstaunlich athletischen herangewachsen. Nicht herkulisch, sondern mehr von langgliedriger, quecksilbriger Schlankheit. Jahre im Ausland in raueren Witterungen verrieten sich in der dunklen Bräune seines Gesichts und den Fältchen um seine Mundwinkel und Augen. Diese bemerkenswerten, außergewöhnlichen Augen waren das einzige Merkmal, das er niemals hatte tarnen können. Immer hatten sie geglänzt wie warmer goldener Honig. Rege, intelligent und sprühend vor Leben wie die Sonne. Oder atemberaubend wie der Tritt eines Pferdes in den Magen.
»Warum bist du hier? Du hast kein Recht dazu.«
Er machte eine angedeutete Verbeugung. »Erlaube mir, mich vorzustellen. John Martin, entfernter Cousin der Braut, erst kürzlich aus dem Ausland heimgekehrt. Bei dem Gedränge hier wunderte sich keiner über einen weiteren Verwandten unter all den anderen Hochzeitsgästen.« Ein verschmitztes Lächeln spielte um seine Lippen. »Allerdings muss ich leider das Zimmer beanstanden, das mir gegeben wurde. Man hat mich buchstäblich unter die Dachbalken verbannt. In eine richtige Dachkammer. Man sollte meinen, ich sei hier nicht willkommen.«
Das genügte. Sie waren allein und hatten das Summen der Gespräche, das Lachen und die fröhlichen Töne des Streichquartetts weit hinter sich zurückgelassen. Hier war niemand, der Elisabeths Verwirrung sehen konnte. Niemand, der etwas zu ihren zitternden Gliedern oder den zerbrochenen Stäben ihres Fächers bemerken konnte. Endlich konnte sie der Wut Luft machen, die in ihr hochkochte. Als hätte sie einen eigenen Willen, holte Elisabeths freie Rechte weit aus und schlug Brendan so heftig ins Gesicht, dass ihre Finger schmerzten. »Du stinkender, herzloser Bastard!« Sie wollte gleich noch einmal zuschlagen und ballte die Hand zur Faust. »Warum konntest du nicht tot bleiben, verdammt noch mal?«
Dem zweiten Schlag wich Brendan schnell genug aus, sodass er ihn nur noch an der Schulter streifte. Aber der dritte, hinter dem sieben Jahre böses Blut steckten, erwischte ihn voll am Kinn. Mehr vor Schreck als vor Schmerz taumelte er zurück und schlug sich den Kopf an der Kante eines Bücherregals an. Sterne explodierten hinter seinen Augen, und er fiel fast auf die Knie.
»Oh nein! O Gott! Das tut mir leid. Alles in Ordnung mit dir?« Hände flatterten um ihn herum, und Finger streiften seine Kopfhaut.
Er zuckte zusammen und stieß eine Reihe gotteslästerlicher Flüche aus.
Die Hände zogen sich zurück. »Du brauchst nicht gleich in eine solch vulgäre Sprache zu verfallen.«
Brendan öffnete die Augen und blickte in Elisabeths besorgtes, aber immer noch wütendes Gesicht. Sie hatte die Arme nun um die Taille geschlungen und war kreidebleich, was ihr glänzendes rotes Haar noch mehr zum Leuchten brachte. Als umtanzten Flammen ihr Gesicht.
»Du hast mir fast den Schädel gebrochen. Was erwartetest du, von mir zu hören?« Er betastete vorsichtig die Beule an seinem Kopf. Sie schwoll schon an und schmerzte höllisch. »Vielen Dank für dieses Riesenei an meinem Kopf!«
»Hör auf, dich wie ein Kleinkind aufzuführen! Wenn ich wollte – und glaub ja nicht, ich wäre nicht versucht –, würde ich dir von Gordon die Prügel verabreichen lassen, die du verdienst. Oder von Aidan. Ja, genau das sollte ich tun. Aidan kommen lassen. Er würde …«
»Nein.« Brendans scharfer Ton ließ sie vor Schreck verstummen. »Du wirst Aidan nicht kommen lassen, sondern schön den Mund halten, Elisabeth. Für jeden, der fragt, bin ich John Martin.«
»Und warum in aller Welt sollte ich schweigen?«
»Das ist kompliziert. Doch glaub mir, wenn ich dir sage, dass etwas anderes zu tun sehr unklug wäre!«
Sie verschränkte die Arme vor der Brust und musterte ihn argwöhnisch. »Aidan sollte erfahren, dass du noch lebst. Dein Bruder …«
»Wenn ich so weit bin, werde ich nach Belfoyle heimkehren. Aber im Moment bin ich noch hier und habe vor, zunächst einmal auch weiterhin zu bleiben.«
Er dürfte nicht mit ihr herumstreiten, ja er hätte sie nicht einmal wissen lassen dürfen, dass er hier war. Er hatte sich geschworen, in einem Umkreis von fünf Quadratkilometern von Elisabeth Fitzgerald nicht aufzufallen und den Mund zu halten. Sein Cousin Jack hatte ihn mindestens tausend Mal vor den Gefahren gewarnt, denen er sich gegenübersehen würde, wenn er sich in die Höhle des Löwen begab. Sei vernünftig! Denk an deine Sicherheit! Geh schnell und leise hinein und wieder hinaus. Aber Elisabeth auf der anderen Seite von Dun Eyres Salon zu sehen, war eine zu große Versuchung gewesen. Er hätte wissen müssen, dass sie ihn erkennen würde. Und dass diesem Erkennen eine hässliche und peinliche Szene folgen würde. Allerdings hatte er mehr an Tränen und Vorwürfe, sie verlassen zu haben, gedacht, als an Fäuste und den inbrünstigen Wunsch, er möge tot geblieben sein.
Lissa war schon immer mehr als nur ein bisschen unberechenbar gewesen.
»Bitte, Elisabeth!«
»Nenn mir einen guten Grund!«
»Wie wäre es mit einer Prügelei zwischen deinem derzeitigen Bräutigam mit deinem früheren Verlobten? Ich kann mir das Getuschel vorstellen, und aus Getuschel entwickeln sich Skandale. Und das wirst du doch bestimmt nicht wollen. Nicht mit einem Haus voller Verwandter und Mr. Shaw, der im Begriff ist, dich zum Altar zu führen. Deine Tanten wären gedemütigt, und du wärst eine Witzfigur. Schon wieder. Denk darüber nach!«
Es war offensichtlich, dass sie das bereits getan hatte und zu dem von ihm erhofften Schluss gekommen war. Sie würde nichts verraten.
Dennoch deutete ihr wütender Gesichtsausdruck auf weitere Schläge in seine Richtung hin, und wenn er sich recht entsann, verhieß das Funkeln in ihren sonst so sanften braunen Augen gar nichts Gutes. »Na schön. Deine Identität ist bei mir sicher, Mr. Douglas, aber nur aus den Gründen, die du mir so klar verdeutlicht hast.« Ihre Stimme zitterte, ihre Hände ballten sich wieder zu Fäusten.
Vorsichtshalber trat er einen Schritt zurück, was jedoch unnötig war, da Elisabeth sich auf ein Sofa fallen ließ und sich geistesabwesend die Schläfe rieb. »Aber warum? Beantworte mir wenigstens diese eine Frage, Brendan! Wir alle hielten dich für tot. Tot und begraben. Was machst du also hier?«
Warum er damals fortgegangen war? Diese Frage konnte er ihr unmöglich beantworten, ohne sie zu Tode zu erschrecken. Und warum er zurückgekehrt war? Das war genauso schwierig zu erklären, ohne das ganze Ausmaß seiner vergangenen Schandtaten zu offenbaren. Aus irgendeinem Grund war es einfacher, von Elisabeth gehasst zu werden, weil sie ihn für einen Schuft hielt, der seine Braut sitzen gelassen hatte, als ihr die noch viel hässlichere Wahrheit zu erklären.
Sein Blick glitt zu dem Stein zwischen ihren Brüsten.
»Gefällt dir die Aussicht?«, fragte sie spitz.
Er schaute ihr wieder ins Gesicht, das jetzt einen resignierten Ausdruck trug, als wäre sie es gewöhnt, dass Männer ihre Brust anstarrten, wenn sie mit ihr sprachen. Irgendetwas tief in seinem Innersten verkrampfte sich bei dem Gedanken an andere Männer, die Elisabeth auf solch dreiste Weise anschauten.
»Vielleicht bin ich ja zurückgekommen wie der junge Lochinvar, als ich hörte, dass du einen anderen heiraten würdest.«
»Wenn das ein Scherz sein soll, wirst du dir etwas Besseres einfallen lassen müssen«, entgegnete sie leichthin. »Wie du vor all diesen Jahren, als du um meine Hand anhieltest, selbst gesagt hast, wäre unsere Ehe eine Vernunftehe gewesen, die auf Geheiß deiner Mutter geschlossen werden sollte.«
Waren das seine Worte gewesen? Verdammt unhöflich von ihm. Ein Wunder, dass Elisabeth seinen Antrag angenommen hatte, wenn er solch dummes Zeug dahergeredet hatte. Und ein noch größeres, dass sie ihm nicht etwas Schweres über den Kopf geschlagen hatte für eine derartige Frechheit.
Er unterdrückte das Schuldbewusstsein, das ihn für einen Moment beschlich, wandte seine Gedanken den Männern zu, die ihn jagten, und verhärtete sich gegen seine mangelnde Entschlossenheit. »Ich bin aus dem einfachen Grund hier, dass Dun Eyre der letzte Ort ist, an dem jemand nach mir suchen würde.«
Wieder schob sie ihr störrisches kleines Kinn vor und verengte fragend ihre Augen.
»Und deshalb wiederhole ich noch einmal, dass mein Name John Martin ist«, sagte er.
Sie verdrehte ihren Fächer, bis die Holzstäbchen noch mehr zersplitterten. »Du bist ein echter Mistkerl, Brendan Douglas.«
Er grinste über die vulgäre Sprache aus diesem hübschen Mund. Elisabeth war schon immer ein sehr widersprüchliches Geschöpf aus Weiblichkeit und Hitzigkeit gewesen. »Aber du liebst mich trotzdem.«
»Früher einmal vielleicht. Doch das hast du dir verscherzt.« Für einen Moment schloss sie die Augen, als versuchte sie, sich auf die neue Realität einzustellen, und als sie sie wieder öffnete, dämpfte Kapitulation die Hitze ihres Blicks. Was fast noch schlimmer war als ihre Wut. Darauf war er gefasst gewesen, aber das hier war etwas völlig anderes.
»Wie konntest du so einfach zurückkommen und von mir erwarten, so zu tun, als wäre nichts geschehen?«, fragte sie. »Du hast mich verlassen, Brendan. Ohne eine Nachricht oder Erklärung – obwohl Gott und Jedermann nur allzu bereit waren, mir eine zu liefern.«
Er drehte sich zum Kamin um und starrte ins Feuer, als könnte er Antworten in den Flammen finden.
»Das hat mich nicht so sehr gestört«, fuhr sie fort. »Ich meine, natürlich war es eine sehr unangenehme Situation – mit Tante Pheeney, die Sprichwörter hervorsprudelte wie ein Wasserspeier, und Tante Fitz, die im Haus herummarschierte und wüste Drohungen gegen dich ausstieß. Doch dann geschah der Mord an deinem Vater – und das war noch viel furchtbarer. Was hätte ich denn danach glauben sollen?«
Er fuhr herum und griff mit einer Hand nach dem Kaminsims, wobei er seine eigenen blutleeren Finger ansah, als gehörten sie jemand anderem. »Was alle anderen annahmen. Dass ich schuldig war.«
»Es gab auch einige, die sich weigerten, das zu glauben«, sagte sie leise. »Selbst damals waren sie von deiner Unschuld überzeugt.«
»Doch ihr habt sie sicher schnellstens aufgeklärt.« Dies war keine Unterhaltung, die er führen wollte. Hier zu sein war ein bisschen zu hart an der Schmerzgrenze. Er hatte nicht gedacht, dass es so sein würde, sondern angenommen, diese Geister wären schon lange ausgetrieben. Wie hatte er nur so dumm sein können. Die Zeit hatte nicht viel dazu beigetragen, diese Wunde zu heilen. »Keine Bange«, blaffte er. »Ich werde dich nicht lange belästigen, und du und dein Mr. Shaw könnt mit meinem Segen zum Altar spazieren.«
Auch Elisabeth schien ihre vorübergehende Verwirrung abgeschüttelt zu haben. Sie erhob sich und strich betont gleichgültig ihre Röcke glatt. »Dann bin ich ja erleichtert. Es hätte mir das Herz gebrochen, wenn der Schuft, der mich sitzen ließ, etwas gegen den Mann hätte, der ehrenhaft genug ist, zu seinem eigenen Hochzeitsfrühstück zu bleiben.«
»Da wir gerade von ihm sprechen – wo hast du ihn eigentlich kennengelernt? Das Letzte, was ich hörte, war, dass du in London warst.«
»Ach? Behältst du mich im Auge?«
»Ich weiß es aus einer ein Jahre alten London Times. Aus was für Verhältnissen kommt er?«
»Bist du jetzt mein Vormund?«
»Nur jemand, den dein Wohlergehen interessiert. Ich mag dich zwar nicht geheiratet haben, aber das bedeutet nicht, dass ich dich nicht glücklich sehen will.«
Elisabeth verschränkte die Arme vor der Brust und sagte spitz: »Na schön. Nicht, dass es dich etwas angeht, doch Gordon hat ein sehr anständiges eigenes Vermögen und eine solide Stellung in der derzeitigen Regierung. Und er ist nicht du. Alles sehr positive Eigenschaften bei einem zukünftigen Ehemann.«
»Autsch. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass es dir leidtut, mich zu sehen!«
»Himmelherrgott, Mann!«, rief sie und griff sich an den Kopf. »Du bist einfach unverbesserlich. Hau ab, Brendan! Kriech in das Loch zurück, in dem du dich bis jetzt verkrochen hattest, und bleib diesmal darin! Du hast schon meine letzte Hochzeit ruiniert. Diese wirst du mir nicht verderben, verstanden?«
»Wenn du nicht aufpasst, wird dich das ganze Haus hören.«
Ihre dunklen Augen funkelten ihn böse an.
»Keine Bange, Lissa. Ich werde schon nicht die Pferde scheu machen. Du und der ehrbare Mr. Shaw werdet heiraten und ehrbare Kinder haben und ein ehrbares Leben führen.«
Statt seine Bemerkung mit einer ähnlich scharfen Antwort zu quittieren, hob Elisabeth das Kinn, straffte die Schultern und rauschte an ihm vorbei zur Tür. Ohne einen Blick zurück riss sie sie auf und mischte sich hocherhobenen Hauptes wieder unter die Gäste.
Brendan ließ mit einem hörbaren Seufzer den angehaltenen Atem entweichen. Die erste Hürde hatte er genommen. Er war im Haus.
Brendan Douglas spazierte durch die Gärten von Dun Eyre und machte sich wieder mit den ausgedehnten Ländereien vertraut, schaute sich das Terrain an und begutachtete die Landschaft. Er sah die Parklandschaft jedoch nicht als das Meisterwerk von gepflegten Parterreanlagen und künstlicher Wildnis, das sie war, sondern als ein Mittel, um sich, je nachdem, wie die Umstände es verlangten, zu verbergen, zu entkommen oder zu kämpfen. Diese Fertigkeiten waren die ersten, die er im Exil gelernt hatte, und sie hatten ihm im Lauf der Jahre mehr als einmal den Hals gerettet. Inzwischen waren sie ihm zur zweiten Natur geworden.
Es hätte eigentlich einfach sein müssen. Da er in der Nähe aufgewachsen war, hatte er unzählige Stunden damit verbracht, auf diesem Gelände herumzustreifen, und kannte Dun Eyre wie seinen eigenen Handrücken. Als er jedoch zu einer hohen Hecke kam, die dort eigentlich nichts zu suchen hatte, musste er zugeben, dass schließlich auch sein Handrücken nicht mehr derselbe war, seit er im letzten November unter einem Stiefelabsatz zerquetscht worden war.
Brendan krümmte die Finger zu einer schmerzenden Faust. Das Knirschen schlecht verheilter Knochen war ein Andenken an jene gefährlichen Zeiten, in denen es so ausgesehen hatte, als hätten seine Verbrechen ihn schließlich doch noch eingeholt.
Damals waren die Götter ihm gut gesonnen gewesen, aber ob er noch einmal so viel Glück haben würde, musste sich erst noch zeigen.
In der Hoffnung, die Dornenhecke umgehen zu können und sich dem Haus von Westen her zu nähern, trat er den Rückweg an. Die Kälte drang durch seinen Rock, und die Knochen in seiner Hand pochten. Auf ein solches Wetter konnte er verzichten. Er hatte den kalten, feuchten Frühling Irlands schon zu lange nicht mehr erlebt und war heute mehr an Sonne, strahlend blauen Himmel und trockenen Wüstenwind gewöhnt.
Je länger er in der Nähe Belfoyles und des Hauses blieb, in dem er seine Kindheit verbracht hatte, desto mehr Erinnerungen tauchten auf wie wieder ausgegrabene Leichen. Jeder vertraute Orientierungspunkt und jedes wohlbekannte Gesicht brachten jene furchtbaren letzten Tage in lebhaften Albträumen zurück. Vaters vorwurfsvoller Blick, der ihn mit Scham und Schuldgefühlen erfüllte. Vaters Tod, der sich in seiner ganzen blutigen Gewaltsamkeit immer wieder vor ihm abspielte, bis es selbst im wachen Zustand kein Entkommen mehr vor diesen Bildern gab.
War Vater schnell und schmerzlos gestorben, oder hatten die Amhas-draoi mit blutigem Gemetzel Vergeltung geübt? Hatte Vater am Ende gewusst, dass Brendan ihn verraten hatte, oder war er in den Tod gegangen, ohne etwas von der Illoyalität seines geliebten Sohnes zu ahnen?
Brendan blinzelte und zwang sich, in die Gegenwart zurückzukehren. Er konnte seine Sorgen für den Rest seines armseligen Lebens in Alkohol ertränken, wenn er wollte. Doch jetzt musste er ruhig und zuversichtlich sein und sich auf seine Ziele konzentrieren.
Wie den Sh’vad Tual zurückzuholen, um ihn zur sicheren Aufbewahrung zu Scathach zu bringen.
Wo er um Gnade winseln würde wie noch nie zuvor, um seine elende Existenz zu retten.
So einfach war das.
In etwas gebückter Haltung gegen die Kälte hielt er den Blick auf den Weg vor sich gerichtet und lauschte angestrengt auf jedes Anzeichen für andere Spaziergänger. In den tiefen Schatten fern des Hauses hatte er den fith-fath abgelegt. Er war völlig aus der Übung, und die Konzentration, die es erforderte, den Tarnungszauber aufrechtzuerhalten, ließ ihm wenig Energie für alles andere. Es war besser, seine magischen Kräfte sparsam zu verwenden.
Die Hecke machte einen Bogen, und der Pfad endete an ein paar flachen Steinstufen. Darunter erstreckte sich das Haus mit seinen verschiedenen Flügeln, die von dem viereckigen zentralen Bau ausgingen. Der Ball war beendet, und Gäste brachen in einer langen Reihe von Kutschen auf oder zogen sich für die Nacht in ihre Zimmer zurück. Einige wenige Lichter glimmten hinter Fenstern, aber das Lichtermeer aus Kerzen und Fackeln, das die Eingänge erhellt hatte, war gelöscht worden, und tiefe Dunkelheit senkte sich nun über das Haus.
Brendan zählte die Fenster im zweiten Stock. Das siebte von rechts gehörte zu Elisabeths Schlafzimmer, in dem hinter den geschlossenen Vorhängen noch Licht zu sehen war. Wahrscheinlich entkleidete sie sich gerade, löste langsam die Strumpfbänder und rollte die Strümpfe an ihren langen Beinen herab, befreite ihre üppigen Rundungen von Korsett und Unterröcken und schlüpfte in das dünne Musselinnachthemd, das sie zum Schlafen trug. Dann würde sie die Nadeln entfernen, die ihre aufgesteckten Locken zusammenhielten, und die bezaubernde Fülle dunkelroten Haares würde wie Seide über ihren Rücken bis zu ihren Hüften fallen. Und zuletzt würde sie ihre schlanken Arme zu ihrem Nacken erheben, die Halskette öffnen, die in der Mulde zwischen ihren wundervollen Brüsten lag, und sie in ihr Kästchen zurücklegen.
Ein ironisches Lachen entrang sich Brendan. Gott, er musste es ja wirklich nötig haben, um von Elisabeth zu fantasieren! Sie hatte ihm nahegestanden wie eine Schwester. Eine kleine Schwester. Sie amüsierte ihn, war klug, lustig, wagemutig und ritt ein Pferd, als wäre sie schon im Sattel geboren worden. Aber Stoff für Fantasien war sie nie gewesen. Und jetzt auf einmal doch? Wenn sein verändertes Aussehen sie erstaunt hatte, war er über das ihre mindestens genauso überrascht gewesen.
Er hatte Elisabeth als ein wenig mollig in Erinnerung, mit einem Gesicht voller Sommersprossen, einer Fülle wild zerzauster, dunkelroter Locken und einem lausbubenhaften Glanz in den großen braunen Augen. Aber heute hatte statt des Mädchens aus seinen Erinnerungen eine sinnliche, verführerische Frau vor ihm gestanden, mit einem Körper, der Brendans Blut in Wallung brachte. Sie zu sehen hatte ihn schwindlig und unbesonnen gemacht von Gedanken, die er niemals haben sollte, und Ideen, die er keine Gestalt annehmen lassen dürfte.
Er hätte Jack begleiten sollen in ihrer letzten Nacht in Ennis. Dieser Filou von einem Cousin verstand es mit seltenem Talent, stets die richtige Frau zu finden, um jegliches Bedürfnis zu befriedigen. Brendan bewegte sich unbehaglich und erstickte seine lüsternen Fantasien mit weitaus unerfreulicheren Gedanken – wie an die furchtbaren Konsequenzen, falls es Máelodor gelingen sollte, den Sh’vad Tual in seinen Besitz zu bringen.
An den dann zu erwartenden Krieg zwischen der Magierrasse der Anderen und ihren nicht magisch begabten Duinedon-Nachbarn und die Katastrophe, die es für beide Seiten wäre, wenn es so weit kommen sollte.
»… ein königliches Lösegeld … was hat sie an …«
»… spielt keine Rolle, Marcus … hör auf …«
Männerstimmen erhoben sich vom Fuß der Treppe.
Brendan erstarrte und hielt den Atem an. Da er jedoch keine Schritte auf den Stufen hörte, mussten sie sich in eine der zahlreichen, mit Bänken versehenen Nischen zurückgezogen haben.
Brendan wandte nicht gleich den fith-fath-Zauber an, um sich zu tarnen, sondern verschmolz nur tiefer mit den Schatten, bis nichts mehr die Männer darauf aufmerksam machen konnte, dass sie Gesellschaft hatten.
»Ich werde noch wahnsinnig vor Langeweile, Gordon. Was zum Teufel tun die Leute hier, um sich zu amüsieren?«
»Es ist nicht London, das ist schon richtig, aber es hat auch seinen eigenen schlichten Charme. Ich bin sogar ganz froh, dem Londoner Getümmel zu entkommen.«
Gordon Shaw und sein Halbbruder Marcus. Brendans Knie versteiften sich, seine Schultern schmerzten schon vor Anspannung, doch er wagte nicht, sich zu bewegen.
»Abgesehen von dem ländlichen Charme kannst du mir nicht ernsthaft einreden, es gefiele dir, in diesem Provinznest Däumchen zu drehen, während die Londoner Saison in vollem Gange ist. Und was sagt Lord Prosefoot zu deiner Abwesenheit während der Sitzung?«
»Er war sehr verständnisvoll. Und es ist ja auch nicht so, als hätte ich mir keine Arbeit mitgebracht. Ich habe sogar schon einiges erledigt. Also reg dich nicht auf! Noch eine Woche, und wir sind auf dem Dampfer nach Holyhead und werden gegen Ende des Monats in London sein.«
Ein theatralisches Stöhnen war zu hören. »Ich glaube nicht, dass ich es überlebe, eine weitere Woche an diese provinzielle Vorstellung von Unterhaltung gebunden zu sein. Ich habe es dir nicht erzählt, aber gestern beim Dinner wurde ich von Miss Fitzgeralds Cousine, Mrs. Tolliver aus Bedfordshire, erwischt. Ich musste mir endlose Vorträge anhören über die Familienbeziehungen zwischen den Shaws und den Tollivers, die angeblich bis zur Zeit der Eroberung zurückgehen. Auch brüderliche Verpflichtungen haben Grenzen.«
»Ja, aber bei demselben Dinner hatte ich ein Gespräch mit Elisabeths Vormund, Lord Taverner, der mir anbot, mit Stuart in Frankreich über einen Botschafterposten für mich zu sprechen. Wer weiß, wie viel weiter ich von dort aus noch gelangen kann! Ich wusste, dass die Verbindung mit den Fitzgerald meine Zukunft sichern würde«, verkündete Shaw stolz.
»Ich bin mir nicht sicher, was du aufregender findest – die Ehefrau oder die politischen Beziehungen.«
»Weißt du was? Ich auch nicht.«
Zynisches Gelächter folgte.
Die arme Lissa! Sie hatte wirklich großes Pech mit der Auswahl ihrer Ehemänner.
Elisabeth bürstete ihr Haar noch lange, nachdem auch das letzte Knötchen rigoros entfernt worden war. Gewöhnlich beruhigten sie die gleichmäßigen Bürstenstriche, aber heute Abend waren ihre unruhigen Gedanken stärker als jeder Versuch, sich zu entspannen. Warum war Brendan von den Toten zurückgekehrt? Vor wem verbarg er sich? Steckte er in Schwierigkeiten? Und warum kümmerte sie das überhaupt?
Als sie die Bürste auf die Frisierkommode zurücklegte, bemerkte sie stirnrunzelnd das leichte Zittern ihrer Finger und das Kribbeln in ihrem Magen. Ach was, sagte sie sich. Das war nur das Lampenfieber vor der Hochzeit. Aufregung. Nervosität. Ein bisschen Furcht. Alles ganz normal und gar nicht anders zu erwarten.
Ihre Nervosität hatte nichts zu tun mit der Rückkehr eines Mannes, den sie für tot und begraben gehalten hatte.
Aber sie hätte es besser wissen müssen. Brendan war viel zu clever, um unbetrauert in einem Armengrab zu enden.
Ihre Furcht war in keinster Weise mit dem überraschenden Erscheinen eines Mannes verbunden, von dem das Gerücht ging, er habe seinen Vater verraten und seinen Tod zu verantworten.
Sie hatte diese Geschichten nie geglaubt. Brendan mochte vieles sein, aber gewiss kein Mörder.
Und ihre Aufregung war ganz entschieden kein Wiederaufflammen kindlicher Verliebtheit.
Sie liebte Gordon, und er liebte sie. Auf eine reife, erwachsene, respektable Art und Weise.
Unwillkürlich hob sie die Hand und befingerte den Stein zwischen ihren Brüsten, der kühl und dunkel auf ihrer Haut lag. Brendan liebte niemand anderen als sich selbst. Das war schon immer so gewesen und würde sich auch niemals ändern.
Als sie dann jedoch zwischen die Laken schlüpfte und die Kerze ausblies, blieb sein Geschenk an ihrem Hals und sein Gesicht in ihrem Gedächtnis eingeprägt.
Sie wusste nicht, wen sie im Moment mehr hasste. Brendan, weil er gekommen war, oder sich selbst, weil sie deshalb so aufgeregt war.
Elisabeths Ankleidezimmertür öffnete sich an lautlosen Angeln. Dicke Teppiche erstickten jeden seiner Schritte. Dem Himmel sei Dank für die Annehmlichkeiten des Reichtums! Sie machten das Einbrechen sehr viel leichter.
Ihre Schlafzimmertür war geschlossen, was ihm die Möglichkeit gab, einen Kerzenstummel anzuzünden. Er setzte sich an die zierliche Rosenholz-Frisierkommode, auf dem sich praktischerweise ihr Schmuckkästchen befand. Als er den Inhalt durchstöberte, fand er ein herzförmiges Medaillon mit Miniaturen ihrer Eltern, ein kleines Bernsteinkreuz, zwei prachtvolle Perlenketten, eine Rauchquarzkette und ein auffallendes Kollier mit Saphiren im Wert eines Lösegeldes für einen Radscha. Natürlich fand er auch Ohrringe und Armbänder, goldene und silberne Kämme, Ringe und Broschen.
Aber keinen Anhänger.
Durchwühlte Schubladen förderten Kosmetiktiegel und Lotionen zutage, Parfumfläschchen und Päckchen mit Haarnadeln und -bändern, Handschuhe, Schnürsenkel und einen zerbrochenen Stickrahmen.
Doch keinen Anhänger.
Verärgert stieß er einen Seufzer aus. Wo zum Teufel hatte sie ihn hingelegt?
Er begann noch einmal von vorn und suchte dieses Mal noch gründlicher. Griff in jeder Schublade in die hintersten Ecken und zog Stück für Stück aus ihrem Schmuckkasten, um es dann, wie er hoffte, an den richtigen Platz zurückzulegen.
Das Ankleidezimmer enthielt tausend Ecken, in denen eine Frau eine Halskette verstecken konnte. Schränke, Tische, Sekretär – er suchte jedes Möbelstück sehr gründlich ab. Er schob sogar eine Hand unter die Sesselkissen und klopfte die Kacheln am Kamin ab, um nach einem geheimen Fach zu suchen.
Außer zwei angekauten Bleistiftstummeln, vier Knöpfen, einer zerknüllten Wäscheliste und einer Handvoll Haarnadeln fand er jedoch auch in den Ecken nichts.
Ein gedämpftes Geräusch aus dem Schlafzimmer ließ ihn innehalten. Nachdem er schnell die Kerze ausgeblasen hatte, erstarrte er förmlich, hielt den Atem an – und räumte das Feld.
Vorläufig.
Kapitel Drei
Der Büfetttisch ächzte buchstäblich unter den Platten mit Eiern, Würstchen, dicken Scheiben Schinken, kalter Zunge und Körben mit Brötchen und Toast. Tee und Kaffee standen in silbernen Kannen auf einer Anrichte, zusammen mit dem Zucker und der Sahne. Brendan zählte die Personen am Tisch. Fünf andere Gäste saßen noch beim Frühstück. Er hätte früher herunterkommen sollen, als die meisten noch benommen vom Wein des gestrigen Abends gewesen waren.
An einem Ende des Tisches saß Miss Sara Fitzgerald; sie hatte die Nase in der heutigen Tageszeitung vergraben. Ihr gegenüber schielte Mrs. Pheeney mit aufrichtiger Sehnsucht und leidgeprüften Seufzern nach den Würstchen. Zwischen ihnen thronte Elisabeths Großtante Charity, eine Frau, der Brendan vor langer Zeit einmal begegnet war, und zwar nicht gerade unter den günstigsten Bedingungen. Wenn er sich recht entsann, hatte er einen Frosch in der Hand gehalten, und sie hatte losgekreischt wie eine Irre.
Am anderen Ende des Tisches waren Shaws und Elisabeths Stühle in scheinbar gutem Einvernehmen dicht zusammengerückt worden. Brendans Lippen verzogen sich zu einer angewiderten Grimasse, die er jedoch schnell in ein Lächeln verwandelte, als Elisabeth ihn sah. Sie war allerdings keine gute Schauspielerin, und ihr Gesicht wurde feuerrot, während ihre Finger ihr Buttermesser umklammerten, als würde sie ihn am liebsten damit erstechen.
Und dort war der Stein, verhöhnte ihn aus den Falten der Spitzenmantille, die um ihre Schultern lag. Brendan beherrschte den Impuls, das Zimmer zu durchqueren, ihr die Kette mit dem Stein vom Hals zu reißen und loszurennen, als wäre der Teufel hinter ihm her. Leider würde er jedoch keine zwanzig Schritte weit kommen, bevor ihn jemand schnappte. Höchstwahrscheinlich Shaw, der zudem auch noch die Kraft besaß, ihn in zwei Stücke zu zerreißen.
»John, wie nett von dir, uns zu dieser frühen Stunde …« Elisabeth sah sich betont nach der Uhr auf dem Kaminsims um, die halb elf anzeigte. »Du meine Güte, es ist ja nicht mal Mittag, Mr. Martin!«, spöttelte sie.
Brendan zog seine Taschenuhr heraus und klappte sie auf, um die Zeit mit der auf der Kaminuhr zu vergleichen. »Sie stimmen bis auf die Minute überein«, sagte er, steckte die Uhr lächelnd wieder ein und nickte Miss Sara Fitzgerald zu, die ihn vom anderen Ende des Tisches nachdenklich betrachtete.
»Ich fürchte, alle anderen kamen und gingen schon vor einer Ewigkeit.« Elisabeth strahlte von einem Ohr zum anderen, was jedoch mehr bemüht heiter als wirklich fröhlich wirkte.
»Gut. Ich hasse es, nicht in Ruhe meinen Tee trinken zu können.« Brendan ging zum Büfett und füllte sich einen Teller, bevor er sich auf einem Platz ihnen gegenüber niederließ, nach einer sauberen Tasse und Untertasse griff und Elisabeth bat, ihm das Salz zu reichen. »Einfach fabelhaft, die Eier. Aber eure Köchin hatte ja schon immer ein Händchen dafür. Erinnerst du dich, als ich um 1803 herum hier bei euch zu Besuch war? Da waren sie perfekt pochiert. Bessere hatte ich noch nie gegessen.«
Shaw betrachtete ihn neugierig. »Ich glaube nicht, dass ich schon das Vergnügen hatte, Mr. …«
»Martin«, antwortete Brendan mit vollem Mund. »John Martin. Ein Cousin zweiten Grades. Oder dritten Grades? Oft kann ich das nicht auseinanderhalten. Es gibt mehr von uns als Flöhe auf einem Hund. Ist es nicht so, Lissa?«
Shaw antwortete mit einem friedfertigen Nicken, während Elisabeths aufgesetztes Lächeln ein wenig ins Schwanken kam.
»Ein Vögelchen verriet mir, dass Sie bald nach London umziehen werden. Vorsicht, Mr. Shaw! Elisabeth könnte Sie in den Bankrott treiben, wenn sie auf die Modeschöpfer und Modistinnen der Großstadt losgelassen wird.«
»Also, das ist doch …!«, schnaubte sie empört.
»Ich glaube, um Ausgaben brauchen wir uns nicht allzu sehr zu sorgen«, erwiderte Shaw.
Brendan spießte ein Würstchen auf. »Nein, wie dumm von mir! Elisabeth schwimmt ja auch in Geld, nicht wahr?«
Shaw antwortete mit einem jovialen Lachen, als hätte Brendan einen großartigen Witz gemacht.
»Nach London, Gordon?«
Shaws Blick glitt zu Elisabeth. »In der Wildnis Irlands werde ich beruflich ja wohl kaum vorankommen, oder?«
»Wahrscheinlich nicht. Ich …«
»London ist ein anderer Ort für eine verheiratete Frau als für ein junges Mädchen, das erst in die Gesellschaft eingeführt wird. Es gibt viel mehr zu tun und zu sehen, als du dir vorstellen kannst.« Gordon begann, sich für das Thema zu erwärmen, und erhob die Stimme. »Die Einladungen. Feste, Dinner, Bälle. Englands Oberschicht wird danach schreien, das neueste Juwel in ihrer Krone kennenzulernen.«