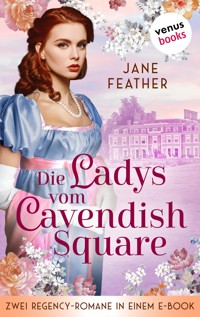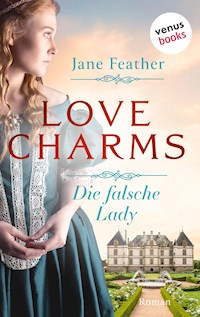
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: venusbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Love Charms
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Im Bann der Gefühle: Der historische Liebesroman »Love Charms – Die falsche Lady« von Jane Feather jetzt als eBook bei venusbooks. England im 16. Jahrhundert. Ihr ganzes Leben lang hat sich die junge Miranda als Schaustellerin in den Straßen Londons durchschlagen müssen. Umso überraschter ist, sie als sie eines Tages von dem eleganten Earl von Harcourt angesprochen wird – denn dieser macht ihr ein unglaubliches Angebot: Da sie der französischen Adeligen Maude zum Verwechseln ähnlich sieht, soll sie deren Rolle übernehmen und jenen Mann heiraten, dessen Aufmerksamkeiten Maude zuwider sind – niemand anderen als den König von Frankreich! Eine Lady über Nacht? Es scheint beinahe unmöglich, doch schon bald mausert sich Miranda zur schönsten Blume am Hofe. Ihrer Hochzeit scheint nichts mehr im Wege zu stehen – wäre da nicht der attraktive Earl von Harcourt, der Mirandas Herz höher schlagen lässt … »Köstlich! Sprudelnd vor überraschenden Ideen und voll packender Leidenschaft – einfach wundervoll zu lesen.« Publishers Weekly Jetzt als eBook kaufen und genießen: Erleben Sie große Gefühle und verführerische Intrigen in »Love Charms – Die falsche Lady« von Jane Feather, Buch 3 der »Love Charms«-Trilogie, deren Einzelbände unabhängig voneinander gelesen werden können. Lesen ist sexy: venusbooks – der erotische eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 716
Ähnliche
Über dieses Buch:
England im 16. Jahrhundert. Ihr ganzes Leben lang hat sich die junge Miranda als Schaustellerin in den Straßen Londons durchschlagen müssen. Umso überraschter ist, sie als sie eines Tages von dem eleganten Earl von Harcourt angesprochen wird – denn dieser macht ihr ein unglaubliches Angebot: Da sie der französischen Adeligen Maude zum Verwechseln ähnlich sieht, soll sie deren Rolle übernehmen und jenen Mann heiraten, dessen Aufmerksamkeiten Maude zuwider sind – niemand anderen als den König von Frankreich! Eine Lady über Nacht? Es scheint beinahe unmöglich, doch schon bald mausert sich Miranda zur schönsten Blume am Hofe. Ihrer Hochzeit scheint nichts mehr im Wege zu stehen – wäre da nicht der attraktive Earl von Harcourt, der Mirandas Herz höher schlagen lässt …
Über die Autorin:
Jane Feather ist in Kairo geboren, wuchs in Südengland auf und lebt derzeit mit ihrer Familie in Washington D.C. Sie studierte angewandte Sozialkunde und war als Psychologin tätig, bevor sie ihrer Leidenschaft für Bücher nachgab und zu schreiben begann. Ihre Bestseller verkaufen sich weltweit in Millionenhöhe.
Bei venusbooks erscheinen als weitere Bände der Reihe »Love Charms«:
»Die gestohlene Braut – Band 1«
»Die geliebte Feindin – Band 2«
In der Reihe »Regency Nobles« erschienen:
»Das Geheimnis des Earls – Band 1«
»Das Begehren des Lords – Band 2«
»Der Kuss des Lords – Band 3«
In der Reihe »Die Ladys vom Cavendish Square« erschienen:
»Das Verlangen des Viscounts – Band 1«
»Die Leidenschaft des Prinzen – Band 2«
»Das Begehren des Spions – Band 3«
Die Reihe »Regency Angels« umfasst die Bücher:
»Die unwiderstehliche Spionin – Band 1«
»Die verführerische Diebin – Band 2«
»Die verlockende Betrügerin – Band 3«
***
eBook-Neuausgabe Mai 2022
Ein eBook des venusbooks Verlags. venusbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, München.
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1998 unter dem Originaltitel »The Emerald Swan« bei Bantam Books, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1999 unter dem Titel »Smaragdfeuer« bei Goldmann, München
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1998 by Jane Feather
Published by Arrangement with Shelagh Jane Feather
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1999 by
Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2022 venusbooks Verlag. venusbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, München.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ah)
ISBN 978-3-96898-161-1
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des venusbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieses eBook gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Love Charms 3« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
Besuchen Sie uns im Internet:
www.venusbooks.de
www.facebook.com/venusbooks
www.instagram.com/venusbooks
Jane Feather
Love Charms – Die falsche Lady
Roman
Aus dem Amerikanischen von Elke Bartels
venusbooks
Prolog
Paris, 24. August 1572
Die Alarmglocke läutete um Mitternacht. Die Straßen, bis dahin noch still und leer, füllten sich jetzt mit Männern, die weiße Kreuze auf den Hüten trugen. Sie versammelten sich zuerst in aller Stille, als wären sie für einen Moment von ehrfürchtiger Scheu vor dem Unternehmen erfüllt, das sie aus ihren Häusern trieb, bewaffnet mit Hakenbüchsen, Schwertern und Messern.
Die Männer formierten sich zu einem Zug und bewegten sich durch die engen Gassen und kopfsteingepflasterten Straßen, die die grimmige, düstere Zitadelle des Louvre umgaben. Eine Woche zuvor war die Zitadelle noch strahlend hell erleuchtet gewesen, und aus den schmalen, vergitterten Fenstern schallte Musik, während sich in den Straßen der Stadt Massen betrunkener Feiernder gedrängt hatten, um die Vermählung der Schwester des französischen Königs Charles, Marguerite, mit dem Hugenottenkönig Henri de Navarre zu feiern. Eine Vermählung, die dem Zweck dienen sollte, die katholischen und protestantischen Parteien in Frankreich zu vereinen.
Aber in dieser Bartholomäusnacht diente die Eheschließung lediglich als Köder, um die Hugenotten in die Enge zu treiben und abzuschlachten, die zu Tausenden in Paris eingetroffen waren, um ihren jungen König zu unterstützen.
Während die Alarmglocke weiter läutete, marschierten Scharen von Männern die Straßen entlang und klopften an alle Türen, die das weiße Kreuz trugen. Die Hausbewohner schlüpften hinaus, um sich ihnen anzuschließen, und die riesige Armee von Attentätern wuchs stetig – eine gewaltige Woge, die von Minute zu Minute anschwoll und sich unaufhaltsam auf die Villen und Amtssitze der protestantischen Führer zuwälzte.
Die ersten Schüsse, das erste Auflodern grellroter Flammen, die ersten wilden, langgezogenen Schreie waren das Startsignal für das Massaker. Der Pöbel entwickelte plötzlich so viele Köpfe wie eine Hydra, als die Massen durch die Straßen stürmten, die Türen jener Häuser einschlugen, die nicht mit dem weißen Kreuz gekennzeichnet waren, und die Bewohner aus Fenstern und von Balkonen schleuderten, um von der entfesselten Menschenmenge unten auf der Straße und in den Höfen in Stücke zerrissen zu werden.
Die Luft war von dem übelkeiterregenden Gestank nach Blut und Schießpulver erfüllt; der Nachthimmel war von einem roten, gespenstisch anmutenden Leuchten erhellt, erzeugt durch die hoch auflodernden Flammen brennender Häuser und den grellen, zuckenden Lichtschein unzähliger Pechfackeln, als sich die Menschenmassen einen Weg durch die schmalen Straßen bahnten. Das triumphierende Geheul einer Horde, die Jagd auf eine halbnackte, blutende Flüchtende machte, glich den alptraumhaften schrillen Schreien blutrünstiger Höllengeister.
Zitternd und völlig außer Atem blieb die junge Frau an der Ecke einer übelriechenden Gasse stehen, die vom Fluß heraufführte. Ihr Herz klopfte so schnell, daß jeder keuchende Atemzug eine Qual war. Ihre bloßen Füße bluteten aus zahlreichen Schnittwunden von ihrer Flucht über die schartigen, spitzen Steine am Kai, und ihr dünner Umhang klebte an ihrem Rücken, naß vor Schweiß. Ihr Haar hing zerzaust und schlaff um ihr bleiches, von Todesangst gezeichnetes Gesicht, und sie hielt ihre beiden Babys an sich gedrückt, eines in jedem Arm, die kleinen Gesichter an ihrer Schulter vergraben, um ihr Wimmern zu dämpfen.
Verzweifelt blickte sie die Gasse entlang und sah die ersten flackernden Fackeln ihrer Verfolger. Die Stimmen des Pöbels erhoben sich zu einem durchdringenden Kreischen des Jubels, als die Männer und Frauen auf den Fluß zustürmten. Mit einem gequälten Aufschluchzen setzte sich die junge Frau wieder in Bewegung, rannte gehetzt am Fluß entlang, während sie ihre Babys an sich preßte, die mit jedem Schritt schwerer zu werden schienen.
Sie konnte die Schritte der Verfolger hinter sich hören, ein donnerndes Stampfen gestiefelter Füße, das von Sekunde zu Sekunde näher kam. Jeder Atemzug verursachte ihr Qualen, und langsam und unausweichlich breitete sich ein Gefühl der Resignation und der Hoffnungslosigkeit in ihr aus und verdrängte ihre panische Angst. Es gab einfach kein Entrinnen. Sie konnte nicht noch schneller laufen, noch nicht einmal ihren Babys zuliebe. Und die Menschenmenge hinter ihr wuchs unaufhaltsam, verstärkt durch andere, die sich der Hetzjagd um des reinen Vergnügens willen anschlossen.
Mit einem letzten verzweifelten Aufschluchzen drehte sich die junge Frau um und stellte sich ihren Verfolgern, während sie ihre Babys noch immer fest an ihre Brust gedrückt hielt. Eines der beiden kleinen Mädchen zappelte und versuchte, den Kopf zu heben. Das andere war still und ruhig wie immer. Selbst im Alter von zehn Monaten waren sie schon so verschieden, diese beiden Zwillingstöchter.
Sie stand keuchend und zitternd da, wie ein von Jägern in die Enge getriebenes Reh, als die aufgebrachte Menschenmenge mit ihren fanatisch glitzernden Augen sie von allen Seiten umzingelte. Jedes einzelne Gesicht schien von Haß erfüllt zu sein, die Zähne zu einem bösartigen Grinsen gefletscht, die Augen blutunterlaufen vor Mordlust. Ihre Schwerter und Messer trieften vor Blut, ihre Kleider waren damit besudelt. Und sie rückten ihr so nahe, daß sie ihren Schweiß und ihren weinsauren Atem und ihren erbarmungslosen Haß riechen konnte.
»Schwöre ab ... schwöre ab ...« Laute, haßerfüllte Stimmen erhoben sich zu einem Sprechchor, und die Worte prasselten auf sie herab, schlugen wie lebendige Wesen auf sie ein. Der Mob drängte sich immer enger um sie, schwitzende Menschenleiber kesselten sie ein, die Gesichter dicht vor das ihre geschoben, als sie sie mit dem Versprechen einer Rettung verhöhnten, von der sie tief in ihrem Inneren wußte, daß sie sie ihr verweigern würden. Sie hatten kein Interesse an einer Bekehrten, sie wollten nur ihr Blut.
»Schwöre ab ... schwöre ab ...«
»Ja, ja, das werde ich tun«, keuchte sie und ließ sich auf die Knie fallen. »Aber ich flehe euch an, tut meinen Babys nichts ... bitte, ich werde für meine Babys abschwören. Ich werde das Kredo sagen.« Hastig begann sie, die lateinischen Worte des katholischen Glaubensbekenntnisses zu murmeln, und hob dabei den Blick zum Himmel, um nicht die haßerfüllten Gesichter der Menschen sehen zu müssen, die sie ermorden würden.
Die Messerklinge, bereits mit Hugenottenblut befleckt, fuhr blitzschnell über ihre Kehle, noch während sie stammelnd zum Ende des Bekenntnisses kam. Ihre letzten Worte gingen in einem Gurgeln unter, als eine dünne Linie von Blut den Weg des Messers kennzeichnete. Die Linie verbreiterte sich in Sekundenschnelle zu einem klaffenden Spalt. Die junge Frau fiel mit dem Gesicht voran auf das Kopfsteinpflaster. Das jämmerliche Geschrei eines Babys erfüllte die plötzliche Stille.
»Zum Louvre ... zum Louvre!« Ein lauter Schlachtruf erhob sich über den Dächern der Stadt, und der Pöbel machte wie ein Mann kehrt und stürmte davon, um wie eine Herde blökender, aufgescheuchter Schafe in den ohrenbetäubenden Ruf »Zum Louvre ... zum Louvre!« einzustimmen.
Der schwarze Fluß floß so träge dahin wie das langsam gerinnende Blut der Frau. Etwas bewegte sich unter ihr. Eines der Babys zappelte und wand sich und wimmerte kläglich, als es sich von der Last des Körpers seiner toten Mutter befreite und aus der erstickenden Wärme kroch. Mit einer seltsamen Zielstrebigkeit krabbelte das kleine Geschöpf wie eine Spinne auf Händen und Zehenspitzen davon, fort von dem schrecklichen Geruch nach Blut.
Es dauerte noch etwa zehn Minuten, bis Francis seine Ehefrau fand. Er stürzte aus der Gasse heraus, sein Gesicht weiß im Licht des aufgehenden Mondes. »Elena!« flüsterte er entsetzt, als er sich neben der Toten auf die Knie fallen ließ. Er riß seine Frau in seine Arme und stieß dann einen gellenden Schrei der Qual aus, der die Stille erzittern ließ, als er das Baby auf dem Boden entdeckte, das mit beinahe leeren Augen zu ihm aufblickte, das winzige Rosenknospenmündchen zu einem kläglichen Jammern verzogen, das kleine Gesicht von dem Blut seiner Mutter verschmiert.
»Großer Gott, hab Erbarmen«, murmelte er erschüttert und hob das Kind mit einem Arm vom Boden auf, um es in seiner Armbeuge zu halten, während er fortfuhr, die tote Mutter der Kleinen an seine Brust zu drücken. Er sah sich um, sein Blick war fast irre vor Schmerz und Kummer. Wo war seine andere Tochter? Um Gottes willen, wo war sie? Hatte der blutrünstige, mörderische Pöbel sie auf seine Messer aufgespießt, wie sie es in dieser Nacht überall in der Stadt mit hilflosen kleinen Kindern getan hatten? Aber wenn ja, wo war ihr Leichnam? Hatten sie sie mitgenommen?
Plötzlich ertönten Schritte hinter ihm, und er drehte mit einem heftigen Ruck den Kopf, während er sich noch immer an das Kind und seine tote Ehefrau klammerte. Seine eigenen Leute rannten aus der Gasse auf ihn zu, atemlos und an allen Gliedern zitternd nach ihrer verzweifelten Flucht vor dem Massaker.
Einer der Männer streckte die Arme aus, um dem Herzog das Kind abzunehmen. Dieser reichte die Kleine wortlos hinauf, schlang dann beide Arme um seine Ehefrau und wiegte sie in stummem Gram hin und her.
»Mylord, wir müssen Mylady und das Kind von hier fortbringen«, flüsterte der Mann mit dem Baby eindringlich. »Es besteht die Gefahr, daß sie noch einmal zurückkommen. Wenn wir uns beeilen, können wir im Chatelêt Zuflucht finden.«
Francis ließ die Tote in seinen Schoß sinken, so daß ihr Kopf auf seinem Knie ruhte. Er drückte ihr sanft die starren, leblosen Augen zu und hob dann behutsam ihre Hand. Ein goldenes, perlenverziertes Armband mit einem seltsam anmutenden Schlangenmuster schmückte ihr schlankes Handgelenk. Ein einzelner, mit Smaragden besetzter Anhänger baumelte an der zierlichen Goldkette, und seine Tränen tropften auf die perfekte, schwungvoll gestaltete Form eines Schwans. Er löste den Verschluß des Armbands, sein Verlobungsgeschenk an Elena, und schob das glitzernde Schmuckstück unter sein Wams. Dann zog er seine tote Ehefrau in seine Arme und erhob sich mit seiner Last schwankend auf die Füße.
Das kleine Mädchen schrie kläglich, ein langgezogener Schrei des Hungers und der Angst. Ihr Träger hob sie auf seine Schulter und drehte sich um, um dem Herzog zu folgen, der mit seiner ermordeten Ehefrau auf den Armen in dem dunklen Schlund der Gasse verschwand, die vom Fluß wegführte.
Kapitel 1
Dover, England, 1591
Die Ähnlichkeit war wirklich außergewöhnlich.
Gareth Harcourt bahnte sich einen Weg durch die Menschenmenge, die fasziniert den Auftritt der Gauklertruppe verfolgte, die ihre improvisierte Bühne auf dem Kai im Hafen von Dover aufgebaut hatte.
Die Augen des Mädchens waren von dem gleichen leuchtenden Himmelblau, ihr Teint hatte die gleiche zarte Cremefarbe, und ihr Haar wies genau die gleiche Schattierung von sattem Dunkelbraun auf, bis hin zu dem rötlichen Schimmer, der im Sonnenlicht besonders prachtvoll hervortrat. An diesem Punkt endete die Ähnlichkeit jedoch. Denn während Maudes dunkles Haar in einem Schwall üppiger Locken auf ihre Schultern herabhing, die täglich mit Hilfe von Lockenpapier und Brennschere gekräuselt wurden, war die Haarpracht der Akrobatin zu einem kurzen, glatten Bubikopf geschnitten, der seine Form wohl eher einer umgestülpten Puddingschüssel verdankte als den etwas raffinierteren Werkzeugen weiblicher Frisierkunst.
Gareth beobachtete voller Vergnügen, wie die zierliche Gestalt auf einem sehr schmalen Balken, der auf zwei Stangen ruhte, in beträchtlicher Höhe vom Erdboden ihre Kunststücke vollführte. Sie bewegte sich so geschickt und flink auf dem knapp zehn Zentimeter breiten Balken, als ob sie festen Boden unter den Füßen hätte, während sie radschlug, auf den Händen ging und in einer atemberaubenden Serie von Manövern Rückwärtssaltos schlug, die den Zuschauern ein bewunderndes Aufkeuchen entlockten.
Maudes Figur ist ähnlich schlank, dachte Gareth, aber es gab einen Unterschied. Maude war blaß und dünn und unterentwickelt. Die Akrobatin, die jetzt auf den Händen stand, so daß ihr der leuchtendorangerote Rock über den Kopf fiel, hatte feste, muskulöse Waden, der Schicklichkeit halber in hautenge Lederbeinlinge gehüllt, und er konnte die Kraft in ihren Armen erkennen, als sie ihr leichtes Gewicht abstützten. Sie löste eine Hand und winkte den Zuschauern fröhlich zu, bevor sie sich erneut mit beiden Händen an dem Balken festhielt und sich dann wieder und wieder federnd von einer Seite zur anderen schwang, wobei ihre Hände mit blitzartiger Geschwindigkeit die Position wechselten und ihr hellorangefarbener Rock wie ein verschwommener Farbfleck um sie herumwirbelte. Dann holte sie abermals Schwung und setzte zu einer Bewegung an, die einem Katharinenrad ähnelte.
Auf dem höchsten Punkt des Rades warf sie sich rückwärts in die Luft, schlug einen Purzelbaum, landete auf beiden Füßen, vollführte einen rasanten Salto, während sich ihr Körper wie ein Bogen krümmte, und richtete sich dann endgültig auf, um sich triumphierend vor ihrem Publikum zu verbeugen.
Gareth ertappte sich dabei, wie er begeistert mit dem Rest der Zuschauer applaudierte. Ihr Gesicht war gerötet von der Anstrengung, ihre Augen glänzten vor Freude über ihre gelungene Darbietung, auf ihrer Stirn standen feine Schweißperlen, und ihre Lippen waren zu einem strahlenden Lächeln verzogen. Sie hob zwei Finger an den Mund und pfiff, und das schrille Geräusch zauberte wie aus dem Nichts einen kleinen Affen hervor, gekleidet in eine rote Jacke und eine Mütze mit einer wippenden orangefarbenen Feder.
Das Tier riß sich die Kappe vom Kopf und sprang mit einem Satz mitten in die Zuschauermenge, während es auf eine Art und Weise schnatterte, die in Gareth’ Ohren entfernt obszön klang. Er warf einen Silberpenny in die ausgestreckte Mütze, worauf sich der Affe mit einer drolligen kleinen Verbeugung bedankte.
Ein kleiner Junge von vielleicht sechs oder sieben Jahren versuchte, die Aufmerksamkeit des jungen Mädchens auf sich zu ziehen, und winkte hektisch von dem Platz am Ende der Bühne, wo er saß. Schließlich rappelte er sich auf und hinkte auf sie zu, wobei er einen mißgebildeten Fuß mühsam hinter dem anderen herzog. Das Mädchen riß ihn sofort mit einer schwungvollen Bewegung in die Arme und tanzte mit ihm auf der Bühne herum.
Es ist wirklich erstaunlich, dachte Gareth, wie sie das bedauernswerte kleine Geschöpf in ihren Armen mit ihrer eigenen Anmut und Geschmeidigkeit erfüllt, so daß seine Verunstaltung schlagartig vergessen ist und sein Gesicht vor Freude leuchtet. Sie strahlte eine temperamentvolle Überschwenglichkeit und Vitalität aus, die sich auf das Kind in ihren Armen zu übertragen schien, bis sie den Jungen schließlich auf einen Stuhl in einer Ecke setzte und sein buckliger kleiner Körper wieder in sich zusammensank, obwohl er noch immer lächelte, als der Affe auf die Bühne zurücksprang und ihm seine Mütze hinhielt.
Das Mädchen leerte den Inhalt der Kappe in einen Lederbeutel an ihrer Taille, warf der Menschenmenge fröhlich lächelnd eine Kußhand zu, setzte dem Affen die Mütze wieder auf den Kopf und verschwand mit einem letzten eleganten Rückwärtssalto von der Bühne.
Die Ähnlichkeit ist tatsächlich verblüffend, ja geradezu unheimlich, dachte Gareth abermals. Das heißt, in allem bis auf die Persönlichkeit, korrigierte er sich in Gedanken. Denn er konnte sich nicht entsinnen, schon jemals einem Menschen begegnet zu sein, der noch weniger Energie als Maude besessen hätte. Sie verbrachte ihre Tage damit, auf einer gepolsterten Wandbank zu liegen, religiöse Traktate zu lesen und sich Riechsalzfläschchen unter ihre kleine, gewöhnlich rosig überhauchte Nase zu halten. Wenn man sie tatsächlich einmal dazu überreden konnte, sich zu bewegen, schwebte sie dahin und schleifte lange Halstücher und Schals hinter sich her, eingehüllt in eine durchdringend nach Kräutern riechende Wolke von den zahllosen Heilmittelchen und Nerventonika, mit denen ihre alte Amme sie versorgte. Sie sprach stets mit einer schwachen Stimme, deren Klang entfernt an eine Rohrpfeife erinnerte und die ihre Zuhörer veranlaßte, mit angehaltenem Atem zu lauschen für den Fall, daß die Rohrpfeife plötzlich kraftlos verstummte, bevor der Satz beendet war.
Gareth war sich jedoch bewußt, daß seine Cousine trotz ihrer scheinbaren Zerbrechlichkeit und ihres bleichen, farblosen Äußeren einen eisernen Willen besaß. Die junge Maude verstand sich ausgezeichnet darauf, Kapital aus ihren Migräneanfällen und Wehwehchen zu schlagen, und was Maude nicht über emotionale Erpressung wußte, das war auch nicht wissenswert. Es machte sie zu einer würdigen Gegnerin für Imogen ... wenn nicht für ihn selbst.
Ein Trio von Musikern hatte gerade auf der Bühne Platz genommen, ausgerüstet mit Flöte, Oboe und Laute, und Gareth wollte sich schon zum Gehen wenden, als er wieder das Mädchen erblickte. Sie kam hinter der Bühne hervor und schlich verstohlen um die Musiker herum, während sie etwas in der Hand hielt. Der kleine Affe hockte auf ihrer Schulter und schien ihr Neuigkeiten von gravierender Bedeutung ins Ohr zu plappern.
Gareth hielt inne. Die spitzbübische Miene des Mädchens war einfach unwiderstehlich. Die Musiker spielten ein paar Noten, um die Tonlage ihrer Instrumente aufeinander abzustimmen, dann setzten sie zu einer heiteren, mitreißenden Melodie an. Der Affe sprang von der Schulter des Mädchens und begann, zu der Musik zu tanzen. Die Zuschauer lachten amüsiert, und bald klopften alle im Takt mit dem Fuß auf den Boden und klatschten im Rhythmus der Musik.
Gareth beobachtete, wie sich das Mädchen unauffällig direkt unterhalb der Musiker postierte. Sie blickte zu ihnen auf und hob etwas an den Mund. Er brauchte eine Minute, um zu erkennen, was das war. Dann grinste er. Dieser kleine Satansbraten! Sie saugte eine Zitrone aus, die Augen unverwandt auf den Flötisten geheftet. Gareth’ Blick schweifte zu dem Jungen, der noch immer auf seinem Stuhl saß. Die Augen des Kindes funkelten vor unterdrücktem Gelächter, und Gareth begriff, daß diese kleine Darbietung speziell zur Erheiterung des Jungen gedacht war.
Gareth wartete in atemloser Faszination auf das, was unweigerlich passieren würde. Der Flötenspieler kam auch prompt ins Stocken, und die Klänge seiner Flöte versiegten, als er das Mädchen so eifrig an der Zitrone saugen sah und sich seine Lippen unwillkürlich zu einer Grimasse verzogen, so daß sein Speichel eintrocknete. Der kleine Junge, der die Szene beobachtete, schüttelte sich vor Lachen.
Mit einem plötzlichen Brüllen sprang der Flötist vorwärts und versetzte dem Mädchen eine mächtige Ohrfeige. Sie verlor das Gleichgewicht und fiel zur Seite, fing sich jedoch sofort wieder und verwandelte ihren Sturz mit all der Geschicklichkeit einer professionellen Unterhaltungskünstlerin in ein Rad, so daß die Zuschauer belustigt auflachten in der Annahme, das gesamte Nebenspiel sei Teil der Vorstellung. Doch als das Mächen zu Gareth’ Füßen landete und sich wieder aufrichtete, hatte sie Tränen in den Augen.
Sie rieb sich reumütig mit einer Hand ihr schmerzendes Ohr und wischte sich mit der anderen hastig über die Augen.
»Ihr wart eine Idee zu langsam«, bemerkte Gareth.
Sie schüttelte den Kopf und schenkte ihm ein mattes Lächeln. »Gewöhnlich bin ich schnell genug. Ich wollte Robbie nur zum Lachen bringen, und normalerweise kann ich Bert in die Tasche stecken, aber ich bin für einen Augenblick von Chip abgelenkt worden.«
»Chip?«
»Mein Affe.« Sie hob abermals zwei Finger an den Mund und stieß einen Pfiff aus, worauf der Affe seinen Tanz aufgab und blitzschnell auf ihre Schulter sprang.
Sie hat eine höchst ungewöhnliche Stimme, dachte Gareth und betrachtete sie mit unverhohlenem Interesse, während sie neben ihm stand und mit kritischem Blick eine Gruppe von Jongleuren beobachtete, die sich zu den Musikern gesellt hatten. Es war eine erstaunlich tiefe Stimme für ein so zierliches Persönchen, und sie hatte ein warmes, melodisches Timbre, das er ausgesprochen reizvoll fand. Sie sprach mit einem leichten Akzent, so schwach, daß er schwer zu identifizieren war.
Plötzlich begann der Affe einen hektischen Tanz auf ihrer Schulter und schnatterte dabei ununterbrochen wie ein wildgewordener Verrückter, während er mit einem klauenähnlichen Finger in Richtung Bühne zeigte.
»Ach du großer Gott, ich wußte doch, daß ich besser hätte verschwinden sollen«, murmelte das Mädchen, als eine äußerst korpulente Frau in Sicht kam. Sie trug ein voluminöses Gewand von einem auffallend leuchtenden Braunrot, durchwirkt mit scharlachrotem Faden; ihr Kopf schien auf einem gewaltigen, wagenradähnlichen Rüschenkragen zu thronen, und das Ganze wurde von einem riesigen Samthut gekrönt, der mit seidenen Bändern unter mehreren Schichten von Kinn zusammengebunden und mit goldenen Federn geschmückt war, die lustig in der Seebrise flatterten.
»Miranda!« Die Stimme, die aus dem Brustkorb dieses sehenswerten Wesens ertönte, paßte zu der grandiosen Erhabenheit seiner Erscheinung. Es war ein gewaltiges, kehliges, mit einem schweren Akzent behaftetes Brüllen, das prompt wiederholt wurde. »Miranda!«
»Ohhh, Gott«, stöhnte das Mädchen abermals und stieß einen leidgeprüften Seufzer aus. Der Affe sprang von ihrer Schulter und hüpfte davon, noch immer aufgeregt schnatternd, und das Mädchen flüchtete sich mit einem Satz hinter Gareth. Sie flüsterte eindringlich: »Ihr würdet mir wirklich einen großen Gefallen tun, Mylord, wenn Ihr einfach nur ganz still stehenbleiben würdet, bis sie vorbeigegangen ist.«
Es kostete Gareth einige Mühe, ernst zu bleiben, aber er gehorchte und rührte sich nicht von der Stelle. Dann schnappte er scharf nach Luft, als er plötzlich fühlte, wie hinter ihm ein warmer Körper unter seinen Umhang schlüpfte und sich fest an seinen Rücken preßte. Es war, als hätte er einen körperlichen Schatten entwickelt – zwar nur so schmal, daß er kaum mehr als eine leichte Ausbuchtung in den Falten seines scharlachroten Seidenumhangs erzeugte, aber dennoch greifbar genug, um einen sinnlichen Schauer über seine Haut prickeln zu lassen.
Der Affe sprang vor die Füße der dicken Frau und begann auf eine Art und Weise zu tanzen und zu schnattern, die geradezu etwas Beleidigendes und Herausforderndes an sich hatte. Die Frau brüllte erneut und hob drohend eine Faust von der Größe einer Schinkenkeule, in der ein dicker, knorriger Stock steckte. Chip zog die Lippen zurück und entblößte gelbliche Zähne, als er sie mit funkelnden Augen auslachte. Dann stürzte er sich in die Menschenmenge, und die Frau, noch immer schimpfend und stockschwingend, folgte ihm.
Ihre Chancen, den Affen einzufangen, sind so gering, daß es schon fast lächerlich ist, dachte Gareth, doch der Affe hatte eindeutig sein Ziel erreicht, indem er die Frau von seiner Herrin weglockte.
»Ich danke Euch vielmals, Mylord.« Das Mädchen schlüpfte wieder unter seinem Umhang hervor und schenkte ihm ein erleichtertes Lächeln. »Ich habe im Moment wirklich kein Verlangen danach, von Mama Gertrude erwischt zu werden. Sie ist der liebste und netteste Mensch auf der Welt, aber sie ist fest entschlossen, daß ich am Ende die Partnerin ihres Sohnes werden soll. Luke ist zwar ein Schatz, aber er ist ausgesprochen trottelhaft und ungeschickt in allem, außer wenn es darum geht, mit Fred fertig zu werden. Ich könnte ihn unmöglich heiraten, geschweige denn, mit ihm zusammen auftreten.«
»Es war mir ein Vergnügen, Euch behilflich zu sein«, murmelte Gareth trocken, trotz ihrer Erklärung um nichts schlauer. Genausowenig konnte er verstehen, warum er die körperliche Nähe eines solchen Irrwisches von einem Mädchen als derart beunruhigend sinnlich empfunden hatte, aber die Haut seines Rückens schien noch immer wie eine Stimmgabel zu vibrieren.
Miranda sah sich suchend um. Die Zuschauer wurden allmählich unruhig, und die Musiker und Jongleure richteten sich danach und verließen unter Verbeugungen die Bühne, um Platz für einen ziemlich einfältig aussehenden jungen Mann in einem guten Wams zu machen, begleitet von einem lebhaften Terrier.
»Das sind Luke und Fred«, informierte Miranda den Besitzer des so überaus praktischen Umhangs. »Es ist eine sehr gute Dressurnummer, wißt Ihr? Er kann Fred dazu bringen, praktisch alles zu tun. Seht nur, wie er gerade durch den Feuerreifen springt ... Aber der arme Luke hat kein Gehirn im Kopf. Ich weiß einfach, daß es nicht mein Schicksal sein soll, ihn zu heiraten und seine Partnerin zu sein.«
Gareth blickte von dem leeren, ausdruckslosen Gesicht des jungen Mannes zu den strahlenden, von lebhafter Intelligenz erfüllten Augen des Mädchens und verstand, worauf sie hinauswollte.
»Jetzt muß ich aber gehen und Chip finden. Mama Gertrude wird ihn nicht einfangen können, und er könnte irgendwelchen Unfug anstellen.« Das Mädchen verabschiedete sich mit einem vergnügten Winken von Gareth und tauchte in der Menge unter, ihr orangeroter Rock ein weithin leuchtender Farbklecks, bis sie endgültig aus seinem Blickfeld verschwand.
Gareth fühlte sich leicht verwirrt, ertappte sich jedoch dabei, wie er leise vor sich hin lächelte. Er warf einen Blick zurück auf die Bühne, wo der Junge auf dem Stuhl niedergeschlagen seiner davoneilenden Tanzpartnerin nachstarrte. Das Kind sah so bedrückt und trostlos aus, als hätte man es allein im Dunkeln gelassen.
Gleich darauf bahnte sich die Frau, die Miranda Mama Gertrude genannt hatte, einen Weg zurück durch die Menschenmenge; ihr Ausdruck war äußerst verstimmt, und sie murmelte verärgert vor sich hin. »Dieses verflixte Mädchen ... wie ein Glühwurm ist sie mit ihrem ständigen Hin- und Hergeflitze. In der einen Minute hier und in der nächsten schon wieder verschwunden. Was gibt es denn an meinem Luke auszusetzen, frage ich Euch?« Bei dieser grimmigen Frage blickte sie Gareth direkt an. »Ein guter, tüchtiger Arbeiter ist er. Und ein gutaussehender Junge obendrein. Also, was gibt es dann an ihm auszusetzen? Jedes normale Mädchen würde sich alle zehn Finger nach einem solchen Mann lecken.«
Sie funkelte Gareth zornig an, als ob er irgendwie für Mirandas Undankbarkeit verantwortlich wäre. Dann zuckte sie die Achseln und segelte, noch immer vor sich hin schimpfend, in einer Wolke von Braunrot davon, während ihr enormer Busen wie der Bug eines Schiffes über ihrem schwingenden Reifrock hervorragte.
Luke hatte seine Darbietung gerade beendet und verbeugte sich vor den Zuschauern. Der Terrier stakste als Schlußnummer auf den Hinterbeinen am Rand der Bühne entlang, aber die Menschenmenge zerstreute sich bereits.
Gertrude reagierte wie elektrisiert, als sie sah, wie die Leute weggingen, und sprang mit einer Behendigkeit auf die Bühne, die außergewöhnlich für eine so schwerfällig wirkende Person war. »Du hast die Mütze nicht herumgehen lassen!« brüllte sie. »Du bist wirklich zum Gotterbarmen blöde, Luke. Los, sieh zu, daß du von der Bühne herunterkommst und das Geld einsammelst!« schimpfte sie und schlug mit ihrem Stock auf den unseligen jungen Burschen ein. »Steht da dumm herum und verbeugt sich und grinst albern, während die Leute schon wieder weggehen! Bei Miranda würdest du so was garantiert nicht erleben, du Tölpel!«
Der junge Mann sprang von der Bühne und begann, sich durch die davonstrebende Menschenmenge zu schlängeln, seine Mütze in der ausgestreckten Hand, als er um Münzen bat, gefolgt von seinem kleinen Hund, der hinter ihm hertrottete. Aber er hatte den richtigen Moment verpaßt, und der Großteil seiner Zuschauer drängelte sich an ihm vorbei und ignorierte ihn und seine Bitten. Gareth ließ einen Shilling in die Mütze fallen, und dem jungen Mann fiel vor Verblüffung fast der Unterkiefer herunter.
»Danke, Mylord«, stotterte er. »Vielen, herzlichen Dank, Mylord.«
»Woher kommt ihr?« Gareth wies mit einer Handbewegung auf die Bühne, die bereits von einigen Arbeitern wieder abgebaut wurde.
»Aus Frankreich, Mylord.« Luke stand etwas verlegen da und starrte seinem rapide entschwindenden Einkommen nach. Er war offensichtlich hin- und hergerissen zwischen dem dringenden Bedürfnis, jedem letzten Penny nachzujagen, den er der Menge vielleicht noch entlocken konnte, und der Verpflichtung, die Fragen des vornehmen Gentlemans zu beantworten, der seine Darbietung mit solcher Großzügigkeit belohnt hatte. »Wir wollen mit der Nachmittagsflut wieder nach Calais übersetzen«, fügte er hinzu.
Der Graf von Harcourt nickte, als betrachtete er das Thema damit als erledigt, und Luke stürzte den davonschlendernden Zuschauern nach. Der Graf beobachtete die Abbauarbeiten noch einige weitere Minuten, dann wandte er sich ab, um zu der Stadt am Fuße der steilen weißen Klippen zurückzugehen, die sich aus dem Ärmelkanal erhoben.
Er selbst hatte Frankreich erst am Abend zuvor verlassen und war im Morgengrauen nach einer stürmischen Überfahrt in Dover an Land gegangen. Er hatte entschieden, noch eine Nacht in der Stadt zu verbringen, um sich dann am nächsten Morgen auf die Weiterreise zu seinem Haus in The Strand, direkt außerhalb der Stadtmauern von London, zu machen.
Seine Entscheidung hatte mehr mit seinem Widerstreben zu tun, wieder in den Sog der erbitterten Schlachten seiner Schwester mit der aufsässigen Maude hineinzugeraten, als mit irgend etwas anderem. In Wahrheit hatte er die stürmische Überfahrt genossen. Vor allem den elementaren Kampf mit den Naturgewalten, als er Seite an Seite mit den verzweifelten Seeleuten gearbeitet hatte, die dankbar für ein weiteres Paar tatkräftiger Hände bei ihren angestrengten Bemühungen gewesen waren, das zerbrechliche Schiff über Wasser zu halten. Gareth hatte den Verdacht, daß die Matrosen sehr viel größere Angst gehabt hatten als er, aber andererseits waren Seefahrer ganz allgemein eine mehr als abergläubische Sorte, die in ständiger Furcht vor einem nassen Grab lebte.
Gareth schob eine Hand in seine Weste aus reichbestickter silbergrauer Seide und tastete nach dem kleinen Samtbeutel, der das Armband enthielt, Henris Geschenk an seine zukünftige Braut. Die Pergamenturkunde in ihrem Umschlag aus Wachspapier ruhte an seiner Brust, und er zeichnete das erhabene Siegel König Henri des Sechsten von Frankreich nachdenklich mit den Fingerspitzen nach. Henri de Navarre war zur Zeit nur dem Namen nach und durch Erstgeburtsrecht König von Frankreich. Die französischen Katholiken würden einen hugenottischen Monarchen nicht bereitwillig akzeptieren, aber wenn es ihm erst einmal gelungen war, seine aufsässigen Untertanen zum Gehorsam zu zwingen, würde er über ein immens großes Staatsgebiet herrschen, unendlich viel mächtiger als sein Heimatland. Ein König von Navarra war ein Niemand im Vergleich zu einem König von Frankreich.
Und unter jenem königlichen Siegel von Frankreich lag der Weg zur Wiedererlangung der Ländereien und der Macht, die die Familie Harcourt einst genossen hatte.
Es war ein Weg von solch schwindelerregender Pracht und Großartigkeit, daß noch nicht einmal Imogen, Gareth’ machthungrige Schwester, es gewagt hätte, diese Möglichkeit auch nur ins Auge zu fassen.
Ein sardonisches Lächeln spiegelte um Gareth’ feingeschwungene Lippen, als er sich ausmalte, wie Imogen auf den Antrag reagieren würde, den er auf seiner Brust trug. Seit Charlottes Tod hatte Gareth sich fast ausschließlich seinen eigenen Geschäften gewidmet, weil es kaum etwas anderes gegeben hatte, was ihn aus seiner lethargischen Gleichgültigkeit gegenüber der weiteren Welt aufzurütteln vermocht hätte, aber dieser einmalige Glücksfall hatte ihn mit neuer Energie erfüllt und den alten politischen Hunger wiederbelebt, der einst sein tägliches Leben bereichert hatte.
Doch zuerst würde er sich die Einwilligung seines Mündels sichern müssen – etwas, was man niemals als selbstverständlich betrachten durfte.
Als er schließlich den Forderungen seiner Schwester nachgegeben hatte und nach Frankreich gefahren war, hatte er ein sehr viel bescheideneres Angebot unterbreiten wollen als das, das er jetzt schwarz auf weiß bei sich trug. Es war ein Angebot an den Ratgeber und engen Vertrauten des Königs, den Herzog von Roissy, ein Vorschlag, daß der Herzog Maude, Tochter des Herzogs d’Albard und Cousine zweiten Grades des Herzogs von Harcourt, zur Ehefrau nehmen sollte. Aber dann hatten die Ereignisse plötzlich eine unerwartete Wendung genommen.
Gareth wandte sich wieder zum Wasser um und blickte hinaus auf den Molendamm, der den Hafen vor den vordringenden Fluten des Ärmelkanals schützte. Es war ein wunderschönes, friedliches Fleckchen Erde, das seinen Namen »Paradieshafen« durchaus verdient hatte. Völlig anders als das hektische, mißtönende Durcheinander in König Henris Belagerungscamp vor den Toren von Paris ...
Gareth war an einem naßkalten Aprilabend in Henris Lager eingetroffen, bei peitschendem Regen, der eher zum Winter gepaßt hätte als zum Frühling. Er war allein gereist, weil er wußte, daß er ohne ein Gefolge von Bediensteten weniger Aufmerksamkeit auf sich ziehen würde. Die gesamte französische Bevölkerung war in Aufruhr, da ihr unerwünschter König Paris belagerte und die Einwohner der Stadt mit einer Hungersnot kämpften, während sie sich gleichzeitig beharrlich weigerten, einen Souverän anzuerkennen, den sie als ketzerischen Usurpator betrachteten.
Die Tatsache, daß Lord Harcourt noch nicht einmal von einem Kammerdiener begleitet wurde und auch keinerlei sichtbare Abzeichen seines Ranges und seiner Identität vorweisen konnte, hatte zuerst für Schwierigkeiten mit dem Lagerkommandanten gesorgt, aber schließlich war er in das Lager eingelassen worden, das einer riesigen Zeltstadt glich. Zwei Stunden lang hatte er müßig in dem Vorzimmer zum Zelt des Königs warten müssen. Es hatte ein ständiges Kommen und Gehen geherrscht, als Offiziere, Kuriere und Diener an ihm vorbeigeeilt waren, ohne mehr als einen flüchtigen Blick auf den hochgewachsenen Mann in seinem dunklen, regendurchnäßten Umhang zu werfen, der voller Ungeduld auf dem plattgetrampelten Gras innerhalb der eingezäunten Fläche hin und her trottete und die Arme schwang, um die Kälte aus seinen Gliedern zu vertreiben.
Als man ihn dann endlich zum König vorgelassen hatte, waren die Dinge auch nicht sonderlich viel besser geworden. König Henri war seit seinem fünfzehnten Geburtstag Soldat gewesen, und jetzt, mit achtunddreißig Jahren, war er ein kampfgestählter, durch und durch abgehärteter, leidenschaftlicher Krieger, der das leibliche Wohl ziemlich geringschätzte. Sein eigenes Quartier war klamm und kalt, nur dürftig beheizt von einem träge vor sich hin glimmenden Kohlenbecken, sein Bett bestand aus einer Strohmatratze auf dem kalten Erdboden. Er und seine Berater, noch immer gestiefelt und gespornt, hatten sich in dicke wollene Reitcaps gehüllt.
Der König hatte Lord Harcourt mit einem höflichen Lächeln begrüßt, aber seine scharfen dunklen Augen waren von Mißtrauen erfüllt gewesen, seine Fragen bohrend und unverblümt. Er war ein Mann, der gelernt hatte, hinter jedem Freundschaftsangebot zunächst einmal Verrat zu wittern, nachdem es zu jenem grauenhaften Massaker am Bartholomäustag gekommen war, als er als Neunzehnjähriger Marguerite de Valois geheiratet hatte und damit unwissentlich die tödliche Falle hatte zuschnappen lassen, in der Tausende von seinen eigenen Leuten ums Leben gekommen waren – in ebenjener Stadt, die er jetzt so kaltblütig und bedächtig durch Aushungern zur Unterwerfung zwang.
Aber Gareth’ Referenzen waren über jeden Zweifel erhaben. Sein eigener Vater war bei jener unglückseligen Hochzeit an Henris Seite gewesen. Der Herzog d’Albard, Maudes Vater, war einer von Henris engsten Freunden gewesen und hatte seine Ehefrau und eine Tochter bei dem Massaker verloren. Die ermordete Ehefrau war eine gebürte Harcourt gewesen. Und so wurde der Graf von Harcourt nach einem gründlichen und scharfen Verhör schließlich als Freund akzeptiert und aufgefordert, dem König bei seinem einfachen Abendessen Gesellschaft zu leisten, bevor er und Roissy Lord Harcourts Vorschlag diskutieren würden.
Der Wein war sauer, das Brot trocken und altbacken, das Fleisch sehr stark gewürzt, um seinen ranzigen, verdorbenen Geschmack zu übertünchen, doch die hungerleidenden Bürger von Paris hätten es ganz sicherlich als Manna betrachtet. Henri für sein Teil fand offenbar nichts an der Kost auszusetzen, denn er aß mit großem Appetit und trank reichlich, und seine große, unförmige Nase rötete sich leicht, als der Wein in den Lederflaschen immer weniger wurde. Schließlich hatte er seine schmalen Lippen mit dem Handrücken abgewischt, die Brotkrümel aus seinem Bart geschüttelt und das Porträt von Lady Maude zu sehen verlangt. Er müsse zuerst ein Urteil darüber fällen, ob die Dame es auch wert sei, Ehefrau seines verehrten und hochgeschätzten Freundes Roissy zu werden, erklärte Henri. Er lachte zwar bei seiner Bemerkung, als hätte er einen Scherz gemacht, aber hinter seinen Worten verbarg sich mehr als nur eine Spur von Ernst.
Gareth hatte die Miniatur seiner jungen Cousine präsentiert. Es war ein gutes Porträt und zeigte Maude als eine blasse, vornehme Erscheinung von einer faden, ätherischen Zerbrechlichkeit, die bei vielen Frauen als Schönheit galt. Der durchdringende Ausdruck der azurblauen Augen, die dem Betrachter aus dem perlenbesetzten Bilderrahmen entgegenblickten, zeugte von dem heftigen Temperament des Mädchens. Ihre Haut war sehr weiß – von einer geradezu ungesunden Blässe, wie Gareth fand. Ihr langer Schwanenhals war einer ihrer größten Ansprüche auf Schönheit, und seine grazile Form wurde auf dem Porträt durch einen Türkisanhänger betont.
Henri hatte die Miniatur in die Hand genommen, und seine dicken, buschigen Augenbrauen hatten sich abrupt zu einem Stirnrunzeln zusammengezogen. Er hatte einen Blick auf Roissy geworfen, einen verblüfften Ausdruck in seinen stechenden Augen.
»Mylord? Stimmt irgend etwas nicht?« Roissy hatte höchst alarmiert dreingeschaut und den Hals gereckt, um das Porträt zu sehen, das der König noch immer in der Handfläche hielt.
»Nein, nein, alles in Ordnung. Die Dame ist ausgesprochen hübsch.« Henri wirkte seltsam abgelenkt und gedankenverloren, als er mit einer schwieligen Fingerspitze auf die Miniatur klopfte. »Wie tragisch, daß sie mutterlos aufwachsen mußte. Ich erinnere mich noch sehr deutlich an Elena.« Er blickte zu Gareth auf. »Ihr habt Eurer Cousine sehr nahegestanden, nicht wahr?«
Gareth nickte lediglich. Elena war ein paar Jahre älter als er gewesen, aber sie hatten ein enges Verhältnis zueinander gehabt, und ihr gewaltsamer Tod hatte ihn zutiefst erschüttert.
Henri kaute nachdenklich auf seiner Unterlippe, als er fortfuhr, auf Maudes Porträt zu starren. »Es wäre zweifellos eine einwandfreie Verbindung.«
»Ja, in der Tat, Sire.« Roissy klang ein wenig ungeduldig. »Die d’Albards und die Roissys sind seit langem verbündet. Und auch die Harcourts.« Er hatte dem Grafen von Harcourt ein schnelles Lächeln geschenkt.
»Ja, doch ... eine ausgezeichnete Partie für einen Roissy«, hatte Henri reserviert erwidert. »Aber auch keine schlechte Verbindung für einen König ... wie?« Er hatte sich mit einem spitzbübischen Grinsen in der Tischrunde umgeschaut, das ihn plötzlich viel jünger hatte erscheinen lassen. »Diese Cousine von Euch gefällt mir ausnehmend gut, Lord Harcourt. Und ich brauche dringend eine protestantische Ehefrau.«
Einen Moment lang hatte verblüfftes Schweigen im Zelt geherrscht, dann hatte Roissy erwidert: »Aber Ihr habt doch bereits eine Ehefrau, Sire.«
Henri hatte gelacht. »Eine katholische Ehefrau, ja. Marguerite und ich sind gute Freunde. Wir leben seit Jahren getrennt. Sie hat ihre Liebhaber, ich habe meine Geliebten. Sie wird jederzeit in eine Scheidung einwilligen, wenn ich sie darum bitte.« Er richtete seinen Blick aus scharfen, intelligenten Augen auf Gareth. »Ich denke, ich werde mir selbst einen Eindruck von Eurem Mündel verschaffen, Harcourt. Und wenn ich feststelle, daß sie so angenehm und gefällig ist wie ihr Porträt, dann wird Roissy sich leider nach einer anderen Ehefrau umsehen müssen.«
Es hatte natürlich Einwände gegeben. Der König könne seine Belagerung von Paris doch nicht einfach aufgeben und zu diesem Zeitpunkt nach England reisen, hatten seine Berater dagegengehalten. Aber Henri war fest entschlossen. Seine Generäle könnten die Arbeit auch ein paar Monate lang ohne ihn fortführen. Es erforderte keine großen taktischen Manöver oder blutige Schlachten, um eine Stadt durch Aushungern zur Unterwerfung zu zwingen. Er würde sich heimlich vom Feld wegstehlen, würde incognito nach England reisen – ein französischer Adliger, der Königin Elizabeths Hof einen Besuch abstattete –, und er würde die Gastfreundschaft des Grafen von Harcourt genießen und die Bekanntschaft der hübschen Lady Maude machen. Und wenn er zu der Überzeugung kam, daß er und sie gut zusammenpaßten, dann würde er persönlich um sie werben.
Das mittelalterliche Schlangenarmband mit dem smaragdbesetzten Schwanenanhänger hatte einst Maudes Mutter gehört. Es war ein einzigartiges und überaus kostbares Schmuckstück. Wie es in den Besitz des Königs gelangt war, wußte Gareth nicht. Vermutlich hatte Francis d’Albard es irgendwann einmal seinem König überreicht, und Henri schien das Armband jetzt als ein höchst passendes Geschenk für d’Albards Tochter zu betrachten und als Zeichen seines guten Willens, ihr den Hof zu machen.
So war es schließlich gekommen, daß Gareth nun den bewußten Antrag unter seinem Wams trug, der Imogen in freudige Verzückung und Panik versetzen würde. Und Gott allein wußte, wie Maude darauf reagieren würde.
Gareth schlenderte durch den baufälligen Torbogen in der langsam zerbröckelnden Stadtmauer. Die Stadt war gut geschützt durch das Kastell hoch oben auf den Klippen und durch die drei Festungen, erbaut von Elizabeths Vater, Heinrich VIII. Die Stadtväter hatten es allerdings seit langem aufgegeben, die Mauern instand zu halten – sie waren ohnehin zu anfällig für eine feindliche Kanonande von der Seeseite her, um die Mühe zu lohnen.
Gareth bog in die Chapel Street ein und strebte auf den Gasthof mit dem Namen »Adam und Eva« zu, wo er sich ein Bett für die Nacht reservieren lassen und auch einigermaßen sicher sein konnte, daß er tatsächlich eines bekommen würde. Gastwirte waren berüchtigt dafür, daß sie ihren Kunden eine solch kostbare Ruhe und Ungestörtheit versprachen und ihnen dann plötzlich unerwünschte Bettgenossen aufdrängten, und zwar zu einer nachtschlafenden Zeit, wenn ein Mann nichts mehr dagegen unternehmen konnte.
Er hatte sich gerade unter dem niedrigen Türsturz des Gasthofs hindurchgeduckt, um den Schankraum zu betreten, als der unmißverständliche Lärm einer wilden Verbrecherjagd um die Ecke der Snargate Street brandete. Gareth trat wieder in die schmale, mit Unrat übersäte Gasse zurück und erhaschte gerade noch einen Blick auf eine vorbeiflitzende Gestalt in einem leuchtendorangefarbenen Kleid. Die Menschenmenge, die die Flüchtende verfolgte und unentwegt wütend »Haltet die Diebin!« schrie, wäre glatt über ihn hinweggetrampelt, wenn er sich nicht mit einem raschen Sprung zurück in die Tür geflüchtet hätte.
Normalerweise hätte ihn die Aussicht auf Lynchjustiz nicht im geringsten beunruhigt. Schläge und Steinigungen waren nun einmal eine Tatsache des Lebens, wenn das gemeine Volk bei einem Übeltäter aus den eigenen Reihen das Gesetz selbst in die Hand nahm, und keiner machte sich Gedanken darüber. Es war mehr als wahrscheinlich, daß das Mädchen eine Diebin war. Das Leben, das sie führte, hatte gewöhnlich die Tendenz, eine ziemlich unbekümmerte Einstellung zu dem Eigentum anderer Leute zu erzeugen.
Achselzuckend wandte Gareth sich wieder der verlockenden Aussicht auf ein schäumendes Ale und eine schmauchende Tabakspfeife im Schankraum des Gasthauses zu, dann blieb er zögernd stehen. Angenommen, sie war nun doch nicht schuldig? Wenn sie ihren Verfolgern in die Hände fiel, würde Unschuld sie nicht vor der brutalen Selbstjustiz des Pöbels bewahren. Sie würden nicht erst innehalten, um ihr Fragen zu stellen. Selbst wenn sie tatsächlich schuldig war, empfand er doch Widerwillen bei dem Gedanken, sie einfach ihrem Schicksal zu überlassen und tatenlos zuzusehen, wie sie von einer aufgebrachten Menschenmenge mit Schlägen und Fußtritten traktiert wurde.
Entschlossen kehrte Gareth in die Gasse zurück und marschierte mit schnellen Schritten hinter der wütenden Horde her. Nach dem anhaltenden Geschrei zu urteilen hatten sie sie noch nicht eingefangen.
Kapitel 2
Miranda rannte die Gasse entlang, einen ängstlich schnatternden Chip auf der Schulter, der sich zitternd an ihr festkrallte, und tauchte mit einem Satz in eine schmale Lücke zwischen zwei Häusern. Es war ein so enger Spalt, daß sie trotz ihrer Zierlichkeit seitlich stehen mußte, eingeklemmt zwischen zwei Mauern und kaum in der Lage zu atmen. Nach dem Jauchegrubengestank zu urteilen wurde die Lücke als Müllkippe für Haushaltsabfälle und menschliche Ausscheidungen benutzt, und in Anbetracht des widerwärtigen Geruchs, der ihr in die Nase stieg, fiel es Miranda sowieso leichter, die Luft anzuhalten.
Chip brabbelte in leiser Verzweiflung vor sich hin und klammerte sich mit seinen mageren Armen an ihrem Hals fest, während sein kleiner Körper vor Furcht zitterte. Sie streichelte beruhigend seinen Kopf und verfluchte im stillen seine ausgeprägte Leidenschaft für kleine, glänzende Gegenstände. Er hatte nicht die Absicht gehabt, den Kamm der Frau zu stehlen, aber niemand hatte ihr eine Chance gegeben, den wahren Sachverhalt zu erklären.
Chip, der fasziniert von dem silbernen Glitzern im Sonnenlicht gewesen war, hatte sich auf der Schulter der Frau niedergelassen und damit einen Panikanfall bei ihr ausgelöst. Er hatte sich bemüht, sie mit seinem interessierten Geschnatter zu beruhigen, als er versucht hatte, den silbernen Kamm aus ihrer kunstvollen Frisur zu ziehen. Er hatte sich das glitzernde Ding nur etwas genauer ansehen wollen, mehr nicht, aber wie sollte man das einer hysterischen Bürgersfrau begreiflich machen, die plötzlich klauenartige Finger in ihrem Haar herumwühlen fühlte, als ob sie nach Läusen suchten?
Miranda war herbeigestürzt, um den Affen wegzuholen, und sofort war die reizbare Menschenmenge zu dem Schluß gekommen, daß sie mit dem Tier unter einer Decke steckte. Miranda, durch ihre Erfahrungen im Berufsleben mit den diversen Stimmungen einer großen Menschenansammlung vertraut, hatte blitzschnell entschieden, daß Diskretion in diesem Fall der bessere Teil von Heldenmut war, und war geflohen. Und damit hatte sie die ganze wütende Meute auf den Fersen gehabt.
Die zornige Horde raste jetzt mit wildem Gebrüll an ihrem Versteck vorbei. Chip zitterte noch heftiger und brabbelte ihr seine Furcht leise ins Ohr. »Ruhig, ganz ruhig.« Miranda drückte ihn noch fester an sich und wartete, bis das Geräusch stampfender Füße in der Ferne verhallt war, bevor sie aus dem engen Spalt herausglitt.
»Ich bezweifle, daß sie so schnell aufgeben werden.«
Sie zuckte erschrocken zusammen und blickte auf, um den Gentleman vom Kai mit wehendem rotem Seidenumhang auf sich zukommen zu sehen. Am Morgen hatte sie seinem Äußeren nicht sonderlich viel Beachtung geschenkt, hatte lediglich die auserlesene Eleganz seiner Kleidung bemerkt, die ihn als Adligen kennzeichnete. Jetzt musterte sie ihn mit sehr viel mehr Sorgfalt. Das silbergraue, reichbestickte Seidenwams, die schwarz-gold gemusterte Kniehose aus Samt, die golddurchwirkten Strümpfe und der seidene Umhang ließen erkennen, daß es sich um einen sehr vermögenden Gentleman handelte, ebenso wie die kostbaren Ringe an seinen Fingern und die Silberschnallen auf seinen Schuhen. Er trug sein schwarzes, lockiges Haar ziemlich kurz geschnitten, und sein Gesicht war unmodern glattrasiert.
Träge braune Augen unter schweren Lidern betrachteten sie mit einem Funkeln der Belustigung. Sein sinnlicher, feingeschnittener Mund verzog sich zu einem breiten Lächeln, das außergewöhnlich kräftige weiße Zähne enthüllte.
Miranda ertappte sich dabei, wie sie sein Lächeln erwiderte und ihm gestand: »Wir haben nichts gestohlen, Mylord. Es ist einfach so, daß Chip sich unwiderstehlich von Dingen angezogen fühlt, die glitzern, und er kann nicht begreifen, warum er sie sich nicht ein bißchen genauer ansehen sollte.«
»Ah ja.« Gareth nickte verstehend. »Und ich nehme an, irgendeine verständnislose Person hatte etwas gegen die genauere Untersuchung durch einen Affen einzuwenden?«
Miranda grinste. »Ja, das blöde Weib. Sie hat geschrien, als ob sie in siedendes Öl getaucht würde. Und dabei war der verflixte Kamm sowieso nur mit wertlosen Similisteinen besetzt.«
Gareth spürte eine flüchtige Aufwallung von Mitleid mit der unbekannten Hysterikerin. »Ich könnte mir vorstellen, daß sie es nicht gewöhnt war, Affen auf ihrem Kopf zu haben«, bemerkte er.
»Schon möglich, aber Chip ist absolut sauber und sehr gutmütig. Er hätte ihr niemals etwas getan.«
»Vielleicht wußte das Objekt seiner Aufmerksamkeit das nicht.« Wieder blitzte eine Funke der Belustigung in den braunen Augen auf.
Miranda kicherte. In Gesellschaft dieses humorvoll aussehenden und eindeutig wohlgesonnenen Gentlemans kam ihr ihre Zwangslage irgendwie gar nicht mehr so bedenklich vor. »Ich wollte Chip gerade wegholen, aber plötzlich sind sie auf mich losgegangen, und deshalb mußte ich schleunigst türmen, was mich natürlich schuldig erscheinen ließ.«
»Hmmm, ja, diesen Eindruck würde es zweifellos erwecken«, pflichtete er ihr bei. »Aber so wie ich die Sache sehe, hattet Ihr wohl kaum eine andere Wahl.«
»Richtig, genau so war es.« Mirandas Lächeln verblaßte plötzlich. Sie neigte den Kopf schief und horchte ängstlich auf das erneut näher kommende Geschrei einer wutentbrannten Horde von Verfolgern.
»Kommt, laßt uns von der Straße verschwinden«, sagte der Gentleman mit plötzlicher Eindringlichkeit. »Dieses orangefarbene Kleid ist so auffällig wie ein Leuchtfeuer.«
Miranda zögerte. Ihr Instinkt riet ihr, wieder zu fliehen, soviel Vorsprung vor der rasch näher kommenden Meute zu gewinnen, wie sie konnte, aber dann spürte sie, wie sich warme, feste Finger um ihr Handgelenk schlossen und sie fortzogen, und in der nächsten Sekunde rannte sie fast neben dem fremden Gentleman her, um mit seinen schnellen, weit ausholenden Schritten mitzuhalten, die sie ins »Adam und Eva« führten.
»Warum gebt Ihr Euch überhaupt mit mir ab, Mylord?« Sie schlüpfte neben ihn und blickte mit neugierigen Augen zu ihm auf.
Gareth sagte nichts. Es war eine gute Frage und noch dazu eine, auf die er keine Antwort parat hatte. Es war einfach so, daß die kleine Akrobatin etwas unendlich Reizvolles an sich hatte, etwas Wehrloses und zugleich Unbezähmbares, das ihn rührte. Er brachte es nun einmal nicht über sich, sie dem Pöbel auszuliefern, obwohl die Realität ihm sagte, daß sie es mehr als gewöhnt war, solchen Gefahren der Straße auszuweichen.
»Hinein mit Euch.« Er legte eine Hand auf ihren Rücken und schob sie durch die schmale Tür in das dämmrige Innere des Gasthofs. Ihre Haut fühlte sich warm unter dem dünnen Stoff ihres Kleides an, und als er auf ihren kleinen Kopf hinunterblickte, sah er, wie weiß ihre Haut an der Stelle war, wo sie ihr dunkles, rötlich braunes Haar gescheitelt trug. Fast geistesabwesend strich er mit einer Fingerspitze über den glatten Scheitel. Sie zuckte zusammen und blickte erschrocken zu ihm auf. Er räusperte sich und sagte brüsk: »Paßt auf, daß Ihr den Affen festhaltet. Ich fürchte, es gibt hier eine Menge glänzender Gegenstände.«
Miranda fragte sich, ob sie sich jene flüchtige Berührung vielleicht nur eingebildet hatte. Sie sah sich kritisch in der Schankstube um. »Ich bezweifle, daß es hier viel gibt, was Chip neugierig machen könnte. Es ist viel zuviel Staub überall. Selbst das Zinn ist trübe und angelaufen.«
»Das mag schon sein, aber haltet ihn trotzdem fest.«
»Mylord Harcourt.« Der Gastwirt kam durch eine Tür am anderen Ende des schmalen Durchgangs und eilte geschäftig auf Gareth zu. Seine kleinen Augen glänzten. »Der Mietstall hat ein gutes Pferd für Euch, wie Ihr es verlangt hattet. He, was ist das denn? Schaff sofort das dreckige Vieh hier raus, du kleine Hure!« Er zeigte mit einem vor Empörung zitternden Finger auf den armen Chip, der sich mittlerweile von dem ausgestandenen Schreck erholt hatte und jetzt auf Mirandas Schulter hockte, während er sich mit wachen, neugierigen Augen umsah.
»Immer sachte, Molton! Das Mädchen ist in meiner Begleitung, und der Affe wird keinen Schaden anrichten.« Gareth betrat den Schankraum. »Bringt mir eine Pfeife und einen Humpen Ale. Oh, und auch einen Humpen für das Mädchen.«
»Ich wünschte, ich wüßte, warum die Leute solche Angst vor einem kleinen Affen haben«, murmelte Miranda, als sie an das kleine Fenster trat, das tief in die weißgetünchte Wand eingelassen war und einen Ausblick auf die Straße bot. Sie rieb mit ihrem Ärmel über die verschmierte Glasscheibe, bis sie eine relativ saubere, klare Stelle geschaffen hatte, und hielt nach ihren Verfolgern Ausschau.
Gareth nahm die lange Tonpfeife von dem Wirt entgegen, der den Pfeifenkopf mit Tabak gefüllt hatte und jetzt eine angezündete Wachskerze bereithielt, um ihm Feuer zu geben. Aromatisch duftender blauer Rauch stieg in Kräuseln zu den rußgeschwärzten Deckenbalken auf, als Lord Harcourt genüßlich an der Pfeife zog. Miranda beobachtete ihn einen Moment lang und rümpfte ihre kleine, wohlgeformte Nase.
»Ich habe noch nie jemanden Pfeife rauchen sehen. In Frankreich ist so was nicht populär.«
»Dann wissen die Franzosen nicht, was ihnen entgeht«, erwiderte Gareth, während er seinen Humpen hob und dem Mädchen mit einem auffordernden Nicken bedeutete, daß sie nach ihrem greifen sollte. Miranda trank mit ihm.
»Ich glaube nicht, daß ich den Geruch mag«, bemerkte sie kritisch. »Der Rauch erschwert einem das Atmen. Chip scheint ihn auch nicht zu mögen.« Sie wies auf den Affen, der sich in die hinterste Ecke der Schankstube verzogen hatte und eine magere kleine Hand auf seine Nase preßte.
»Ihr werdet mir verzeihen müssen, wenn ich es nicht für nötig halte, Rücksicht auf die Vorlieben und Abneigungen eines Affen zu nehmen«, erwiderte der Graf, als er abermals an seiner Pfeife zog.
Miranda kaute auf ihrer Unterlippe. »Ich hatte nicht die Absicht, unhöflich zu sein, Mylord.«
Er neigte bestätigend den Kopf, aber in seinen braunen Augen war wieder dasselbe humorvolle Funkeln, und Miranda fühlte sich beruhigt und trank einen weiteren Schluck von ihrem Ale. Ihr wurde erst jetzt richtig bewußt, daß sie nach der wilden Hetzjagd durch die Straßen völlig ausgedörrt war. Sie unterzog ihren Retter einer verstohlenen Musterung. Er hatte etwas sehr Entspanntes an sich, wie er da so lässig gegen die Theke lehnte, eine Miene heiterer Gelassenheit, die sie als ebenso tröstlich empfand, wie sie attraktiv war. Sie vermittelte ihr ein Gefühl des Wohlbehagens und der Sicherheit.
Wie hatte ihn der Gastwirt noch genannt? Ach ja, Mylord Harcourt, das war es. »Ich möchte Euch für all Eure Freundlichkeit danken, Mylord Harcourt«, wagte sie zu äußern. »Schließlich ist es ja nicht so, als ob wir irgendwie miteinander bekannt wären.«
»Seltsamerweise habe ich allmählich das Gefühl, sogar sehr gut mit Euch bekannt zu sein«, gab er zurück und fügte trocken hinzu: »Ob ich will oder nicht.«
Miranda drückte ihre Nase gegen die zerkratzte Fensterscheibe und sagte sich, daß es lächerlich war, sich gekränkt zu fühlen, selbst wenn seine Bemerkung so geklungen hatte, als machte er sich über sie lustig. Er war nur für einen kurzen, flüchtigen Augenblick in ihr Leben getreten und würde ebensoschnell wieder daraus verschwinden.
Die Gasse draußen vor dem Fenster war still und verlassen. »Ich glaube, ich kann jetzt unbesorgt wieder gehen. Ich möchte Euch nicht länger zur Last fallen, Mylord.«
Gareth blickte überrascht drein. »Wenn Ihr Euch sicher seid, daß keine Gefahr droht«, erwiderte er. »Aber Ihr könnt gerne so lange hier drinnen bleiben, wie Ihr möchtet.«
»Danke, aber ich sollte jetzt besser gehen.« Sie wandte sich zur Tür um. »Und nochmals vielen Dank für die vielen Gefälligkeiten, die Ihr mir erwiesen habt, Mylord.« Sie verabschiedete sich mit einer ziemlich ruckartigen knappen Verbeugung und verließ den Schankraum. Der Affe sprang wieder auf ihre Schulter, drehte sich zu Gareth um und machte eine obszöne Geste mit einem klauenähnlichen Finger, wobei er einen Schwall von Geschnatter von sich gab, das unverkennbar kriegerisch klang.
Undankbares Biest, dachte Gareth, während er an seiner Pfeife zog. Aber die erstaunliche Ähnlichkeit des Mädchens mit Maude beschäftigte ihn noch immer. Es hieß, für jeden Menschen auf Erden existiere irgendwo ein Doppelgänger, doch bisher hatte er eine solche Idee immer als völlig absurd abgetan.
»Wann möchtet Ihr zu Abend essen, Mylord?« Molton erschien wieder im Schankraum.
»In einer Stunde.« Gareth trank sein Ale aus und zog ein letztes Mal an seiner Pfeife. »Ich will zuerst in den Mietstall gehen, um mir das Pferd anzusehen. Außerdem werde ich ein Bett für die Nacht brauchen. Ich werde für das Privileg zahlen, ein Bett ganz für mich allein zu haben, und eine separate Schlafkammer, wenn Ihr eine habt.«
»O ja, M’lord. Eine sehr schöne Kammer über dem Waschhaus, genau richtig für eine Person.« Molton verbeugte sich so tief, daß seine Stirn fast gegen seine Knie schlug. »Aber ich werde Euch eine Krone dafür berechnen müssen, M’lord. Ich könnte bequem drei Leute in dem Bett unterbringen, ohne daß es ein Gedränge geben würde.«
Gareth’ bewegliche Augenbrauen schossen in die Höhe. »Aber ich dachte, ich hätte Euch gerade eben sagen hören, daß es genau richtig für eine Person wäre?«
»Für eine Person ist es perfekt, M’lord«, erklärte Molton würdevoll. »Aber es bietet Platz für drei.«
»Ah ja, ich verstehe. Jetzt ist mir die Sachlage vollkommen klar.« Gareth nahm seine juwelenbesetzten Handschuhe von der Theke. »Dann laßt bitte mein Gepäck in die Waschhauskammer hinaufbringen, und ich werde dann zu Abend speisen, wenn ich wieder zurück bin.« Er schlenderte aus dem Gasthof und ließ einen eifrigen nickenden, katzbuckelnden Molton zurück, der sich wie ein Kasper vor der entschwindenden Kehrseite des Grafen verbeugte.
Das verkäufliche Pferd in dem Mietstall entpuppte sich als ein magerer Klepper, aber Gareth war zuversichtlich, daß es ihn die siebzig Meilen bis nach London tragen würde, wenn er es schonend behandelte, und es war ja nicht so, als ob er es schrecklich eilig hätte. Imogen würde natürlich schon wie auf glühenden Kohlen sitzen, und Miles würde nervös umherhasten auf der Suche nach einem Versteck, um dem unablässigen Hagel von Klagen und Mutmaßungen zu entrinnen. Gareth klingelten schon im voraus die Ohren, wenn er an den Empfang zu Hause dachte und sich das aufgeregte Kreischen seiner Schwester ausmalte, zusammen mit dem schwachen Kontrapunkt ihres Ehemanns. Er war ganz und gar nicht darauf erpicht, sich so bald der Realität zu stellen.
Nicht zum ersten Mal fragte er sich, wieso er eigentlich zugelassen hatte, daß seine Schwester die Verantwortung für seinen Haushalt übernahm. Nach dem schrecklichen Debakel mit Charlotte hatte er, verwirrt und niedergedrückt von seinen geheimen Schuldgefühlen, irgendwie nicht aufgepaßt, und Imogen war eine unübertroffene Meisterin darin, jede sich bietende Gelegenheit beim Schopf zu ergreifen, wenn es um ihren Bruder ging. Bevor er überhaupt richtig begriffen hatte, wie ihm geschah, waren sie und ihr gesamter Haushalt – einschließlich der unglaublich lästigen und unangenehmen Maude – in seinem Haus in The Strand einquartiert, da Imogen es als ihre Mission betrachtet hatte, ihren Bruder in seinem Kummer zu trösten und ihm den Haushalt zu führen. Und nun, fünf Jahre später, waren sie immer noch da.
Imogen war eine schwierige, temperamentvolle Frau, aber ihre eine, alles verzehrende Leidenschaft galt dem Wohlergehen ihres jüngeren Bruders. Nach dem Tode ihrer Mutter hatte sie sich des damals zehnjährigen Gareth angenommen, eine Aufgabe, die sie als lebenslängliche Verpflichtung anzusehen schien. Zwölf Jahre älter als er, hatte sie ihn mit einer innigen Zuneigung überschüttet, die kein anderes Ventil gefunden hatte ... und so war es noch immer. Ihr glückloser Ehemann mußte sich notgedrungen mit dem begnügen, was immer an Brosamen für ihn abfiel. Gareth sträubte sich zwar standhaft gegen diese schwesterliche Affenliebe, brachte es aber einfach nicht übers Herz, Imogen absichtlich zu verletzen. Oh, sicher, er kannte ihre Fehler durchaus: ihren maßlosen Ehrgeiz für die Familie Harcourt, der seinen Ursprung in ihren Ambitionen für ihren Bruder hatte, ihr hitziges, jähzorniges Wesen, ihre Rücksichtslosigkeit gegenüber ihren Bediensteten und ihren Angehörigen, ihre Extravaganz. Und dennoch konnte er sich nicht dazu überwinden, sie aus seinem Leben auszuschließen, wie er es zu gerne getan hätte.
In ihrem Eifer, für das Glück ihres Bruders zu sorgen, hatte Imogen sogar eine perfekte zukünftige Ehefrau für ihn gefunden, die an Charlottes Stelle treten sollte. Lady Mary Abernathy, eine kinderlose Witwe Ende Zwanzig, war eine untadelige Wahl. Eine untadelige Frau. Eine, die niemals einen Fehler machen würde, wie Imogen ihm erklärt hatte. Sie würde genau wissen, welche Aufgaben sie als Lady Harcourt zu erfüllen hätte, und Gareth würde niemals befürchten müssen, daß sie ihre Pflicht vernachlässigte.