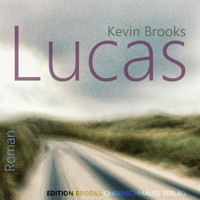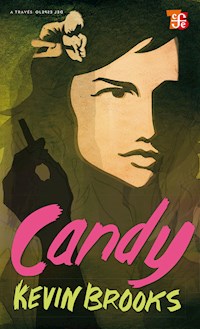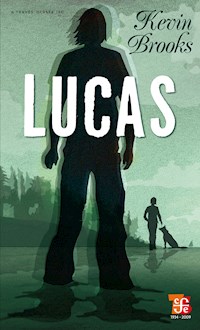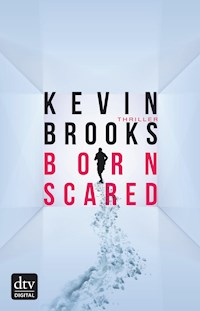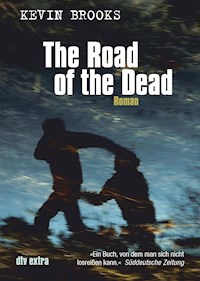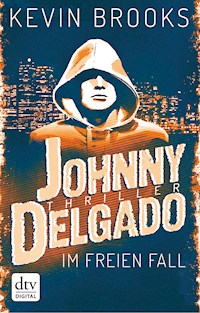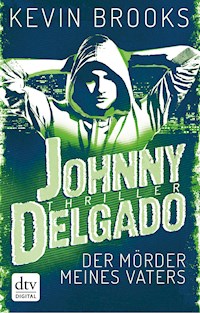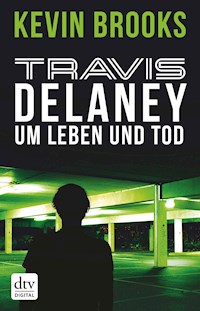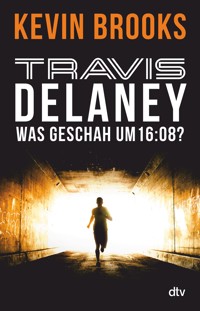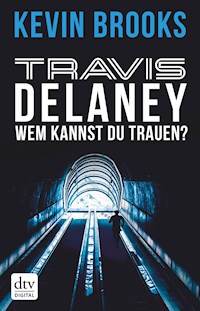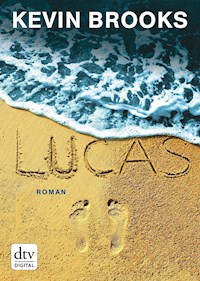
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Deutscher Jugendliteraturpreis 2006 Eine Geschichte über Liebe und Hass - und alles, was dazwischen liegt. Im Rückblick schreibt Caitlin die Geschichte des letzten Sommers auf – des Sommers, in dem Lucas auf ihre Insel kam und in dem die Welt ihrer Kindheit zerbrach. Während sie selbst vom ersten Moment an fasziniert ist von jenem Fremden, der schön ist und geheimnisvoll, von nirgendwoher zu kommen scheint und sich jeder Einordnung entzieht, reagieren die meisten Inselbewohner misstrauisch und vorurteilsvoll. Caitlin freundet sich mit Lucas an und beginnt sich sogar in ihn zu verlieben. Zugleich muss sie miterleben, wie ihm die Erwachsenen alle krummen Dinger in die Schuhe schieben wollen, die in der Gegend passieren, und wie die tonangebende Jugendclique ihn verspottet und verfolgt. Auch Caitlin selbst zieht nun Hass auf sich und gerät in Gefahr. Und es kommt immer schlimmer: Eben noch galt Lucas schlicht als unerwünschter Herumtreiber, dann unterstellt man ihm, er habe ein kleines Mädchen belästigt, das er in Wirklichkeit vorm Ertrinken gerettet hat. Als auf der Insel eine junge Frau ermordet in den Dünen gefunden wird, ist für Caitlin erschütternd klar, was passieren wird. Hat sie eine Chance, Lucas vor der gnadenlosen Hetzjagd zu schützen, die nun beginnt? Ausgezeichnet mit dem Buxtehuder Bullen Ausgezeichnet mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis 2006 (Jugendjury) Nominiert für den Gustav-Heinemann-Friedenspreis Auf der Empfehlungsliste der Besten 7 (Deutschlandfunk/Focus) im Juni 2005 Eule des Monats Juli 2005, verliehen vom Bulletin für Kinder- und Jugendliteratur
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 514
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Kevin Brooks
Lucas
Roman
Aus dem Englischen von Uwe-Michael Gutzschhahn
Für Susan –
für alles,
für immer
Es war mein Vater, der die Idee hatte, ich sollte über Lucas, Angel und alles andere, was im letzten Sommer passiert ist, schreiben. »Du wirst dich dadurch nicht besser fühlen«, sagte er, »vielleicht wird sogar eine Weile alles noch schlimmer. Aber du darfst nicht zulassen, dass die Traurigkeit in dir drinnen stirbt. Du musst ihr ein bisschen Leben gönnen. Du musst …«
»… alles rauslassen?«
Er lächelte. »So ungefähr.«
»Ich weiß nicht, Dad«, seufzte ich. »Ich bin mir nicht sicher, ob ich eine Geschichte schreiben kann.«
»Ach was, Unsinn. Jeder kann eine Geschichte schreiben. Es ist das Einfachste von der Welt. Was glaubst du, wie ich es sonst schaffen würde, damit mein Geld zu verdienen? Du musst nur die Wahrheit erzählen, genau so, wie es war.«
»Aber ich weiß nicht, wie es war. Ich kenne nicht alle Details, alle Fakten –«
»Geschichten sind keine Fakten, Cait, auch nicht Details. Geschichten sind Gefühle. Du hast doch deine Gefühle, oder etwa nicht?«
»Eher zu viele«, sagte ich.
»Na bitte, das ist alles, was du brauchst.« Er legte seine Hand auf meine. »Wein dir eine Geschichte, Kleines. Es geht. Glaub mir.«
Und genau das hab ich gemacht, ich habe mir eine Geschichte geweint.
Und das ist sie.
Caitlin McCann
Eins
Ich sah Lucas zum ersten Mal letzten Sommer an einem sonnigen Nachmittag Ende Juli. Natürlich wusste ich da noch nicht, wer er war … das heißt, wenn ich es mir genau überlege, wusste ich nicht einmal, was er war. Das Einzige, was ich vom Rücksitz des Wagens aus erkennen konnte, war eine grün gekleidete Gestalt, die im flimmernden Dunst der Hitze den Damm entlangtrottete; eine schmächtige, zerlumpte Person mit einem Wuschelkopf aus strohblondem Haar und einer Art zu gehen – ich muss immer noch lächeln, wenn ich dran denke –, einer Art zu gehen, als würde er der Luft Geheimnisse zuflüstern.
Wir waren auf dem Weg vom Festland zurück.
Dominic, mein Bruder, war bei Freunden in Norfolk gewesen, nachdem er einen Monat zuvor sein erstes Jahr an der Uni beendet hatte. Am Morgen hatte er angerufen, er sei auf dem Weg nach Hause. Sein Zug sollte um fünf ankommen und er hatte gefragt, ob wir ihn am Bahnhof abholen würden. Eigentlich hasst es Dad, gestört zu werden, wenn er schreibt (was er fast immer tut), und genauso hasst er es, irgendwohin zu müssen, aber wenn man mal vom üblichen Seufzen und Stöhnen absah – Warum kann der Junge kein Taxi nehmen? Was hat er gegen den verdammten Bus? –, dann konnte ich am Blitzen in seinen Augen erkennen, dass er sich ehrlich darauf freute, Dominic wiederzusehen.
Nicht dass Dad unglücklich war, die ganze Zeit mit mir zu verbringen, aber seit Dom an der Uni war, hatte er, glaube ich, das Gefühl, als fehle etwas in seinem Leben. Ich bin sechzehn (damals war ich fünfzehn) und Dad ist irgendwas über vierzig. Schwierige Alter – für uns beide. Erwachsen werden, erwachsen sein müssen, Mädchensachen, Männersachen, mit Gefühlen klarkommen, die keiner von uns versteht … das ist nicht leicht. Wir können einander nicht immer geben, was wir brauchen, egal wie sehr wir uns bemühen. Manchmal hilft es einfach, jemanden dazwischen zu haben, jemanden, an den man sich wenden kann, wenn einem die Dinge über den Kopf wachsen. Wenn sonst nichts, so war Dominic doch zumindest immer ein guter Vermittler gewesen.
Natürlich war das nicht der einzige Grund, warum Dad sich freute ihn wiederzusehen – Dominic war schließlich sein Sohn. Sein Junge. Er war stolz auf ihn. Er machte sich Sorgen um ihn. Er liebte ihn.
Ich auch.
Aber irgendwie war ich nicht ganz so aufgeregt ihn wiederzusehen wie Dad. Ich weiß nicht, warum. Nicht dass ich ihn nicht sehen wollte, ich wollte es ja. Es war nur … ich weiß auch nicht.
Irgendwas störte mich.
»Bist du fertig, Cait?«, hatte Dad gefragt, als es Zeit war aufzubrechen.
»Warum fährst du nicht allein?«, schlug ich vor. »Dann könnt ihr euch auf dem Rückweg mal so richtig ausquatschen zwischen Vater und Sohn.«
»Ach, komm, er will doch auch seine kleine Schwester wiedersehen.«
»Na gut, warte eine Sekunde. Ich hol eben Deefer.«
Dad hat fürchterliche Angst, allein zu fahren, seit Mum vor zehn Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Ich versuche ihn immer zu ermutigen, aber ich mag auch nicht zu sehr drängen.
Jedenfalls waren wir aufs Festland gefahren und hatten Dominic vom Bahnhof abgeholt, und da saßen wir nun alle – die ganze Familie McCann in unseren altersschwachen Fiesta gestopft, auf dem Weg zurück zur Insel. Dad und Dominic vorn, ich und Deefer auf der Rückbank. (Deefer ist übrigens unser Hund. Ein großes, schwarzes, übel riechendes Etwas mit einem weißen Streifen über dem einen Auge und einem Kopf groß wie ein Amboss. Dad behauptet immer, Deefer sei eine Mischung aus Stinktier und Esel.)
Dominic hatte, seit er seinen Rucksack in den Kofferraum geworfen und in den Wagen gestiegen war, nonstop geredet. Uni hier, Uni da, Schriftsteller, Bücher, Zeitschriften, Partys, Leute, Geld, Clubs, Konzerte … er unterbrach sich nur, wenn er eine Zigarette anzündete, was ungefähr alle zehn Minuten der Fall war. Und wenn ich sage Reden, dann meine ich nicht Sich-Unterhalten, sondern Brabbeln wie blöde. »… Ich sag dir, Dad, du würdest es verdammt nicht glauben … diese Idioten haben doch tatsächlich verlangt, dass wir EastEnders gucken, Himmel noch mal … Soll irgendwas mit Massenkultur zu tun haben, was immer das sein mag … Und noch so eine Sache, die allererste Vorlesung, ja? Ich sitze da, höre diesem schwachsinnigen alten Professor zu, der über Marxismus oder sonst irgendeinen Scheiß rumschwafelt, und denk mir meinen Teil. Plötzlich hört er auf zu reden, sieht mich an und fragt: ›Warum machen Sie sich keine Notizen?‹ Ich konnt’s nicht fassen. Warum machen Sie sich keine Notizen? Scheiße! Ich dachte, Uni hätte was mit freier Willensentscheidung zu tun, weißt du? Erziehung zur Mündigkeit und Eigenverantwortung, die Freiheit, im eigenen Tempo zu lernen …«
Und und und. In einer Tour immer so weiter.
Das gefiel mir nicht.
Die Art, wie er sprach, sein ständiges Fluchen, wie er seine Zigarette rauchte und mit den Händen herumwedelte wie ein Möchtegern-Intellektueller … es war nur peinlich. Ich fühlte mich unwohl – es war dieses Zusammenzucken vor Unbehagen darüber, dass jemand, den du gern hast und der dir nahe steht, plötzlich anfängt sich wie ein kompletter Idiot zu benehmen. Und es gefiel mir auch nicht, dass er mich so vollkommen ignorierte. Gemessen an der Aufmerksamkeit, die ich von ihm bekam, hätte ich auch gar nicht da sein können. Ich fühlte mich wie ein Fremder in unserem eigenen Auto. Erst kurz bevor wir die Insel erreichten, unterbrach sich Dominic, um Luft zu holen, drehte sich um, kraulte Deefers Kopf (»Hey, Deef«) und wandte sich an mich.
»Alles klar, Kleine? Wie läuft’s denn so?«
»Hallo, Dominic.«
»Was ist los? Du siehst anders aus. Verdammt, was hast du mit deinen Haaren gemacht?«
»Dasselbe wollte ich dich fragen.«
Er grinste und fuhr sich mit der Hand über den blond gefärbten Kurzhaarschnitt. »Gefällt’s dir?«
»Sehr schick. Surfermäßig. Sehen alle so aus in Liverpool?«
»Na ja, sie sehen jedenfalls nicht so aus«, sagte er und strich mir übers Haar. »Hübsch. Wie nennt sich der Stil – Igel?«
»Igel haben Stacheln«, erwiderte ich und richtete ein Haargummi gerade. »Das sind Puschel.«
»Puschel? Na klar.« Er paffte seine Zigarette. »Wie findest du es denn, Dad?«
»Ich finde, es steht ihr«, sagte Dad. »Und abgesehen davon hab ich lieber einen Igel in der Familie als einen Neonazi-Surfer.«
Dominic lächelte, während er weiter auf meine Haare schaute.
»Und was hält dein Liebster davon?«, fragte er.
»Wie bitte?«
»Simon«, sagte er. »Was meint Simon dazu?«
»Keine Ahnung.«
»Ihr habt euch doch nicht etwa getrennt, oder?«
»Oh, sei doch nicht so kindisch, Dominic. Simon ist bloß ein Freund –«
»In dem Glauben möchte er dich gern lassen.«
Ich stöhnte. »Mann, ich dachte, du würdest erwachsen, wenn du zur Uni gehst?«
»Ich doch nicht«, antwortete er und zog ein Gesicht. »Ich entwickle mich rückwärts.«
All die schlechten Erinnerungen an Dominic kamen langsam wieder hoch. Das Sticheln, die höhnischen Bemerkungen, dass er mich ständig auf den Arm nahm und wie ein dummes kleines Mädchen behandelte … Ich glaube, das war einer der Gründe, warum ich ein bisschen verhalten war über seine Rückkehr – ich wollte nicht mehr wie ein dummes kleines Mädchen behandelt werden, schon gar nicht von jemandem, der sich selbst nicht dem eigenen Alter entsprechend aufführte. Und die Tatsache, dass ich ein Jahr zugebracht hatte, ohne ständig wie ein Trottel behandelt zu werden, machte das Ganze noch schlimmer. Ich war es nicht mehr gewöhnt. Und wenn man etwas nicht gewöhnt ist, ist es noch schwerer, damit klarzukommen. Deshalb wurde ich langsam sauer.
Aber dann, gerade als ich dabei war, ernstlich wütend zu werden, reichte Dominic nach hinten und berührte ganz leicht meine Wange.
»Schön, dich zu sehen, Cait«, sagte er sanft.
Einen Moment war er wieder der Dominic, den ich kannte, bevor er volljährig wurde, der wahre Dominic, der, der auf mich aufpasste, wenn es nötig war, dass jemand auf mich aufpasste – mein großer Bruder. Aber fast im selben Augenblick zuckte er die Schultern und wandte sich ab, als wäre er sich selbst unangenehm, und das alte Großmaul Dom war wieder da.
»Hey Dad«, donnerte er los, »verdammt, wann besorgst du dir endlich ein neues Auto?«
»Und wozu brauche ich ein neues Auto?«
»Weil das hier ein verfluchter Schrotthaufen ist.«
Sehr freundlich.
Der Inselhimmel hat sein eigenes unverkennbares Licht, einen schillernden Glanz, der sich mit den Stimmungen der See verändert. Es ist nie gleich und doch immer gleich. Wenn ich es sehe, weiß ich jedes Mal, dass ich gleich zu Hause bin.
Zu Hause, das ist eine kleine Insel mit Namen Hale. Sie hat eine Länge von ungefähr vier Kilometern und bringt es an der breitesten Stelle auf zwei Kilometer. Mit dem Festland ist sie durch eine schmale Straße verbunden, die auf einem kurzen Damm das Mündungsgebiet des Flusses durchquert. Die meiste Zeit würde ein Fremder gar nicht merken, dass es ein Damm ist, und auch nicht glauben, dass Hale eine Insel ist, denn in der Regel ist die Mündung nichts als eine weite Fläche aus Reet und braunem Schlick. Aber bei Springflut, wenn das Wasser der Mündung etwa einen halben Meter über die Straße steigt und niemand mehr rüberkann, bis die Ebbe einsetzt, dann weiß man, es ist eine Insel.
Aber als wir an jenem Freitagnachmittag die Mündung erreichten, war Ebbe und der Damm lag klar und trocken in der flimmernden Hitze vor uns – ein erhöhter Streifen blassgrauer Beton, begrenzt von weißen Geländern, unterhalb davon auf beiden Seiten ein Fußweg und Kopfsteinpflaster als Uferbefestigung bis hinunter ins Wasser. Hinter den Geländern glänzte die Mündung in diesem wunderbaren silbernen Licht, das nachmittags aufkommt und bis zum frühen Abend anhält.
Wir waren halb über den Damm, als ich Lucas sah.
Ich erinnere mich ziemlich genau an den Moment: Dominic lachte gerade dröhnend über irgendetwas, das er gesagt hatte, und tastete dabei seine sämtlichen Taschen ab auf der Suche nach einer neuen Zigarette; Dad versuchte, so gut er konnte, amüsiert zu wirken und zog müde an seinem Bart; Deefer saß wie immer kerzengerade in seiner Ich-bin-einsehr-ernster-Hund-in-einem-Auto-Pose und blinzelte nur ab und zu mal; ich hatte mich zur Seite gelehnt, um den Himmel besser sehen zu können. Nein … das kriege ich besser hin. Ich erinnere exakt meine Haltung. Ich saß leicht rechts von der Mitte der Rückbank, die Beine übereinander geschlagen und ein wenig nach links gebeugt, um über Dominics Schulter hinweg durch die Windschutzscheibe zu sehen. Den linken Arm hatte ich ausgestreckt und um Deefers Rücken gelegt, die Hand ruhte auf seiner Decke, die voller Staub und Hundehaare war. Mit der rechten Hand hielt ich mich am Rahmen des offenen Fensters fest, damit ich mehr Halt hatte. Ich erinnere alles noch ganz genau. Das Gefühl des heißen Metalls in meiner Hand, die Gummileiste, den kühlenden Wind auf den Fingern …
Das war der Moment, als ich ihn zum ersten Mal sah – eine einsame Gestalt am äußersten Ende des Damms, auf der linken Straßenseite, mit dem Rücken zu uns, unterwegs zur Insel.
Abgesehen vom Wunsch, Dominic möge endlich aufhören so laut herumzublöken, war mein erster Gedanke: Wie seltsam, jemanden über den Damm gehen zu sehen. Leute, die zu Fuß unterwegs sind, gibt es hier selten. Die nächste Stadt ist Moulton (wo wir gerade herkamen), ungefähr fünfzehn Kilometer weit weg auf dem Festland; zwischen Hale und Moulton gibt es nichts außer kleinen Ferienhäusern, Bauernhöfen, Heideland, Viehweiden und ein, zwei abgelegenen Pubs. Deshalb gehen die Inselbewohner nie zu Fuß, es gibt einfach nichts in der Nähe, wohin man laufen könnte. Und wenn man nach Moulton will, fährt man entweder mit dem Auto oder nimmt den Bus. Daher sind die einzigen Fußgänger, mit denen man hier in der Gegend rechnen kann, Wanderer, Vogelliebhaber, Wilddiebe oder, ganz selten, Leute wie ich, die einfach gern laufen. Doch selbst aus der Entfernung konnte ich erkennen, dass die Gestalt da hinten in keine dieser Kategorien passte. Ich war mir nicht ganz im Klaren, warum, aber ich wusste es. Deefer wusste es auch. Er hatte die Ohren gespitzt und blinzelte neugierig durch die Windschutzscheibe.
Als wir näher kamen, konnte ich die Gestalt besser wahrnehmen. Es war ein junger Mann oder ein Junge, lässig angezogen mit graugrünem T-Shirt und ausgebeulter grüner Hose. Er hatte sich eine Armyjacke um die Taille gebunden und eine grüne Leinentasche über die Schulter geworfen. Das Einzige an ihm, was nicht grün war, waren die zerschlissenen schwarzen Boots an seinen Füßen. Auch wenn er eher klein wirkte, war er doch nicht so schmächtig, wie ich anfangs gedacht hatte. Er war zwar nicht unbedingt muskulös, aber er sah auch nicht eben schwächlich aus. Es ist schwer zu erklären. Er besaß so etwas wie eine verborgene Kraft, eine anmutige Stärke, die sich in seiner Ausgeglichenheit zeigte, in seiner Haltung, in der Art, wie er ging …
Wie ich schon sagte, wenn ich an Lucas’ Gang denke, muss ich jedes Mal lächeln. Ich habe diesen Gang noch unglaublich lebendig in Erinnerung; sobald ich meine Augen schließe, sehe ich ihn genau vor mir. Ein lockeres Traben. Schön und stetig. Nicht zu schnell und nicht zu langsam. Schnell genug, um irgendwo hinzukommen, aber nicht so schnell, dass er unterwegs etwas verpassen würde. Federnd, lebhaft, entschlossen, unbeschwert und ohne Eitelkeit. Ein Gang, der sich in alles, was ihn umgab, einfügte und doch von allem unberührt blieb.
Man kann an der Art, wie Menschen gehen, viel über sie erfahren.
Als der Wagen noch näher herankam, merkte ich, dass Dad und Dominic aufgehört hatten zu reden, und ich war mir plötzlich einer eigenartigen, fast geisterhaften Stille bewusst, die in der Luft lag, nicht nur im Auto, sondern auch draußen. Die Vögel hatten aufgehört zu singen, der Wind hatte sich gelegt und der Himmel am Horizont hatte sich zum strahlendsten Blau aufgehellt, das ich je gesehen habe. Es war wie in einer dieser Filmszenen in Zeitlupe, die in absoluter Stille ablaufen, wenn einem die Haut anfängt zu prickeln und man einfach weiß, dass jeden Moment etwas Gewaltiges passieren wird.
Dad fuhr mit mehr oder weniger gleich bleibender Geschwindigkeit, wie er das immer tut, aber jetzt schien es, als würden wir uns kaum bewegen. Ich konnte die Reifen auf der trockenen Straße summen hören und die Luft, die am Fenster vorbeisauste, und ich konnte die Geländer auf beiden Seiten in verschwommenem Weiß vorbeizucken sehen, daher wusste ich, dass wir uns bewegten, aber die Entfernung zwischen uns und dem Jungen schien sich nicht zu verändern.
Es war unheimlich. Fast wie ein Traum.
Dann, mit einem Mal, schienen Zeit und Entfernung wieder voranzutaumeln und wir fuhren auf gleiche Höhe mit dem Jungen. Als es so weit war, wandte er seinen Kopf und sah uns an. Nein, das ist falsch – er wandte seinen Kopf und sah mich an. Genau mich. (Als ich vor kurzem mit Dad darüber sprach, sagte er, er hätte genau das gleiche Gefühl gehabt – dass Lucas ihn ansah, als wäre er die einzige Person auf der ganzen Welt.)
Es war ein Gesicht, das ich nie vergessen werde. Nicht einfach wegen seiner Schönheit – obwohl Lucas ohne jeden Zweifel schön war –, sondern mehr wegen seines wunderlichen Ausdrucks, jenseits von allem zu sein. Jenseits der blassblauen Augen, der zerzausten Haare und des traurigen Lächelns … jenseits all dessen gab es noch etwas anderes.
Etwas …
Ich weiß noch immer nicht, was es war.
Dominic brach den Bann, indem er aus dem Fenster starrte und stöhnte: »Was ist das denn für einer, verdammt?«
Und dann war der Junge fort, vorübergesaust in den Hintergrund, während wir den Damm verließen und abdrehten Richtung Osten der Insel.
Ich wollte zurückschauen. Ich war wild entschlossen zurückzuschauen. Aber ich konnte nicht. Ich hatte Angst, dass er vielleicht nicht mehr da war.
Der Rest der Fahrt hatte etwas von einem verschwommenen Bild. Ich erinnere mich, dass Dad ein eigenartiges schniefendes Geräusch machte und mich im Spiegel ansah, dann räusperte er sich und fragte, ob mit mir alles in Ordnung sei.
Und ich weiß noch, wie ich antwortete: »Hm hmm.«
Und dass Dominic fragte: »Kennst du ihn, Cait?«
»Wen?«
»Den Gammeltypen, den kleinen Lump … dieses komische Etwas, das du da eben angestarrt hast.«
»Halt die Klappe, Dominic.«
Er lachte und äffte mich nach – »Halt die Klappe, Dominic.« – und dann wechselte er das Thema.
Ich erinnere mich, wie Dad einen Gang herunterschaltete und danach den Wagen in einem seltenen Ausbruch von Vertrauen den Black Hill hochjagte, und ganz vage erinnere ich noch, dass wir an dem Schild Beware Tractors, zu Deutsch: Vorsicht, Traktoren, vorbeifuhren, von dem allerdings die beiden Buchstaben T und r durch eine Hecke verdeckt sind, sodass man liest: Beware actors – Vorsicht, Schauspieler. Jedes Mal, wenn wir dran vorbeifahren, sagt einer von uns: Guck mal, John Wayne! Oder Hugh Grant oder Brad Pitt … Aber ich erinnere mich nicht, wer es an dem Nachmittag sagte.
Ich war eine Zeit lang irgendwo anders.
Wo, weiß ich nicht.
Alles, woran ich mich erinnere, ist ein seltsames Schwirren in meinem Kopf, eine derart intensive Erregung und Trauer, wie ich sie noch nie zuvor erlebt hatte und vielleicht auch nie wieder spüren werde.
Es war, als ob ich gewusst hätte – da schon –, was passieren würde.
Während des letzten Jahres habe ich mich oft gefragt, was gewesen wäre, wenn ich Lucas an dem Tag nicht gesehen hätte. Wenn wir den Damm zehn Minuten früher überquert hätten oder zehn Minuten später. Wenn Dominics Zug Verspätung gehabt hätte. Wenn Flut gewesen wäre. Wenn Dad auf dem Rückweg noch tanken gefahren wäre. Wenn Lucas, wo immer er herkam, einen Tag früher oder später aufgebrochen wäre …
Was wäre passiert? Wäre alles anders gekommen? Wäre ich jetzt, in diesem Moment, eine andere Person? Wäre ich glücklicher? Trauriger? Würde ich andere Träume haben? Und was wäre mit Lucas? Was wäre mit Lucas passiert, wenn ich ihn an dem Tag nicht gesehen hätte? Würde er noch …
Und dann merke ich immer, wie völlig sinnlos solche Gedanken sind. Was, wenn … was hätte sein können …
Es spielt keine Rolle.
Ich habe ihn gesehen und nichts wird daran je etwas ändern.
Diese Dinge, diese Momente, die man für außergewöhnlich hält, sie haben so eine Fähigkeit, wieder zurück in die Wirklichkeit zu schmelzen, und je weiter wir uns von dem Damm entfernten – je weiter wir uns von dem Moment entfernten –, desto weniger kribbelig fühlte ich mich. Als wir in den schmalen Weg einbogen, der hinunter zu unserem Haus führt, war das Schwirren in meinem Kopf so gut wie weg und die Welt wieder in etwa bei Normal angekommen.
Der Wagen polterte den Weg entlang und ich schaute hinaus auf das vertraute Bild: die Pappeln im Sonnenlicht, das immer wieder zwischen den Zweigen aufblitzte; die grünen Felder; die holperige Zufahrt; dann das alte graue Haus, wie es friedlich und einladend im kühler werdenden Sonnenlicht lag; und hinter allem der Strand und das Meer, das in der Weite des Abends funkelte. Außer einem einsamen Containerschiff, das langsam am Horizont auftauchte, lag das Meer ganz still und leer da.
Dad hat mir einmal erzählt, dass ihn dieser Teil von Hale, die Ostseite, an seine Kindheit zu Hause in Irland erinnere. Ich bin nie in Irland gewesen, also kann ich nichts dazu sagen. Aber ich weiß, dass ich alles an diesem Ort liebe – den Frieden, die Wildnis, die Vögel, den Geruch von Salz und Seetang, das Pfeifen des Windes, die Unberechenbarkeit des Meers … ich liebe sogar dieses abgelegene alte Haus mit seinem verwitterten Dach und seinen unebenen Mauern, seinem Wirrwarr von Anbauten und baufälligen Schuppen. Vielleicht ist es ja nicht das schönste Haus der Welt, aber es ist meins. Der Ort, wo ich lebe. Ich bin hier geboren.
Ich gehöre hierher.
Dad stellte den Wagen im Hof ab und schaltete den Motor aus. Ich öffnete die Tür. Deefer sprang hinaus und bellte Rita Gray, unsere Nachbarin, an, die mit ihrem Labrador den Weg entlangkam. Ich stieg aus dem Wagen und winkte ihr. Gerade als sie zurückwinkte, kamen zwei Höckerschwäne landeinwärts über ein Feld geflogen – niedrig, man hörte ihre Flügel im Wind schlagen. Die Labrador-Hündin lief ihnen hinterher und bellte wie blöde.
»Die kriegt sie doch sowieso nicht«, rief Dad.
Rita zuckte die Schultern und lächelte. »Aber es tut ihr gut, John, sie braucht es als Training – oh, hallo, Dominic, ich hab dich gar nicht erkannt.«
»Hi, Mrs G.«, antwortete Dominic und schlurfte ins Haus.
Die Labrador-Hündin war inzwischen den halben Weg hinuntergelaufen, die Zunge hing ihr heraus und sie kläffte den leeren Himmel an.
Rita schüttelte den Kopf und stöhnte. »Verdammter Hund, ich weiß nicht, warum sie – oh, Cait, ehe ich es vergesse, Bill hat gefragt, ob du sie wegen morgen mal anrufst.«
»Okay.«
»Sie wird so etwa bis neun zu Hause sein.«
»In Ordnung, danke.«
Sie nickte Dad zu, dann schritt sie davon den Weg hinunter, ihrem Hund hinterher. Sie pfiff und lachte und schwang die Hundeleine durch die Luft. Ihr rotes Haar wehte im Wind.
Ich merkte, dass Dad sie beobachtete.
»Was ist?«, sagte er, als er spürte, dass ich ihn ansah.
»Nichts«, antwortete ich lächelnd.
Drinnen hatte Dominic seinen Rucksack auf den Boden geworfen und stapfte die Treppe hinauf. »Ruf mich, wenn es was zu futtern gibt«, sagte er noch. »Ich hau mich nur schnell mal ’ne Runde hin. Bin echt geschafft.«
Die Tür zu seinem Zimmer schlug zu.
Es war ein merkwürdiges Gefühl, noch jemanden im Haus zu haben. Seine Anwesenheit machte mich nervös. Ich glaube, ich hatte mich dran gewöhnt, mit Dad allein zu leben. Mit unseren Geräuschen, unserer Stille. Ich hatte mich an die Ruhe und Einsamkeit gewöhnt.
Dad hob Dominics Rucksack auf und lehnte ihn gegen die Treppe. Er lächelte mich beruhigend an und sagte, als könne er meine Gedanken lesen: »Er ist einfach ein großes Kind, Cait. Er meint es nicht böse.«
»Ja, ich weiß.«
»Das wird schon. Mach dir keine Sorgen.«
Ich nickte. »Willst du was essen?«
»Jetzt noch nicht, hm? Lass ihn ein paar Stunden schlafen, dann essen wir alle zusammen.« Er beugte sich herab und zupfte an meinen Haaren. »Puschel, sagst du?«
»Puschel«, bestätigte ich.
Dann rückte er ein Haargummi zurecht, trat zurück und sah mich an. »Steht dir gut, ehrlich.«
»Danke«, sagte ich grinsend. »Du siehst auch nicht so schlecht aus. Hast du gemerkt, wie Rita dich angeschaut hat?« »Die schaut doch jeden so an. Sie ist noch schlimmer als ihre Tochter.«
»Rita fragt sogar jedes Mal extra nach dir, weißt du das?«
»Lass das, Cait –«
»Ich mach doch nur Spaß, Dad«, sagte ich. »Jetzt schau nicht so besorgt.«
»Wer ist hier besorgt?«
»Du. Du machst dir ständig Sorgen um alles.«
Wir plauderten noch ein paar Minuten weiter, aber ich wusste, er wollte zurück an seine Arbeit. Immer wieder schaute er auf die Uhr.
»Ich werd erst mal Bill anrufen«, sagte ich ihm. »Und dann geh ich ein bisschen mit Deefer raus. Wenn ich zurückkomme, mach ich was zu essen.«
»Okay«, sagte er. »Ich glaube, ich arbeite noch ein paar Stunden weiter, solange es geht.«
»Wie kommst du denn mit dem neuen Buch voran?«
»Ach, weißt du, immer die alte Geschichte …« Einen Moment stand er einfach nur da, schaute zu Boden, rieb sich den Bart und ich dachte, er würde mir etwas erzählen, ein paar von seinen Problemen mit mir teilen. Aber nach einer Weile seufzte er bloß wieder und sagte: »Also, dann mach ich jetzt mal besser weiter – sieh zu, dass du wieder zurück bist, bevor es dunkel ist. Ich seh dich später, Kleines.« Und damit verschwand er gebeugt in sein Arbeitszimmer und schloss die Tür.
Dad schreibt Bücher für Jugendliche oder junge Erwachsene, wie die Buchhändler gern sagen. Wahrscheinlich hast du schon mal von ihm gehört. Vielleicht hast du ja sogar eines seiner Bücher gelesen: So eine Art Gott; Nichts wird jemals sterben; Neue Welt … Nein? Na ja, selbst wenn du die Bücher nicht gelesen hast, über sie hast du bestimmt schon gelesen. Es sind solche, die für Preise nominiert werden, sie aber nie gewinnen, solche, die von den Zeitungen verrissen werden, weil sie angeblich unmoralisch sind, ein schlechtes Beispiel geben und die Unschuld unserer Jugend zerstören. In jedem Fall sind es Bücher, mit denen man nicht besonders viel Geld verdient.
Bill aß gerade, als sie den Hörer abnahm. »Mm-ja?«
»Bill? Ich bin’s, Cait.«
»Einen Mm – warte mal eben …« Ich hörte den Fernseher im Hintergrund plärren, während Bill kaute, schluckte und rülpste … »So«, sagte sie. »Örrps – ’tschuldigung.«
»Deine Mum hat gesagt, ich soll dich anrufen. Ich hab sie auf dem Weg getroffen.«
»Ja, ich dachte schon, die kommt gar nicht mehr in die Puschen – warte mal eben …«
»Bill?«
»So ist es besser, ich muss dringend eine rauchen. Wie geht’s dir?«
»Gut.«
»Ich hab gesehen, wie du im Auto nach Hause gekommen bist. Wo warst du?«
»Dom abholen.«
»Hey, erzähl mal.«
»Ach, komm, Bill …«
»Was ist?«
»Das weißt du genau. Mensch, er ist neunzehn.«
»Na und?«
»Du bist fünfzehn …«
»Mädchen sind eben früher reif als Jungen, Cait. Das ist allgemein bekannt.«
»So? Na, du ganz bestimmt.«
Sie lachte. »Kann ich was dazu, dass meine Hormone so viel Hunger haben?«
»Vielleicht solltest du auf Diät gehen.«
»Pah!«
»Egal, Dom hat eine Freundin.«
»Wen?«
»Weiß ich nicht, jemanden an der Uni, nehme ich an.« Blitzschnell entwarf ich ein Bild in meinem Kopf. »Eine große Blonde mit langen Beinen und tonnenweise Geld.«
»Das sagst du doch bloß.«
»Nein, echt nicht. Sie heißt Helen, wohnt irgendwo in Norfolk –«
»Da hast du’s.«
»Was?«
»Sie wohnt in Norfolk – ich zwei Minuten von euch. Das sagt doch alles.«
Sie lachte wieder, dann legte sie die Hand auf die Muschel und sprach mit jemandem im Hintergrund.
Ich spielte mit der Telefonschnur zwischen meinen Fingern und wischte ein Spinnennetz von der Wand. Dann schlenkerte ich mit dem Fuß. Ich sagte mir: Ignorier es, vergiss es, lass es nicht an dich ran … aber ich schaffte es nicht. Die Sache mit Bill und Dominic fing an mir aus den Händen zu gleiten. Am Anfang war es lustig gewesen: Lieber Dr.Sommer, meine beste Freundin ist verliebt in meinen großen Bruder, was soll ich tun? Ja, es war lustig gewesen, als Bill zehn und Dominic vierzehn war. Aber jetzt war es überhaupt nicht mehr lustig, weil Bill es nicht mehr als Witz meinte. Sie meinte es wirklich. Und das machte mir Sorgen. Das Dumme war, wenn ich ihr erzählte, was ich wirklich davon hielt, würde sie bloß drüber lachen. Sie würde sagen: Ach, komm, Cait, sei doch nicht immer so schrecklich ernst, es ist doch nur ein kleiner Spaß …
Deshalb ließ ich es, egal ob richtig oder falsch, einfach weiterlaufen.
»Cait?«
»Ja, wer war das?«
»Was?«
»Ich dachte, du hättest mit jemandem gesprochen.«
»Nein, ist bloß die Glotze. Hab sie nur leiser gestellt. Egal, bleibt es bei morgen?«
»Wie viel Uhr?«
»Wir treffen uns um zwei an der Bushaltestelle –«
»Warum soll ich nicht bei euch vorbeikommen? Wir können doch zusammen zum Bus gehen.«
»Nein, ich muss noch vorher woandershin. Wir treffen uns um zwei.«
»Der Bus fährt um zehn vor.«
»Gut, dann Viertel vor. Was ziehst du an?«
»Anziehen? Ich weiß nicht, nichts Besonderes – wieso?«
»Ach, nichts, ich dachte nur, wir donnern uns zur Abwechslung mal ein bisschen auf.«
»Aufdonnern?«
»Du weißt schon. Rock, Absätze, hautenges Top …«
Ich musste lachen. »Wir fahren doch nur nach Moulton.«
»Ja, aber … du siehst echt gut aus, wenn du dich zurechtmachst. Solltest du öfter tun. Du kannst nicht andauernd diese abgetragenen Shorts und ein T-Shirt anziehen.«
»Tu ich doch gar nicht.«
»Tust du wohl. Shorts und T-Shirt im Sommer, Jeans und Pulli im Winter –«
»Was ist daran falsch?«
»Nichts – was ich nur sagen will: Ab und zu muss man auch mal ein bisschen Aufwand treiben. Bisschen Beine zeigen, bisschen Bauch, bisschen Lippenstift draufknallen, verstehst du …«
»Mal sehen. Vielleicht …«
»Ach, komm, Cait. Es wird lustig.«
»Ich hab gesagt, vielleicht.«
»Man weiß ja nie, vielleicht reißen wir einen echt geilen Typen auf … Was macht eigentlich Dom morgen? Ratatazong, Dom.«
»Mensch, Bill.«
»Upps – ich muss auflegen. Ich glaube, Mum ist wieder da, und ich hab immer noch die Fluppe brennen. Wir treffen uns morgen um zwei.«
»Viertel vor – Bill?« Aber sie war schon aus der Leitung.
Ich legte den Hörer auf und ging in die Küche. Das Haus war still. Schwache Geräusche trieben durch die Stille – das angenehme Tap-tap von Dads Tastatur, das Brummen eines Flugzeugs hoch oben am Himmel, der ferne Schrei einer einsamen Möwe. Durch das Fenster sah ich das Containerschiff um den Point fahren – schwer beladen mit bunten Stahlcontainern. Der Himmel darüber bewölkte sich ein bisschen, aber die Sonne schien immer noch warm und hell und tauchte die Insel in einen rosa Schein.
Ich mag diese Tageszeit. Wenn das Licht sanft glüht und die Luft ein Gefühl von Schläfrigkeit verbreitet – dann scheint es, als ob die Insel nach einem langen, schweren Tag ausatmen und sich für die Nacht bereitmachen würde. Im Sommer sitze ich oft Stunden in der Küche und schaue zu, wie der Himmel seine Farbe ändert, während die Sonne untergeht, aber an diesem Abend fand ich keine Ruhe. Ich nehme die Dinge zu schwer, genau wie Dad. Ich machte mir Sorgen um ihn. Ich machte mir Sorgen um Dominic, dass er sich im letzten Jahr so sehr verändert hatte. Und der Junge auf dem Damm … es machte mir Sorgen, wieso ich nicht aufhören konnte an ihn zu denken … und Bill … ich wünschte mir, ich hätte sie nicht angerufen. Ich wünschte mir, wir würden morgen nicht in die Stadt fahren. Ich wünschte mir … ich weiß nicht, was. Ich wünschte mir, ich müsste nicht erwachsen werden. Das Ganze war einfach zu deprimierend.
Ich rief nach Deefer und lief den Fußweg hinunter.
Das Problem mit Dad ist, er hat zu viel Traurigkeit in den Knochen. Man kann das an der Art erkennen, wie er geht, wie er seine Umgebung ansieht und sogar daran, wie er sitzt. Als ich an jenem Abend das Haus verließ, schaute ich hinüber zum Fenster seines Arbeitszimmers und sah ihn, über den Schreibtisch gebeugt, in seinen Bildschirm starren, eine Zigarette rauchen und irischen Whiskey schlürfen. Er sah so traurig aus, dass ich hätte heulen können. Es war dieser unverhüllte Blick der Trauer, den man selten sieht, der Blick eines Menschen, der sich alleine glaubt.
Es ist natürlich wegen Mum. Seit sie tot ist, ist er mit seiner Traurigkeit allein. Nicht dass er mit mir nie über Mum spräche – das tut er schon. Er erzählt mir, wie wunderbar sie war, wie schön sie war, wie freundlich, wie fürsorglich, wie lustig – »Gott, Cait, wenn Kathleen lachte, dann ging dir das Herz auf.« Er erzählt mir, wie glücklich sie zusammen waren. Er zeigt mir Fotos, liest mir ihre Gedichte vor, erzählt mir, wie sehr ich ihn an sie erinnere … er erzählt mir, wie traurig er ist. Aber er wird nie seinen eigenen Rat befolgen – nie seiner Traurigkeit ein bisschen Leben gönnen.
Ich weiß nicht, warum.
Manchmal denke ich, es ist deshalb, weil er will, dass die Traurigkeit in ihm drinnen stirbt. Dass er sie, wenn sie bei ihm drinnen stirbt, von mir fern hält. Aber was er nicht merkt, ist, dass ich gar nicht von seiner Traurigkeit ausgeschlossen sein will. Ich will auch ein Stück von ihr. Ich will sie ebenfalls spüren. Kathleen war meine Mutter. Ich habe sie kaum gekannt, aber das Mindeste, was er tun könnte, wäre mich teilhaben lassen an ihrem Sterben.
Ich weiß nicht, ob das irgendwie Sinn macht.
Ich weiß nicht mal, ob es wahr ist.
Aber das war es, was ich dachte.
Unten an der schmalen Gezeitenbucht, die sich tief ins Land hineinschiebt, war Deefer auf die kleine Holzbrücke spaziert und starrte eine Schwanenfamilie an – ein Elternpaar und drei große Jungschwäne. Einer der Eltern machte ein großes Getöse, um seine Brut zu verteidigen, er näherte sich Deefer mit ausgebreiteten Flügeln, gebogenem Hals und lautem Zischen. Deefer blieb völlig unbeeindruckt. Er kennt das alles. Deshalb stand er einfach nur da, starrte hinüber und wedelte leicht mit dem Schwanz. Ein paar Minuten später gab der Schwan auf, schüttelte den Kopf und paddelte zurück zu seiner Familie.
Die schmale Bucht folgt einer Senke, die parallel zum Strand verläuft und sich die ganze Strecke entlang von der Mitte der Insel bis zum Watt gegenüber dem Point erstreckt. Zwischen Bucht und Strand gibt es eine ausgedehnte Salzwiesenfläche, einen blassgrünen Teppich aus Seespargel und Portulak, der mit zahllosen moorigen, von Schilf und Binsen gesäumten Tümpeln übersät ist. Wenn man sich auskennt wie ich, gibt es kleine Pfade durch die Salzwiesen, die direkt hinüber zum Strand führen. Andernfalls muss man den ganzen Weg an der schmalen Bucht entlang bis zum westlichen Ende des Strands laufen, da wo die Salzwiesen ins Ufer übergehen, oder aber man läuft quer durch ein Labyrinth aus Dünen und Ginster nach Osten und folgt dem Weg bis zu der breiten, flachen Bucht neben dem Watt.
Ich rief Deefer, wir überquerten die Salzwiesen und erreichten den Strand bei dem alten Betonbunker. Als wir hinunter ans Wasser gingen, frischte der Seewind auf und würzte die Luft mit einer Mischung aus Salz und Sand und unbekannten Dingen, die nur Hunde riechen können. Während Deefer loszog und den Kopf in den Wind streckte, um die Geschichten seiner Welt zu erschnuppern, blieb ich einen Moment stehen und lauschte auf die Geräusche des Meers. Die Wellen, die sanft auf den Strand lappten, der Wind in der Luft, der knirschende Sand, die Seevögel … und unter alldem, oder auch über alldem, das leise Knistern des Watts neben dem Point.
Der Point ist das östlichste Ende der Insel, ein dünner Finger aus Kieseln, auf der einen Seite vom Meer, auf der andern vom Watt begrenzt. Wenn Ebbe ist, kann man dort die Überreste alter Schiffe sehen, die hinabgezogen wurden in die Tiefen. Wie Skelette längst verendeter Tiere ragen ihre freigelegten, schwarz gewordenen Gerippe aus dem Schlamm und warnen eindringlich vor den Gefahren, die im Schlick lauern. Jenseits des Watts liegt ein zerklüftetes Inselchen in der sich öffnenden Mündung, verschattet vom Gewirr eines verkümmerten kleinen Waldes. Die kleine Insel erhebt sich in einer eindrucksvollen Mischung aus Schönheit und Drohung über die Küste, denn die Äste ihrer vertrockneten Bäume sind von Wind und Flut in merkwürdige ausgreifende Formen gebogen, wie missgebildete Hände, die sich nach Hilfe recken.
Selbst im Hochsommer ist dieser Teil des Strands gewöhnlich menschenleer. Besucher der Insel bleiben im Allgemeinen auf der Westseite, der Dorfseite, wo der Sand fein ist und es genügend Parkplätze gibt. Dort liegt auch der »Country Park« (eine Wiese mit Abfalleimern), man kann Klippenwanderungen machen und Drachen steigen lassen, es gibt einen Eiswagen und einen Musikpavillon – es bestehen sogar Pläne, dort einen Wohnwagenpark zu eröffnen. Es ist eine andere Welt. Hier im Osten der Insel sind die einzigen Menschen, mit denen man rechnen kann, Einheimische, Angler, Leute mit Hunden, ab und zu mal einer von diesen Anoraktypen, die mit einem Metalldetektor herumlaufen, und manchmal, spät in einer Sommernacht, heimliche Liebespaare in den Dünen.
An dem Abend aber, als das Licht langsam schwand, war der Strand leer. Eine starke Brise wehte von See her und die Temperatur sank allmählich. Es würde nicht mehr lange dauern, bis die Kälte der Nacht hereinbräche, und alles, was ich anhatte, war – wie Bill so freundlich gesagt hatte – ein T-Shirt und ein paar abgetragene Shorts. Während ich mir die Arme rieb, rief ich wieder nach Deef, machte mich auf und ging schnellen Schrittes den Strand entlang Richtung Point.
Ohne es recht zu wollen, fing ich an über den Jungen auf dem Damm nachzudenken. Ich fragte mich, wer er war, wohin er unterwegs war, was er hier vorhatte … Ich baute mir im Kopf Geschichten zurecht. Er war der Sohn eines Inselbewohners, stellte ich mir vor, der eine Zeit lang weg gewesen war, vielleicht beim Militär, möglicherweise sogar im Gefängnis, und jetzt kam er wieder nach Hause. Sein Vater war ein weißhaariger alter Mann, der allein in einer winzigen alten Fischerkate wohnte. Er hatte wahrscheinlich den ganzen Tag geputzt, etwas Gutes zu essen besorgt und die Kammer für seinen Jungen gerichtet …
Nein, dachte ich. Der Junge ist nicht alt genug, um beim Militär gewesen zu sein. Wie alt wird er sein? Fünfzehn, sechzehn, siebzehn? Ich rief mir sein Gesicht in Erinnerung und – verflucht – mein Herz setzte doch tatsächlich einen Schlag aus. Diese blassblauen Augen, die zerzausten Haare, dieses Lächeln … ich sah das alles ganz deutlich vor mir. Aber das Merkwürdige war, egal wie sehr ich mich in Gedanken mit dem Gesicht beschäftigte, es ließ sich unmöglich sagen, wie alt der Junge war. Im einen Moment wirkte er wie dreizehn, im nächsten war er ein junger Mann – achtzehn, neunzehn, zwanzig …
Sehr merkwürdig.
Aber wie auch immer, ich entschied mich, er sei nicht der Sohn eines Inselbewohners. Er sah einfach nicht so aus. Inselbewohner – und die Nachkommen der Inselbewohner – haben ein ganz typisches Aussehen. Sie sind klein und dunkel, haben heruntergezogene Augenlider und drahtiges Haar, das dem Wind standhält, und selbst wenn sie nicht klein und dunkel sind, keine heruntergezogenen Augenlider und auch kein drahtiges Haar haben, sehen sie trotzdem so aus. Der Junge war kein Inselbewohner. Das Gesicht, das ich im Kopf hatte, war nicht vom Wind gegerbt. Das Gesicht, das ich im Kopf hatte, gehörte einem Jungen von nirgendwoher.
Ob er Arbeit braucht?, überlegte ich. Oder sucht er jemanden? Ein Mädchen, seinen geliebten Schatz – oder vielleicht einen Feind? Jemanden, der ihn betrogen hat. Jemanden, der ihn in seinem Stolz verletzt hat. Er ist landauf, landab gereist auf der Suche nach …
Ich unterbrach mich, als mir bewusst wurde, was ich mir da zurechtträumte. Mein Gott, Caitlin, sagte ich mir. Was um Himmels willen tust du da? Schatz? Feind? Ehre? Das sind Kitschroman-Fantasien. Wie peinlich. Guck dich mal an. Du führst dich auf wie ein dummes kleines Mädchen, das wegen eines dämlichen Popstars in Ohnmacht fällt. Meine Güte, reiß dich zusammen. Werd endlich erwachsen, werd endlich erwachsen, werd endlich erwachsen, werd endlich erwachsen …
Ich schüttelte den Kopf und ging weiter.
Es ist schwer, über das Erwachsenwerden nachzudenken, wenn du mittendrin steckst. Es ist schwer herauszufinden, was du selber willst. Manchmal hörst du so viele Stimmen im Kopf, dass du kaum entscheiden kannst, welche deine ist. Mal willst du dies, mal willst du jenes. Du glaubst, du willst dies, aber dann willst du doch lieber was anderes. Du glaubst, du solltest dies wollen, aber alle sagen plötzlich, es wird von dir erwartet, dass du etwas anderes willst.
Es ist nicht einfach.
Ich erinnere mich an ein Erlebnis, als ich ungefähr zehn oder elf war. Ich kam aus der Schule und heulte mir die Augen aus dem Kopf, weil die anderen Kinder mich Baby genannt hatten. Dad tröstete mich und wartete geduldig, bis die Tränen trockneten, dann setzte er mich hin und gab mir einen Rat: »Hör zu, Cait«, sagte er. »Du wirst dir die Hälfte deiner Kindheit wünschen erwachsen zu sein und dann, wenn du erwachsen bist, wirst du dir die Hälfte der Zeit wünschen wieder ein Kind zu sein. Deshalb mach dir nicht zu viele Sorgen darüber, was richtig oder falsch für dein Alter ist – tu einfach immer, was du willst.«
Das brachte mich wieder auf Dad, auf seine Einsamkeit, sein Schreiben, sein Trinken … Aber plötzlich fiel mir eine unerwartete Bewegung auf und alle Gedanken verschwanden. Irgendjemand schwamm im Meer, ein Stück vom Point entfernt in Richtung Strand. Und schlagartig war mir bewusst, dass es dunkel wurde, dass mir kalt war und ich keine Ahnung hatte, wo Deefer steckte.
»Deefer!«, rief ich und schaute in die Runde. »Hier bin ich. Komm her, Deef!«
Ich wartete, lauschte auf das Klingeln seines Halsbandes, dann pfiff ich und rief wieder, aber es kam keine Antwort. Inzwischen hatte der Schwimmer den Strand fast erreicht. Ich beschirmte die Augen, um besser sehen zu können. Es war ein junger, blonder Mann mit schwarzer Schwimmbrille. Irgendetwas an ihm wirkte vage vertraut, aber das Licht war zu unscharf und ich konnte kein Gesicht erkennen. Wer immer es war, auf jeden Fall war er ein guter Schwimmer. Als er näher ans Ufer kam, konnte ich das gleichmäßige Klatschen seiner Hände hören, wie sie durchs Wasser schnitten. Klatsch … klatsch … klatsch … ein eigenartig gespenstischer Laut.
Ich schaute wieder in die Runde und rief nach Deefer. Keine Antwort. Ich schaute in alle Richtungen – zurück den Strand entlang, über Binsen und die Salzwiesen, zum Watt. Nichts. Kein schwarzer Hund. Nicht das geringste Lebenszeichen. Nur ich und eine Gestalt mit dunkler Schwimmbrille, die mich etwas nervös machte. Jetzt watete sie aus dem Meer und kam knirschend die Kiesel hinauf direkt auf mich zu. Groß, muskulös, breitschultrig, nur mit einer engen Badehose und einer auffallenden Armbanduhr bekleidet. Ein dünnlippiges, spöttisches Grinsen kräuselte seinen Mund, und als er näher kam, sah ich, dass sein Körper mit einer Art Öl oder durchsichtigem Fett eingeschmiert war. Das Wasser kullerte in kleinen Regenbogenperlen von seiner Haut.
»Na, wenn das nicht die kleine Caity McCann ist«, sagte er, nahm die Schwimmbrille ab und lächelte mich an. »Was für eine angenehme Überraschung.«
»Oh – Jamie«, sagte ich zögernd. »Was machst du denn hier?«
Als er weiter auf mich zusteuerte, seine Badehose zurechtzog und sein komisches Grinsen grinste, wusste ich nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Jamie Tait war der Sohn von Ivan Tait, einem reichen Geschäftsmann, der hier in der Gegend viel Land besaß und Parlamentsabgeordneter für Moulton-Ost war. Falls die Insel je so etwas wie eine Berühmtheit hervorgebracht hatte, musste das wohl Jamie sein – er war Kapitän des County Schools Junioren-Rugbyteams, war mit sechzehn englischer Schwimmchampion geworden und galt jetzt, in seinem zweiten Uni-Jahr, als aufsteigender Stern in Oxford.
Jamie Tait war ein strahlender junger Held.
Oder, wie Dad sagen würde, das größte kleine Arschloch der Insel.
Er war ungefähr einen Meter vor mir stehen geblieben, schlug die Schwimmbrille gegen sein Bein, atmete schwer und betrachtete mich von oben bis unten.
»Na, was meinst du, Cait?«, sagte er. »Hab ich’s immer noch drauf?«
»Hast du was drauf?«
Er schnippte sich die nassen Haare von den Augen. »Den Stil, das Zeug … Ich hab doch gesehen, wie du mich beobachtet hast.«
»Ich hab dich nicht beobachtet, ich hab nach meinem Hund geschaut.«
»Na gut«, sagte er zwinkernd. »Kapiert.«
Sein starrender Blick war mir unheimlich. Das blasse Stahlgrau, wie Androidenaugen, man konnte unmöglich sagen, was sich dahinter abspielte. Ich mochte die Art nicht, wie er dastand, die Art, wie er seinen Körper hielt. Zu dicht und doch nicht zu dicht. Dicht genug, um ein Wegschauen peinlich erscheinen zu lassen. Dicht genug, um etwas anzudeuten, zu sagen – schau, schau her, wie findest du es?
Ich trat einen Schritt zurück, pfiff nach Deefer und ließ meine Augen über den Strand wandern. Er war immer noch nicht zu sehen. Als mein Blick wieder zurückkehrte, war Jamie nachgerückt und hatte seine beiden Daumen in die Badehose gehakt. Ich konnte das Öl auf seiner Haut riechen, es überdeckte etwas süßlich seinen Atem.
»Ist Dom schon aus Liverpool zurück?«, fragte er.
»Seit dem Nachmittag, er ist heute zurückgekommen. Macht es dir was aus –«
»Kommt er heute Abend rüber?«
»Keine Ahnung. Ich denke, ich –«
»Was ist los, Cait? Schau dich an, du zitterst ja.« Er lächelte. »Ich würde dir gern was zum Anziehen geben, aber wie du siehst, kann ich dir nicht viel anbieten.« Sein Blick fiel an ihm herab und er lachte. »Das ist die Kälte, weißt du.«
»Ich muss los«, sagte ich und wollte gehen. Mein Herz stampfte und meine Beine waren ganz schwach. Halb erwartete ich, dass eine Hand nach meinem Arm greifen würde – aber nichts geschah.
Ich glaube nicht, dass ich in dem Moment Angst hatte, ich war einfach nur wütend. Wütend auf mich … ich weiß nicht, warum. Weil ich da war, nehme ich an. Wütend, dass er mich wütend gemacht hatte.
Nach einem halben Dutzend Schritten hörte ich ihn hinter mir herknirschen und mit freundlicher Stimme rufen: »Warte, Caity, warte doch mal. Ich will dich was fragen.«
Ich ging weiter.
Ich dachte, ich wäre im Vorteil. Ich hatte Schuhe an, Jamie nicht. Barfuß auf scharfen Kieselsteinen zu laufen ist nicht gerade leicht. Aber nach wenigen Sekunden hatte er mich eingeholt und lief hopsend und grinsend neben mir her.
»Hey, wo brennt’s? Warum so eilig?«
»Ich hab dir doch gesagt, ich muss meinen Hund suchen.«
»Wie heißt er denn?«
»Deefer.«
»Deafer?«, lachte er. »Deaf wie ›taub‹? Tauber Hund? Das ist gut. Sehr einfallsreich.« Er lachte wieder, dann legte er die Hände um seinen Mund und fing an zu rufen: »Dea-fer! Deafer! Dea-fer! Dea-fer …« – und drehte sich beim Gehen im Kreis wie die Scheinwerfer eines Leuchtturms – »Dea-fer! Deafer! Deafer!«
Ich lief weiter Richtung Bunker und überlegte, was ich tun könnte. Es gab alle möglichen unschönen Gerüchte über Jamie Tait, von denen er die meisten, wie Dominic meinte, selbst in die Welt gesetzt hatte. »Jamie ist okay«, hatte mir Dom mal gesagt. »Er muss nur ab und zu ein bisschen Dampf ablassen. Der ganze Kram, dass er verrückt sei, ist nur Inselgerede. Jamie ist ein Teddybär, ehrlich.«
Nun ja, dachte ich, Teddybär hin oder her, je schneller ich Deefer finde und nach Hause komme, desto besser.
Inzwischen hatte ich den Bunker erreicht. Ein gedrungener kreisförmiger Bau, halb im Boden versunken, mit dicken Betonmauern und Flachdach, der aussieht – und riecht – wie eine schmuddelige öffentliche Toilette. Ich runzelte die Nase von dem Gestank und versuchte zu verschwinden, aber ich wusste nicht, welche Richtung ich einschlagen sollte. Sollte ich den Weg durch die Salzwiesen nehmen und Richtung zu Hause gehen oder sollte ich lieber zurück an den Strand laufen und weiter nach Deefer suchen? Welchen Weg? Salzwiesen, Strand, zurück zum Point …?
Jamie hatte mit seinem schwachsinnigen Geschrei aufgehört, sprang am Rand der Salzwiesen entlang und stocherte im Schilf rum. »Hier steckt er nicht drin«, rief er mir zu und bückte sich, um einen Stock aufzuheben, der genau auf der Grenzlinie des Strands lag. »Hey, vielleicht hat er den Duft von Rita Grays Hündin in der Nase. Du weißt, wie Hunde reagieren, wenn sie den Geruch wittern.« Er stieß den Stock gegen eine leere Coladose, dann kam er auf mich zu. »Wie geht’s eigentlich Bill? Ist sie immer noch scharf auf deinen Bruder?«
Ich beachtete ihn nicht und ließ meinen Blick über den Strand wandern, aber durch das abnehmende Licht wirkte alles unscharf und es war, als könnte ich mich auf nichts mehr konzentrieren. Der Himmel wurde dunkler, mit gelben und grauen Streifen dazwischen, und das Meer wirkte jetzt schwarz und eisig.
Jamie kam mit dem Stock über der Schulter auf mich zu. »So«, sagte er, »und was machen wir jetzt?« Ich schob die Hände in meine Taschen und sagte nichts. Er lächelte und nickte in Richtung des Bunkers hinter mir. »Mein Umkleideraum.«
»Was?«
»Der Bunker, da zieh ich mich um.« Er schaute auf seine Badehose herab. »Du denkst doch wohl nicht, ich laufe so den ganzen Weg zurück, mit nichts an außer der Badehose? Die buchten mich ja ein.«
Ich schaute weg. »Ich muss jetzt los.«
Er kam näher. »Wie geht’s deinem alten Herrn, Cait? Schreibt er weiter unartige Bücher für Kids?«
Ich sagte nichts.
Jamie grinste. Er atmete immer noch schwer, aber nicht, weil er außer Atem war.
»Ich muss mal wieder vorbeikommen«, sagte er. »Mich unterhalten mit dem bedeutenden Mann. Was meinst du? Ich und Johnny McCann. Johnny Mac. Wir könnten zusammen einen trinken, einen kleinen Irish Whiskey, eine rauchen … Was hältst du davon, Cait? Würde dir das gefallen?«
»Tschüss, Jamie«, sagte ich und wandte mich ab, um zu gehen.
Er reagierte schnell, trat vor mich hin und senkte den Stock, um mir den Weg zu versperren. Ein kaltes Leuchten vereiste seinen Blick. »Ich habe dich was gefragt, Cait.«
»Geh aus dem Weg –«
»Ich hab dich was gefragt.«
»Bitte, ich will nach Hause …«
Er schürzte seine Lippen und lächelte. »Na, komm schon, Caity, lass uns nicht weiter rumfackeln. Du kannst mich nicht erst anmachen und dann deine Meinung ändern.«
»Was?«
»Du weißt genau, was ich meine. Komm schon, es wird kalt. Lass uns reingehen. Ich zeig dir meinen Umkleideraum. In meiner Jacke hab ich eine Flasche. Ein schöner Tropfen Whiskey wird uns aufwärmen –«
»Wie geht’s Sara?«, fragte ich.
Sara war seine Verlobte. Sara Toms. Ein auffallend schönes und gewandtes Mädchen, wie es sich so ein strahlender junger Held nur wünschen konnte. Sie war die Tochter von Kriminalinspektor Toms, dem Chef der örtlichen Polizei. Sara war krankhaft eifersüchtig. Ich hatte mir eingebildet, es wäre unter diesen Umständen vielleicht klug, ihren Namen zu nennen, aber kaum hatte ich es gemacht, wünschte ich mir, ich hätte es bleiben lassen. Beim Klang ihres Namens gefror Jamie. Seine Pupillen zogen sich zu Stecknadelköpfen zusammen und sein Mund verengte sich zu einem schmalen Schlitz. Einen Moment dachte ich, er würde gleich explodieren, aber dann verließ ihn – mit einem beinahe sichtbaren Stöhnen – der Zorn und etwas anderes setzte sich an die Stelle. Etwas viel Schlimmeres. Er lächelte und kam näher. Nicht nahe genug, um mich wirklich zu berühren, aber doch so nahe, dass er mich rückwärts gegen die Mauer des Bunkers drängen konnte. Meine Gedanken rasten, das Blut schoss mir durch die Adern, aber ich wollte immer noch nicht so richtig glauben, dass etwas verkehrt lief. Es war lächerlich, ehrlich. Mein Instinkt sagte mir, ich sollte ihm in die Eier treten und weglaufen, aber etwas anderes, eine angeborene Höflichkeit, nehme ich an, sagte: Nein, warte, warte einen Moment, er will dich nur provozieren, es ist nicht ernst gemeint, stell dir vor, wie peinlich es wäre, wenn du ihm in die Eier trätest, überleg mal, was die Zeitungen draus machen würden – Sohn eines Parlamentsabgeordneten von Inselmädchen angegriffen. Ich stellte mir die Schlagzeile tatsächlich vor. Kannst du das glauben?
Eine Weile sagte und tat er gar nichts, sondern stand nur da, atmete schwer und starrte mir in die Augen. Ich versuchte mir immer noch einzureden, dass alles in Ordnung sei, dass es nichts gab, worüber ich mir Sorgen zu machen brauchte, dass er nichts als ein etwas unausgeglichener verwöhnter Knabe sei, der bloß ab und zu ein bisschen Dampf ablassen müsse … und dann spürte ich, wie er meine Hand nahm und zu sich hin führte.
»Nein –«
»Halt die Klappe.«
Ich fühlte nackte Haut, kalt und ölig. Ich versuchte meine Hand wegzuziehen, aber er war zu stark.
»Lass –«
»Was?«, sagte er grinsend.
Tritt ihn, dachte ich, tritt ihm in … aber ich konnte es nicht. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich konnte überhaupt nichts tun. Das Einzige, was ich konnte, war ihm ungläubig in die Augen sehen, als er fester zugriff und noch etwas näher kam – und dann erschütterte ein Knurren aus tiefer Kehle die Luft.
»Scheiße!«, zischte er, vor Angst gelähmt. »Was ist das?«
Es war Deefer, der groß mit gebleckten Zähnen und gesträubten Haaren dastand. Das Knurren klang nass und blutig.
Jamie hielt noch immer meine Hand. Ich zog sie weg.
»Was ist das?«, flüsterte er, seine Augen sausten umher, als wollte er versuchen hinter sich zu schauen, ohne den Kopf zu drehen.
Ich konnte nicht sprechen. Selbst wenn ich es gewollt hätte, ich hätte nichts sagen können. Ich wollte ihn von mir weghaben, ich wollte ihn wegschieben, aber ich konnte nicht ertragen ihn zu berühren. Meine Hand, die Hand, die er genommen hatte … ich merkte plötzlich, dass ich sie zur Seite streckte, sie von mir weghalten wollte. Meine Kehle war knochentrocken.
»Jesses, Cait«, sagte er mit zusammengepressten Zähnen. »Was ist das, verflucht noch mal? Sag schon.«
Ich war kurz davor, Deefer auf ihn zu hetzen. Ein Wort von mir und er hätte Jamie in Stücke gerissen. Stattdessen gelang es mir endlich – nach einer Stunde, wie es mir vorkam, was aber in Wahrheit wahrscheinlich nicht mehr als dreißig Sekunden waren –, mich ein bisschen zu beruhigen, meine Gedanken zu ordnen und meine Stimme wiederzufinden. Ich sagte zu Deefer: »Sitz.« Ich sagte, er solle da bleiben und Wache halten. Und dann sagte ich Jamie, er solle ein Stück zurücktreten.
»Was –«
»Beweg dich rückwärts oder ich hetz dir den Hund auf den Hals.«
Er tat einen vorsichtigen Schritt nach hinten.
»Dreh dich nicht um«, sagte ich zu ihm. »Rühr dich nicht vom Fleck. Wenn du dich bewegst, beißt er zu.«
Jamie sah mich an. »Hey, Cait, komm schon. Du glaubst doch nicht, dass ich es ernst gemeint habe, oder? Ich hab nur ein bisschen rumgemacht. Ich wollte nicht –«
Ich ließ ihn stehen.
»Cait!«, rief er. »Nur noch einen Moment … Was tust du? Cait? Du kannst mich doch nicht einfach hier lassen, ich werde erfrieren. Cait!«
Als ich die schmale Bucht erreichte, hatte sich meine äußere Ruhe aufgelöst und ich zitterte wie ein Blatt. Ich atmete tief durch und schrie nach Deefer. Während ich auf seine Antwort wartete, glitt ich das Ufer hinab und wusch mir im Wasser die Hände, schrubbte sie, bis sie taub waren und keine Spur eines Gefühls mehr in ihnen existierte. Dann wusch ich mir die Tränen aus dem Gesicht.
Es ist deine eigene Schuld, sagte ich mir, wie konntest du nur so dumm sein? Dumm, dumm, dumm, dumm … Warum hast du nicht gleich kehrtgemacht und bist abgehauen, als du ihn gesehen hast? Du weißt doch, was mit ihm los ist. Warum bist du nicht einfach weggegangen?
Ich kannte die Antwort.
Ich war nicht weggegangen, weil ich nicht unhöflich sein wollte. Ich hatte nicht unfreundlich sein wollen …
Es war jämmerlich.
Als ich das Ufer wieder hinaufkletterte, saß Deefer auf der Brücke und wedelte mit dem Schwanz.
»Wo warst du, verdammt noch mal?«, sagte ich und wischte mir Rotztränen aus dem Gesicht. »Du solltest auf mich aufpassen. Komm her.« Er senkte den Kopf und kam tief gegen den Boden geduckt zu mir angewatschelt. »Nächstes Mal«, sagte ich ihm, »nächstes Mal … komm sofort zurück, wenn ich dich rufe. In Ordnung?« Ich tätschelte seinen Kopf. »Es ist nicht gut, wenn man es bis zur letzten Sekunde rauszieht – wenn ich dich rufe, kommst du zurück.« Sein Schwanz schlug heftig und er gähnte vor Scham. »Und dass du ja niemandem davon erzählst«, sagte ich schniefend. »Das ist etwas nur zwischen dir und mir, klar? Wenn es Dad mitkriegt, bringt er ihn um. Das ist kein Witz, Deef. Er bringt ihn um.«
Das Haus war still, als ich zurückkam. Ich ging nach oben und duschte, zog mir saubere Sachen an, überprüfte im Spiegel, dass ja keine Tränen mehr zu sehen waren, dann legte ich mein T-Shirt und die Shorts mit anderer dreckiger Wäsche zu einem Bündel zusammen und ging wieder runter in die Küche. Gerade, als ich die Sachen in die Waschmaschine stopfte, kam Dad herein.
»Hi, Cait – was machst du?«
»Nur ein bisschen Wäsche waschen … ich war … da war Öl am Strand …«
»Öl?«
»Teer oder so was.« Ich zuckte die Schultern. »Hab was davon auf mein T-Shirt bekommen.«
»Oh«, sagte er und sah mich an. »Ist alles in Ordnung mit dir? Deine Augen –«
Ich drehte mich weg. »Es ist nichts, nur ein bisschen Sand …«
»Komm, lass mich mal nachsehen.«
»Ich sag doch, es ist in Ordnung, Dad.«
Er warf mir einen verdutzten Blick zu. »Was ist los?«
»Nichts, tut mir Leid. Ich wollte dich nicht anfahren. Ehrlich, es ist nichts. Mir geht’s gut.« Ich programmierte die Waschmaschine und stellte sie an. »Hast du schon gegessen?«
»Ich hab eigentlich gar keinen Hunger, Kleines.«
»Was ist mit Dominic? Er schläft doch nicht etwa noch, oder?«
»Er ist weggegangen. Musste ein paar Leute treffen …«
»Wo?«
Dad schüttelte den Kopf. »Im Dog & Pheasant, nehme ich an.«
»Hattest du keine Lust mitzugehen?«
Er lächelte verlegen. »Ach, das wär dem Jungen doch nur peinlich. Du weißt ja, wie das ist … Vielleicht gehen wir ein andermal ganz in Ruhe einen trinken …« Er trat hinüber an den Schrank und holte eine neue Flasche Whiskey heraus. Seine übertriebene Ruhe sagte mir, dass er schon ein paar Drinks intus hatte. Er setzte sich an den Tisch und schenkte sich noch einen ein.
»Hast du einen schönen Spaziergang gemacht?«
»Ja … ja, war gut … bisschen kalt.«
Er nickte und sah aus dem Fenster. »Und du würdest mir sagen, wenn irgendwas nicht in Ordnung wäre?«
»Ja, Dad, ich würd es dir sagen.«
»Versprochen?«
»Versprochen.«
Er trank seinen Whiskey und sah mich mit leicht glasigen Augen an. »Niemand behält ein Geheimnis besser für sich als ein Kind.«
»Ich bin kein Kind.«
»Nein«, sagte er traurig. »Das ist wohl wahr.«
»Dad –«
»Der Junge«, meinte er plötzlich, »sag mal, was hältst du von ihm?«
»Welcher Junge?«
Er lächelte viel sagend. »Der gut aussehende Junge auf der Brücke.«
»Auf dem Damm?«
Er trank einen weiteren Schluck. »Brücke, Damm, was auch immer … Hat er dich nicht verwundert?«
»Verwundert, wieso? Wovon redest du, Dad?«
»Von Geheimnissen«, sagte er und zwinkerte dabei mit den Augen.
»Ich glaub, du hast zu viel getrunken.«
»Ich bin ganz klar.«
»So siehst du aber nicht aus.«
»Na ja, ist ein ziemlich kurioser Tag gewesen.«
»Ja.«
Er schaute mich einen Moment an, sein Kopf schwankte leicht auf den Schultern, dann holte er tief Luft und stand auf. »Also, ich mach dann wohl besser weiter. Mal sehen, ob ich was hinkriege, das uns die Rechnungen bezahlt …« Er lächelte wieder, dann drehte er sich um, griff nach Flasche und Glas und ging Richtung Tür.
»Dad?«, sagte ich.
»Ja, Kleines?«
»Trink nicht zu viel, okay?«
»Okay.«
»Bitte.«
»Ich geb dir mein Wort.« Er kam zu mir und küsste mich, dann schlurfte er hinaus, zurück in sein Arbeitszimmer. Sein Atem roch nach Whiskey und süßem Tabak.
Nachts konnte ich lange nicht einschlafen. Die Luft war schwer und stickig, ich fand keine Ruhe. Die Bettdecke erdrückte mich, das Kissen war zu weich, zu dick, die Matratze zu hart. Ich konnte nicht aufhören an das zu denken, was am Strand passiert war. Jamie Tait. Das Gefühl seiner Hand, seine gruseligen Augen, seine schmierige Haut … Ich wusste, ich sollte mit jemandem drüber reden, aber ich hatte keine Ahnung, mit wem. Und selbst wenn ich es jemandem erzählte, was käme dabei heraus? Es stand meine Aussage gegen seine. Er war ein Lokalheld, ein Oxford-Student, der Sohn eines Parlamentsabgeordneten. Und was war ich? Nichts, nur ein merkwürdiges kleines Mädchen mit Puscheln im Haar, ein Mädchen, das immer die gleichen Klamotten trug. Die mutterlose Tochter eines Schriftstellers ohne Frau …
Und überhaupt, überlegte ich weiter, was war denn wirklich passiert? Er hat dich doch kaum berührt, oder? Er hat ja gar nichts getan … er hat dich doch kaum berührt …
Dann fing ich wieder an zu weinen.
Später, als ich am offenen Fenster saß und hinaus in das Dunkel schaute, hörte ich Dad leise in seinem Arbeitszimmer singen. Die Worte trieben sanft durch die Nachtluft: »… Oh, I’ll take you back, Kathleen … to where your heart will feel no pain … and when the fields are fresh and green I’ll take you to your home again …«
Irgendwann schlief ich ein, aber in den frühen Morgenstunden weckte mich Deefers Bellen, als ein Auto dröhnend den Weg entlangkam und quietschend auf dem Hof anhielt. Gelächter und betrunkene Stimmen zerrissen die Nacht.
»Ha, wir sind da! Dommo, Dommo …«
»Pass auf!«
»Wuff! Wuff!«
»Mann, ich kann nicht raus.«
»Hey, hey, Caity –«
»Schhh!«
»Pass auf die scheiß Tür auf –«
»Ha! Jaaa doch …«