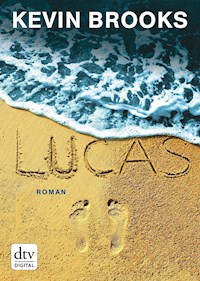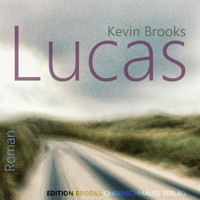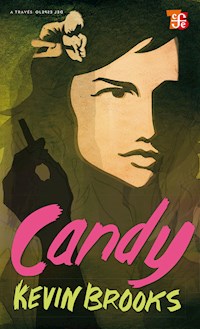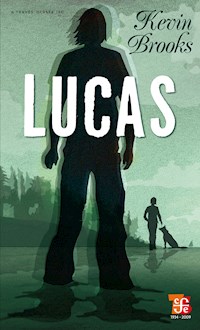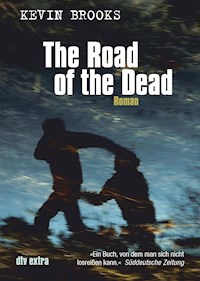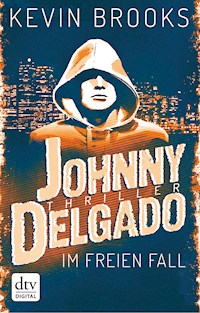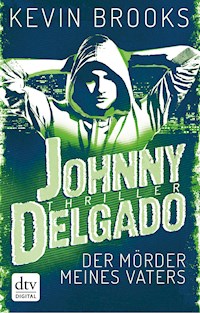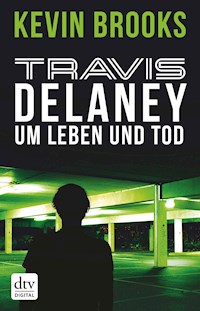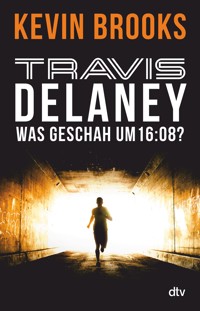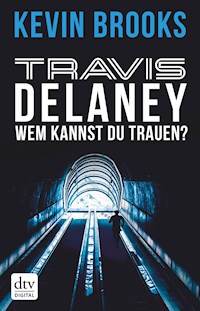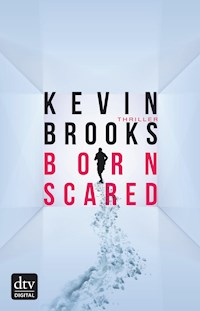
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Kannst du deine Angst besiegen? Elliot hat Angst – vor allem im Leben. Das Einzige, was seine Angst in Schach hält, sind seine Medikamente. Und dann, eines Morgens, sind sie aufgebraucht und alles geht schief: Die ganze Stadt wird von einem Schneesturm lahmgelegt, und Elliots Mutter, die nur kurz zu ihrer Schwester wollte, kommt und kommt nicht wieder. Nicht weit entfernt, wird Elliots Tante Opfer eines Raubüberfalls, und als Elliots Mutter an der Haustür auftaucht, wird auch sie von den Tätern gefesselt und geknebelt. Als seine Mutter nicht auftaucht, bleibt ihm nichts anderes übrig: Er muss nach draußen, in den Schneesturm, um seine Mutter zu suchen. Und gerät selbst in die Fänge der Gangster ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 224
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Kevin Brooks
Born Scared
Roman
Aus dem Englischen von Uwe-Michael Gutzschhahn
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
1Heiligabend
Ich habe es inzwischen bis in den Flur geschafft. Jacke, Mütze, Stiefel, Handschuhe …
Kalter Schweiß läuft mir den Rücken runter.
Es ist drei Uhr nachmittags an Heiligabend.
Der Schneesturm nimmt zu.
Mein Herz pocht. Ich schaudere, zittere. Mir ist schlecht. Und jede Zelle meines Körpers brüllt mich an, ich soll umkehren und weglaufen.
Doch ich kann mich nicht rühren.
In keine Richtung.
Ich kann nicht zurück.
Ich kann nicht nach draußen.
Ich schaffe es nicht.
Unmöglich.
Ich kann da nicht raus.
Ich habe Angst.
2Weniger als nichts
Meine Angstpillen sind gelb, was keine schlimme Farbe für mich ist.
Rot bedeutet Blut (und Weihnachtsmänner), Schwarz ist der Tod, Blau ist die tiefe See, in der alles versinkt.
Gelb bedeutet Käse und Bananen.
Und Tabletten.
Keine Ahnung, wieso ich sie Angstpillen nenne. Eigentlich sind es Tabletten gegen Angst.
Ich habe vor nahezu allem chronische Angst.
Manchmal glaube ich, mich erinnern zu können, dass ich schon im Leib meiner Mutter Angst hatte. Ist nicht viel mehr als ein schwaches Gefühl und ich weiß auch nicht, wovor ich da drin hätte Angst haben können oder wie ich sie – in meinem unfertigen Zustand – hätte erkennen sollen.
Außer …
Außer.
Es ist wahrscheinlich korrekter zu sagen, manchmal glaube ich, mich erinnern zu können, dass wir schon im Leib unserer Mutter Angst hatten. Wir waren nämlich zu zweit da drin: ich und meine Schwester – Ellamay. Wir waren Zwillinge. Und tief im Innern weiß ich, dass meine embryonalen Ängste – wenn es das war, was ich spürte – sowohl Ellamays waren als auch meine.
Wir hatten Angst.
Gemeinsam.
Wir waren wie eins.
Das sind wir noch immer.
Und vielleicht wussten wir, was kommen würde. Vielleicht hatten wir Angst, weil wir wussten, einer von uns würde sterben …
Nein, ich denke, das stimmt nicht.
Ich glaube nicht, dass irgendwer weiß, was Tod bedeutet, bevor es uns jemand erklärt. Und das Merkwürdige ist: Obwohl es in jedem Leben einen Schlüsselmoment geben muss, in dem wir zum ersten Mal begreifen, dass alles, was lebt, irgendwann stirbt, und dass an irgendeinem Punkt in der Zukunft auch unser eigenes Leben enden wird, kann ich mich beim besten Willen nicht an den Moment erinnern, als ich es herausfand. Und es würde mich wundern, wenn irgendjemand anderes sich an diesen Moment erinnern könnte.
Was doch eigentlich komisch ist, findest du nicht?
Allerdings erinnere ich mich sehr wohl an die Wirkung, die dieser Moment auf mich hatte.
Ich weiß nicht, wie alt ich damals war – vier, fünf, sechs? – , doch ich kann mich noch gut erinnern, wie ich nachts im Bett lag, mit dem Kopf unter der Decke, und versuchte, mir den Tod vorzustellen. Die vollkommene Abwesenheit von allem. Kein Leben, keine Dunkelheit, kein Licht. Kein Sehen, kein Fühlen, kein Wissen. Keine Zeit, kein Wo und Wann, kein Nichts, für immer, immer, immer, immer …
Es war beängstigend.
Das ist es noch immer.
… Stunden um Stunden daliegen, unentwegt ins Dunkel stieren, auf der Suche nach dieser unvorstellbaren Leere, und doch niemals mehr sehen als eine gewaltige Schneise absoluter Schwärze, die sich Milliarden und Abermilliarden Kilometer tief ins All erstreckt. Und ich weiß, die Vorstellung reicht nicht. Wenn ich sterbe, wird es keine Schwärze und keine Milliarden und Abermilliarden Kilometer geben, es wird nicht mal nichts geben, es wird weniger als nichts geben …
Und diese Vorstellung lässt mir noch immer die Tränen in die Augen steigen.
Aber manchmal …
Manchmal.
Manchmal fühlt es sich an, als ob diese Erinnerung nicht meine eigene wäre, als ob sie jemand anderm gehörte. Oder ich es vielleicht in einem Buch gelesen hätte – eine Geschichte über einen verwirrten Jungen, der nachts im Bett liegt und versucht, sich den Tod vorzustellen – und mich so damit identifiziert hätte, dass ich im Lauf der Zeit zu der Überzeugung gelangte, ich sei dieser verwirrte Junge und seine Vorstellungen wären meine eigenen.
Nicht dass das irgendetwas ändert, glaube ich jedenfalls.
Erinnerung ist Erinnerung, egal woher sie stammt.
Ich bin inzwischen auf den Flurboden gesunken und sitze mit geschlossenen Augen da, den Rücken gegen die Wand gelehnt. Ich versuche gleichmäßig zu atmen, versuche mein pochendes Herz zu beruhigen, versuche den Kopf zu leeren.
Nach einer Weile kommt Ellamay mit ihrer Stimme, die so tröstlich wie immer klingt.
Schon gut, Elliot. Alles wird gut.
»Ich hab Angst.«
Ich weiß. Aber du wirst nicht allein sein. Ich werde auf dem ganzen Weg bei dir sein.
»Ich glaube nicht, dass ich das schaffe.«
Doch, du schaffst das.
»Es ist zu schwer.«
Du musst es schaffen, Elliot.
»Ich weiß.«
Für Mum.
»Ich weiß.«
Für uns.
Wir sind Frühgeburten, wir kamen in der sechsundzwanzigsten Woche. Ich wog etwas unter fünfhundert Gramm, Ella noch weniger. Es war eine traumatische Geburt. Zuerst waren sich die Ärzte gar nicht sicher, ob überhaupt einer von uns überleben würde. Mum hatte viel Blut verloren und war in einem extrem schlechten Zustand, und während sie eilig zu einer Not-OP weggebracht wurde, verlegte man Ellamay und mich auf die Intensivstation für Neugeborene, wo wir in Brutkästen gesteckt und an alle möglichen Sachen angeschlossen wurden, um uns am Leben zu halten.
Bei Ellamay klappte es nicht.
Sie lebte nur eine Stunde.
Ich wäre ihr fast gefolgt.
Unsere Herzen hörten praktisch im selben Moment auf zu schlagen. Doch auch wenn die Ärzte und Schwestern es irgendwie schafften, mich zu retten, für Ella konnten sie nichts mehr tun.
Ein Teil von mir starb mit ihr und ein Teil von ihr lebte in mir weiter.
Gemeinsam sind wir sowohl tot als auch lebendig.
Angst in der Welt draußen – im Gegensatz zu der Welt im Mutterleib – erlebte ich zum ersten Mal, als ich nach Ellas Tod in dem Brutkasten aufwachte. Dieser Moment ist genauso ein Teil von mir wie alles andere, was mich zu dem macht, was ich bin – mein Herz, mein Hirn, mein Fleisch, mein Blut.
Ich lag nur da – auf dem Rücken, mit offenen Augen – und schaute durch die gewölbte Kuppel des Brutkastens, die aus durchsichtigem Kunststoff war, hinauf zu dem weißen Himmel der Decke. Schwache Geräusche schwebten um mich herum – leises Piepsen, gedämpfte Stimmen, tiefes Brummen –, und auch wenn ich nicht wusste, was diese Geräusche waren, hatte ich keine Angst vor ihnen. Sie waren die Geräusche meiner Welt und klangen für mich so normal wie das Geräusch meines eigenen stotternden Atems.
Dann plötzlich wurde alles anders.
Der weiße Himmel verdunkelte sich, als aus dem Nichts drei unbekannte Dinge auftauchten und sich über mich senkten. Ich wusste nicht, was sie waren – bewegliche Dinge, bedrohliche Dinge, Dinge, die fremde, brabbelnde Geräusche machten – wah dah … pah banah … al tah plah … tah jah ah lah …
Monster.
Dann rückte eines von ihnen noch näher heran, beugte sich über den Brutkasten und wurde dabei immer größer und größer … das war der Moment, in dem die Angst in mir ausbrach. Sie war unkontrollierbar, erdrückend, allumfassend.
Der reine Terror.
Es war das, was ich war.
Die drei unbekannten Dinge an jenem Tag waren meine Mum, ihre ältere Schwester Shirley und Dr. Gibson. Und das Komische (das Eigenartige) daran war, dass sie – die ersten Menschen, die mich zu Tode erschreckten – seitdem zu den einzigen dreien geworden sind, die mich nicht zu Tode erschrecken.
Sie sind für mich die einzigen wirklichen Menschen auf der Welt.
Alle anderen sind Goriller.
3Billig und schäbig
Die zwei Männer in dem gestohlenen Land Rover waren beide als Weihnachtsmänner verkleidet. Die Weihnachtsmann-Verkleidung war eine Last-Minute-Entscheidung gewesen, und weil Heiligabend war, gab es natürlich in den meisten Geschäften und auch bei den Kostümverleihern keine Weihnachtsmann-Sachen mehr. Nur der Billy-Billig-Shop im Einkaufszentrum von Catterick hatte noch was, und zwar aus einem klaren Grund: Die Kostüme wirkten dermaßen billig und schäbig, dass selbst Dagobert Duck sie niemals gekauft hätte. Der rote Nylonstoff war so dünn, dass er geradezu durchsichtig wirkte, und der zottelige weiße Besatz an Mütze und Jacke war nicht aufgenäht, sondern nur angeklebt. Teile des faserigen Zeugs lösten sich schon und die dünnen weißen Fädchen klebten wie Schuppen auf dem hauchdünnen, elektrostatisch aufgeladenen Nylon fest. Die Kostüme hatte es nur noch in XXL gegeben, und weil keiner der beiden Männer auch nur annähernd so groß und so breit war, mussten sie improvisieren und ein paar eilige Änderungen vornehmen. Sie hatten zusätzliche Löcher in die Gürtel gestanzt, Ärmel und Hosenbeine nach oben gerollt, und unter den übergroßen Weihnachtsmann-Mützen trugen sie Strickmützen. Und weil Weihnachtsstiefel nicht im Preis der Verkleidung inbegriffen waren, hatten beide Männer Turnschuhe an.
4So viel anderes
Die schlimmste Zeit für meine Mutter waren meine allerersten Lebensjahre, in denen ich fast ununterbrochen schrie und weinte. Die Leute meinten, sie solle sich keine Gedanken machen – ist doch nicht ungewöhnlich, Babys schreien nun mal –, aber Mum wusste, dass dieses Schreien anders war. Ich weinte nicht einfach wie ein normales Baby, ich heulte und kreischte, ich zitterte am ganzen Leib und wich vor so gut wie allem zurück.
»Da stimmt doch was nicht, oder?«, fragte Mum Dr. Gibson. »Irgendwas ist doch mit dem Jungen nicht in Ordnung.«
Der Arzt sah mich an – ich lag in Mums Armen –, dann wandte er sich wieder an Mum. »Ich weiß nicht, was mit ihm ist. Ehrlich nicht. Die Check-ups im Krankenhaus haben kaum etwas Ungewöhnliches gezeigt. Sein Herz schlägt deutlich schneller als üblich und sein Blutdruck ist ziemlich hoch, doch nach dieser traumatischen Geburt ist es nur allzu verständlich, dass er auf die Krankenhausumgebung instinktiv mit Angst reagiert.«
»Aber die Herzfrequenz und der Blutdruck steigen auch an, wenn Sie ihn untersuchen«, erklärte Mum.
»Aber nicht so stark wie im Krankenhaus. Außerdem ist ja klar, dass er vor mir auch Angst hat, schließlich weiß er ja, dass ich wieder an ihm herumfingern und ihn mit Nadeln traktieren werde.«
»Nein«, sagte Mum entschieden und schüttelte den Kopf. »Es ist mehr als das. Dass er unruhig und aufgeregt ist, sobald man ihn untersucht, kann ich ja verstehen, aber es gibt so viel anderes, was dieselbe Reaktion auslöst – fremde Menschen, unbekannte Geräusche, Autos, Vögel, Hunde, Regen, Wind, Dunkelheit … er kriegt Panik im Dunkeln. Nicht einfach bloß Angst – das würde ich ja verstehen –, nein, im Dunkeln ist er vollkommen gelähmt. Er hat noch nie ohne Licht geschlafen.«
Der Arzt runzelte die Stirn und kratzte sich am Kopf. »Na ja, körperlich scheint mit ihm aber alles in Ordnung zu sein. Wie ich schon sagte, die Check-ups im Krankenhaus waren eindeutig, und Sie wissen selbst, dass ich wirklich alles untersucht habe, was einem einfällt – Herz, Leber, Blut, mögliche Allergien oder Infektionen –, doch ich habe nichts Ungewöhnliches gefunden.« Er unterbrach sich, zögerte einen Moment und sah mich wieder an. »Das Einzige, was mir überhaupt noch einfällt: Vielleicht hat seine extreme innere Unruhe ja gar keinen physischen Grund.«
»Was soll das heißen?«
»Die Symptome, von denen wir gesprochen haben – erhöhte Herzfrequenz, hoher Blutdruck –, sind klassische Anzeichen für Angst und Furcht. Dass Elliot eine instinktive Angst vor dem Krankenhaus hat und sich – in geringerem Maß – auch vor mir fürchtet, halte ich zwar für ziemlich normal, zugleich könnte es aber auch sein, dass seine Symptome psychisch bedingt sind.«
Mum wurde sichtlich blass.
»Das wäre nicht ungewöhnlich«, erklärte der Arzt und legte ihr beruhigend eine Hand auf den Arm. »Babys haben alle möglichen seltsamen Probleme und manchmal lässt sich einfach nicht feststellen, was mit ihnen los ist. Und sie können es uns ja auch noch nicht sagen, solange sie nicht sprechen gelernt haben. Doch meiner Erfahrung nach hat die große Mehrheit von ihnen dann, wenn sie sprechen können, diese Probleme längst überwunden.«
»Die große Mehrheit?«, fragte Mum und hob eine Augenbraue.
»Mit Elliot wird alles gut«, sagte der Arzt in sanftem Tonfall. »Vertrauen Sie mir, alles wird bestens sein.«
Doch es wurde nicht alles gut. Ich überwand meine Probleme nicht. Und als ich gut genug sprechen konnte, um meine Gefühle auszudrücken, gab es keinen Zweifel, was mit mir nicht stimmte.
»Ich habe Angst, Mummy.«
»Angst wovor, Schatz?«
»Vor allem.«
5Knöpfe aus massivem Gold
Der Weihnachtsmann auf dem Beifahrersitz des gestohlenen Land Rover zog fluchend den faserigen Bart nach unten und kratzte sich an seinem unrasierten Kinn.
»Das Scheißding bringt mich um«, sagte er und schnippte wütend gegen den Bart. »Fühlt sich an, wie wenn das Zeug aus Asbest wär oder so was.«
»Zieh ihn wieder hoch«, befahl der Weihnachtsmann auf dem Fahrersitz.
»Ich versteh nicht, wieso –«
»Zieh ihn wieder hoch.«
Die Stimme des Fahrers war ruhig und verhalten, doch es lag etwas Kaltes darin und sein Kompagnon wusste, dass er diese Kälte besser nicht ignorierte. Er hatte aus erster Hand erlebt, wozu sein Partner fähig war, wenn jemand ihn nicht ernst nahm, und auch wenn sie tatsächlich Partner waren, mehr oder weniger jedenfalls: Wenn der Mann, der neben ihm saß, ihm wehtun wollte, würde er nicht lange fackeln, Partner hin oder her.
»Ich sag ja nur«, murmelte der Weihnachtsmann auf dem Beifahrersitz, während er den Bart mit dem Gummizug wieder in seinem Gesicht befestigte.
»Lass es einfach, verstanden?«
Der Weihnachtsmann auf dem Beifahrersitz wandte sich mit einem beleidigten Schulterzucken ab und schaute aus dem Fenster.
Es war 11.42 Uhr.
Sie nahmen die Nebenstrecke auf das Dorf zu, fuhren durchs Moor. Der Weihnachtsmann auf dem Beifahrersitz kannte die Gegend wie seine Westentasche. Als Jugendlicher war er oft mit seinen Freunden hier oben gewesen. Die Warnschilder mit der Aufschrift BETRETENVERBOTEN! MILITÄRISCHESSPERRGEBIET hatten sie geflissentlich missachtet und die Gegend genau abgesucht nach allem Möglichen, was die Soldaten am Ende des Manövers vom Vorabend zurückgelassen hatten – leere Patronenhülsen, ausgebrannte Leuchtgeschosse, sogar scharfe Munition, wenn man Glück hatte. Er wusste, dass man bei klarem Wetter hier oben kilometerweit sehen konnte, bis zu den fernen Hambleton Hills, aber heute fiel der Schnee dicht und schwer, die Sicht lag praktisch bei null. Der raue Moorwind blies so stark, dass die Schneeschwaden waagrecht über die verlassene Landschaft trieben, und er spürte, wie der Wagen kämpfen musste, um die Spur zu halten.
Während er den Kopf gegen die kalte Scheibe lehnte, fragte er sich erneut, was er hier eigentlich machte. Wieso gerätst du immer wieder in solche Situationen?, fragte er sich. Ich meine, was ist dein Problem? Was ist so schwer daran, Nein zu sagen?
Der Mann hieß Leonard Dacre. Die meisten Leute nannten ihn Dake.
Der Fahrer hieß Carl Jenner.
»Wenn das hier vorbei ist«, brach Jenner das Schweigen, »kannst du dir das teuerste Weihnachtsmann-Kostüm der Welt kaufen.« Er warf einen Blick zu Dake. »Mit Knöpfen aus massivem Gold, Seidenhosen und einem Gürtel aus Schlangenleder …«
»Einem Bart aus Eisbärfell …«
»Genau.«
Die beiden Männer grinsten sich an und der Land Rover fuhr weiter durch den Schnee.
6Gorillazähne
Ich verstecke nicht gern Dinge vor Mum – es kommt mir dann immer so vor, als würde ich sie betrügen –, aber ich habe vor langer Zeit gelernt, dass es für uns beide oft besser ist, wenn ich bestimmte Dinge für mich behalte.
Wie zum Beispiel Ellamay.
Ich war etwa vier, als ich zum ersten Mal merkte, dass ich Ellamay für mich behalten musste. Der Arzt war bei uns zu Hause gewesen, um nach mir zu schauen, und danach saß ich – während er mit Mum sprach – auf dem Boden und blätterte in meinem Lieblingsbilderbuch. Da trat plötzlich Ellamay zu mir.
Alles in Ordnung, Elliot?, fragte sie. Was hat der Arzt diesmal gesagt?
»Er will, dass ich zu einem besonderen Doktor gehe«, antwortete ich ihr.
Zu was für einem denn?
»Zu einem Kopf-Doktor.«
Wieso?
»Damit er macht, dass ich keine Angst mehr habe.«
»Elliot?«
Diesmal war es nicht Ellamays Stimme und für einen kurzen Moment wusste ich nicht, was los war. Dann fragte Mum: »Was tust du, Elliot? Mit wem redest du?«
Ich schaute zu ihr hoch. »Mit Ellamay.«
»Mit wem?«
»Ellamay.«
Mum schaute verwirrt, und als sie sich zu dem Arzt umdrehte, sah ich, dass auch sie Angst hatte.
»Wer ist Ellamay, Elliot?«, fragte mich der Arzt.
»Meine Schwester.«
»Deine Schwester?«
Ich nickte.
Der Arzt drehte sich zu Mum um. »Ellamay?«
Mum schüttelte den Kopf und ich sah Tränen in ihren Augen. »Von mir hat er das nicht …«, murmelte sie und musste sich räuspern. »Sie wissen doch, ich konnte es nicht ertragen, ihr einen Namen zu geben … er muss ihn sich ausgedacht haben …«
»Haben Sie Elliot schon mal mit ihr sprechen hören?«
»Ich hab immer gedacht, er redet nur mit sich selbst.«
Sie weinte jetzt richtig, Tränen liefen ihr übers Gesicht. Ich stand auf, ging zu ihr und schlang meine Arme um sie.
»Nicht weinen, Mummy … tut mir leid, ich wollte nicht, dass du weinst.«
»Schon gut, Schatz«, schluchzte sie. »Ist nicht deine Schuld …«
Doch es war meine Schuld. Wessen Schuld sollte es sonst sein?
Und seither spreche ich nur laut mit Ellamay, wenn wir allein sind.
Es gab noch etwas, das ich lernte, nicht laut zu sagen – das Wort Goriller. Goriller sind alle Menschen auf der Welt außer Mum, Tante Shirley und dem Arzt. Sie heißen Goriller, weil sie in meinen Träumen als schreckliche, furchterregende Wesen mit zotteligen Gorillaleibern, langen, zupackenden Armen, krummen Beinen, kleinen Menschenköpfen und böse grinsenden Mündern zu mir kommen, die Lippen weit nach hinten über ihre bösartigen Gorillazähne gezogen …
So empfinde ich andere Menschen.
Als schreckliche Wesen, die mich zerfleischen und fressen wollen.
Goriller.
Als ich das Wort zum ersten Mal vor Mum aussprach, meinte sie, ich solle das nie wieder sagen.
»Wieso nicht?«, fragte ich sie.
»Du kannst Menschen nicht als Gorillas bezeichnen, Elliot.«
»Goriller«, korrigierte ich sie. »Nicht Gorillas.«
»Egal«, antwortete sie (was ich ziemlich unsinnig fand), »die Leute könnten denken, dass du Gorilla sagst, so wie ich es eben auch gedacht habe, und sie könnten meinen, du willst sie beleidigen.« Sie sah mich an. »Du möchtest doch nicht, dass jemand denkt, du willst ihn beleidigen, oder?«
Ich sagte Nein und seither benutze ich das Wort nur noch, wenn ich allein oder mit Ellamay zusammen bin. Was aber nichts ändert. So wie ich auf Goriller reagiere – ich schreie wie wild und renne in Panik davon –, halten sie mich sowieso für verrückt. Da könnten sie ruhig auch noch denken, ich würde sie beleidigen. Außerdem sah ich schon damals – im Alter von drei oder vier – fast nie jemanden außer Mum, Shirley und dem Arzt; die Chance, dass ich einen Goriller auf die Palme brachte, indem ich ihn Goriller nannte, war also praktisch gleich null.
Ich wünschte, das Ganze wär leichter. Ich wünschte, ich könnte dir meine Hände auf den Kopf legen und das, was in mir ist, übertragen. Ich wünschte, du könntest ich sein, und sei es nur für einen Augenblick. Dann wüsstest du, wie ich mich fühle.
Aber das wird wohl nicht gehen, oder?
Wünsche werden nie wahr.
7Die Schneekugel
Schüttel sie
so
Es ist jetzt zwölf Minuten nach drei und ich bin wieder zurück in meinem Zimmer. Immer noch in Mütze, Stiefeln und Handschuhen, die Haut immer noch klebrig vom trocknenden kalten Schweiß und immer noch krank bis ins Mark vor Angst.
Was machst du, Elliot?, fragt Ellamay und klingt verwirrt und ein wenig frustriert. Ich dachte, wir wollten jetzt los. Ich dachte, wir –
»Schon gut«, antworte ich. »Mir ist nur etwas eingefallen. Ich brauche bloß eine Minute.«
Ich durchquere das Zimmer und gehe ins Bad.
Oh, klar, sagt Ellamay. Verstehe.
Sie denkt, ich muss noch mal aufs Klo.
»Nein, das ist es nicht«, sage ich, während ich das Schränkchen über dem Waschbecken öffne. »Ich schau nur schnell nach, ob auch wirklich keine Tabletten mehr da sind.«
Du hast doch schon nachgeguckt.
»Doppelt ist sicherer.«
Aber das hast du auch schon gemacht.
»Dann schau ich eben zum dritten Mal.«
In dem Schränkchen stehen vier leere Pillenfläschchen aus braunem Glas. Ich hebe immer ein paar leere auf, falls ich mal eine fallen lasse oder so. Und Ellamay hat recht, ich habe schon alle Fläschchen zweimal gecheckt. Aber manchmal – bei allen möglichen unwichtigen Sachen – komme ich mit den Zweifeln nicht klar und etwas in mir gibt so lange keine Ruhe, bis ich die Zweifel in den Boden gestampft habe.
Deshalb überprüfe ich die Flaschen noch einmal – nehme eine raus, schüttel sie
so
Schraube den Deckel ab, sehe hinein, drehe das Fläschchen auf den Kopf und schlage es leicht in die Handfläche …
Nichts, leer.
Ich drehe den Deckel wieder drauf, stelle es zur Seite, nehme die nächste Flasche aus dem Schrank. Schüttel sie
so
Schraube den Deckel ab, sehe hinein …
Nichts.
Ich mache das Gleiche mit den zwei anderen Fläschchen, aber auch die sind beide leer, so wie ich es gewusst habe.
Zufrieden?
»Noch nicht.«
Ich fange an, alles andere aus dem Schränkchen zu räumen – Tablettenschachteln (gegen Kopfschmerzen und Verdauungsprobleme), Salbe (gegen Ausschlag), Zahnpasta, Zahnbürste –, und als die Fächer vollständig leer sind, stehe ich da und scanne die staubige Leere nach irgendwelchen Anzeichen von etwas Gelbem, in der unwirklichen Hoffnung, doch noch eine verlorene Tablette zu finden, wenn ich nur lange genug schaue. Aber ich finde keine. Also strecke ich die Hand aus und fahre mit den Fingern über den Staub, taste alle Ecken der Fächer ab, jede kleinste Lücke zwischen den Fächern und der Rückwand, jeden Ort, wo sich noch eine gelbe Tablette versteckt haben könnte …
Es ist nichts da.
Kein Zweifel.
Ich schließe das Schränkchen, fasse in meine Tasche und ziehe die aktuelle Flasche heraus. Schüttel sie
so
und die letzte Tablette klimpert leise gegen das Glas. Ich schließe für einen Moment die Augen und überlege, sie jetzt zu nehmen. Die Wirkung der vorherigen lässt langsam nach und ich spüre, wie sich das zu regen beginnt, wovor ich mich am meisten fürchte – die Bestie, meine Angst vor der Angst –, und ich weiß, wenn ich die Tablette jetzt nicht nehme …
Heb sie für später auf, sagt Ellamay.
»Ich glaub, das kann ich nicht.«
Wahrscheinlich wirst du sie später viel dringender brauchen als jetzt.
Ich weiß, dass sie recht hat.
Ich weiß, ich muss warten.
Ich schüttel die Flasche noch einmal
so
und stecke sie wieder zurück in die Tasche.
War’s das?, fragt Ellamay. Können wir jetzt gehen? Wenn wir nicht bald aufbrechen, ist es draußen stockdunkel.
»Ich weiß«, antworte ich, gehe hinüber zu meinem Nachttisch und nehme meine Taschenlampe. »Deshalb brauche ich unbedingt die hier.«
Ich schalte sie an, um sicherzugehen, dass sie auch funktioniert. Ich weiß es natürlich schon – ich prüfe sie jeden Abend und habe erst vor ein paar Tagen die Batterien gewechselt –, doch ich kann nicht anders, ich muss sie trotzdem noch einmal testen.
Sie funktioniert, der Strahl ist stark und hell.
Ich schiebe die Taschenlampe in meine Jackentasche, drehe mich Richtung Tür, um zu gehen …
und bleibe stehen.
Drehe mich wieder zurück.
Was ist denn jetzt wieder?, fragt Ella.
Die Schneekugel war ein Geschenk von Tante Shirley. Sie hatte mit ihrem Sohn Gordon einen Ausflug nach Whitby gemacht, und als sie sich in einem der Andenken-Läden umsah, entdeckte sie die Schneekugel, die ihr wirklich gefiel. Genauer gesagt gefiel sie ihr so gut, dass sie gleich zwei davon kaufte – eine für sich und eine für Mum.
Ich hatte noch nie eine Schneekugel gesehen, und als Mum sie mir schließlich zeigte – nachdem sie lange überlegt hatte, ob mir die Kugel vielleicht Angst machen würde –, hatte ich keine Vorstellung, was das war. Ich erinnere mich, wie ich sie in den Händen hielt, neugierig anstarrte und mich fragte, was das um Himmels willen sein könnte. Eine kleine Glaskuppel, gefüllt mit einer klaren Flüssigkeit und einem Miniatur-Wald darin. Es war eine Märchenszene – Rotkäppchen, wie es mit dem großen bösen Wolf durch den Wald läuft –, und auch wenn die kleinen Figuren und Bäume aus Plastik nicht sonderlich schön waren, gefielen sie mir doch. Das ganze Teil kam mir sehr besonders vor.
»Schüttel sie«, sagte Mum lächelnd.
Ich wusste nicht, was sie meinte.
»So«, erklärte sie und zeigte es mir mit der Hand.
Ich ahmte sie nach, schüttelte ungelenk die Kugel, und als sie sich mit einem Sturm winziger Schneeflocken füllte, war ich so überrascht, dass ich aufschrie vor Freude.
Mum war sehr erleichtert, dass ich keine Angst vor der Schneekugel hatte, und glücklich, dass mir zur Abwechslung mal etwas gefiel, deshalb schenkte sie mir das Ding. Seitdem steht es bei mir auf dem Regal.
Shirley hat ihre Schneekugel im Wohnzimmer auf der Fensterbank stehen, und die wenigen Male, die ich bei ihr war – zu Besuch mit Mum –, habe ich mich immer gefragt, ob es wohl eine Verbindung zwischen unseren zwei identischen Schneekugeln gibt, so eine Art Bewusstsein füreinander auf die Distanz …
Oder so.
Keine Ahnung.
Was ist los, Elliot?, fragt Ella.
»Nichts«, antworte ich und schaue von der Schneekugel weg.
Was hast du gesehen?
»Was meinst du?«
Du weißt genau, was ich meine. Was hast du gerade in der Schneekugel gesehen?
»Nichts …«
Sie weiß, dass ich lüge. Sie weiß es immer.
Erzähl schon, sagt sie leise. Was hast du gesehen?
»Es hat geschneit … als ob sie jemand geschüttelt hätte. Deshalb hab ich hingeschaut. Und ich hab was gesehen … glaube ich jedenfalls.«
Im Schnee?
»In dem Ganzen.«
Was war es, Elliot? Was hast du gesehen?
Ich war da drinnen, in der Schneekugel. Oder etwas von mir war drinnen … eine verdreckte Gestalt, die auf dem Weg durch den Wald lief … Schnee fiel im Dunkel … große schwarze Bäume überall um mich rum und die weiß bedeckten Äste funkelten in einem ungekannten Licht … und hoch über mir war eine einfache Holztreppe, die einen Steilhang hinaufführte …
Das war es, was ich gesehen hatte.
Es war alles da, in einem einzigen zeitlosen Augenblick, dann war es wieder verschwunden und in meinem Herzen blieb nur ein ungewohntes – und sehr beunruhigendes – Gefühl von Totsein zurück.
8Ein blutroter Albtraum
Ich war sechs, als Mum mich zu einer Kinderpsychologin brachte. Ich glaube nicht, dass sie es wirklich wollte – einerseits wusste sie, dass es mir Angst machen würde, andererseits bedeutete es, sich selbst einzugestehen, dass mein Problem eher psychisch als körperlich bedingt war, und das wollte sie noch immer nicht akzeptieren. Doch tief im Innern wusste sie Bescheid und ihr war auch klar, dass sie irgendwas unternehmen musste. Also fragte sie unseren Arzt, ob er jemanden empfehlen könne, und nachdem er sich umgehört hatte, gab er ihr eine Adresse und Mum machte einen Termin bei der Frau.
Wir schafften es bis in das Wartezimmer.
Aber als die Psychologin (oder Therapeutin oder wie immer sie sich nannte) aus ihrem Sprechzimmer trat und Mum und mich hereinrief, konnte ich mich einfach nicht rühren. Ihr Anblick erschreckte mich so sehr, dass ich in eine Art Schockstarre fiel – ich saß gelähmt auf dem Stuhl, die Muskeln blockierten, meine Augen standen hervor und die Kehle wurde mir so eng, dass ich kaum noch Luft bekam. Auch die Psychologin erstarrte einen Moment lang und ich sah es ihr an, dass sie erschrocken war über