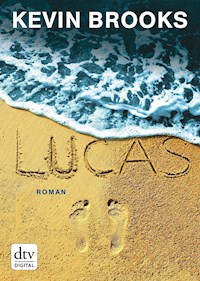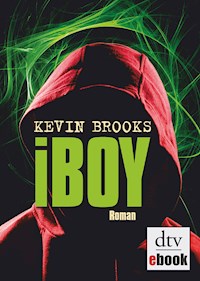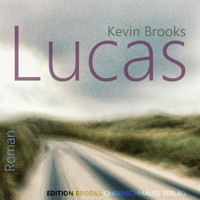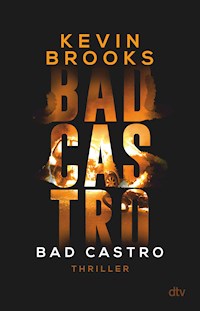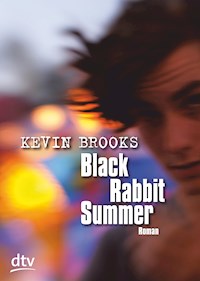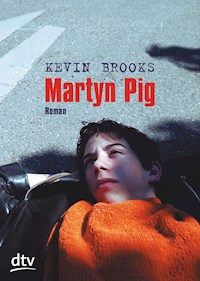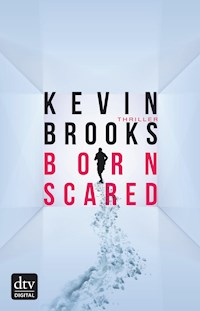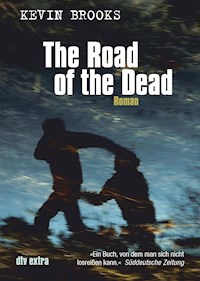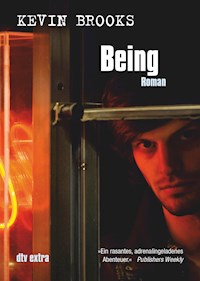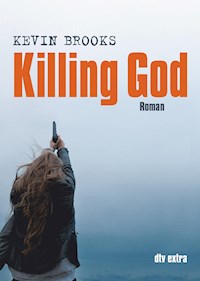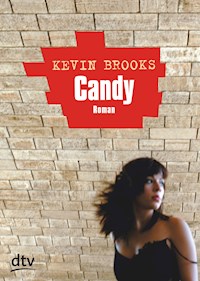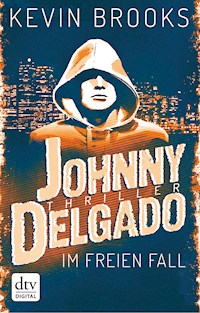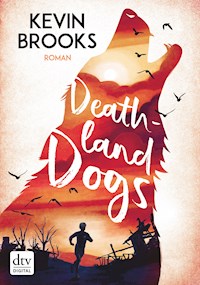
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Pünktlich zum 60. Geburtstag: Das neue Meisterwerk von Kevin Brooks Die Deathlands. Eine öde Wüste, die von wolfsähnlichen Hunden – den Deathland Dogs - beherrscht wird. Das Nomansland am Rande der Deathlands. Hier leben die wenigen verbliebenen Clans, die um die kargen Ressourcen streiten. Jeet ist ein sogenanntes »Dogchild«: Aufgewachsen bei den Deathland Dogs, lebt er seit einigen Jahren wieder unter den Menschen. Doch immer noch sind die Deathland Dogs für ihn seine eigentliche Familie, ihre Instinkte schlummern weiterhin in ihm. Als es zum Kampf zwischen seinen Leuten und dem benachbarten Clan der Dau kommt, soll Jeet sich mittels seiner als »Dogchild« erworbenen Fähigkeiten in die Siedlung der Dau einschleusen. Sein Auftrag: Material für den bevorstehenden Kampf sicherzustellen. Dadurch gerät er unversehens ins Zentrum des Konflikts und ist sich seines Lebens nicht mehr sicher. Doch für eine Flucht ist es bereits zu spät…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 686
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Kevin Brooks
Deathland Dogs
Roman
Aus dem Englischen von Uwe-Michael Gutzschhahn
Unter den zivilisierten Staaten herrscht immer Krieg aller gegen alle.
Nach Thomas Hobbes, Leviathan
Denn Tiere dürfen nicht am Menschen gemessen werden.
Henry Beston, Das Haus am Rand der Welt
Dieses Buch spielt in einer Welt nach dem Untergang unserer heutigen Zivilisation. Nur noch wenige Menschen können lesen und schreiben. Sie tun es in einer reduzierten Form, die im englischen Original mit einer stark vereinfachten Schreibung ausgedrückt wird. Um diese Vereinfachung nachzubilden, wird in der deutschen Fassung komplett auf Kommas verzichtet.
Über den Hintergrund der Schreibung in Original und Übersetzung informiert ein Text auf www.dtv.de
Ich weiß nicht wie ich das machen soll.
Ich sitze hier auf dem Fußboden mein Schreibheft im Schoß und das Weiß der leeren Seite flackert im Licht des Feuers orange. Und ich weiß immer noch nicht wie ich Gun Surs Auftrag erfüllen soll. Wie soll ich eine Beschreibung dieser Welt geben über die ich so wenig weiß? Was weiß ich denn schon über unsere Zeit über unser Leben und über den Krieg? Was weiß ich von alldem und überhaupt?
Es ist kalt. Das weiß ich. In den Nächten ist es immer kalt.
Und wenn die Sonne am Morgen aufgeht die Nachtkälte sich im grellweißen Licht auflöst und die Felsen der Sand und die staubwirbelnde Luft in der sengenden Hitze anfangen zu flimmern und zu glühen ---
Es wird heiß werden.
Auch das weiß ich.
Tagsüber wird es immer heiß.
Und vor allem weiß ich dass morgen die Dau weiter da sein werden – nur 800 Meter hinter dem toten Glasstein des Niemandslands – dass sie uns weiter aufmerksam beobachten und auf den richtigen Moment lauern werden. Dass sie warten auf den Tag für die Erstürmung unserer Mauer. Für das Eindringen in die Stadt und das Abschlachten der Menschen bis auf den Letzten von uns der noch lebt ---
Aber was weiß ich sonst?
Was gibt es sonst noch zu wissen?
Es ist spät und wird mit jeder Minute kälter.
Ich muss schlafen.
Morgen ---
Wenn die Sonne am Morgen aufgeht die Nachtkälte sich im grellweißen Licht auflöst ---
Morgen werde ich zu Starry gehen.
Starry ist nicht einfach nur mein Onkel und mein Ziehvater – der Mann der mich rehumanisiert und mir alles beigebracht hat was ich weiß. Er ist auch der einzige Mensch der mir je etwas bedeutet hat.
Die meisten Männer in seinem Alter – er ist 26 – sind Krieger. Aber Starry wurde vor fast 10 Jahren ausgemustert. Nach einem Kampf mit den Wilden hat er nämlich das linke Bein verloren. Deshalb ist er jetzt nur noch auf die Art Krieger wie wir es alle sind. Jeder von uns muss ständig bereit und in der Lage sein zu kämpfen und niemand läuft je ohne irgendeine Form von Waffe herum. Starry besitzt einen alten Colt Dragoon Revolver den er in einem Holster an der rechten Hüfte trägt. Wahrscheinlich war der Revolver früher mal eine richtig gute Waffe. Doch im Lauf der Zeit wurde er so oft repariert und neu zusammengebaut dass ihn heute fast nur noch Drähte und nicht zueinanderpassende Schrauben und Bolzen zusammenhalten.
Ich besitze keine Schusswaffe. Was ich habe ist eine 90 Zentimeter lange Schleuder an meinem Gürtel sowie ein Messer mit Horngriff und einer 20 Zentimeter langen Klinge das ich in einem Halfter am Schenkel trage.
Es war nicht schwer Starry an diesem Morgen zu finden. Er ist ein Gewohnheitsmensch und geht jeden Morgen bei Sonnenaufgang mit seiner Angelrute zum Strand. Dort hockt er immer auf demselben zerstörten Rest der Strandmauer und versucht zu fangen was das Wasser hergibt – was meistens nicht viel ist.
Es war noch früh als ich hinkam. Die Sonne lichtete erst gerade den Dunstschleier am Horizont. Aber schon jetzt war die Luft schwer von der Hitze und der Gestank des Wassers – eine faulige Mischung aus Salz Öl und verrottendem Fisch – wurde mit der steigenden Temperatur immer schlimmer.
Schon was gefangen? fragte ich Starry während ich auf die Mauer kletterte und mich neben ihn setzte.
Er schüttelte den Kopf. Wird jeden Tag schwieriger Jeet. Alles da draußen stirbt.
Ich schaute hinaus Richtung Meer. Die zerstörte Strandmauer liegt inzwischen nicht mehr so nah an der Wasserkante – je nach Ebbe und Flut zwischen 25 und 40 Meter entfernt. Aber näher ans Wasser zu gehen wäre gefährlich. Der stinkende schwarze Schlick entlang der Uferlinie kann dich blitzschnell in die Tiefe reißen und dazu lauern im Flachwasser auch noch alle möglichen anderen Gefahren. Der große schwarze Kieferfisch jagt gewöhnlich nur im offenen Meer. Doch wenn die Tiere großen Hunger haben kommen sie aus Not manchmal auch näher ans Ufer heran. Und man weiß dass sie ihrer Beute schon mal mit einem Sprung aus dem Wasser hinterherjagen. Aber die viel größere Gefahr stellen die Riesenaale dar. Sie lauern Stunden um Stunden unter der Oberfläche des öligen schwarzen Schlicks und warten mit stumpfsinniger Geduld auf das leiseste Geräusch und die kleinste Erschütterung die ein mögliches Fressen signalisieren könnte – meistens ein Stadthund oder sonst irgendein Aasfresser der am Strand nach Fleischfetzen sucht. Die Aale sind normalerweise Nachtjäger und lassen ihre Beute so dicht wie möglich herankommen ehe sie angreifen. Doch genau wie beim Kieferfisch hängt ihr Verhalten von der Größe ihres Hungers ab und mit den Jahren sind sie immer dreister geworden. Sie jagen jetzt oft auch am Tag und wollen nicht immer lange im Schlick liegen und abwarten. So werden sie mehr und mehr zu aktiven Räubern die aus dem Schlick herausschießen und ihrer Beute rasend schnell hinterhergleiten. Und sie jagen alles was sich bewegt. Ein ausgewachsener Riesenaal ist ein extrem starkes Tier – bis zu 8 Meter lang und 1 Meter dick – und absolut in der Lage einen Menschen zu töten. Und die Aale können sich auch so weit über Land bewegen dass sie die Ränder der Stadt erreichen. Erst vor ein paar Nächten haben sie einen 3-jährigen Jungen nur wenige Meter von seinem Haus entfernt an der Beach Road erwischt.
Genau deshalb angelt Starry immer von demselben 4 Meter langen Stück der zerstörten Strandmauer aus. Es liegt nicht nur in relativer Sicherheit zur Uferlinie sondern ist auch die höchste Stelle aller Mauerreste und erhebt ihn 6 Meter weit über den Strand. Das Einzige was ein Riesenaal nicht kann ist klettern.
Während ich weiter aufs Meer starrte musste ich daran denken wie ich vor ein paar Jahren glaubte dort draußen in großer Entfernung ein Schiff gesehen zu haben das sich langsam am Horizont entlangschob. Damals wusste ich nicht was ein Schiff war. Doch als ich Starry erzählte was ich gesehen hatte – ein langes dunkles Ding groß wie ein Heulerfisch aber so gerade wie ein Brett und mit kleinen rechteckigen Teilen obendrauf und Stangen die in die Luft ragten – hatte er geantwortet dass das nach einem Tankschiff klänge. Und er hatte mir erklärt was ein Tankschiff war und gesagt ich müsse geträumt oder Halluzinationen haben weil alle großen Tankschiffe schon seit Langem nicht mehr existierten. Aber ich wusste genau: Ich hatte es gesehen – wie sollte ich von etwas träumen das ich noch nie beobachtet hatte und das es überhaupt nicht mehr gab? Doch ich behielt meine Gedanken für mich.
Diesmal gab es draußen auf dem Meer nichts zu sehen. Es lag so still da wie immer und der dunkle gelbe Schleier über der Wasseroberfläche machte es unmöglich irgendetwas zu sehen. Nicht einmal der Schwimmer von Starrys langer Angelleine war zu erkennen. Ich sah nur das silberne Glitzern des Sonnenlichts auf der Schnur wie es in dem gelbbraunen Dunst verschwand.
Na Jeet? fragte Starry nach einer Weile. Was kann ich für dich tun?
Nachdem ich ihm erzählt hatte was Gun Sur von mir wollte schwieg Starry eine Weile. Er saß nur da und spähte mit seinen stets vor der Sonne zusammengekniffenen Augen hinaus aufs Meer. Ein leichtes Stirnrunzeln kräuselte seine Brauen.
Nachdem er sich zur Seite gebeugt und eine kleine Fliege von der Zungenspitze gespuckt hatte drehte er sich zu mir um und sagte: Erzähl mir noch mal was Gun Sur über die Schlacht gesagt hat.
Ich antwortete: Er hat gesagt dass wir uns jetzt dem Ende nähern und dass nach der letzten Schlacht nur wir oder die Dau übrig sein werden. Und dass es die Sieger sind die die Geschichte des Krieges aufschreiben – und die werden wir sein. Deshalb muss unsere Geschichte aufgeschrieben werden.
Das waren genau seine Worte?
Ja und danach hat er mir noch gesagt dass er nicht bloß eine Chronik der Schlacht selbst haben will. Vielmehr soll ich in einem schriftlichen Bericht auch die Zeit und das Leben unserer Leute in den Tagen und Wochen vor der Schlacht beschreiben.
Starry nickte nachdenklich.
Ich fragte: Was denkst du hat das zu bedeuten?
Es bedeutet dass Gun Sur endlich die Wahrheit akzeptiert hat.
Welche Wahrheit?
Die Wahrheit die jeder seit Langem kennt: Wir werden bald kein Wasser mehr haben. Es hat jetzt schon seit fast einem Jahr nicht mehr geregnet und die Quelle ist beinahe versiegt. Wenn sich das Wetter nicht bald ändert – und dafür gibt es absolut keine Anzeichen – haben wir demnächst nichts mehr zu trinken.
Starry schwieg einen Moment und konzentrierte sich auf die Angelschnur als wenn er gespürt hätte dass irgendwas anbiss. Doch ein paar Sekunden später schüttelte er den Kopf und redete weiter.
Ohne Wasser können wir nicht überleben. Und wir können auch nicht nach Wasser suchen weil die einzigen nicht versiegten Quellen entweder in den Deathlands liegen oder nördlich von den Dau. Doch wenn wir hier ausharren und einfach weiter auf Regen hoffen werden wir irgendwann zu schwach sein um uns noch zu verteidigen. Deshalb hat Gun Sur entschieden dass es nur eine einzige Option für uns gibt: Wir müssen die Dau jetzt angreifen bevor es zu spät ist – und sie ein für alle Mal vernichten.
Aber wie sollen wir sie denn schlagen? Die sind doch fast 5-mal so viele wie wir. Sie haben mehr Krieger als wir. Mehr Waffen und Munition. Eine bessere Ausrüstung – wenn wir versuchen das Niemandsland zu überqueren haben wir nicht einmal nachts die geringste Chance. Sie werden jeden Einzelnen von uns erspähen und abknallen wie wie --- wie heißt das noch mal?
Lockenten. Starry sagte es mit einem gequälten Lächeln.
Wir können froh sein wenn wenigstens ein paar lebend das Lager erreichen.
Starry sagte nichts sondern nickte nur.
Ich überlegte. Gun Sur muss irgendeinen Plan haben.
Starry nickte wieder und diesmal sah er mich an. Egal was du von ihm hältst – und es gibt ja viele die glauben er hätte ausgedient: Aber der Marshal ist kein Idiot. Er hat bestimmt einen Plan. Wahrscheinlich arbeitet er seit Monaten dran. Vielleicht schon seit Jahren. Die Frage ist nur worin dieser Plan besteht und ob er gelingen kann.
Als Starry wieder hinaus aufs Meer schaute wusste ich nicht ob er über Gun Sur nachdachte oder sich bloß auf seine Angelschnur konzentrierte. Doch wie auch immer – am besten wartete ich einfach ab. Und genau das tat ich. Ein paar Minuten später holte er tief Luft und stieß einen Seufzer aus. Dann drehte er sich zu mir um legte mir seine Hand auf die Schulter schaute mir in die Augen und sagte:
Ich bin stolz auf dich Jeet.
Wieso?
Gun Sur hätte jeden für den Bericht auswählen können. Aber das hat er nicht. Er hat dich gewählt.
Nur weil ich schreiben kann.
Andere können auch schreiben. Nicht viele vielleicht aber er hat trotzdem dich genommen.
Weil ich jünger bin als sie. Deshalb werde ich wahrscheinlich lange genug leben um den Bericht zu Ende zu schreiben.
Nein. Er hat dich gewählt weil du außerhalb stehst. Du bist nicht so wie wir andern und das gibt dir einen klareren Blick auf die Welt.
Weil ich ein Hundskind bin?
Du bist etwas Besonderes Jeet. Vergiss das nicht.
Starry tätschelte meine Schulter und wandte sich wieder der Angelschnur zu.
Er zog die Schnur ein paar Zentimeter nach oben. Schließlich fragte er: Wie kommst du an deine Schreibsachen? Ich hab noch irgendwo ein paar von diesen alten Bleistiftstummeln und ein paar Reste Papier. Aber das reicht nie und nimmer für –
Gun Sur hat mir ein Schreibheft gegeben.
Starry drehte sich mit einem erstaunten Blick zu mir um.
Ich weiß sagte ich. Ich konnte es auch gar nicht glauben. Ist ein komplettes Heft. Etwa 100 Seiten stark so wie ein ganzes Buch – und alle Seiten sind leer. Außerdem hat er mir noch 2 Bleistifte gegeben. Keine Stummel sondern komplette Stifte.
Starry schüttelte verblüfft den Kopf. Wo hat er denn das Heft und die Stifte her?
Hab ich ihn nicht gefragt. Er hat nur gemeint ich soll sie nicht verschwenden.
Starry starrte mich eine Weile weiter an mit einem Blick ungläubigen Staunens. Dann schüttelte er den Kopf und richtete seine Aufmerksamkeit wieder aufs Meer. Ich schwieg eine Zeit lang schaute bloß auf den endlosen Schleier aus Ozean und Himmel und horchte verwundert auf das riesige hohle Schweigen ---
Dann drehte ich mich zu Starry um und erzählte ihm von meinen Sorgen.
Ich erzählte ihm die Wahrheit – dass ich keine Ahnung hatte wie ich Gun Surs Auftrag erfüllen sollte. Ich wusste einfach nicht was und wie ich es schreiben sollte. Ich wusste nicht ob ich bloß die Fakten wiedergeben sollte so wie ich sie kannte oder ob ich auch etwas von mir aufnehmen durfte – meine eigene Geschichte meine Gedanken meine Gefühle – und mir war auch nicht klar wie ich von all dem berichten sollte worüber ich nichts wusste ---
Ich sagte zu Starry: Ich weiß noch nicht einmal wo ich anfangen soll.
Hat Gun Sur was gesagt welche Form der Bericht haben soll?
Er hat nur gesagt dass ich alles aufschreiben soll.
Dann würde ich an deiner Stelle einfach die Geschichte all dessen erzählen was ich weiß. Ich würde mich selbst beschreiben und meine Welt – den Ort die Leute und wie alles ist – und ich würde mir absolut keine Gedanken machen über das was ich nicht weiß oder nicht verstehe. Wenn ich damit fertig wäre – und glaub mir Jeet du weißt eine Menge mehr als du denkst – wäre ich in einer viel besseren Lage als am Anfang. Ich könnte all jene Dinge neu einschätzen von denen ich nichts zu wissen glaubte.
Danach lächelte Starry still in sich hinein. Es war ein Lächeln das ich nur zu gut kannte – ein Lächeln der Zufriedenheit. So lächelt er wenn er sich freut weil er etwas besonders gut ausgedrückt hat. Ich sehe immer gern wenn er lächelt. Starrys Herz ist voller großer Trauer und er hat jedes Glück verdient das er finden kann.
Und dann fuhr er fort: Wenn ich alles herausgefunden hätte was ich wirklich wissen muss würde ich anfangen meine Fragen zu stellen.
Und wen würdest du fragen?
Also du weißt ja dass du immer mich fragen kannst Jeet. Ich werde dir helfen so gut ich kann. Doch wenn du das hier ordentlich machen willst musst du die Ältesten fragen. Natürlich musst du dir im Klaren sein dass manches von dem was sie dir erzählen werden verworren und mythisch verbrämt oder sogar absolut unwahr sein wird. Trotzdem sind sie die Einzigen die alles über unsere Vergangenheit wissen.
Und wenn du ich wärst und du so viele Informationen wie möglich gesammelt hättest: Wie würdest du das Ganze zusammensetzen?
Wie immer es aus dir heraussprudelt antwortete er. Solange es die Geschichte erzählt ist alles in Ordnung.
Aber das genau ist das Problem. Ich weiß nicht wie ich die Geschichte erzählen soll. Ich weiß nicht wie ich die Dinge in Worte fassen soll.
Schließ deine Augen sagte er.
Was?
Schließ deine Augen.
Ich schloss sie.
Und jetzt erzähl mir alles was du hören fühlen riechen und schmecken kannst. Denk nicht drüber nach. Spür es einfach und sprich es aus.
Ich tat was er sagte und beschrieb das Gefühl der Hitze auf meiner Haut den Geruch des Meers der Luft und des Strands. Ich beschrieb das leise murmelnde Pfeifen des Seewinds und den Geschmack den er mir in die Kehle blies. Den Geschmack von Salz und Staub Schlick und Verwesung.
Und jetzt öffne deine Augen sagte Starry und erzähl mir was du siehst.
Ich sagte: Den Strand das Meer die Klippen den Himmel die Sonne ---
Welche Farbe hat das Meer?
Ich zögerte und schaute genau hin.
Nicht drüber nachdenken erinnerte er mich. Sag mir einfach was du siehst. Welche Farbe hat das Meer?
Dunkel. Eine Art grünliches Schwarz.
Und der Strand?
Braun. Sandfarben mit Flecken von öligem Schwarz --- und am Fuß der Mauer ist er irgendwie kieselig grau und weiß.
Und wie fühlt sich das an?
Was?
Das Ganze. Wie fühlt es sich für dich an?
Wie wenn es alles ist was ich kenne --- wie wenn es stirbt.
Fertig sagte Starry und lächelte mich an.
Was meinst du mit fertig?
Mehr musst du nicht tun. Nimm alle Gefühle aus deinem Herzen und deiner Seele und setz sie in Worte um. Du kannst das. Du hast es ja gerade getan. Es ist ganz einfach.
Ich nickte zögernd – noch nicht vollständig überzeugt dass es wirklich so einfach war wie er sagte. Doch zumindest schien die Vorstellung einen Bericht zu schreiben nicht mehr ganz so unmöglich. Aber ich brauchte noch etwas anderes von Starry. Etwas das er mir nicht würde erfüllen wollen. Doch ich brauchte es. Ich wusste nicht wieso ich es brauchte aber ich brauchte es. Es zu tun wäre schmerzlich für Starry. Das wusste ich. Und ich hasste mich dafür ihn drum bitten zu müssen. Doch es ging nicht anders.
Was hast du? fragte er als er den Kummer in meinem Gesicht sah.
Ich schaute ihn an. Es gibt etwas worum ich dich bitten muss --- bevor ich irgendwas anderes anfange.
Und worum geht es?
Ich will dass du mir meine Geschichte erzählst.
Deine Geschichte?
Den Angriff der Wilden und der Hunde ---
Ich sah den Schmerz und die Trauer in seinen Augen.
Tut mir leid sagte ich. Ich weiß dass es nicht fair ist von mir dich darum zu bitten. Und dass du fragen wirst wieso ich es von dir hören muss wo ich doch alles selber weiß oder zumindest das meiste. Es ergibt auch für mich keinen Sinn. Aber irgendwie muss ich es einfach ---
Schon gut sagte er leise. Ich verstehe.
Ja?
Er nickte. Du musst wissen wer du bist wo du herkamst und wie du hier gelandet bist. Erst dann kannst du anfangen andern zu erzählen was und wo hier ist.
Aber ich weiß ja schon wo ich herkam und wie ich hier hingekommen bin. Ich kenne meine Geschichte.
Du kennst die Innenseite. Die Geschichte aus deiner Sicht betrachtet. Aber du musst auch die andere Seite kennen. Die Geschichte aus Sicht der Außenwelt.
Ich wusste nicht was ich darauf antworten sollte. Ich war mir nicht sicher ob ich verstand was er meinte. Aber gleichzeitig wusste ich irgendwie dass er recht hatte.
Er blinzelte in die Sonne dann senkte er den Kopf und starrte eine Weile in den Sand --- einfach nur blind in den trockenen roten Staub ---
Und dann fing er an mir meine Geschichte zu erzählen.
Er wurde als der Lange Marsch bekannt erklärte mir Starry. Er begann vor so langer Zeit dass es keinen mehr gibt der mit Sicherheit sagen kann wo er losging. Doch die meisten der Ältesten glauben er begann als taktischer Rückzug aus einer Schlacht mit den Dau und war ursprünglich als befristete Maßnahme geplant. Als Möglichkeit für unsere Leute sich neu zu formieren und ihre Chancen neu zu überdenken. Doch aus irgendeinem Grund konnten sie keinen sicheren Ort finden um ihr Quartier aufzuschlagen. Deshalb mussten sie immer weitergehen in der Hoffnung irgendwann einen geeigneten Ort zum Verkriechen zu entdecken und dort eine Weile lagern zu können bis sie genügend Kräfte gesammelt hätten um den Kampf gegen die Dau wieder aufzunehmen --- doch dazu kam es nie. Sie fanden nie den richtigen Ort – oder wenn dann wurden sie von den Dau bald wieder vertrieben – und am Ende ging der Rückzug einfach immer weiter. Er wurde zum Dauerzustand. Es gab nichts anderes mehr als einen jahrzehntelangen Exodus quer durch die Deathlands auf der Suche nach einem Ort der Zuflucht.
Starry unterbrach sich für einen Moment um seine Gedanken zu ordnen. Dann fuhr er fort.
Wieder kennt niemand die Wahrheit doch die zuverlässigsten Schätzungen gehen von 2000 bis 3000 Leuten aufseiten der Dau zu Beginn des Langen Marschs aus. Unsere Leute waren etwa 1000 Mann stark. Zu der Zeit streiften noch immer Scharen von Wilden durch die Deathlands aber wahrscheinlich waren es höchstens ein paar 100. Und soweit man weiß war das alles was es an Menschen noch gab. Natürlich kann niemand mit Gewissheit sagen ob nicht irgendwo auf der Erde noch andere existierten. Doch damals gab es keine Hinweise darauf und es gibt sie bis heute nicht. Die rund 4000 Menschen die zu Beginn des Langen Marschs noch existierten waren höchstwahrscheinlich die einzigen Überlebenden.
Er unterbrach sich wieder kurz und kratzte sich gedankenverloren am Kopf.
Ich weiß nicht wie viele Wagen und Pferde unsere Leute hatten als der Lange Marsch begann. Doch als ich geboren wurde waren es höchstens noch eine Handvoll Pferde und vielleicht 25 oder 30 Wagen. Auch damals schon mussten also die meisten Wagen von Menschen gezogen werden ---
Er lächelte traurig vor sich hin.
Als Kind hatte ich immer Angst vor den Pferden. Ich hielt sie für Monster – schmutzige und übel riechende Bestien mit bösen Augen abgemagert bis auf die Knochen übersät mit triefenden Wunden und Wolken von Schmeißfliegen. Doch natürlich waren sie keine Monster. Sie waren einfach nur bemitleidenswert wie wir alle – ausgehungert krank und ständig am Ende ihrer Kräfte. Wir kämpften alle bloß noch ums Überleben. Die Deathlands hatten ihren Preis gefordert. Das Land war einfach nur tot und leer. Einfach nur Tausende Kilometer Nichts: riesige Ebenen aus hartem schwarzem Glasstein oder aus Asche und Staub wo nichts wächst und praktisch nichts leben kann --- keine Pflanzen kein Gras keine Bäume. Es gab nur tote Wälder aus verkohlten Baumstummeln. Die grellweiße Sonnenhitze glühte den ganzen Tag und die Nächte waren so kalt dass sich das Eis in unsere Knochen fraß --- es ist ein Wunder dass überhaupt jemand von uns das überlebt hat. Aber irgendwie schafften wir es. Wir liefen einfach weiter taumelten dahin in der Hoffnung dass wir vor dem Versiegen unserer Reserven das nächste Wasserloch erreichen würden --- und dann wenn wir Glück hatten unseren Durst stillen und vielleicht eine kurze Weile ausruhen könnten. Aber nur sofern uns die Dau nicht zu dicht auf den Fersen waren ---
Er unterbrach sich wieder und spähte zur Uferlinie.
Was ist? fragte ich und folgte seinem Blick.
Ich dachte ich hätte etwas im Schlick gesehen.
Einen Aal?
Weiß nicht. Ich dachte nur dass ich etwas gesehen hätte – irgendwas das sich bewegt.
Die nächsten paar Minuten saßen wir schweigend da starrten nach vorn und suchten den schwarzen Schlick nach irgendeinem Anzeichen von Bewegung ab. Doch es gab nichts. Nicht mal eine Luftblase. Aber als Starry weitersprach blieben wir trotzdem wachsam.
Egal sagte er. Wo war ich stehen geblieben?
Bei den Wasserlöchern antwortete ich.
Er nickte. Es gab nur wenige und sie lagen weit auseinander. Die meisten waren nichts als tote Schlammlöcher mit gerade so eben genug Wasser um uns am Leben zu halten. Es gab nur ganz wenige Stellen mit gutem Wasser und versprengtem Leben: kleine Grünflecken Blätter die aus verkohlten Baumstummeln wuchsen und kleine Tiere und Vögel.
Doch im Großen und Ganzen sah man nur äußerst selten andere Lebewesen in den Deathlands --- bis auf die Hunde natürlich. Die Rudel der Deathland Dogs waren immer da. Sie folgten uns ständig. Tagsüber hielten sie Abstand und wagten sich nie in Schussweite aber nachts waren sie dreister. Wir mussten Wachen aufstellen denn sie stahlen alles: Essen Knochen Fell- und Lederstücke ja sogar Holzreste. Und wenn die Viecher ein krankes Pferd oder ein unbewachtes Kind erwischen konnten ---
Starry zögerte als ob er sich plötzlich erinnerte mit wem er sprach.
Tut mir leid Jeet. Ich wollte dich nicht –
Wir müssen alle essen sagte ich und meine Stimme klang kälter als ich beabsichtigt hatte.
Ich weiß. Ich wollte nur sagen –
Ist klar. Schon gut. Erzähl weiter.
Nach einem kurzen Schweigen fuhr er fort.
Zu der Zeit als wir die Black Mountains erreichten hatten wir keine Pferde mehr. Das letzte war schon lange vorher gestorben. Auch fast alle unsere Leute waren in den Deathlands gestorben. Von den etwa 1000 die den Langen Marsch angetreten hatten waren nur noch weniger als 200 übrig als wir die Berge erreichten --- und von diesen 200 waren viele während des Marschs geboren worden. Deine Mutter dein Vater du und ich --- wir alle waren Kinder des Marschs. Und wir zählten zu den Glücklichen. Die meisten die in den Deathlands geboren wurden überlebten nicht. Auch die Dau waren nicht besser dran --- sie erlitten die gleichen Verluste wie wir. Zum Zeitpunkt des Überfalls waren sie nur noch weniger als 1000 und auch ihre Pferde waren längst alle tot.
Er schwieg wieder und schaute eine Weile mit leerem Blick auf die Uferlinie dann fuhr er mit der Geschichte fort.
Der Canyon war der einzige Weg durch die Berge. Es gab zwar Pfade die die Berge hinauf- und über sie hinwegführten doch die waren zu steil und zu heimtückisch für die Wagen. Und wenn wir uns für den Weg außen um die Berge herum entschieden hätten wären wir wesentlich länger unterwegs gewesen. Die Dau waren uns dicht auf den Fersen. Wenn wir um die Berge herumgelaufen und die Dau direkt durch den Canyon gegangen wären hätten sie viel Zeit wettgemacht und uns wahrscheinlich sogar überholt. Dann hätten sie auf der anderen Seite bloß noch in einem Hinterhalt warten müssen um uns restlos zu vernichten. Der Canyon war also unsere einzige Chance. Wir wussten dass er gefährlich war – ein perfekter Ort für einen Überfall. Unsere Kundschafter hatten in den Bergen Spuren der Wilden gesichtet. Doch zu dem Zeitpunkt gab es von ihnen nur noch ganz wenige und ihre Banden umfassten sowieso nie mehr als ein Dutzend Leute. Solange wir zusammenblieben wäre es für sie Selbstmord gewesen uns anzugreifen. Aber unglücklicherweise hatten wir sie unterschätzt. Wir wussten dass sie grausam und wild waren. Doch unser Fehler war dass wir Wildheit mit Dummheit gleichsetzten – und dieser Fehler hatte fatale Folgen.
Starry schüttelte den Kopf und für einen Moment spürte ich seine tief im Innern zurückgehaltene Wut. Aber sie flackerte nur kurz auf und war fast schon im selben Moment wieder verschwunden. Und als er fortfuhr – den leeren Blick noch immer starr auf die Uferlinie gerichtet – klang er bloß traurig und resigniert.
Der Canyon war knapp 5 Kilometer lang und an den meisten Stellen etwa 40 Meter breit. Doch es gab auch ein paar erheblich engere Abschnitte. Die großen schwarzen Berge ragten so hoch auf dass die steilen Canyonwände kaum Licht hereinließen. Obwohl es heller Tag war schien es daher manchmal so dunkel wie in der tiefsten Nacht.
Starry schloss die Augen und ich wusste er spielte die Szene noch einmal vor seinem inneren Auge ab. Ich wartete dass er fortfuhr doch er schwieg weiter. Vollkommen still und mit geschlossenen Augen saß er da ganz und gar in seinen Gedanken versunken.
Wie alt warst du damals? fragte ich ihn leise.
Das Geräusch meiner Stimme ließ ihn die Augen aufschlagen. Er blinzelte und rieb sich die Lider.
Was? fragte er.
Wie alt du damals warst?
Ich war 16 ---
Er presste die Augen einen Moment lang fest zu. Dann öffnete er sie wieder und schüttelte den Kopf als wenn er etwas aus seinem Gehirn vertreiben wollte.
Ich war 16 wiederholte er. Kesra dein Vater war 15 und meine Schwester Pooli – deine Mutter – war 13. Du selber warst gerade erst ein paar Monate auf der Welt. Wir befanden uns alle beim selben Wagen. 3 von uns zogen ihn – Kesra sein Cousin Rahmat und ich. Pooli saß hinten mit dir und einem anderen Baby das Jele hieß. Jeles Mutter war bei der Geburt gestorben und Pooli kümmerte sich um das Kind. Es gab ein Problem mit der Vorderachse des Wagens und wir hatten ein paarmal anhalten müssen um sie zu reparieren. Als wir den Punkt erreichten an dem der Überfall geschah lagen wir deshalb ein gutes Stück hinter den anderen Wagen zurück. Es war der engste Teil des Canyons den wir bis dahin gesehen hatten. Gerade breit genug dass sich ein Wagen durchzwängen konnte. Zuerst war ich froh als ich es sah. Wenn sich alle Wagen hintereinander durch die Schlucht schlängeln mussten dann würde es eine Verzögerung geben und wir könnten zu den anderen aufschließen. Und sobald wir das Ende der Wagenschlange erreichten würden wir sogar Zeit haben ein wenig auszuruhen. Doch je näher wir dem Pass kamen desto unwohler wurde mir. Ich wusste nicht recht wieso aber irgendwas schien nicht in Ordnung. Ich kam nicht darauf was es war und schaute wieder und wieder in alle Richtungen – nach hinten nach oben nach vorn – um zu sehen was mich beunruhigte. Doch alles wirkte vollkommen normal auch als wir schließlich das Ende des Zuges erreichten. Kesra merkte dass ich mir Sorgen machte und wollte wissen was ich hatte. Aber gerade als er den Mund aufmachte fuhr der Wagen vor uns an und rollte durch die Wegenge. Wir spannten uns wieder ins Geschirr und zogen unseren Wagen nach vorn. Während der Wagen hinter uns langsam durch den schmalen Hohlweg holperte sah ich mich weiter um. Doch dann fand ich dass ich meine Sorge endlich aufgeben könnte. Selbst wenn es etwas gab das ich übersehen hatte – bald hätten wir die Passstelle ja überwunden. Und wenn wir erst drüben bei den anderen wären könnte uns nichts mehr passieren.
Starry schwieg erneut und stieß einen Seufzer aus. Dann redete er weiter.
Wir näherten uns gerade der engsten Stelle als ich plötzlich begriff was mir die ganze Zeit Kopfzerbrechen gemacht hatte. Wenn man ganz genau hinschaute sah man dass irgendwas an den Steilwänden des Canyons nicht stimmte. So wie einige der Felsbrocken und Steine lagen – sie waren einfach zu kipplig und viel zu sauber ausbalanciert. Wenn sie von Natur aus so dagelegen hätten wären sie bereits vor Jahren herabgestürzt. Sobald ich begriff was das hieß riss ich den Mund auf um einen Warnruf auszustoßen. Doch es war schon zu spät. Plötzlich erscholl von irgendwo über uns ein markerschütternder Schrei – das Signal der Wilden zum Angriff – und im nächsten Moment hörten wir nur noch das heftige Grollen und Donnern riesiger Felsbrocken und Steinplatten die in den Canyon stürzten und die Luft mit Staubwolken erfüllten.
Starry schüttelte wieder langsam den Kopf.
Es war wie das Ende der Welt Jeet --- als ob der ganze Berg auf uns herabstürzen würde --- und es schien ewig zu dauern. Die Luft war schwarz von Staub. Ich konnte nicht sehen nicht atmen --- alles dröhnte und krachte um mich herum --- und ich erinnere mich an das Kreischen und Johlen der Wilden als sie die Felswände des Canyons heruntergestürmt kamen. Sie schrien wie die Teufel --- und dann krachte mir etwas gegen den Schädel. Ich weiß nicht was es war – ein durch die Luft fliegendes Felsstück oder ein Stein aus der Schlinge eines Wilden --- doch es warf mich zu Boden und einen Moment lang verlor ich das Bewusstsein --- und als ich wieder aufwachte ---
Er zögerte. Kämpfte mit seiner Erinnerung.
Ich erinnere mich nicht richtig was danach war. Alles versank in einem Wirrwarr aus Staub und Dunkel und schaurigen Schreien ---
Er seufzte wieder.
Erst viel später fand ich heraus mit wie viel Sorgfalt und Präzision die Wilden ihren Überfall geplant hatten. Er hätte perfekt funktioniert wenn da nicht die Hunde gewesen wären. Durch den Bergrutsch den die Wilden ausgelöst hatten war der Hohlweg komplett blockiert. Das isolierte uns von den andern ohne dabei groß unseren Wagen zu beschädigen. Sie wussten genau was sie taten. Indem sie uns vom Rest unserer Leute abschnitten machten sie den einen großen Vorteil von uns zunichte – unsere zahlenmäßige Überlegenheit. Sie waren nicht mehr in Unterzahl. Niemand weiß genau wie viele Wilde an dem Überfall beteiligt waren – ich habe nicht einen von ihnen gesehen – doch inzwischen ist man übereingekommen dass es wohl nur etwa 7 oder 8 gewesen sind. Aber wir waren bloß 4 – zusammen mit Pooli. Dazu kam das Überraschungsmoment das die Position der Wilden noch verstärkte. Wir hatten überhaupt keine Chance. Doch das fand ich wie gesagt erst später heraus. In dem Moment war ich so benommen und verwirrt – und zu Tode erschreckt – dass ich nur noch durch den Staub taumelte ohne zu wissen wohin. Ich lief einfach instinktiv auf den Pass zu oder zumindest dorthin wo ich ihn vermutete ---
Als Starry schwieg kurz die Augen schloss und erneut einen erschöpften Atemzug ausstieß wusste ich was er als Nächstes erzählen würde. Ich spürte es kommen --- spürte wie die ewig währende Schuld und Trauer wieder in ihm aufstieg.
Ich habe nicht eine Sekunde daran gedacht irgendwem zu helfen sagte er leise. Kesra Pooli du Rahmat --- ich habe euch einfach eurem Schicksal überlassen. Die Idee bei meiner Familie zu bleiben und mit ihnen zu kämpfen --- sie kam mir überhaupt nicht in den Sinn.
Er wischte sich eine Träne aus dem Auge.
Ich habe euch alle dem Tod überlassen murmelte er.
Du konntest nicht klar denken erklärte ich ihm so wie ich es schon Hunderte Male zuvor getan hatte. Du hattest das Bewusstsein verloren. Du hattest eine Gehirnerschütterung –
Ich war ein Feigling.
Ich schwieg. Wir hatten das schon so oft besprochen dass es nichts mehr zu sagen gab. Er ließ sich nicht umstimmen. Und außerdem – auch darüber hatte ich unzählige Male nachgedacht – konnte ja sein dass er recht hatte. Vielleicht war er an dem Tag wirklich ein Feigling gewesen.
Doch selbst wenn habe ich ihm das nie vorgehalten.
Wir sind was wir sind.
Dann wischte sich Starry wieder die Augen trocken räusperte sich und redete weiter.
Vor lauter Staub konnte ich überhaupt nichts sehen. Deshalb wusste ich nicht dass der Canyon durch den Bergrutsch komplett dicht war. Erst als ich gegen die Mauer aus Felssteinen stieß bemerkte ich sie überhaupt. Und genau in dem Moment als sich der Staub einen Moment lang lichtete und ich den großen Felshaufen vor mir erkannte traf mich der erste Pfeil. Zuerst wusste ich nicht was es war. Ich spürte nur einen heftigen Stich in meinem Schenkel. Und als ich nach unten schaute sah ich das gefiederte Ende eines Pfeils das aus dem Bein ragte. Es tat nicht übermäßig weh – jedenfalls erinnere ich mich nicht an einen größeren Schmerz – und als ich anfing die Felsbrocken hochzuklettern und mich dabei ein zweiter Pfeil in den Arm traf behinderte mich selbst das nicht groß. Ich machte einfach weiter und kletterte blind nach oben. Dabei nahm ich die Kampfgeräusche von unserem Wagen – das Kreischen und Rufen Weinen und Jammern – nur vage wahr. Auch die gedämpften Rufe von der anderen Seite des Bergsturzes erreichten mich kaum. Das alles gehörte zu einer anderen Welt. Meine Welt war bloß die staubige Stille der herabgestürzten Felsbrocken. Das Gefühl des Gesteins unter meinen Händen und Füßen und der absolute und einzige Wunsch in mir weiterzumachen am Leben zu bleiben weiterzumachen weiterzumachen weiterzumachen ---
Er schwieg wieder und starrte in die Ferne. Nach einer Weile blinzelte er schwer und fuhr mit hohler Stimme fort.
Das Nächste was ich mitbekam war dass ich hinten in einem fahrenden Wagen lag und dass man mir mein Bein abgenommen hatte. Das war nur wenige Tage nach dem Angriff doch die Pfeilwunde hatte sich so schnell entzündet dass ich ohne die Amputation gestorben wäre. Ich war immer noch sehr krank lag im Fieber und halluzinierte. Daher fand ich erst einige Zeit später heraus was eigentlich geschehen war. Der Rest unserer Leute – die die vor dem Überfall den Hohlweg passiert hatten – hatte den Angriff sofort bemerkt. Und sobald keine Steine mehr herabstürzten hatten sie alles darangesetzt uns zu retten und waren schnellstmöglich über die Blockade geklettert. Doch da war es schon zu spät. Der Wagen verschwand bereits in der Ferne. Er bewegte sich mit einigem Tempo und weit und breit gab es kein Zeichen von euch. Deine Eltern Rahmat du und Jele --- ihr wart alle weg. Man nahm an dass ihr in dem Wagen wart – die 3 Männer mit Sicherheit tot und der Rest von euch hoffentlich noch am Leben.
Starry sah mich an.
Es war ziemlich klar dass die Wilden dich und Jele als ihre eigenen Kinder großziehen und deine Mutter zur Fortpflanzung behalten würden.
Und mein Vater und Rahmat waren bloß Frischfleisch ergänzte ich.
Starry nickte. Die Wilden kannten jeden Winkel der Berge und mit Sicherheit hatten sie auch ihre Fluchtroute genau geplant. Wenn sie den Canyon erst mal verlassen hatten und in die Berge verschwunden waren würde man sie nie mehr finden. Deshalb folgten ihnen unsere Leute. Sie rannten so schnell sie konnten. Doch sie müssen gewusst haben dass es sinnlos war und sie die Wilden niemals einholen würden. Trotzdem gaben sie die Hoffnung nicht auf und liefen weiter --- und dann plötzlich sahen sie wie der Wagen scharf zur Seite ausscherte fast umkippte und stehen blieb. Das geschah in 500 Metern Entfernung und zunächst wussten unsere Leute nicht was passiert war. Doch dann entdeckten sie die Hunde. Es waren Dutzende – mindestens 30 oder 40. Das größte Rudel von Deathland Dogs das je ein Mensch gesehen hat. Sie waren wie aus dem Nichts aufgetaucht. Im einen Moment war überhaupt nichts gewesen und dann plötzlich waren sie überall. Sie machten sich über die Wilden und über den Wagen her wie eine Horde rasender Dämonen. Ob sie der Blutgeruch angelockt und in einen Rausch versetzt hatte oder ob sie einfach wahnsinnig waren vor Hunger ---
Er warf mir einen Blick zu als ob er eine Antwort suchte.
Ich zuckte nur mit den Schultern.
Was immer es war – bis unsere Leute den Wagen erreichten war praktisch nichts mehr da. Die Hunde waren verschwunden. Die Wilden waren verschwunden. Deine Eltern du und Jele --- einfach nicht mehr da. Es gab nur noch den mit Blut verschmierten Wagen ein paar Fetzen Fleisch und Wolken von Fliegen die in der Hitze summten.
Er wischte sich den Schweiß von der Stirn.
Unsere Leute fanden mich auf ihrem Rückweg. Ich war ohnmächtig geworden und in einen Spalt zwischen den Felsbrocken gestürzt. Zum Glück hörte einer unserer Männer ein leises Stöhnen als er wieder auf die andere Seite kletterte. Sie zogen mich heraus trugen mich über den Bergsturz zurück ---
Starry drehte sich zu mir um und sah mich an.
Und das war es so in etwa sagte er. Das ist alles was ich über die Geschichte weiß oder zumindest so viel wie ich im Moment verkrafte. Der Rest ist deine Sache Jeet. Und nur du kannst ---
Er unterbrach sich plötzlich – seine Aufmerksamkeit wurde in Richtung Strand gezogen und er fluchte heftig vor sich hin. Ich musste nicht fragen was er gesehen hatte. Ich konnte es selber sehen. Ein kleines Mädchen von höchstens 3 Jahren war wie aus dem Nichts auf dem Strand aufgetaucht. Sie schlenderte in Richtung Uferlinie und blieb ab und zu stehen um Steine aufzulesen die ihr gefielen.
Das ist Sheren murmelte Starry. Laolys kleines Mädchen.
Sie war versunken in ihrem eigenen kleinen Glück. Vollkommen blind gegen mögliche Gefahren und sich kein bisschen des riesigen schwarzen Kopfs bewusst der sich aus dem öligen Schlick erhoben hatte – eines Kopfs von dem der schwarze Schlamm herabtropfte und dessen kleine gelbe Augen funkelten wie Glas. In dem halb offen stehenden Maul zeigten sich ganze Reihen von blendend weißen nadelspitzen Zähnen.
Gerade als Starry den Mund öffnete um Sheren zu warnen stieß sich der Riesenaal aus dem schwarzen Schlick und schoss über den Strand auf das kleine Mädchen zu.
Als ich von der Mauer sprang und über den Strand jagte übernahm der Hund in mir die Führung – er schärfte meine Sinne und ich sah und hörte alles gleichzeitig und in absoluter Klarheit. Ich sah die kleine Sheren die von Starrys Warnruf aufgeschreckt erst zu ihm hochschaute und dann merkte ich wie ich auf sie zulief. In ihr vorher so seliges Gesicht traten Verwirrung und Unsicherheit. Und schließlich – als sie den Aal hörte oder spürte sich umblickte und ihn pfeilschnell über den Strand auf sich zujagen sah – verwandelte sich die Unsicherheit in schiere Panik. Der Aal war etwa 6 Meter lang und 60 Zentimeter dick und bewegte sich unglaublich schnell. Er schlängelte nicht und er glitt nicht sondern schoss über den Sand wie ein großer schwarzer Speer. Plötzlich hörte ich einen Schrei – nicht von Sheren sondern von einer 15- oder 16-jährigen Frau die gerade oben am Strand aufgetaucht war. Es war Sherens Mutter Laoly. Sheren fuhr herum als sie den Schrei hörte und Laoly fuchtelte wild mit den Armen und rief ihrer Tochter zu sie solle rennen. Doch Sheren war in Schockstarre und konnte sich nicht rühren.
Hinter mir knallte ein lauter Schuss.
Starrys Pistole.
Sie funktionierte noch.
Der Aal jagte weiter.
Ich rannte weiter.
Ich hatte jetzt mein Messer in der Hand und rannte so schnell dass meine Füße kaum den Boden berührten. Doch ich würde es nicht schaffen. Trotz meiner Geschwindigkeit – ich war 10-mal schneller als jeder Mensch auch wenn ich mit den Hunden beim äußersten Tempo nie hatte mithalten können – war der Aal einfach überlegen. Und er war schon viel dichter an Sheren dran.
Ich war jetzt vielleicht noch 10 Meter von ihr entfernt.
Der Aal keine 5 Meter.
Ich hörte noch einen weiteren Schuss doch diesmal klang er verkehrt – zu locker und knackend – und im selben Moment hörte ich einen Schmerzensschrei von Starry. Ich wusste was passiert war – der alte Dragoon-Revolver war in seiner Hand explodiert – doch ich dachte nicht bewusst an Starry. Der Aal hatte jetzt Sheren fast erreicht. Sie stand noch immer wie angewurzelt da. Sie war völlig erstarrt und gab nicht mal einen Laut von sich. So als wüsste sie dass es vorbei war. Die Schreie ihrer Mutter hatten sich in ein hoffnungsloses Schluchzen verwandelt.
Als der Aal fast über Sheren war überlegte ich kurz ob ich mein Messer werfen sollte. Doch er bewegte sich so schnell dass ich selbst auf kurze Distanz nicht hätte sicher sein können ihn wirklich voll am Kopf zu treffen – die einzige Möglichkeit ihn aufzuhalten. Und wenn ich das Messer warf und nicht traf war die einzige Chance ihn zu töten vertan. Wahrscheinlich war sie das sowieso. Der riesige Aal stürzte sich jetzt mit weit aufgerissenem Maul auf Sheren während ich immer noch ein paar Schritte entfernt war.
Ich nutzte meine einzige Chance und stieß mich so fest ich konnte vom Boden ab hechtete Richtung Aal und schleuderte die Messerklinge in die Richtung seines Kopfs. Doch gerade als die Klinge einsinken wollte schloss sich das Maul des Aals knirschend um Sheren und das Tier drehte sich von mir weg. Zwar versetzte ich ihm eine heftige Wunde doch sie traf nicht mal annähernd den Schädel. Als sich der Aal umwandte und zurück Richtung Schlick jagte – Sherens Kopf und Schultern hingen ihm dabei schlaff aus dem Maul – gab es nicht das geringste Anzeichen dass ich ihn überhaupt verletzt hatte.
Bis ich mich wieder aufgerichtet hatte war der Aal schon in dem ölig schwarzen Schlamm verschwunden. Das Einzige was noch auf seine Existenz hindeutete waren ein paar ölige Luftblasen an der Oberfläche. Plötzlich hörte ich ein hektisches Fliegengesumm und als ich nach unten sah entdeckte ich den Grund. Sherens Körper war von dem mächtigen Kiefer des Aals durchtrennt worden – es musste passiert sein als er den Kopf von mir wegdrehte. Jedenfalls lagen die Überreste des Mädchens noch im Sand. 2 kleine Beine und 2 kleine Füße – vollkommen unverletzt. Sie waren noch mit dem Unterleib und der Hüfte verbunden. Durch die gewaltige Wucht mit der sie vom restlichen Torso getrennt worden waren schienen sie wie mit einem riesigen Schwert abgeschlagen.
Blut sickerte aus dem zurückgebliebenen Rest. Das flüssige Rot sank in den Sand und der Geruch zog bereits die Aasfresser vom Strand an: winzige Krebse Sandwürmer und kleine gelbe Käfer mit flachem Rücken. Die Aasfresser wurden auch von einem dicken Streifen dunklem Fleisch angelockt das ein paar Meter entfernt im Sand lag – bei meinem verfehlten Messerwurf hatte ich dem Aal offenbar ein Stück weggehackt.
Ich trat zu dem Fleischstück spießte es mit der Spitze von meinem Messer auf und hob es hoch. Es roch nicht gut – säuerlich und beißend scharf mit einem Hauch von Ammoniak – doch es war Fleisch.
Nahrung.
Man darf Nahrung nicht verschwenden.
Ich schaute hinüber zu Starry. Sein nutzloser alter Revolver lag zerfetzt am Fuß der Mauer. Ein paar Teile glühten noch. Und Starry hielt sich die blutende Hand an die Brust. Er merkte dass ich ihn ansah hob die heile Hand schüttelte kurz den Kopf und winkte mir – er wollte mir zeigen dass mit ihm alles in Ordnung war.
Ich betrachtete Laoly. Sie war zusammengesunken und hockte mit aschfahlem Gesicht und leerem Blick am Boden. Sie gab auch keinen Laut von sich und weinte auch nicht sondern starrte nur blind vor sich hin.
Ich blickte auf die von Fliegen bedeckten Überreste ihrer Tochter.
Es gab nichts zu denken.
Ich zog mein Messer aus dem Stück Aalfleisch wischte die Klinge am Hemd ab und lief mit langsamen Schritten nach Hause.
Ich bin jetzt wieder daheim in meinem Haus dort wo ich letzte Nacht war – ich sitze auf dem Boden vorm Feuer und halte das Schreibheft aufgeschlagen in meinem Schoß. Ich weiß immer noch nicht richtig ob ich das kann. Doch ich werde Starrys Rat befolgen und mit der Geschichte all dessen beginnen was ich über mich und meine Welt weiß: die Deathlands die Hunde die Stadt die Menschen --- wie alles war und wie es jetzt ist. Und ich kann genauso gut da anfangen wo Starry aufgehört hat – mit meinem Leben bei den Deathland Dogs.
Ich erinnere mich an überhaupt nichts von dem Tag als die Wilden uns angriffen und nur an sehr wenig von den folgenden Wochen und Monaten. Von meiner Mutter und meinem Vater wurden nie irgendwelche Überreste gefunden und ich bin mir absolut sicher dass sie von den Hunden getötet und gefressen wurden. Oder im Fall meines Vaters vielleicht auch von den Wilden getötet und dann von den Hunden gefressen. Nicht so sicher bin ich mir bei Jele dem Waisenkind das meine Mutter gestillt hatte. Während meiner Zeit bei den Hunden bin ich auch anderen Hundskindern begegnet und es ist gut möglich dass eines von ihnen Jele war – keiner von uns hätte das ja wissen können. Doch auch wenn es keinen Beweis gibt dass sie nicht wie ich von den Hunden angenommen und aufgezogen wurde vermute ich dass sie das gleiche Schicksal hatte wie meine Eltern. Ich habe keine vernünftige Erklärung wieso ich glaube sie ist tot. Doch wann immer ich versuche sie mir vorzustellen oder sie in meinem Kopf lebendig werden zu lassen ist da einfach nur Leere.
Es gibt einfach nichts.
Und dann stelle ich mir jedes Mal die gleiche Frage: Wenn die Hunde Jele getötet haben wieso dann nicht mich?
Eine Antwort habe ich nicht.
Es könnte ganz einfach so sein dass meine Hundsmutter flink genug war mich zu erreichen ehe ich von den Hunger leidenden Hunden zerfetzt wurde und dass Jele dieses Glück nicht hatte. Oder vielleicht hatte Jele etwas an sich was die Hunde nicht mochten – einen falschen Geruch eine falsche Stimme oder ein falsches Äußeres.
Wer weiß?
Hunde haben sehr komplexe und oft scheinbar absurde Empfindlichkeiten.
Sicher weiß ich nur dass ich angenommen wurde.
Von meinen frühen Jahren bei den Hunden sind mir nur ein paar vage und bruchstückhafte Eindrücke in Erinnerung geblieben und dazu 1 oder 2 isolierte Erlebnisse. Ich erinnere mich an die schwere Süße der Milch mit der mich meine Mutter säugte und an die wohltuende Wärme ihres Fells wenn sie mich nachts vor der eisigen Kälte beschützte. Ich erinnere mich an ihre raue Zunge auf meiner Haut und den fleischigen Geruch ihres Atems den Klang ihrer Stimme den behutsamen Griff mit den Zähnen in meinem Nacken wenn sie mich Tag für Tag und Monat für Monat stundenlang ohne Unterbrechung herumtrug bis ich endlich gut genug auf allen 4en laufen und halbwegs mit dem Rudel mithalten konnte. Ich erinnere mich auch an den Hunger – das Warten mit den anderen Welpen in der Höhle und den Schmerz unserer leeren Mägen wenn wir auf die Rückkehr des Rudels von der Jagd warteten. Und an die Hoffnung auf halb verdautes Fleisch in ihren Mägen das sie dann für uns zum Fressen hochwürgten. Wenn wir ganz großes Glück hatten kamen sie womöglich sogar mit einem ganzen Kadaver von etwas zurück das wir selber zerreißen und fressen durften. Ein Kaninchen ein Vogel ein Menschenkind ---
Ja manchmal habe ich Menschenfleisch gegessen.
Aber ich habe keine Gewissensbisse keine Scham und keine Schuldgefühle.
Ich war und bin ein Tier.
Ein Fleischfresser.
Ich aß und esse das Fleisch anderer Tiere.
Menschen sind Tiere.
Und wir alle müssen essen.
An diesem Punkt musste ich eine Weile mit dem Schreiben aufhören. Es ist nicht wichtig was ich getan habe aber nachdem ich die Geschichte von allem erzähle was ich über mich und über meine Welt weiß sollte ich wohl auch das aufschreiben. Ich legte ein bisschen Holz nach. Ich erhitzte einen Topf mit Wasser. Und dann saß ich einfach eine Weile bloß da --- trank heißes Wasser nagte an ein paar Stücken getrocknetem Fleisch starrte in die Flammen --- versuchte nachzudenken versuchte mich zu erinnern --- und bemühte mich zu der Zeit und den Orten zurückzukehren die ich so lange aus meinem Kopf verbannt habe ---
Die meisten Hundskinder werden nicht sehr alt. Wir sind so viel schwächer und langsamer als Hunde und so viel hilfloser. Unsere felllose Haut verbrennt in der Sonne und hält uns nachts nicht warm. Unser Gehör ist schlecht. Wir riechen fast nichts. Wir haben nicht mal die Zähne die es braucht um rohes Fleisch zu zerreißen und Knochen aufzubeißen. Wir sind einfach nicht geschaffen für ein Leben in der Wildnis. Deshalb sterben die meisten sehr jung. Die die überleben sind solche wie ich deren Mütter stark genug sind ihnen das notwendige Mehr an Schutz und Fürsorge zu geben. Und die die Pflicht verspüren länger für uns zu sorgen als sie das normalerweise müssten.
Ich hatte Glück. Meine Mutter gab mir die Hilfe die ich brauchte und so konnte ich die meisten meiner Defizite überwinden.
Davon abgesehen war mein einziger Vorteil gegenüber den Hunden die mich aufzogen mein Verstand. Ich war nicht klüger als sie – bei Weitem nicht – ich dachte nur anders was mir manchmal einen Vorteil verschaffte. Meistens half mir mein Menschenverstand überhaupt nicht – häufig war er sogar eher ein Hindernis – aber ganz selten funktionierte er wirklich zu meinen Gunsten.
An einen von diesen Momenten erinnere ich mich mit absoluter Klarheit – ich weiß wirklich nicht wieso er so deutlich in mir haften geblieben ist. Ich kämpfte mit einem anderen Hund um ein Stück Fleisch. Es war nicht viel mehr als ein knorpeliges Knochenstück doch wir waren beide halb verhungert und hatten seit Tagen nichts mehr gefressen. Deshalb wollten wir jeder das Fleisch unbedingt haben und teilen kam nicht infrage. Wir wollten und brauchten unbedingt jeder das Ganze. Wir hatten beide im selben Moment danach geschnappt und jeder hielt sein Ende gut fest. So entstand ein wildes Gezerre – wir knurrten durch die Zähne gruben unsere Füße ins Fleisch rissen so fest wir nur konnten und warfen den Kopf hin und her. Es war kein Spiel. Zu der Zeit war ich vielleicht 3 Jahre und nach menschlichem Ermessen unglaublich stark und zäh für mein Alter. Doch obwohl mein Gegner deutlich jünger war – keine 6 Monate alt – war er praktisch ein ausgewachsener Hund was bedeutete er war 4-mal so groß wie ich und mindestens 4-mal so kräftig. Sein Körper bestand nur aus Muskeln. Sein Kiefer war stark wie eine Schraubzwinge und seine Zähne hart wie Stahl.
Ich hatte keine Chance.
Und ich wusste es.
Ich wusste ich konnte unmöglich gewinnen.
Doch gleichzeitig wusste ich dass ich nicht nachgeben durfte. Wenn ich zurückgesteckt und das Fleisch kampflos dem andern Hund überlassen hätte wäre das als Schwäche gesehen worden und in Erinnerung geblieben. Und nicht nur bei dem Hund mit dem ich kämpfte. Auch sämtliche anderen Hunde die uns beobachteten hätten gewusst dass sie mir in Zukunft alles wegschnappen könnten ohne groß kämpfen zu müssen. Deshalb musste ich so lange durchhalten und mich wehren wie nur möglich.
Genau das tat ich.
Doch nach kurzer Zeit war ich derart erschöpft dass ich eigentlich gar nicht mehr richtig kämpfte. Ich hielt nur einfach das Fleisch fest und wurde von dem jungen Rüden über den Boden geschleift. Er wusste dass ich am Ende war und er bloß so lange weiterziehen musste bis ich das Fleisch irgendwann losließ.
Und genau das tat er.
Er ging Schritt um Schritt zurück und zerrte mich mit. Seine Augen brannten sich erbittert in meine. Doch ich schaute nicht mehr zu ihm. Ich schaute vielmehr über seine Schultern hinweg zu dem ausgetrockneten Flussbett dahinter. Das Flussbett war nicht sehr tief – höchstens 2 Meter. Doch nach dem was ich sehen konnte und was ich hoffte war das Ufer so steil dass es praktisch senkrecht nach unten wegbrach. Und weil sich der Hund rückwärts aufs Flussbett zubewegte sah er das nicht kommen. Mein Problem war nur: Er war dermaßen überzeugt von seinem nahenden Sieg dass er fast keine Kraft mehr in das Gereiße legte sondern nur noch lässig und ohne größeres Tempo zog. Und wenn er mit dieser Geschwindigkeit über die Böschung taumelte gab es keine Garantie dass er wirklich unten im Flussbett landen würde. Also holte ich noch einmal tief Luft und setzte den allerletzten Funken Kraft frei den ich noch hatte. Und für einen winzigen Moment grub ich meine Füße in den Boden und riss so fest an dem Fleisch wie ich nur konnte. Das stoppte ihn bloß einen Augenblick lang aber er war doch ein wenig überrascht und – was noch wichtiger war – sauer. Also reagierte er genau wie ich gehofft hatte: Er legte plötzlich wieder all seine Kraft in den Kampf. Ich aber packte das Fleisch nur umso fester und ließ mich von meinem Gegner über den Boden ziehen. Nach wenigen Sekunden sah ich den Schock in seinen Augen – er spürte wie seine Hinterläufe im Nichts verschwanden und der Rest des Körpers folgte. Und als er rücklings ins Flussbett stürzte war seine Angst derart groß dass er das Fleisch einfach losließ.
Und das wars.
Ich hatte gewonnen.
Ich hatte meinen Verstand benutzt um ihn zu schlagen. Und ich hatte ihn nicht nur geschlagen und das Fleisch gewonnen sondern ihn auch vor allen anderen Hunden gedemütigt. Das bedeutete: Wenn noch einmal ein Hund vorhatte mir ein Stück Fleisch wegzunehmen würde er es sich vielleicht 2-mal überlegen. Er würde vielleicht einen Augenblick zögern. Und manchmal ist so ein Augenblick alles was du brauchst.
Augenblicke ---
Ich erinnere mich an andere Augenblicke mit den Hunden. Die meisten der Tiere waren beinhart – immer hungrig immer jagend und immer gejagt. Es gab noch andere Rudel in den Deathlands – mindestens ein Dutzend in unserem Teil des Gebiets. Gelegentlich taten sich mehrere Rudel zusammen so wie beim Angriff auf die Wilden als diese den Wagen gestohlen hatten. Doch meistens waren die Rudel eher Rivalen die für immer und ewig um Land und Nahrung kämpften und einander die Jungen stahlen und fraßen. Manchmal brachten sie sich auch gegenseitig um. Und sämtliche Rudel lagen zudem in ständigem Kampf mit den Menschen – den Wilden den Dau und unseren Leuten. Die Hunde waren eine Bedrohung für die Dau und die Wilden und sie waren eine Bedrohung für uns. Wenn wir die Chance hätten würden wir sie töten und essen und sie würden das Gleiche mit uns tun.
Es war und ist noch immer eine kriegerische Welt.
Doch ich erinnere mich auch an gute Zeiten bei den Hunden. Diese Erinnerungen sind inzwischen tief in meinem Innern vergraben. Sie müssen es sein damit ich leben kann. Eines der ersten Dinge die Starry mir beigebracht hat war dass ich alles über mein Leben bei den Hunden vergessen müsse. Du kannst entweder ein Hund sein oder ein Mensch erklärte er mir. Aber niemals beides. Wenn du versuchst beides zu sein wirst du sterben.
Und er hatte recht.
Aber sogar jetzt noch kommen die vagen Erinnerungen an die guten Zeiten immer wieder nach oben – das Rennen mit den Hunden oder das gemeinsame Ausruhen nach dem Fressen. Das gemeinsame Schlafen im trägen Licht der untergehenden Sonne und einfach das Zusammensein ---
Augenblicke reiner Zugehörigkeit.
Ich spüre einen Schmerz in mir während ich diese Worte schreibe. Es ist ein Gefühl das ich nicht vergessen kann und gleichzeitig nicht mehr erinnere und ich weiß es wird niemals verschwinden.
Es war eine Verbindung aus Hunger und übersteigertem Selbstvertrauen die zu meiner Rückeroberung und dem Massaker an meinem Rudel führte.
Obwohl die Stadt und das Lager der Dau relativ reichhaltige Quellen an Nahrung darstellten näherten wir uns ihnen normalerweise nie. Es war zu riskant. Die Menschen konnten uns aus der Distanz töten und ihre Siedlungen waren zu gut bewacht. Die Wahrscheinlichkeit von ernsten Verwundungen und möglichem Tod überwogen den potenziellen Lohn eines Raubzugs. Deshalb hielten wir uns trotz aller Versuchung auf Abstand.
Doch es kam eine Zeit in der die Jagd so schlecht lief dass wir kaum etwas zu fressen fanden. Wenn wir nicht bald richtige Nahrung bekämen würden wir alle verhungern. Und das gab den Ausschlag. Es war eine einfache Entscheidung: Wenn wir nicht in die Stadt oder das Lager der Dau einfielen würden wir sehr wahrscheinlich sterben. Gut möglich dass zumindest einige von uns bei dem Angriff getötet oder verletzt würden doch dieses Risiko mussten wir eingehen. Und es war immer noch besser im Kampf zu sterben als bloß dazuliegen immer schwächer zu werden und langsam dem Ende entgegenzusiechen.
So wurde beschlossen die Menschen anzugreifen.
Und am Ende stellte es sich als ziemlich einfach heraus.
Als Erstes mussten wir entscheiden welche der Siedlungen wir angreifen wollten – die Stadt oder das Lager. Beide hatten ihre Vor- und Nachteile. Die Stadt wurde auf ihrer Nordseite von einer großen Steinmauer geschützt die sich in einem weiten Bogen von den Klippen im Osten bis zu den Klippen im Westen erstreckte. Der Süden der Stadt war nur von See her erreichbar – und Hunde wissen von Geburt an dass das Meer den sicheren Tod bedeutet.
Das Lager war nicht vom Meer geschützt und hatte weder Mauern noch Zäune. Deshalb war es viel leichter dort reinzukommen als in die Stadt. Doch im Lager lebten auch viel mehr Menschen. Das Risiko entdeckt zu werden war daher deutlich größer.
Die Entscheidung fiel nachdem wir mehrere Nächte die beiden Gelände ausgekundschaftet hatten und ein Hund einen unbewachten Zugang zu der Stadt entdeckte – einen alten Tierbau an der westlichen Felskuppe der unter der Mauer hindurchlief. Der Eingang zu dem Bau lag versteckt unter einem umgestürzten Baum in einem Flecken Buschland auf der Nordseite der Mauer. Und der Tunnel endete an einer Erdböschung in einem Dornbuschdickicht direkt hinter der Mauer. Nach dem Geruch – oder dem fehlenden Geruch – des Baus zu urteilen war klar dass er schon seit Jahren nicht mehr benutzt wurde.
Er war perfekt: ein unbekannter und ungeschützter Weg in die Stadt und wieder hinaus.