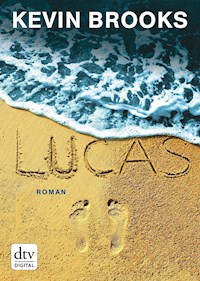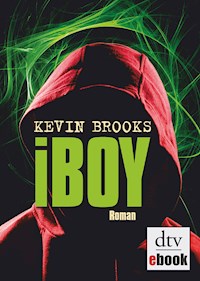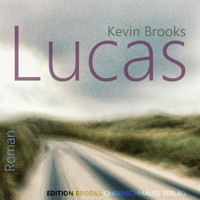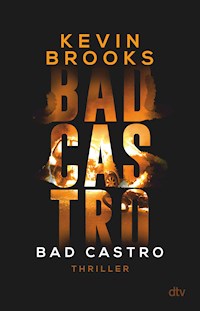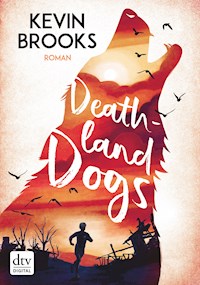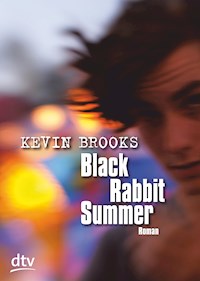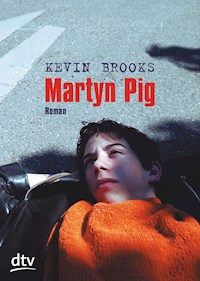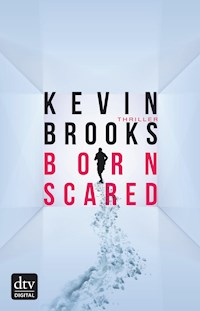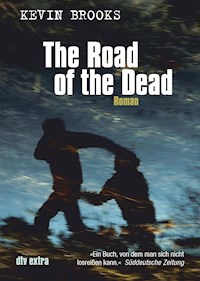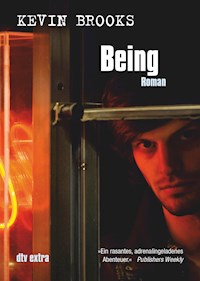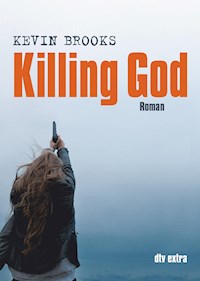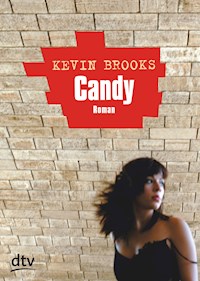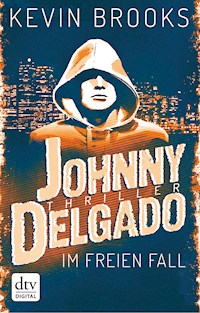7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Ein Rausch aus Liebe und Musik. Und ein dunkles Geheimnis … Alles, was in Lilis Leben zählt, sind ihr Freund Curtis, der Frontman ihrer Band »Naked«, und ihre Musik. Bis der begnadete Gitarrist William Bonney zu »Naked« stößt. Lili und William verlieben sich ineinander – und von einem Moment auf den anderen gerät Lilis Leben aus den Fugen. Denn William stammt aus Nordirland, das von blutigen Unruhen erschüttert wird, und in seiner Familie gibt es ein dunkles Geheimnis, das alles zu zerstören droht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 548
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Kevin Brooks
Live fast, play dirty, get naked
Roman
Aus dem Englischen von Uwe-Michael Gutzschhahn
Für Phil, Pete, Sid und Kenny
1
In dem langen heißen Sommer von 1976 wurde mein Herz geboren; mein Leben erhielt seine Form, meine Liebe wurde besiegelt, meine Seele ging verloren und zerbrach. Es war der Sommer von so vielem – Hitze und Gewalt, Träumen und Albträumen, Himmel und Hölle –, und wenn ich heute zurückschaue, fällt es mir schwer, das Gute vom Schlechten zu unterscheiden.
Es war alles gut und schlecht.
Alles zusammen, alles gleichzeitig.
Es war alles.
Es war der Sommer, als ich siebzehn wurde. Es war der Sommer, der endlose Wochen lang glühte, bis der Teer in den Straßen schmolz. Es war der Sommer des Wahnsinns, der Sommer des Punk, der Sommer weggeworfenen Lebens …
Es war all das.
Und mehr.
Viel mehr …
Es war der Sommer von William Bonney.
Williams Geschichte hat mich jetzt beinahe fünfunddreißig Jahre begleitet, verborgen unter dem Siegel meines Herzens, und obwohl ich nun nichts mehr für mich behalten muss, kann ich nicht anfangen, darüber zu sprechen, ohne vorher etwas über Curtis Ray zu erzählen. Denn ohne Curtis wäre ich William niemals begegnet. Genau genommen gäbe es ohne Curtis überhaupt nichts zu erzählen.
2
Als ich im Herbst 1970 auf die Mansfield Heath School kam, kannte ich Curtis Ray nicht persönlich, ich wusste nur, wer er war. Jeder wusste, wer er war; Curtis war einfach so ein Typ, den alle kennen. Obwohl damals erst zwölf – ein Jahr älter als ich –, galt er schon da als jemand, der anders war. Er war Curtis Ray, der mit den langen blonden Haaren aus der zweiten Jahrgangsstufe, der hippe Typ mit der provozierenden Ausstrahlung, der Surf Beads, Ohrringe und eine schwarze Lederjacke trug, der Junge, der E-Gitarre spielte. Er war ein Typ, den man entweder liebte oder hasste – und ich glaube, selbst die, die behaupteten, ihn zu hassen, waren insgeheim ein bisschen in ihn verknallt; nicht bloß die Mädchen, sondern auch die Jungen.
Weil er ein Jahr älter war und zu der Zeit außerdem Lichtjahre von meinem sozialen Umfeld entfernt, gab es für mich keinen Zweifel, dass er von meiner Existenz nichts wissen konnte. Ich dagegen wusste, dass er existierte. Ich sah ihn fast jeden Tag im Vorbeigehen. Aber das war auch alles, was er je für mich sein konnte: eine Gestalt, die auf den Schulfluren an mir vorbeiging, ein ehrfürchtig geflüsterter Name – »schau, da ist Curtis Ray« –, ein Junge von einem anderen Stern.
Egal, wie oft ich von ihm träumte – und ich gebe ja zu, dass ich sehr wohl von ihm träumte –, wusste ich doch immer, es waren nur Träume. Er war wirklich von einem anderen Stern. Er war cool, er war hip, er war aufsässig anders. Ich war nur anders. Er sah so gut aus, dass ihm selbst Mädchen, die seine langen Haare und seine verrückte, schräge Musik hassten, nicht widerstehen konnten. Ich dagegen fiel in die Rubrik: »Sieht ganz okay aus, wenn man auf die Art steht.« Und während Curtis genau zu wissen schien, wer er war und was er sein wollte, verbrachte ich meine ersten Teeniejahre in einem Zustand ewiger Unsicherheit. Mir fehlte nicht nur Selbstvertrauen, sondern auch der Glaube daran, dass die Welt um mich herum irgendeinen Sinn ergab. Ich begriff einfach nicht, was das Ganze sollte, wozu es gut war, welche Absicht dahintersteckte …
Alles in allem war ich ein ziemlich unsicheres Mädchen. Und auch wenn die Freundinnen, die Curtis im Lauf der Zeit hatte, sowohl zahlreich als auch ganz unterschiedlich in Alter, Typ und Charakter waren, hatten sie doch – abgesehen davon, dass sie alle schön und sexy aussahen – eines gemeinsam: die Nichtexistenz jeglicher Unsicherheit. Deshalb gab es einfach keinen Grund zu glauben, dass Curtis Ray für mich je mehr als ein Traum sein könnte.
Doch an einem strahlend blauen Sommertag in der ersten Juliwoche des Jahres 1975 wurde mein Traum plötzlich Wirklichkeit.
Seit meinem fünften Lebensjahr, als meine Mum mich zu meiner ersten Unterrichtsstunde brachte, hatte ich Klavier gespielt. Mum hatte selbst immer Klavier spielen wollen, behauptete sie jedenfalls, und es grämte sie sehr, dass sie es als Kind nicht gelernt hatte.
»Ist doch noch nicht zu spät«, sagte ich jedes Mal. »Also, ich meine, man kann doch nicht bloß als Kind Klavierspielen lernen.«
»Es hat mit meinen Fingern zu tun«, sagte sie dann immer. »Sie sind nicht mehr geschmeidig genug.« Oder: »Du weißt doch, was ich für Kopfschmerzen habe, Schatz … ich könnte mich gar nicht darauf konzentrieren.«
Ich glaube, in Wirklichkeit wollte sie es deshalb nicht lernen, weil sie wusste, Klavierspielen bedeutet Arbeit und Hingabe. Und von ihren Süchten einmal abgesehen gab sich meine Mutter nur einem hin: Sie vermied konsequent alles, was mit harter Arbeit verbunden war. Dennoch beharrte sie mit großer Freude darauf, dass ich lange und hart am Klavier übte … und das tat ich. Doch für mich war es keine harte Arbeit, denn es machte mir Spaß. Von der ersten Stunde an, als ich fünf war, liebte ich alles daran – die Musik, den Zauber, die wunderbare Welt aus Klängen und Liedern … Melodien, Töne, Strukturen, Rhythmen … alles erschien mir so spannend. Außerdem war ich wirklich gut am Klavier. Kein Wunderkind oder so, aber es ging mir ganz natürlich von der Hand, und mit acht oder neun war ich schon ziemlich weit. Zu meinem zehnten Geburtstag bekam ich mein eigenes Instrument – ein wirklich schönes Bechstein-Klavier, auf dem ich noch heute viel spiele – und ich nahm weiter Unterricht, belegte auch in der Schule Klavier und übte unentwegt, bis ich fast siebzehn war. Genau das tat ich auch an dem heißen Sommertag 1975: Ich übte im Musikraum der Schule eines der Stücke für die demnächst anstehende Klavier-Aufnahmeprüfung in die letzte Klasse.
Mansfield Heath war eine mittelgroße Privatschule in Hampstead im Norden von London, wo ich wohnte. Sie war eine der ersten privaten Schulen im Land, in denen Jungen und Mädchen gemeinsam unterrichtet wurden. Das Hauptgebäude, das aus dem 17. Jahrhundert stammte, war ein imposanter alter Backsteinbau mit Türmchen und Wasserspeiern und schweren Eichentüren, umgeben von üppig grünen Sportplätzen und uralten Bäumen. Der Musikraum befand sich in einem kleinen Ziegelstein-Anbau neben der Kapelle, gleich hinter den Sportplätzen.
Es war Freitagnachmittag, so gegen zwei Uhr, und ich war allein. Mein Musiklehrer – Mr Pope – ließ mich hier üben, wann immer der Raum nicht anderweitig gebraucht wurde, und nachdem ich gerade ein paar Freistunden hatte, nutzte ich die Chance, mich in eine besonders schwierige Stelle des Stücks zu vertiefen, das ich gerade einstudierte. So saß ich also allein im Musikraum vor dem Klavier, spielte die Stelle wieder und wieder und war derart konzentriert, dass ich nicht hörte, wie die Tür aufging und jemand hereinkam. Ich spielte einfach weiter. Gerade hatte ich die heikle Stelle in den Griff bekommen und nun wollte ich sehen, wie sich die Passage in das gesamte Stück einfügte, weshalb ich direkt zurück an den Anfang ging und das Ganze einmal komplett durchspielte.
Es war ein Stück von Debussy, die Arabesque Nr. 1. Eine wunderbare Musik, so leicht und verträumt wie ein perfekter Sommertag, und auch wenn ich mit einigen der technisch schwierigen Stellen noch ein bisschen kämpfte, hielt mich das nicht davon ab, mich jedes Mal beim Spielen in der Schönheit dieser Musik zu verlieren. Und wenn ich das Ende erreichte und sich der letzte leise Akkord sanft in der widerhallenden Stille verlor … also, das war immer wieder etwas ganz Besonderes für mich. Das plötzliche Schweigen, das Gefühl der Musik, die durch die Luft davonschwebte, der Zauber der Melodie, die noch in meinem Kopf nachklang …
Ich gönnte mir jedes Mal einen Moment der Stille, um dieses Gefühl auszukosten.
Doch als ich an diesem Tag dasaß und den Moment genoss, wurde die Stille von einem leisen Applaus in meinem Rücken zerstört. Erschrocken fuhr ich herum, in der Erwartung, Mr Pope zu sehen, doch statt des graubärtigen Gesichts meines Musiklehrers sah ich einen lächelnden Curtis Ray.
»Das war spitze«, sagte er, immer noch leise klatschend. »Absolut spitze …«
Ich starrte ihn an. Er lehnte lässig an der Wand drüben beim Fenster, die stechenden blauen Augen auf meine gerichtet … und er lächelte mir zu. Ich konnte es nicht fassen. Er war Curtis Ray … er war da, bei mir. Er lächelte mich an.
»Debussy, stimmt’s?«, sagte er.
»Was?«
»Die Musik … das Stück, das du gerade gespielt hast, das war doch Debussy.«
»Ach so, ja …«, antwortete ich, immer noch ein bisschen fassungslos. »Ja … die erste Arabeske.«
Er nickte. »Echt schön.«
Unwillkürlich warf ich einen Blick zur Partitur auf dem Klavier – vielleicht wusste er ja nur deshalb, dass es Debussy war, weil er es vom Titelblatt abgelesen hatte. Aber das Titelblatt war nicht zu sehen. Und als ich mich wieder zu ihm umdrehte, spürte ich schon, wie Verlegenheit in mir aufstieg, weil ich so arrogant gewesen war zu glauben, er könne diese Art Musik doch unmöglich nur vom Hören erkannt haben.
»Entschuldigung«, fing ich an. »Ich wollte nicht –«
»Du bist Lilibet Garcia, nicht?«, sagte er, drückte sich von der Wand ab und schlenderte lässig auf mich zu.
»Lili«, sagte ich.
»Magst du nicht, wenn man dich Lilibet nennt?«
»Du vielleicht?«
Er lächelte. »Ich heiße ja auch Curtis Ray.«
Wenn der Ausdruck Krass! damals schon in Mode gewesen wäre, hätte ich das wahrscheinlich gesagt … oder zumindest gedacht. Aber wir waren noch in den Zeiten vor Krass! und ich musste mich damit begnügen, ironisch vor mich hinzudenken: Wirklich wahr? Curtis Ray? Das hätt ich ja nie gedacht …
Wenn ich es genau überlege, war Ironie wahrscheinlich das Letzte, was mir in dem Moment einfiel, und vermutlich dachte ich auch überhaupt nichts in diese Richtung.
Zum einen war ich viel zu verlegen. Verlegen wegen meines flatternden Herzens, verlegen, weil ich nicht aufhören konnte, Curtis anzustarren, und weil mir plötzlich bewusst wurde, dass ich mein absolut unvorteilhaftes rosa Schulkleid anhatte, während er so lässig wie immer aussah in seinem coolen weißen T-Shirt und seinen coolen weißen Jeans – als Sechstklässler musste er nämlich keine Schuluniform mehr tragen. Und dann hatte ich auch noch Söckchen an, verdammt. Diese peinlichen weißen Söckchen.
Aber am allerpeinlichsten war mir die Tatsache, dass ich überhaupt verlegen war. Ja, mein Herz flatterte und ich starrte und wand mich – ich benahm mich wie ein alberner kleiner Teenie und genierte mich für meine Klamotten. Das Ganze war so schrecklich armselig, ich hasste mich dafür.
Aber ich konnte es nicht ändern.
»Du spielst echt gut«, sagte Curtis.
»Danke«, murmelte ich.
Er stand jetzt vor mir. Nicht zu nah, aber nah genug, dass ich genau mitbekam, wie wahnsinnig toll er aussah. Er hatte immer schon richtig gut ausgesehen, sogar in diesem komischen Stadium mit dreizehn, vierzehn, doch jetzt, mit siebzehn, war er zu einem schlanken, tough wirkenden jungen Mann geworden mit einem Gesicht, das fast schon zu perfekt war, um wahr zu sein. Es schien sich verwandeln zu können – es zeigte dir immer genau das, was du in ihm sehen wolltest. Wenn du also Curtis ansahst und glaubtest, du hättest den schönsten Jungen der Welt vor dir, dann sahst du genau das. Aber manchmal konntest du auch ein Gesicht voller Trauer, herzzerreißender Leere oder sogar Grausamkeit entdecken …
Doch an dem Tag standen keine Trauer und keine Grausamkeit in seinem Gesicht, sondern nur ein umwerfendes Lächeln, eine schimmernde Schönheit und diese hypnotisierenden strahlend blauen Augen.
»Alles in Ordnung mit dir?«, fragte er.
»Ja, Entschuldigung …«, murmelte ich. »Ich war nur …«
Ich starrte ihn immer weiter an, sonst nichts. Er hatte jetzt eine Schachtel Zigaretten aus seiner Hosentasche gezogen und wollte sich eine anzünden.
»Hältst du das für eine gute Idee?«, fragte ich. »Mr Pope kann jeden Moment reinkommen.«
Curtis lachte. »Der gute alte Johnny hat bestimmt nichts dagegen«, antwortete er und zündete die Zigarette an. »Der schnorrt doch ständig Fluppen von mir. Ich hab sogar schon öfter einen Joint mit ihm geraucht.«
»Ehrlich?«
»Ja klar … Johnny ist tief drinnen so eine Art Hippie.« Er nahm einen kräftigen Zug von der Zigarette und schnippte die Asche auf den Boden. »Aber egal«, fuhr er fort, »spielst du auch noch was anderes?«
Ich sah ihn an, nicht sicher, was er meinte.
»Abgesehen von Klavier«, erklärte er. »Spielst du noch andere Instrumente?«
»Ach so«, sagte ich. »Nein, nicht wirklich … ich meine, na ja, ich spiel ein bisschen Gitarre.«
»Ja?«
Ich schüttelte den Kopf, weil mir klar wurde, dass ich mit jemandem sprach, der – wie es hieß – ein absolutes Genie auf der Gitarre war. »Aber nicht gut«, murmelte ich. »Bloß so ein paar Akkorde, sonst nichts …«
Er lächelte. »Welchen magst du am liebsten?«
»Was?«
»Welcher Akkord gefällt dir am besten?«
»G-Dur«, sagte ich, ohne nachzudenken.
Er nickte. »Ja, G-Dur ist toll. Hat so was von Größe, nicht? So eine Weite und Offenheit.«
Ich lächelte, weil ich genau wusste, was er meinte. »Und welcher gefällt dir am besten?«, fragte ich.
Er sah mich an. »Rat mal.«
Ich schwieg einen Moment, überlegte ein bisschen, aber das musste ich eigentlich gar nicht. Die Antwort kam instinktiv: »E-Dur«, sagte ich.
Sein Lächeln sagte mir, dass ich recht hatte.
»Kannst du Bass spielen?«, fragte er.
»Kontrabass?«
»Nein, E-Bass, du weißt schon …« Er tat so, als ob er eine Bassgitarre spielte. »So einen.«
»Keine Ahnung«, sagte ich. »Hab ich noch nie versucht.«
»Hast du Lust, es mal ausprobieren?«
»Wie meinst du das?«
»Ich such einen Bassgitarristen«, erklärte er. »Für meine Band.«
»Du spielst in einer Band?«
Er nickte. »Wir sind noch nicht aufgetreten, aber wir haben ein Jahr lang immer wieder zusammen geprobt und so langsam werden wir richtig gut. Das Problem ist nur, Kenny – das ist unser Bassist – na ja, der hat plötzlich beschlossen, dass er nicht mehr Bass spielen will, sondern Rhythmusgitarre.« Curtis nahm einen tiefen Zug von der Zigarette. »Also, um ehrlich zu sein, Kenny ist sowieso ziemlich scheiße am Bass, deshalb tut er uns eigentlich einen Gefallen, wenn er aufhört. Aber jetzt müssen wir jemand anderen suchen …« Er sah mich an. »Auf was für Musik stehst du? Abgesehen von Debussy.«
Das war eine heikle Frage. Oder besser gesagt, es wäre eine heikle Frage gewesen, wenn ich versucht hätte zu spekulieren, auf welche Musik Curtis stand, um dann so zu tun, als ob ich genau die Richtung auch mochte – was ich zuerst tatsächlich tun wollte. Aber auch wenn er inzwischen nicht mehr so richtig hippiemäßig aussah – er hatte seine langen Haare abgesäbelt und trug jetzt etwas, das wie ein verrücktes Vogelnest wirkte, und seine vergammelten alten Jeans waren unmodern, aber sehr cool, ohne Schlag –, nahm ich natürlich an, dass er Musik mochte, die mir nicht gefiel und mit der ich mich auch nicht auskannte, zum Beispiel Progressive Rock: Bands wie Genesis und Yes und Pink Floyd. Und wenn ich ihm erzählt hätte, dass ich Genesis mochte, und er mich gefragt hätte, welches mein Lieblingsalbum sei, hätte ich kein einziges nennen können. Und das wäre wirklich peinlich gewesen. Deshalb sagte ich ihm lieber die Wahrheit und versuchte erst gar nicht, ihn zu beeindrucken.
»Na ja, ich hab gerade das neue Album von Cockney Rebel gekauft«, erklärte ich. »Das gefällt mir echt gut.«
»Welches?«, fragte Curtis. »The Best Years of Our Lives?«
»Nein … das davor.«
»The Psychomodo?«
»Ja, genau.«
Er nickte wissend. »Ist aber nicht so gut wie The Human Menagerie.«
»Welches Album ist das schon?«
Er warf die Zigarette zu Boden und trat sie aus. »Wen magst du noch?«
»In letzter Zeit hab ich viel die Sensational Alex Harvey Band gehört und David Bowie … und ich finde die alten Sachen von den Stones gut.«
»Was ist mit den Stooges? Hast du von denen gehört?«
Ich schüttelte den Kopf. »Ich glaub, nein.«
»Iggy Pop and the Stooges … die musst du dir anhören. Die sind unglaublich. So richtig schön laut und dreckig, verstehst du?«
»Klar«, sagte ich, nicht ganz sicher, was er meinte. »Und das sind Sachen, die dir gefallen?«
»Ich mag alles Mögliche«, sagte er. »Die Stooges, Velvet Underground, die New York Dolls … die Faces, Dr. Feelgood.« Er sah mich an. »Hast du die Feelgoods gesehen? Die haben im Januar im Rainbow gespielt. Fantastisch. Wahnsinnsband – so richtig schön schnell.«
Ich lächelte. »Schnell?«
»Ja.«
»Das heißt, hauptsächlich magst du Sachen, die laut, dreckig und schnell sind?«
»Ja«, sagte er grinsend. »Das bringt es ziemlich genau auf den Punkt.«
»Und deine eigene Band ist auch so?«
»Warum kommst du nicht mal vorbei und findest es selbst raus? Wir proben morgen. Du kannst ja mal hören, was wir so spielen, und wenn’s dir gefällt …« Er unterbrach sich und sah mich an. »Na ja, wie gesagt, wir suchen einen Bassisten und ich glaube, du wärst einfach perfekt.«
»Wieso denn?«, fragte ich total überrascht. »Ich meine, ich könnte das verstehen, wenn ihr jemanden an den Keyboards suchen würdet –«
»Scheiße, nein«, sagte er. »Keyboards geht überhaupt nicht. Wir brauchen jemanden am Bass.«
»Aber ich hab doch noch nie Bass gespielt.«
»Na und?« Er zuckte mit den Schultern. »Das hast du schnell raus. Ist nichts anderes als eine Gitarre mit ein paar Saiten weniger.« Er lächelte. »Und abgesehen davon spielen wir ja nicht Debussy oder so was.«
»Ja, schon, aber trotzdem versteh ich nicht, wieso du mich fragst … es muss doch andere Leute geben –«
»Ich will keine anderen Leute«, sagte er auf einmal mit Nachdruck. »Ich hab’s mit andern Leuten probiert, aber genau das sind sie eben – andere Leute. Und das ist nicht gut genug. Ich brauche besondere Leute, Leute, die wirklich ernst meinen, was sie tun.« Er sah mich nachdrücklich an. »Egal was du machst, es hat keinen Sinn, wenn du es nicht wirklich ernst meinst, Lili. Verstehst du, was ich damit sagen will?«
»Ja …«, sagte ich leise, etwas erstaunt über die plötzliche Leidenschaft. »Ja, ich versteh, was du meinst.«
Er starrte mich noch einen Moment länger an, ohne etwas zu sagen, und sein Blick brannte sich in meine Augen, dann entspannte er sich auf einmal wieder und ein sorgloses Lächeln trat in sein Gesicht. »Schau«, sagte er, »ich weiß, das Ganze kommt ein bisschen plötzlich für dich und klingt wahrscheinlich total absurd, aber ich glaube einfach, du wärst perfekt für die Band. Du liebst Musik, das ist eindeutig. Du kannst spielen. Du bist irgendwie verrückt … und du siehst echt gut aus.« Er grinste. »Ich meine, was kann man von einem Bassisten mehr wollen?«
»Verrückt?«, sagte ich und hob eine Augenbraue.
»Ja …«
»Du findest, ich bin verrückt?«
Er lächelte. »Das ist ein Kompliment.«
Ich wusste, was er meinte, und ich war vollkommen einverstanden, es als Kompliment zu nehmen. Verrücktsein gefiel mir gut. Ich hatte kein Problem mit Verrücktsein. Aber Curtis hatte auch gesagt, dass ich gut aussah, und das machte mir seltsamerweise Probleme. Erstens, weil mir das noch nie jemand gesagt hatte und ich deshalb kaum glauben konnte, dass er es ernst meinte. Und wenn er es nicht ernst meinte … also, dann wäre er doch ein ziemlich beschissener Typ, oder? Aber wenn er es ernst meinte, dann hätte mir ja Curtis Ray – der Curtis Ray – gerade erklärt, dass ich gut aussähe. Und das war etwas völlig anderes.
Um ehrlich zu sein, ich fühlte mich so verworren großartig, dass ich mir fast wünschte, er würde es nicht ernst meinen.
»Und?«, sagte er. »Was meinst du?«
»Wozu?«
»Zu der Band … Bass zu spielen. Hast du Lust, es mal auszuprobieren?«
Ich sah ihn an. »Meinst du das ernst?«
Er nickte. »Das habe ich doch eben gesagt: Egal, was du machst, es hat keinen Sinn, wenn du es nicht wirklich ernst meinst.«
»Ja, okay«, antwortete ich. »Ich probier’s.«
Er lächelte breit. »Du wirst es bestimmt nicht bereuen.«
Wie sich herausstellte, hatte er damit einerseits recht, andererseits unrecht … aber damals konnte ich das nicht wissen. Und er auch nicht.
»Da wohn ich«, sagte er, schrieb seine Adresse auf ein Stück Papier und reichte es mir. »Im Moment proben wir in der Garage von meinem Dad. Ist nicht ideal … aber solange wir nichts Besseres haben, bleibt uns nichts anderes übrig.«
Ich sah auf das Stück Papier. Curtis’ Zuhause lag ungefähr eineinhalb Kilometer von meinem entfernt.
»Komm so gegen zwei«, sagte er. »Okay?«
»Morgen?«
»Ja.«
Ich sah ihn an. »Wie heißt die Band?«
»Naked.«
»Naked?«
»Ja.« Er lächelte wieder sein Lächeln. »Wir werden gigantisch werden.«
3
Als ich am nächsten Tag durch Hampstead zu Curtis’ Haus lief, war ich so durcheinander und nervös wegen der ganzen Sache, dass ich schon kurz davor war zu kneifen. Ich hatte einfach so viele Zweifel – was würden die andern aus der Band über mich denken? Was wäre, wenn Curtis plötzlich merkte, dass er einen Fehler gemacht hatte und ich doch nicht so »perfekt für die Band« war? Und auch wenn ich mir immer wieder sagte, es sei egal, wie ich aussah und was ich anhatte, ließ sich die Angst, uncool zu sein, nicht unterdrücken. Ich hatte getan, was ich konnte – mir unfachmännisch drei Kilo schwarzen Eyeliner und viel zu viel roten Lippenstift von meiner Mutter draufgeknallt –, aber ich hatte mir noch nie viele Gedanken über meinen Haarschnitt oder über Klamotten und Make-up gemacht. Ehrlich gesagt wusste ich gar nicht genau, was gerade cool war und was nicht. Die meisten Anziehsachen kaufte ich auf Trödelmärkten oder in Charity-Shops, und soweit ich mich erinnere, waren meine Haare zu der Zeit ein missglückter Versuch von Stufenschnitt à la Suzi Quatro. Vielleicht hätte das gar nicht so schlecht ausgesehen, wenn ich nicht kurz zuvor mit stumpfer Schere eine Attacke auf die Frisur unternommen hätte, die damit endete, dass ich aussah wie ein leicht verwahrlostes mittelalterliches Straßenkind. Also, ganz ehrlich: Wenn man sich ein sechzehnjähriges Mädchen mit zu viel Eyeliner, wild zusammengemixten Klamotten und dem Haarschnitt einer Geisteskranken vorstellt … dann hat man wahrscheinlich ein einigermaßen zutreffendes Bild von mir vor Augen.
Egal, ich war wie gesagt ziemlich nervös an dem Tag und machte mir über alles Mögliche Sorgen, und je näher ich dem Haus kam, in dem Curtis wohnte, desto verlockender schien mir der Gedanke, einfach umzukehren und wieder heimzugehen. Doch sosehr auch die Nerven mit mir durchgingen – andererseits platzte ich fast vor Hoffnung und Aufregung, und auch wenn ich vor Schiss beinahe umkam, siegte am Ende trotzdem die Erregung. Denn das war es, was mich weitergehen ließ: der Rausch, die Begeisterung, der Kick des Ganzen. Ja, ich hatte Panik. Und ja, ich wusste, dass ich mich vielleicht zum Affen machen würde. Aber das, was ich da tat – was auch immer letztlich dabei herauskommen würde …
Ich wollte es unbedingt.
Ich wollte es.
Und ich tat es.
Curtis’ Haus war ein ziemlich großes, frei stehendes Gebäude in einer gehobenen Gegend von Hampstead. Es war zwar nicht annähernd so groß wie das Haus, in dem ich wohnte, aber schließlich war Curtis’ Vater auch nicht Filmproduzent wie meiner. Curtis’ Vater war Arzt. Genau wie seine Mutter. Und auch wenn ich das damals noch nicht wusste, waren sie beide sehr prüde, sehr konservativ und fanden den Lebensstil, für den sich ihr Sohn entschieden hatte, sehr enttäuschend.
Doch als ich an jenem Nachmittag hinkam, hatte ich keine Ahnung von dem Konflikt zwischen ihm und seinen Eltern. Ich wusste nicht, dass sie ihm bereits verboten hatten, die Garage als Probenraum zu benutzen – an dem Tag konnte die Probe nur deshalb dort stattfinden, weil sein Vater das ganze Wochenende an einer Ärztetagung teilnahm und seine Mutter bei ihren Eltern in Maidstone war. Als Curtis mich begrüßte, in die Garage führte und den anderen vorstellte, zitterten mir die Hände, mein Herz flatterte und für einen kurzen, schrecklichen Moment hatte ich das Gefühl, mich übergeben zu müssen. Doch komischerweise fühlte ich mich zugleich richtig gut. Richtig lebendig. Aber auch komplett verängstigt und extrem gehemmt. Es war so ein Gefühl wie in der Achterbahn – eine erregende Mischung aus Übelkeit, Angst und einer Spannung, die den Kreislauf auf Touren bringt.
»Okay«, sagte Curtis und schloss die Garagentür. »Also … dann sind ja jetzt alle da.« Er lächelte mich an. »Alles in Ordnung mit dir?«
Ich nickte. »Ja …«
»Gut.« Er führte mich in die Mitte der Garage, wo das Equipment der Band aufgebaut war. »Das ist Kenny«, sagte er und deutete auf einen ziemlich groß gewachsenen Jungen mit einer Bassgitarre, der neben einem der Lautsprecher stand. »Und das«, fuhr Curtis fort, während er sich zu dem andern Jungen am Schlagzeug wendete, »das ist Stan.«
»Hi«, murmelte ich verlegen und winkte lasch mit der Hand. »Ich bin Lili …«
Während mich Stan wenigstens kurz ansah und mir zunickte, würdigte mich Kenny kaum eines Blickes. Er schaute nur für den Bruchteil einer Sekunde vage in meine Richtung, dann drehte er sich um und stimmte seinen Bass. Ich kannte beide, Stan und ihn, aus der Schule. Sie waren in derselben Jahrgangsstufe wie Curtis und ich hatte sie ein paarmal mit ihm zusammenstehen sehen. Aber sie waren mir nie als besonders cool aufgefallen. Eigentlich hatte ich eher gedacht, sie hingen nur mit Curtis ab, um mit ihm gesehen zu werden, und nicht weil sie wirklich etwas mit ihm zu tun hatten. Jedenfalls war ich ein bisschen überrascht, dass sie zur Band gehörten. Sie sahen einfach nicht aus wie Typen, die in einer Band spielen.
Stans richtiger Name war Phillip Smith, aber aus Gründen, die niemand mehr wusste, hieß er seit jeher nur Stan. Er war ein schmaler Typ, ein bisschen schlaksig, mit strähnigen Haaren und langem, tristem Gesicht, das nie eine Emotion zeigte. Er wirkte immer so, als ob ihm alles egal wäre, was ich am Anfang nur für gespielt hielt. Doch als ich ihn etwas besser kannte, begriff ich, dass ihm tatsächlich alles egal war. Er lebte einfach sein Leben, spielte Schlagzeug, machte sein Ding … und das war’s. Mehr brauchte er nicht. Alles andere – der Rest der Welt – interessierte ihn nicht.
Und dafür bewunderte ich ihn irgendwie.
Nicht dass ihn gekümmert hätte, was ich dachte … ich hätte es ihm auch nie erzählt. Ehrlich gesagt zeigte Stan so wenig Interesse für die Gedanken anderer Leute, dass er nur sprach, wenn es absolut notwendig war. In der ganzen Zeit, die ich ihn kannte, habe ich ihn, glaube ich, höchstens ein Dutzend Worte aneinanderreihen hören. Er war selbst dann absolut wortkarg, wenn es nur um das Anzählen zu Beginn eines Songs ging.
»Kannst du das nicht machen?«, fragte er Curtis.
»Verdammt, du musst doch bloß bis vier zählen«, antwortete Curtis dann jedes Mal und schüttelte angesäuert den Kopf. »Das ist ja wohl nicht so schwer.«
»Ich weiß …«
»Na also, dann mach’s.«
Und dann zählte Stan. Aber beim nächsten Song sagte er bloß: »Eins, zwei …«, und spielte einfach los, manchmal schlug er auch nur viermal die Stöcke zusammen … und Curtis fing wieder an, mit ihm zu streiten.
Doch die Auseinandersetzungen führten nie richtig weiter. Und das lag nur zum Teil daran, dass Stan Diskussionen für überflüssig hielt. Der Hauptgrund bestand darin, dass er einfach ein verdammt guter Schlagzeuger war. Curtis wusste sehr genau, wie wichtig ein guter Schlagzeuger für eine Band ist, deshalb riskierte er lieber nicht, Stan zu verlieren. Auch wenn er sich ab und zu mit ihm stritt, vermied er doch, Stans Rolle in der Band aufs Spiel zu setzen.
Mit Kenny lief es ganz anders. Wie Curtis mir schon erzählt hatte, schätzte er Kenny Slater als Bassisten kein bisschen. Es stellte sich heraus, dass Kenny überhaupt nur in der Band geduldet war, weil ihm das meiste Equipment gehörte. Seine stinkreichen Eltern schoben es ihm hinten rein, denn anders als Curtis’ Mum und Dad waren sie überglücklich, ihren Sohn auf jede erdenkliche Weise zu unterstützen. Sie gehörten außerdem zu der Sorte Eltern, die ihren Nachwuchs gern mit Spielzeug überschütten, um aller Welt zu zeigen, wie wunderbar reich sie sind … was ich damals ebenfalls nicht wusste, auch wenn es nicht schwer zu erraten war. Kenny benahm sich nämlich meistens wie ein verwöhntes Kind, das niemand leiden kann und dessen Launen von den anderen Kindern nur ertragen werden, weil er ihnen Süßigkeiten kauft und sie mit seinen teuren Spielsachen spielen lässt.
Ich kann mich natürlich täuschen, doch an jenem Tag hatte ich das deutliche Gefühl, dass mich Kenny nicht mochte. Er mochte aber auch Curtis und Stan nicht richtig und außerdem schien er nicht einmal richtig Lust auf das Ganze zu haben. Doch die Vorstellung, er würde nach Hause gehen und den Rest der Band mit seinem Equipment weiterspielen lassen, war einfach absurd.
»Okay«, sagte Curtis zu mir und lächelte, während er sich eine ramponierte schwarze Gitarre über die Schulter hing. »Bist du bereit, die beste Band der Welt zu hören?«
Während ich sah, wie er zu den andern hinüberging und sein Gitarrenkabel ansteckte, fiel mir wieder auf, wie perfekt er aussah. Das hier war seine Welt … das hier war alles, was ihn ausmachte. Seine Gitarre wirkte wie ein Teil von ihm, und als er die Lautstärke aufdrehte und mühelos eine Reihe von Blues-Riffs runterspielte, wusste ich sofort, dass die Gerüchte, die ich gehört hatte, stimmten – er war wirklich ein Genie auf der Gitarre. Dabei waren die Riffs, die er spielte, gar nicht besonders schwierig oder so, es lag nur an der Art, wie er sie spielte, so natürlich, lässig und rein, und an der rauen Schönheit des Sounds, der nicht aus den Boxen und nicht mal aus der Gitarre zu kommen schien, sondern irgendwo tief aus Curtis’ Seele …
Ich war echt sprachlos.
Zufrieden mit dem Klang seiner Gitarre, drehte er die Lautstärke auf und donnerte einen Akkord raus, ein gewaltiges fettes E-Dur, so laut, dass die Wände zitterten – und mein Magen auch. Ich konnte mich gerade noch zurückhalten, mir die Hände über die Ohren zu legen. Ich schaute zu Curtis, der mich anlächelte, wohl um mich daran zu erinnern, dass E-Dur sein Lieblingsakkord war.
Ich nickte ihm zu und er lächelte zurück.
Einen Moment lang hielt er meinem Blick stand, dann drehte er sich zu Stan um. »Fertig?«
Stan nickte.
Curtis schaute zu Kenny rüber. »Okay?«
Kenny zuckte die Schultern.
Curtis ging hinüber und stellte sich vors Mikro. »Das hier ist unser Erkennungssong. Er heißt Naked.«
Er schwieg einen Moment, schloss die Augen und dann – leicht nach vorn gebeugt, fast wie unter Schmerzen – stieg er mit einem Dröhnen wirbelnder Akkorde ein, dass es mich fast aus den Schuhen warf. Nach vier schnellen Gitarrentakten stürmten Bass und Schlagzeug los und ich schwöre, der ganze Fußboden bebte. Es war ein gewaltiger, riesiger Sound und da wusste ich, was Curtis gemeint hatte, als er von Musik sprach, die dreckig und laut war. Und schnell … Gott, spielten sie schnell. Es war atemberaubend. Curtis war wie ein Wahnsinniger – er drosch die Akkorde heraus und wand sich und wirbelte durch die Garage, taumelte rückwärts, wankte nach vorn – und dann schoss er zum Mikro und fing an zu singen – und seine Stimme war unglaublich. So kraftvoll, so laut und rau, so einfach und brutal … doch gleichzeitig unfassbar schön. Voller Gefühl, Leidenschaft, Emotion …
Ein Gesang, der tief aus seinem Innern kam.
Abgesehen von dem Refrain, als alle drei ein gutturales »Naked! Naked!« skandierten, konnte ich nicht viel von dem Text verstehen, doch von dem bisschen, was ich verstand, hatte ich den Eindruck, dass es um Dekadenz und Poesie und monströse Seelen ging.
Ich hatte noch nie etwas gehört, das sich mit dieser Musik vergleichen ließ.
Der Song dauerte nicht lange – höchstens drei Minuten –, und sobald er zu Ende war, rief Curtis »Monkey!« und sie setzten zu einem weiteren Song an. Der zweite war etwas langsamer, ein bisschen weniger atemlos und nicht ganz so manisch wie Naked, hatte aber die gleiche Intensität und Dunkelheit und er schien eins von den Stücken zu sein, die mit jedem Hören besser werden.
Der letzte Song, den sie spielten, war ein bisschen anders. Er hieß Heaven Hill und Curtis fing ganz leise an, mit trauriger Stimme zu einer unbegleiteten eindringlichen Gitarrenmelodie zu singen, bevor sich der Song allmählich zu einem wabernden Echo bittersüßer Harmonien aufbaute, die von einem hypnotisierenden Herzschlagrhythmus aus wummerndem Bass und Schlagzeug untermauert wurden. Wieder kannte ich nichts, was sich damit vergleichen ließ, und wenn mich jemand gefragt hätte, was das für eine Musik war, hätte ich es beim besten Willen nicht sagen können.
Sie war ganz einfach unvergesslich.
Als der Song endete und sich in der Ausgangsmelodie der Gitarre verlor, drehte sich Curtis zu Kenny und Stan um, nickte, wischte sich den Schweiß aus dem Gesicht und sah mich an.
»Und?«, fragte er. »Was sagst du?«
»Fantastisch«, erklärte ich. »Echt .. ich bin total begeistert, vor allem vom letzten Song.«
»Ja«, stimmte er zu. »Am Mittelteil müssen wir noch ein bisschen arbeiten … aber ansonsten haben wir’s fast.« Er nahm die Gitarre ab, lehnte sie gegen die Wand und kam zu mir rüber. »Das heißt also, du findest, wir sind okay?«
»Ja, echt.«
Er lächelte wieder. »Möchtest du jetzt mal ausprobieren, auf dem Bass zu spielen?«
Ich warf einen Blick zu Kenny rüber, der leise an den Saiten zupfte, und fragte mich, ob es wirklich seine Idee war, nicht mehr Bass spielen zu wollen, oder ob es eher Curtis war, der es nicht wollte. Jedenfalls wirkte er ziemlich mürrisch, doch da das bei ihm eine Art Grundhaltung zu sein schien, war mir nicht klar, was er wirklich empfand. Und auch wenn Curtis gesagt hatte, Kenny sei »sowieso ziemlich scheiße am Bass« – für mein Gefühl hatte es gut geklungen. Andererseits, was wusste ich schon vom Bassspielen?
Das genau war das Problem: Ich wusste gar nichts. Und trotzdem war ich da und sollte Kenny ersetzen, der, soweit ich es beurteilen konnte, ein absolut kompetenter, vielleicht sogar überdurchschnittlicher Bassist war.
Nicht gerade die angenehmste Situation.
»Lili?«, fragte Curtis.
»Ja …«, murmelte ich und schaute wieder zu ihm. »Entschuldigung, ich hab nur …« Ich senkte die Stimme. »Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Ich meine –«
»Klar ist das eine gute Idee«, sagte er forsch-fröhlich. »Los … versuch’s einfach.« Er legte seine Hand auf meinen Arm und führte mich dorthin, wo Kenny stand. »Ist ganz leicht«, sagte er zu mir. »Kenny spielt auch erst seit ein paar Monaten Bass … stimmt’s, Kenny?«
Kenny sah ihn an. »Was ist?«
»Ich hab nur Lili gerade erzählt, dass du nicht lange gebraucht hast, Bass zu lernen«, sagte Curtis grinsend. »Und jetzt bist du total heiß.«
Kenny zuckte nur mit den Schultern.
Curtis sagte zu ihm: »Dann gib ihn her.«
»Was?«
»Deinen Bass.« Er seufzte. »Jetzt mach schon, Kenny, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit.«
Kenny warf mir einen Seitenblick zu, dann nahm er unwillig den Bass ab und reichte ihn Curtis. Curtis lächelte ihn verkniffen an, wartete, dass er zur Seite trat, und wandte sich schließlich, den Bass hochhaltend, zu mir um. Es war ein Fender Mustang … nicht dass ich das damals schon gewusst hätte. Das Einzige, was ich damals wusste, war, dass das Ding riesig wirkte.
»Also«, sagte Curtis zu mir und lächelte wieder normal. »Ich nehme an, du bist Rechtshänderin?«
»Ja.«
»Okay, lass uns erst mal wegen der Größe probieren.« Er trat dicht an mich ran und schlang mir den Gitarrengurt über den Kopf, dann ließ er den Fender-Bass vorsichtig nach unten sinken, bis das ganze Gewicht auf dem Gurt lag. »Na, wie fühlt sich das an?«, wollte er wissen.
»Der wiegt ja ’ne Tonne«, erklärte ich ihm.
»Da gewöhnst du dich dran. Soll ich dir den Gurt anpassen? Oder ist es okay so?«
»Ich glaub, es passt.«
»Gut«, sagte er, trat zurück und musterte mich von oben bis unten. »Echt, steht dir. Siehst toll aus.«
Aber es fühlte sich nicht toll an. Nicht nur, dass der Bass so lang war wie ich groß, er schien auch genauso viel zu wiegen wie ich. Es reichte mir schon, mit dem Teil einfach nur dazustehen, ganz zu schweigen davon, es auch noch zu spielen.
»Vielleicht ist es ja besser, wenn du dich erst mal hinsetzt«, sagte Curtis. »Moment, ich hol dir einen Stuhl.« Er ging ans hintere Ende der Garage und schleppte einen alten Holzstuhl mit senkrechter Rückenlehne an. »Versuch’s mal damit«, sagte er.
Es war mir ein bisschen peinlich, mich hinzusetzen und den Bass auf die Schenkel zu stützen, aber es fühlte sich deutlich bequemer an und das wog die Verlegenheit locker auf.
»Besser?«, fragte Curtis.
»Ja, danke.«
»Gut … dann lass uns mal loslegen.« Er sah mich an. »Benutzt du normalerweise ein Plektrum, wenn du Gitarre spielst? Oder zupfst du?«
»Plektrum.«
»Okay … also, Bass kannst du entweder Fingerstyle spielen, so wie Kenny, oder mit Plektrum. Fingerstyle-Spieler machen sich manchmal lustig über Leute, die mit Plektrum spielen …« Er warf einen Blick zu Kenny rüber und grinste leicht. »Aber für mich macht das keinen wirklichen Unterschied. Ich meine, solange du den richtigen Sound hinkriegst, ist es doch egal, wie du’s machst, oder? Ist also absolut deine Sache … wenn du gewohnt bist, mit Plektrum zu spielen, kannst du’s ja erst mal auch hier tun.« Er reichte mir ein Plektrum. »Okay?«
»Ja.«
»Gut … also, das Einzige, was du wissen musst, ist, dass ein Bass genauso gestimmt ist wie die ersten vier Saiten einer Gitarre.« Er griff hinüber und berührte die erste Saite. »Das heißt, das hier ist E, dann kommt A, D und G. Okay?«
»Ja.«
»Das hier ist die Lautstärke«, sagte er und zeigte auf einen der zwei Reglerknöpfe. »Der andere passt den Ton an.« Er schaute zu mir. »Und das ist auch schon so ziemlich alles.«
»Okay«, sagte ich.
»Also dann …« Er lächelte. »Auf geht’s.«
Ich sah ihn an, weil ich davon ausging, dass er wissen wollte, was ich tat. Würde ich zögern? Würde ich ihn fragen, was ich tun sollte? Oder würde ich einfach loslegen?
Ich holte Luft und legte los.
Die einzigen Gitarren, die ich bis dahin gespielt hatte, waren akustische, noch dazu meistens klassische Akustikgitarren, die Nylonsaiten haben und nicht besonders laut sind. Als ich also die leere E-Saite des riesigen Fender Mustang anschlug und der gewaltige Basston aus den Boxen wummerte … also, es ist echt schwer zu beschreiben, wie einem das durch und durch bis in die Eingeweide geht. Dieser tiefe, dunkle, wuchtige Sound, das Gefühl, das man dabei spürt … das durch die Vibration des Bodens meinen ganzen Körper erfasste … es war so unglaublich gut.
Ich spielte ein bisschen weiter, schlug ein paarmal die freie E-Saite an – dump-dump, dump-dump – und dann die A-Saite – domp-domp, domp-domp –, dann wieder E. Ich fuhr den Hals der Bassgitarre runter, drückte die E-Seite am dritten Bund und stampfte ein fettes großes G raus. Die Saite war unsäglich dick und fest gespannt, viel schwerer runterzudrücken als die weichen Nylonsaiten einer klassischen Akustikgitarre. Mein Finger begann schon fast beim ersten Mal zu schmerzen. Ich spielte noch ein paar Töne, glitt hinauf zu A, dann zu B, doch danach musste ich den Hals loslassen und meine Finger ausschlagen, um den Schmerz zu lindern.
»Gut?«, fragte Curtis.
»Ja … wunderbar. Ist nur ein bisschen schwer, die Saiten gedrückt zu halten.«
»Auch daran gewöhnst du dich.«
Er ging hinüber und nahm seine Gitarre hoch. »Willst du mal versuchen mitzuspielen?«
»Weiß nicht … ich glaub nicht, dass ich schon so weit bin …«
»Klappt bestimmt«, sagte er. »Wir spielen nur ein bisschen 12-taktigen Blues, du weißt schon… simple Drei-Akkord-Sachen. E, A und H … verstehst du, was ich meine?«
»Ja, aber ich weiß nicht –«
»Bleib einfach bei den einzelnen Tönen – dah-dah, dahdah, dah-dah, so wie du es gerade gemacht hast. Okay?«
Ich nickte. »Ich werd tun, was ich kann.«
»Gut.« Er drehte sich zu Kenny um, der eine Gitarre nahm, sie anschloss und sich dann an eine der Boxen stellte. »Fertig?«
Kenny nickte.
Curtis drehte sich wieder zu mir um. »Steig einfach ein, wenn du so weit bist, okay?«
Ich nickte.
Curtis drehte die Lautstärke an seiner Gitarre auf, spielte ein paar schnelle Blues-Tonleitern runter, regelte ein bisschen den Klang nach und dann fing er – mit einem kurzen Nicken zu Stan – an zu spielen.
Er spielte ziemlich langsam, begann mit einem traditionellen absteigenden Blues-Intro und danach fielen Kenny und Stan ein und führten den Rhythmus fort, während Curtis die Dinge mit ein paar einfachen, aber sehr wirkungsvollen Blues-Riffs am Laufen hielt. Es waren tatsächlich ziemlich einfache Sachen und ich wusste im Innern, wie mein Part war … zumindest welche Noten ich spielen musste und wo und wann ich sie spielen musste. Es war nur die Frage, es tatsächlich zu tun.
Denk nicht drüber nach, sagte ich mir immer wieder. Tu’s einfach. Nimm den Rhythmus im Kopf auf – dah-dah, dahdah, dah-dah, dah-dah – und dann los, schlag die E-Saite an.
Ich wartete … während die Tonart zu H wechselte.
Dah-dah, dah-dah, dah-dah, dah-dah …
Und dann zurück zu A.
Dah-dah, dah-dah, dah-dah, dah-dah …
Und schließlich wieder zurück zu E.
Dah-dah, dah-dah, dah-dah, dah-dah …
Dah-dah, daaaah …
Und dann stieg ich ein.
Obwohl ich nur einzelne Noten spielte, brauchte ich eine Weile, bis ich heraushatte, wie ich sie mit dem wummernden Rhythmus einer Bassgitarre spielen musste, doch nachdem ich ein paarmal abgebrochen und wieder eingesetzt hatte, um mit der Haltung meiner rechten Hand zu experimentieren, kapierte ich, wie ich Länge und Ausklang jedes Tons und damit auch den Rhythmus besser kontrollieren konnte.
Während wir weiter dieses simple Drei-Akkord-Schema spielten, wurde ich immer sicherer und bald traute ich mich, hier und da ein paar Extratöne einzuflechten. Ich war noch immer weit davon entfernt, eine Basslinie im eigentlichen Sinn zu spielen, aber ein Fortschritt war es trotzdem. Ich war nicht mehr eingeschüchtert oder übermäßig unsicher. Ehrlich gesagt spürte ich sogar langsam, wie es mir richtig Spaß machte. Obwohl diese Musik so schlicht war, dass sie schon fast dumm wirkte – besonders der Part, den ich spielte –, wirkte sie genauso hypnotisierend wie die stärksten Stücke, die ich je gespielt hatte, einschließlich Debussy. Vielleicht sogar noch stärker. Es machte süchtig. Ich wollte gar nicht mehr aufhören. Ich wollte nur, dass wir weitermachten, weiter diese wunderbar idiotische Musik spielten – dah-dah, dah-dah, dah-dah, dah-dah –, noch mal und noch mal und noch mal …
Aber schließlich schmerzten meine Finger vom Drücken der Basssaiten so sehr, dass ich aufhören musste. Ich konnte einfach körperlich nicht mehr weiterspielen.
Ein paar Sekunden, nachdem ich aufgehört hatte, hörten auch die andern auf.
»Tut mir leid«, sagte ich und schüttelte die pochenden Finger aus.
»Kein Problem«, sagte Curtis und lächelte mich an. »Ist vielleicht keine schlechte Idee, deine Hand mal eine Minute lang still zu halten.«
»Was?«
»Du spritzt überall Blut rum.«
Ich hörte auf, die Hand herumzuschlenkern, und schaute auf meine Finger.
Die Basssaiten hatten sich so tief in meine Fingerkuppen gegraben, dass der Zeigefinger blutete.
»Scheiße«, flüsterte ich.
Curtis lachte.
Ich funkelte ihn an.
»Hey«, sagte er immer noch lächelnd. »Willkommen in unserer Band.«
4
Nach diesem Wochenende änderte sich alles für mich. Ich verbrachte viel Zeit mit Curtis, ging mehrmals die Woche abends zu ihm, um Bass zu lernen und Naked-Songs einzustudieren … zumindest redete ich mir ein, dass ich deshalb zu ihm ging. Und anfangs war es auch wirklich das Einzige, was ich dort tat.
Wir trafen uns nach der Schule, tranken vielleicht schnell noch einen Kaffee und aßen irgendwas, dann gingen wir zu ihm nach Hause und verbrachten zwei oder drei Stunden in seinem Zimmer, um Songs durchzugehen. Ich saß mit dem Bass auf dem Bett, Curtis hockte mit der Gitarre neben mir, wir schlossen beide an einen kleinen Probenverstärker an und dann spielten wir einfach die Songs durch – noch mal und noch mal und noch mal –, bis ich sie in- und auswendig konnte. Curtis gab mir immer wieder Tipps, wie ich den Bass spielen sollte, wie ich das Beste aus ihm rausholte, wie ich den richtigen Sound hinkriegte und – was viel wichtiger war – das richtige Feeling … und nach ein paar Wochen oder so war ich nicht bloß halbwegs gut geworden, sondern hatte auch jede Menge Selbstvertrauen getankt. Ehrlich gesagt so viel, dass ich sogar anfing, bei einigen Songs mit Curtis zusammen zu singen.
Die Songs stammten alle von ihm, sowohl die Musik als auch die Texte, und ich fand bald heraus, dass er trotz seiner Lässigkeit in allen anderen Dingen das Songschreiben ungemein ernst nahm. Die Songs bedeuteten ihm alles, sie kamen ihm aus dem Herzen, aus der Seele. Auch die Texte waren so persönlich, dass er – so stolz er auf sie war – eisern jede Erläuterung verweigerte.
»Songs sind Songs«, verkündete er einmal. »Sie brauchen keine Erklärung.«
»Ja, schon«, sagte ich. »Aber die Worte –«
»Sind einfach bloß Worte.«
Curtis war auch in Bezug auf seine Musik sehr eigen und bestimmend. Er wusste genau, wie sie zu klingen hatte und wie sie zu spielen war. Die Meinungen und Vorschläge anderer interessierten ihn einfach nicht. Schnell begriff ich, dass Kenny und Stan gar nicht mehr versuchten, sich bei ihm Gehör zu verschaffen – sie taten einfach, was er ihnen sagte. Und es dauerte Monate, bevor Curtis widerwillig akzeptierte, dass meine Grundlagen in klassischer Musik und mein jahrelanges Lernen und Üben nicht völlig unwichtig und wertlos waren. Auf den ersten Blick hatte er natürlich recht, denn für die Musik, die wir spielten, war meine klassische Ausbildung völlig unwichtig und wertlos. Aber ich wusste nun mal eine Menge über Musik – wie sie funktioniert, wie Dinge zusammenpassen, wie man Rhythmus, Struktur und Melodie am wirkungsvollsten einsetzt – und Curtis begriff schließlich, dass es sich lohnte, meine Ideen ab und zu zur Kenntnis zu nehmen.
Aber das war erst später …
In jener ersten Zeit war ich völlig zufrieden, meine Vorstellungen für mich zu behalten, auf Curtis zu hören und mit voller Konzentration die Grundlagen zu lernen.
Eine weitere Veränderung war, dass sich durch das ständige Bassspielen die Haut an den Fingerkuppen der linken Hand schnell verhärtete, sodass das Bluten aufhörte und die Griffe weniger schmerzhaft wurden. Die Kehrseite war, dass mir die Verhärtung beim Klavierspielen überhaupt nicht half. Ich schaffte es trotzdem, irgendwie durch die Klavierprüfung zu kommen, doch es war deutlich, dass mein Klavierspiel litt. Was mir nicht wirklich viel ausmachte. Denn auch wenn es mir immer noch gefiel und ich weiter klassische Musik liebte, verlor ich mit der Zeit jedes Interesse an der akademischen Seite des Spielens. Musik war inzwischen für mich so viel mehr geworden und die Vorstellung, Musik zu studieren, schien plötzlich so sinnlos, so künstlich … so seelenlos.
Ich verbrachte nicht nur viel Zeit mit Curtis allein, sondern auch mit der gesamten Band, um zu üben, die Songs einzustudieren und neue zu entwickeln. Es war nicht einfach, einen neuen Probenraum zu finden. Curtis’ Eltern hatten ihn nicht nur kategorisch aus der Garage verbannt, sondern sogar ein Schloss vor das Tor gehängt, damit er selbst dann nicht reinkonnte, wenn sie weg waren. Also mussten wir etwas anderes finden, wo wir spielen konnten, und etwa einen Monat lang übten wir ein paarmal die Woche in einem Club in Kilburn. Der Club war einer von mehreren im Londoner Norden, die Stans Vater gehörten, und er hatte nichts dagegen, dass wir dort probten, wann immer der Laden frei war … jedenfalls bis Curtis es irgendwie schaffte, das Verstärkersystem des Clubs zu überlasten, die Lautsprecheranlage zu schrotten und einen Schaden von £1500 anzurichten, womit Stans Dad nicht besonders gut klarkam. Danach probten wir an allen möglichen Orten – in einer verlassenen Fabrik, in einer Garage, in einem Tanzstudio, im Keller eines besetzten Hauses in Seven Sisters …
Grundsätzlich eignete sich alles, was ein Dach und einen Stromanschluss hatte.
So eroberte, während die Tage dahingingen und die Sommerferien anfingen, Naked mein Leben. Wir probten hart, wir studierten neue Songs ein … und wenn ich nicht mit der Band zusammen war oder allein am Bass übte, verbrachte ich meine Zeit nur noch mit Curtis. Ich würde lügen, wenn ich sagte, es hätte damals noch nicht gefunkt zwischen uns. Ich glaube, wir wussten beide von dem Moment an, als wir uns in dem Musikraum trafen, was passieren würde. Aber körperlich lief noch nichts zwischen uns in diesen ersten paar Wochen. Es gab nur dieses Sich-Anlächeln und Witze machen, jede Menge spielerisches Flirten, und wenn wir nebeneinander auf Curtis’ Bett saßen und beide Gitarre spielten, beugte sich Curtis auch ein paarmal zu mir rüber, nahm meine Hand und führte die Finger behutsam über das Griffbrett, während mein Herz anfing zu pochen, mir heiß wurde und ich mich total aufgewühlt fragte, ob er mich küssen würde, wie das wohl wäre und wie ich mich fühlen würde, falls er plötzlich mehr wollte, als mich nur küssen …
Ich dachte ziemlich oft drüber nach. Fragte mich, ob ich es wirklich wollen würde, stellte mir vor, wie es wäre, was ich empfinden und was es bedeuten würde …
Als der große Moment schließlich kam – in Curtis’ Zimmer an einem schwülen Sonntagnachmittag im Juli, an dem seine Eltern nicht da waren … na ja, da war es nichts von dem, was ich mir vorgestellt hatte. Das soll nicht heißen, dass es schrecklich war oder so, es war nur … keine Ahnung. Es war einfach nicht, wie ich es mir vorgestellt hatte. Wie gesagt hatte ich ja die ganze Zeit irgendwie gewusst, dass es passieren würde, und war mir auch ziemlich sicher gewesen, dass ich es wollte. Ich mochte Curtis wirklich, ich bewunderte ihn, ich sah zu ihm auf … ehrlich gesagt, ich hatte Ehrfurcht vor ihm. Er war etwas Besonderes. Und ich fühlte mich zweifellos von ihm körperlich angezogen. Als er also an dem Nachmittag ins Zimmer zurückkam, nachdem er sich vorher entschuldigt hatte, er müsse mal eben ins Bad … als er die Tür schloss, zu mir kam, sich neben mich aufs Bett setzte, den Arm um meine Taille legte und mich zärtlich auf den Mund küsste … war es wirklich genau das, was ich wollte. Ich war mir zwar noch nicht vollkommen sicher, ob es darüber hinausgehen sollte, doch irgendwie wusste ich, dass es so kommen würde … und wir landeten zusammen im Bett und Curtis flüsterte atemlos: »Bist du sicher, dass es okay ist?«, und ich sagte: »Ja … ja, es ist okay …«
Und es war okay.
Mehr oder weniger …
Zum einen war es mein erstes Mal und ich wusste nicht recht, wie es eigentlich sein musste, was ich tun sollte. Ich wusste nicht, ob es normal war, ein bisschen Angst zu haben vor dem, was passieren würde, und – um ganz ehrlich zu sein – auch ein bisschen abgetörnt zu sein. Es muss an der schieren Körperlichkeit gelegen haben. An der Realität des sexuellen Akts, die so gar nichts zu tun hat mit der Traumwelt des Sich-Verliebens. Ich glaube, die Realität des Ganzen war einfach ein bisschen zu viel für mich. Die nackte Wirklichkeit von Curtis’ Körper, sein tierisches Ächzen und Stöhnen, sein beängstigend forderndes Verlangen … so war das in meinen Träumen nie gewesen.
Ich erinnere mich ziemlich deutlich daran, wie ich nach dem ersten Mal im Bett lag und Curtis zusah, als er die Jeans anzog und sich eine Zigarette anzündete … und ich weiß noch, wie ich dachte: War es das? War es das, worum es immer geht?
Aber wie gesagt, es war okay.
Es war sowohl meine als auch Curtis’ Entscheidung gewesen und ich hätte Nein sagen können, wenn ich gewollt hätte. Es war nicht so, dass ich zu irgendetwas gezwungen worden wäre. Und Curtis war auf seine Art ziemlich zärtlich und lieb. Es war nur einfach …
Keine Ahnung.
Es veränderte alles so sehr. Es veränderte, wie ich Curtis sah. Es machte mir bewusst, dass er – in einer Hinsicht zumindest – nicht anders war als die übrigen Jungs. Und es veränderte auch mich, indem es mir das Kind raubte, das ich im Innern noch war, indem es mich zu schnell erwachsen werden ließ.
Es veränderte uns.
Es veränderte alles.
Und von da an sehnte sich ein Teil von mir ständig zurück nach der Zeit vor diesem Sonntagnachmittag, nach der Zeit, als ich abends ins Bett gehen und in völliger Unschuld davon träumen konnte, wie Curtis mich angesehen oder gelächelt hatte, oder auch nur von dem Gefühl seiner Hand, als er meine Finger über das Griffbrett der Bassgitarre führte …
Bevor ich Curtis traf, gehörte ich nicht zu denen, die abends ständig weggingen. Nicht dass ich ein Stubenhocker war oder so, ich ging auf Partys, in Clubs und zu Konzerten, aber ich musste nicht jede Nacht durch die Stadt ziehen. Doch mit Curtis … na ja, er gehörte eben zu denen, die jede Nacht unterwegs sein müssen. Jetzt, wo wir ein Paar waren, ging ich plötzlich auch ständig weg. Manchmal waren wir zu zweit, manchmal kamen auch Kenny und Stan mit und manchmal überraschte mich Curtis, indem er Leute mitbrachte, die ich noch nie getroffen hatte. Er kannte jede Menge Leute und bis heute weiß ich nicht, wie und wo er sie traf. Er schien sie eben einfach zu kennen. Die meisten hatten mit Kunst zu tun – es waren Schriftsteller, Musiker, Lyriker, Maler –, und wenn auch manche okay waren und man niemanden als langweilig bezeichnen konnte, waren es doch keine besonders angenehmen Menschen. Das schien Curtis nicht weiter zu stören. Sie konnten laut, derb, abstoßend, schmutzig … unheimlich, verrückt, gemein oder sogar gefährlich sein – Curtis kümmerte das nicht. Solange sie anders waren, zählte für ihn nur das. Er liebte alles Abnormale. Er fand es interessant. Es war fast so, als ob er das Leben als Zirkus sähe und sich selbst als Zirkusdirektor, der sich mit dressierten Tieren und Clowns und Freaks umgab. Deshalb fragte ich mich manchmal, ob er mich auch so sah – als eine Unterhaltungsnummer im Zirkus seines Lebens.
Ich muss allerdings zugeben, dass wir richtig gute Zeiten zusammen hatten. Curtis nahm mich zu Konzerten von allen möglichen Bands an alle möglichen Orte mit – Bands, von denen ich nie gehört hatte, Bands, die großartig, und andere, die schrecklich waren. Wir sahen Dr. Feelgood, Eddie & the Hot Rods, Bazooka Joe, die Stranglers, die Count Bishops, Kilburn and the High Roads, The 101s … und ein Dutzend andere. Auch wenn ich das damals nicht wusste, waren viele dieser Bands Vorläufer des Punk und in manchen spielten Leute, die später richtig groß wurden. The 101s waren zum Beispiel die Band von Joe Strummer. Ian Dury spielte bei Kilburn and the High Roads. Und Adam Ant war bei Bazooka Joe.
Und als ich diese Art von Bands sah und die Leute, die mitkamen, um sie zu hören, begriff ich zum ersten Mal, dass in der Musikwelt irgendwas Neues aufkam … zumindest in London. Es lag eine andere Stimmung in der Luft. Die klassische Rockmusik war übers Ziel hinausgeschossen, berühmte Gruppen wie die Rolling Stones und Led Zeppelin waren zu bombastisch und abgehoben. Einfachheit war wieder gefragt. Der Rock ’n’ Roll kehrte zu seinem Ursprung zurück: kurze Songs, keine Solos, Alltagsklamotten, Alltagsmenschen.
Das gefiel mir sehr.
Weniger gut gefiel mir der Klamottenladen in Chelsea, von dem alle sprachen und in den Curtis mich irgendwann mitnahm. Der Laden hieß Sex und wurde später als der Geburtsort der Sex Pistols bekannt. Als Curtis mich im August 1975 zum ersten Mal dorthin mitnahm, hatte das Sex schon mehr und mehr den Ruf eines Orts, wo man unbedingt hinmusste. Der Laden gehörte Malcolm McLaren und Vivienne Westwood, die ihn auch führten, und im Lauf der Jahre arbeiteten dort Leute wie Glen Matlock und Sid Vicious, Chrissie Hynde (die später die Pretenders gründete) und eine gewisse Jordan, die die unglaublich freizügigen und provozierenden Sachen des Ladens gerne zur Schau stellte. Viele der Klamotten waren Bondage-Sachen: Latex-Zeug, Kapuzen, T-Shirts mit pornografischen Abbildungen drauf – Kleidung, die schockieren sollte. Allein darum ging es in meinen Augen an diesem Ort – schockierend, anstößig, empörend zu sein. Was Curtis natürlich faszinierend fand. Das war ein Grund, weshalb er gern hinging. Ein anderer – den er aber schlichtweg leugnete – war, dass Jordan nicht als Einzige im Laden freizügige und provozierende Sachen trug. Es gab jede Menge Mädchen, die in zerrissenen Fischnetzstrümpfen und schwarzem Lack umherstolzierten – und die meisten liebten es, sich mitten im Laden umzuziehen statt in einer Umkleidekabine: je mehr Zuschauer, desto besser.
»Das hat überhaupt nichts mit Sex zu tun«, erinnere ich mich an einen von Curtis’ Aussprüchen, als ich mitbekam, wie er ein halb nacktes Mädchen angaffte. »Es geht darum, Tabus zu brechen, verstehst du … die traditionellen Moralvorstellungen über Bord zu werfen …«
»Ja, klar«, antwortete ich. »Natürlich.«
Doch auch wenn die Mädchen und das ganze erotische Klima des Ladens für Curtis eindeutig einen Teil der Attraktion ausmachten, der Hauptgrund, weshalb er sich dort gerne aufhielt, war, dass es im Sex einfach abging. Nicht dass Curtis – oder sonst jemand – damals so richtig wusste, was dieses Es war, doch sein Instinkt sagte ihm, egal was es sein mochte, es war neu und aufregend, es war anders, es würde groß rauskommen, und Curtis war entschlossen, ein Teil davon zu sein. Deshalb verbrachte er so viel Zeit im Sex und lernte nach und nach alle kennen, die zum harten Kern gehörten – die Sex Pistols, Johnny Rotten, Sid Vicious, Malcolm McLaren, Siouxsie Sioux, Steven Severin … all die Namen und Gesichter, die einmal als die Pioniere der aufkommenden Punkszene bekannt werden sollten.
Ich war nicht jedes Mal dabei, wenn er nach Chelsea fuhr – manchmal ging er auch mit Kenny und Stan und manchmal allein –, und selbst wenn ich mitkam, hatte ich nicht viel mit den andern zu tun. Ich redete nur mit den Leuten, wenn sie mich ansprachen, hielt mich ansonsten im Hintergrund und blieb für mich. Das lag zum Teil sicher daran, dass ich noch immer ziemlich schüchtern und ein bisschen von dem Ganzen überfordert war. Aber viel wichtiger war, dass ich die meisten Leute dort nicht sonderlich mochte. Sie waren interessant, sie waren anders und ohne Zweifel wirkten einige von ihnen faszinierend … aber ich persönlich fand die meisten nicht besonders sympathisch. Wobei sympathisch für Curtis überhaupt kein Kriterium war. Für ihn zählten nur die Energie, die Gefahr, die neuen Ideen, neuen Sounds, neuen Klamotten – die selbst gefärbten Punkhaare, die Do-it-yourself-Mode, das übertriebene Makeup … das ganze schockierende Gehabe.
Natürlich ist es heute völlig akzeptiert, wild abstehende Haare zu haben und sie so schrill zu färben, wie es dir gefällt, und inzwischen tragen auch Eltern in den mittleren Jahren maschinell eingerissene Jeans von Asda, deshalb ist es schwer zu verstehen, dass diese Dinge einmal als empörend empfunden wurden.
Aber so war es.
Und Curtis interessierte sich mit aller Leidenschaft für sie.
Am 9. November des Jahres gingen wir ins St. Martin’s College, wo die Sex Pistols ihren allerersten Auftritt hatten. Curtis wirkte inzwischen total szenig. Seine Haare waren kurz abgeschnitten und leuchtend grün gefärbt, er trug immer Eyeliner und Lippenstift und hatte sich angewöhnt, mehr oder weniger ständig dieselben Klamotten zu tragen: schmutzige alte Jeans mit geraden Beinen, die am Knie eingerissen waren; ein abgewetztes T-Shirt mit abgerissenen Ärmeln, schwarze Motorradstiefel und eine uralte schwarze Lederjacke, auf deren Rücken er in blutroter Farbe NAKED geschmiert hatte.
Auch für Drogen interessierte er sich mehr und mehr.
Das war nichts völlig Neues für Curtis. Seit wir uns kannten, hatte er immer mal etwas Dope geraucht, und auch wenn es mir nicht besonders gefiel, gewöhnte ich mich bald daran. Ich selbst konnte mich zwar nie so richtig fürs Kiffen begeistern – was nicht heißen soll, ich hätte nie etwas angerührt –, aber in Curtis’ Welt, die meine Welt geworden war, war es einfach etwas, das jeder tat. Es war keine große Sache. Wenn du ein bisschen Gras hattest, rauchtest du es. Wenn du ein bisschen Koks hattest, schnieftest du es. Wenn du aus deinem Kopf rauskonntest, machtest du es. So einfach war das.
Doch in jener Nacht im November, der Nacht des Sex-Pistols-Auftritts, wusste ich sofort, dass Curtis mehr als bloß einen Joint oder eine Linie Koks genommen hatte, als ich ihn in dem besetzten Haus in Seven Sisters traf, wo wir manchmal probten. Er war komplett zugedröhnt, hatte riesige Augen und war so nervös und verschwitzt und durchgeknallt … es machte mir richtig Angst.
»Verdammte Scheiße, was hast du genommen, Curtis?«, fragte ich.
»Was ist?«
»Was du genommen hast?«
»Nichts … hab was geraucht, mehr nicht. Ist echt gutes Zeug … willst du auch was, bevor wir gehen?«
»Nein, danke.«