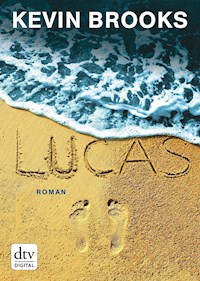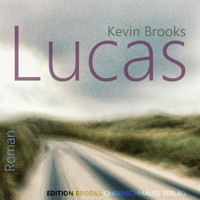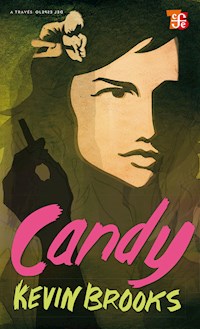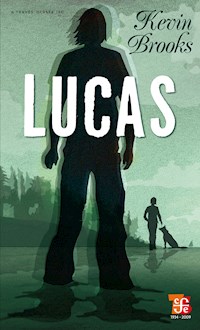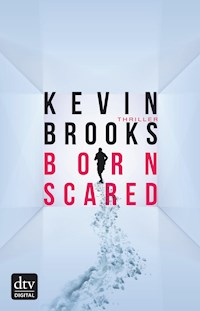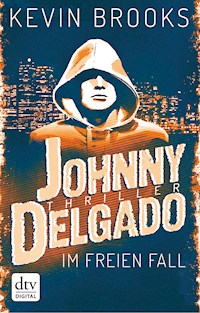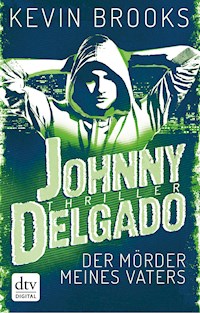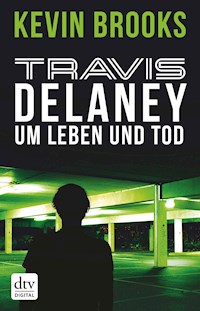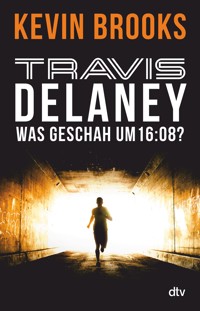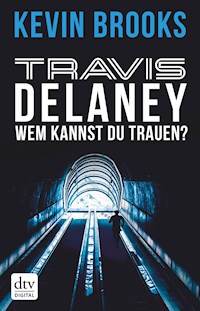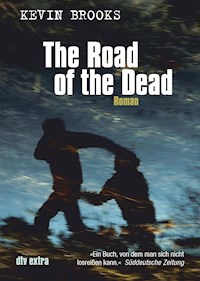
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Deutscher Jugendliteraturpreis 2009 »Der Tod Ihrer Schwester war ein Versehen«, sagte er nebenhin. »Sie war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. So was passiert eben leider manchmal.« Spät eines Nachts erfahren die beiden Brüder Ruben und Cole, dass ihre Schwester Rachel tot ist - sie wurde erwürgt, in einer gottverlassenen Gegend viele Meilen weit weg von ihrem Zuhause in London. Ruben und Cole brechen auf in diese Einöde, um mehr über den Mord und die Ermittlungen herauszubekommen, denn erst wenn der Mörder gefunden ist, kann Rachel beerdigt werden. Insgeheim ahnt Ruben - der Jüngere und Sensiblere der beiden -, dass es für Cole um mehr geht: Cole will Rache. Ruben kennt Coles Impulsivität und weiß, wie rasch sein Bruder zuschlagen kann; er will Cole vor sich selbst schützen. Doch das Dorf in Dartmoor, wo Rachel ihre letzten Tage verbrachte, entpuppt sich als Hexenkessel und den beiden schlägt so viel Hass entgegen, dass auch Ruben machtlos ist gegen den Strudel der Gewalt, in den Cole sich bewusst hineinbegibt. Gewalt erscheint in dieser gesetzesfernen Welt als das einzige Mittel, um herauszufinden, was Rachel wirklich passiert ist, als der einzige Weg, diejenigen dingfest zu machen, die für ihren grausamen Tod verantwortlich sind. Kann dieser Zweck die Mittel heiligen? Was passiert mit denen, die letztlich ähnlich handeln wie ihre Feinde? Verändern gute Motive den Charakter der Tat? So oder so droht die einmal entfesselte Gewalt auch Ruben fürs Leben zu zeichnen ... Kevin Brooks erhielt 2009 für diesen Roman den Deutschen Jugendliteraturpreis - zum zweiten Mal nach 2006 (›Lucas‹).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 385
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Kevin Brooks
The Road of the Dead
Roman
Aus dem Englischen vonUwe-Michael Gutzschhahn
Deutscher Taschenbuch Verlag
Deutsche Erstausgabe 2008© der deutschsprachigen Ausgabe:Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, MünchenDas Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung -und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Rechtlicher Hinweis §44 UrhG: Wir behalten uns eine Nutzung der von uns veröffentlichten Werke für Text und Data Mining im Sinne von §44 UrhG ausdrücklich vor.eBook ISBN 978-3-423-41055-7 (epub)ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-71286-6Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Website www.dtv.de/ebooks
Für Ted Watson –der noch immer in mir lebendig ist!
|7|Bei dem Dorf Post Bridge beginnt der Lych Way, der Pfad der Toten, über den die Leichen nach Lydford gebracht wurden. Dort befand sich die Pfarrkirche, bis im Jahr 1260Bischof Bronescombe den Bewohnern des Dartmoor, die näher an Widdecombe als an Lydford wohnten, das Recht zusprach, sich bei Taufen und Beerdigungen dorthin zu begeben.
A Book of Dartmoor, S.Baring-Gould
Angst einflößend, wie man es sich heute kaum vorstellen kann, muss der Weg über das einsame und unheimliche Land mit seinen sphinxhaften grauen Felsblöcken gewesen sein, die den Pfad wie ewiglich Trauernde säumten… kein Laut außer dem Krächzen der Raben oder den stolpernden Schritten der Trauernden, »wie sie schweigend und langsam den Toten folgten«. Vor ihnen nichts als die mühsamen, endlosen Kilometer durch Felsen, Morast und Überschwemmung… Oft muss es nötig gewesen sein, sich schon im Licht des flüchtigen Wintermondes oder mit noch weniger hilfreichen Sturmlaternen aufzumachen, deren schauriger Schein wie Irrlichter über den Weg huschte.
Devonshire, D.St. Leger-Gordon
Bald kommt das Jüngste Gericht.
Lass es kommen.
Es ist nicht wichtig.
Serbisches Zigeunerlied
Inhalt
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
|9|Eins
Als der Tote Mann Rachel erwischte, saß ich hinten in einem Mercedes-Wrack und fragte mich, ob der Regen aufhören würde. Ich wollte nicht, dass er aufhörte. Ich fragte mich bloß.
Es war spät, fast Mitternacht.
Cole, mein Bruder, hatte den Mercedes erst vor ein paar Stunden auf den Schrottplatz gebracht und mich gebeten, ihn durchzusehen, während er loszog, um irgendwen wegen irgendwas zu treffen. Ich hatte eine Stunde zugebracht, alles durchzuchecken und zu schauen, ob es sich lohnte, den Wagen auseinanderzunehmen, dann hatte es angefangen zu regnen – und da war ich nach hinten gestiegen.
Ich hätte mich sicher auch anderswo unterstellen können. Ich hätte Schutz in einem der alten Abstellschuppen suchen können, ich hätte zurück ins Haus gehen können, aber die Schuppen waren dunkel und voller Ratten, außerdem schüttete es so richtig heftig und das Haus lag genau auf der anderen Seite des Hofs…
Und und und.
Ich mochte den Regen.
Ich wollte nicht, dass er aufhörte.
Ich mochte das Geräusch, mit dem er hart auf das Autodach |10|trommelte. Es gab mir das Gefühl, sicher und im Trockenen zu sein. Ich war gern nachts allein auf dem Autofriedhof. Es machte mich glücklich. Ich mochte, wie die Lichter in der Dunkelheit kristallweiß über der Toreinfahrt strahlten und alles besonders erscheinen ließen. Es gefiel mir, die Regentropfen für aufgefädelte Juwelen, die Haufen Schrottblech für Berge und Hügel und die übereinandergestapelten wankenden Schrottautos für Wachttürme zu halten.
Ich war glücklich damit.
Dann, als eine Windbö das Schild über der Toreinfahrt traf, es in seinen rostigen Ketten ächzen ließ und ich durch das gesplitterte Rückfenster schaute und die bekannten verblichenen Worte las: FORD & SÖHNE – AUTO-ERSATZTEILE: UNFALL-PKWS, VANS & LASTWAGEN, VERSICHERUNGS-TOTALSCHÄDEN UND FAHRZEUGE OHNE TÜV – ANKAUF GEGEN BARZAHLUNG, genau da spürte ich Rachel zum ersten Mal in meinem Innern.
Ich weiß nicht, wie ich diese Empfindungen, die ich manchmal bekomme, beschreiben soll. Cole hat mich mal gefragt, wie das sei, alles zu wissen, was es zu wissen gibt, aber nichts über das Wie und Warum. Ich sagte, ich wüsste es nicht. Und das stimmte.
Ich weiß es nicht.
Was die Empfindungen betrifft, die ich manchmal habe, diesen Eindruck, bei oder in anderen Menschen zu sein – ich habe keine Ahnung, was da eigentlich abläuft, woher diese Empfindungen kommen und warum ich sie kriege. Ich weiß nicht mal, ob sie wahr sind oder nicht. Doch ich habe seit Langem aufgegeben, mir darüber Gedanken zu machen. Sie sind einfach da und weiter |11|lässt sich dazu nichts sagen.
Ich habe sie nicht ständig und ich empfange sie auch nicht von jedem Menschen. Genau gesagt kommen sie außerhalb meiner Familie nur äußerst selten von jemandem. Am häufigsten empfange ich sie von Cole. Manchmal auch von Mum und ganz selten einmal von Dad, doch am stärksten sind die Empfindungen, wenn sie von meinem Bruder stammen.
Mit meiner Schwester war es allerdings immer anders gewesen. Bis zu jener Nacht hatte ich von Rachel noch nie was gespürt. Absolut nichts. Nicht mal ein leichtes Flackern. Keine Ahnung, wieso. Vielleicht lag es ja daran, dass wir ohnehin immer viel miteinander gesprochen hatten, also brauchten wir nichts weiter. Oder vielleicht war es so, weil sie nun mal meine Schwester war. Was weiß ich. Ich hatte einfach bis dahin nie irgendwelche Empfindungen von ihr empfangen, gerade deshalb war es so merkwürdig, sie in jener Nacht plötzlich zu spüren – so merkwürdig und unheimlich…
So erschreckend.
Plötzlich saß sie neben mir, hinten in dem Mercedes, und schaute sich auf dem Autofriedhof um, dann zerplatzte der Augenblick und ich war bei ihr, wir gingen auf einem sturmgepeitschten Weg mitten durch ein verlassenes Moor. Wir froren, waren durchnässt und müde, wir hatten Angst, die Welt war schwarz und leer und ich wusste nicht, wieso.
Ich wusste überhaupt nichts.
»Was machst du hier, Rachel?«, fragte ich sie. »Ich dachte, du wolltest heute Abend nach Hause kommen.«
Sie antwortete nicht. Sie konnte mich nicht hören. Sie war Hunderte |12|Kilometer entfernt. Sie konnte mich nicht spüren. Das Einzige, was sie spürte, waren die Kälte, der Regen, der Wind und die Dunkelheit…
Und dann plötzlich spürte sie noch etwas anderes. Das Rasen des Bluts in ihrem Herzen. Eine lähmende Angst in ihren Knochen. Irgendetwas in ihrer Nähe. Da war was… etwas, das da nicht hätte sein dürfen.
Ich spürte es im selben Moment wie sie und es war für uns beide zu spät.
Der Tote Mann trat aus der Dunkelheit, riss sie nach unten und alles wurde für immer dunkel.
Ich weiß nicht, was danach geschah. Die Empfindungen hörten auf. Ich verlor das Bewusstsein.
Einige Zeit später erwachte ich von dem Schmerz, mit dem ein gezacktes Messer mein Herz aufschlitzte, und ich wusste ohne jeden Zweifel, dass Rachel tot war. Der letzte Atemzug hatte sie gerade verlassen, ich konnte noch sehen, wie er sich mit dem Wind fortstahl. Ich sah ihn über einen Steinkreis und durch die Zweige eines geduckten Weißdorns schweben, dann kam der Sturm mit purpurschwarzem Licht herabgefahren und drückte den Himmel zu Boden, und das war das Letzte, was ich mitbekam.
|13|Zwei
Drei Tage später saß ich mit Mum, Cole und einem graugesichtigen Mann in dunkelblauem Anzug in einem klimatisierten Büro. Das Büro befand sich im obersten Stockwerk der Polizeiwache Bow Green und der Mann im dunkelblauen Anzug war der Kriseninterventions-Beamte, der unsere Familie betreute – Detective Constable Robert Merton.
Es war Freitagmorgen, neun Uhr.
Wir trafen DC Merton nicht zum ersten Mal. Am Mittwochmorgen, als uns die Polizei über Rachels Tod informiert hatte, war er noch eine Weile bei uns zu Hause geblieben und hatte länger mit Mum geredet. Am Donnerstag war er wieder vorbeigekommen und diesmal sprach er mit uns allen. Er hatte berichtet, was Rachel zugestoßen war, was als Nächstes geschehen würde und was vielleicht sonst noch passieren könnte. Er hatte uns Fragen gestellt. Gesagt, wie leid es ihm täte. Er hatte versucht uns zu beruhigen. Versucht uns zu helfen. Er hatte uns Faltblätter und Broschüren überreicht, uns von Trauerberatung, Opferunterstützung und hundert anderen Dingen erzählt, die keiner hören wollte.
Brabbel, brabbel, brabbel.
Mehr war es nicht.
|14|Nichts als Gebrabbel.
Es hatte keine Bedeutung. DC Merton machte bloß seinen Job. Das wussten wir. Aber wir wussten auch, dass sein Job nicht in unsere vier Wände passte, genauso wenig wie er selbst. Er war Polizist. Er trug einen Anzug. Er redete zu viel. So was brauchten wir bei uns zu Hause nicht. Als er am Donnerstagabend wieder anrief, um einen neuen Termin auszumachen, hatte ihm Mum deshalb erklärt, wir würden zu ihm kommen.
»Das ist doch nicht nötig, Mary«, hatte er geantwortet.
»Um neun«, hatte Mum ihm entgegnet.
Und jetzt waren wir also da, saßen an seinem übervollen kleinen Schreibtisch und warteten, was er noch zu erzählen hatte.
Er wirkte müde. Seine Schultern hingen nach vorn, seine Augen waren schwer und ich hatte den Eindruck, als wäre er lieber woanders. Als er einen Stapel Akten aus einer Schublade zog und ihn auf den Schreibtisch legte, sah ich, wie er sich mühte, das Gesicht zu wahren.
»Also, Mary«, sagte er schließlich und lächelte Mum trübsinnig an: »Wie haben Sie alles bewältigt?«
Mum starrte ihn bloß an. »Meine Tochter ist tot. Was glauben Sie wohl, wie ich alles bewältigt habe?«
»Entschuldigung, ich wollte nicht…« Sein Lächeln zog sich vor Verlegenheit zusammen. »Ich meinte den Medienrummel und so weiter?« Er kniff die Augen zusammen. »Ich habe gehört, gestern gab es ein bisschen Ärger?«
Mum schüttelte den Kopf.
»Nein?« Merton sah kurz zu Cole hinüber, dann wandte er sich wieder an Mum. »Ein Fernsehreporter behauptet, er sei tätlich angegriffen worden.«
|15|»Er kam auf den Hof«, sagte Mum achselzuckend. »Cole hat ihn vom Gelände geworfen.«
»Ich verstehe.« Merton sah wieder Cole an. »Es ist vielleicht besser, wenn Sie uns so was machen lassen. Ich weiß, Sie wollen nicht, dass irgendwelche Leute bei Ihnen rumschnüffeln. Aber die Medien können manchmal ganz hilfreich sein. Es ist besser, sie nicht gegen sich aufzubringen.«
Cole antwortete nichts, sondern starrte nur ungerührt zu Boden.
Merton sah ihn immer noch an. »Wenn jemand zu aufdringlich wird, müssen Sie mir nur Bescheid sagen.« Er lächelte. »Wunder versprechen kann ich zwar auch nicht–«
»Sagen Sie ihnen einfach, Sie sollen uns in Ruhe lassen«, unterbrach ihn Cole ruhig. »Wenn noch mal jemand auf unseren Hof kommt, tret ich ihm in die Eier.«
Mertons Lächeln verschwand. »Schauen Sie, ich versuche mein Bestes, die Privatsphäre Ihrer Familie zu schützen, Cole, aber ich gebe Ihnen den ernsthaften Rat, nicht noch mal handgreiflich zu werden.«
»Ja, gut.«
»Ich meine es ernst.«
»Ich auch.«
Merton sah ihn an, das Gesicht ganz erregt. Cole starrte zurück. Merton öffnete den Mund und wollte etwas sagen, doch als er den Blick in Coles Augen sah, änderte er plötzlich seine Absicht.
Ich verstand, warum.
Seit Rachels Tod war Cole so tief in sich versunken, dass sich schwer sagen ließ, ob er überhaupt noch etwas empfand. Es war einfach nichts da. Keine Traurigkeit, kein Schmerz, kein Hass, |16|keine Wut. Das war erschreckend.
»Ich mach mir Sorgen um ihn«, hatte mir Mum erst an diesem Morgen vor unserem Aufbruch gesagt. »Hast du seine Augen gesehen? Es fehlt was darin. So hat dein Vater immer unmittelbar vor einem Kampf geguckt – als wäre ihm egal, ob er am Leben bleibt oder stirbt.«
Ich wusste, sie hatte recht. Auch Merton wusste das. Deshalb tat er so, als würde er die Akten auf seinem Schreibtisch betrachten – dabei versuchte er, den Blick in Coles Augen zu vergessen. Damit hatte er allerdings wenig Glück. Das ist kein Blick, den man schnell vergisst.
»Tja, also«, sagte er nach einer Weile und schaute zu Mum auf. »Es war sehr nett von Ihnen, dass Sie extra den weiten Weg zu mir gekommen sind, Mary, aber solche Umstände hätten Sie sich wirklich nicht machen müssen. Wie ich Ihnen schon sagte, es ist völlig in Ordnung für mich, Sie zu Hause aufzusuchen, wann immer Sie wollen. Dafür bin ich ja schließlich da. Zu jeder Zeit, Tag und Nacht, egal, was ist–«
»Ist schon okay so«, antwortete ihm Mum. »Wir möchten lieber unter uns sein, vielen Dank.«
»Natürlich«, sagte Merton lächelnd. »Aber wenn Sie es sich anders überlegen–«
»Sicher nicht.«
Merton sah Mum einen Augenblick an, dann nickte er und redete weiter. »Gut, also ich glaube, ich habe Ihnen schon am Telefon erzählt, dass inzwischen Ihr Schwager Rachels Leiche eindeutig identifiziert hat.« Er machte eine kurze Pause und tat so, als würde er drüber nachdenken. »Ich glaube, er ist gestern von Plymouth aus hingefahren.«
|17|»Mittwoch«, sagte Mum.
»Wie bitte?«
»Joe ist am Mittwochabend hingefahren. Gestern ist er zurückgekommen.«
»Haben Sie mit ihm gesprochen?«
Wieder nickte Mum nur.
Merton sah sie an und wartete, dass sie etwas sagte. Als sie schwieg, wandte er seine Aufmerksamkeit dem Stapel auf seinem Schreibtisch zu und fing an, in den Unterlagen herumzusuchen. »Tja, also«, sagte er, »ich dachte, wir sprechen einfach noch mal über ein, zwei Dinge, wenn das für Sie in Ordnung ist.« Er schaute auf. »Ich weiß, es ist schwierig, aber in diesem frühen Stadium ist es ganz wichtig, so viel Informationen wie möglich zusammenzutragen. Und wir glauben auch, dass es am besten ist, wenn wir Sie immer auf dem neuesten Stand halten, wie unsere Nachforschungen vorangehen.« Er warf mir einen Blick zu. »Wenn Ruben nicht die ganze Zeit dabei sein will, dann können wir sicher auf–«
»Ich bin okay«, erwiderte ich.
Er warf mir einen gönnerhaften Blick zu. Ich starrte zurück. Er schaute Mum fragend an.
»Ruben weiß, was passiert ist«, sagte sie. »Das Schlimmste hat er schon mitbekommen. Wenn es noch mehr gibt, kann er das genauso wissen wie jeder andere. Er ist vierzehn. Er ist kein Kind mehr.«
»Natürlich«, sagte Merton und senkte seinen Blick auf den Haufen Unterlagen. Ich wusste, dass er nicht einverstanden war, aber ändern konnte er nicht viel daran. Er nahm ein paar Papiere vom Stapel, betrachtete sie einen Moment, dann setzte er seine Lesebrille auf und überflog den Inhalt noch einmal.
|18|Wir hatten alles schon dutzendfach gehört. Dieselben Fragen, dieselben Antworten:
Ja, Rachel war neunzehn Jahre alt.
Ja, sie war arbeitslos.
Ja, sie wohnte bei ihrer Familie unter der Adresse Ford & Söhne Auto-Ersatzteile, Canleigh Street, London E3.
Nein, sie hatte keine Feinde.
Nein, sie hatte keinen festen Freund.
Und danach die immer gleichen simplen Fakten:
Am Freitag, den 14.Mai, hatte Rachel den Zug nach Plymouth genommen, um eine frühere Schulfreundin namens Abbie Gorman zu besuchen. Abbie wohnt mit ihrem Mann in dem kleinen Dorf Lychcombe auf dem Dartmoor. Am Abend des 18.Mai brach Rachel in Lychcombe auf, um nach London zurückzufahren. Sie kam nie an. Ihre Leiche wurde am nächsten Morgen in einem abgelegenen Moorgebiet ungefähr eineinhalb Kilometer vom Dorf entfernt gefunden. Sie war vergewaltigt, misshandelt und erwürgt worden.
Ganz einfach.
Fakten.
Ich warf Mum einen Blick zu. Sie weinte nicht – das Weinen hatte sie hinter sich–, aber ihr Gesicht wirkte wie tausend Jahre alt. Sie war erschöpft. Seit drei Tagen hatte sie nicht mehr geschlafen. Ihre Haut war trocken und blass.
Ich nahm ihre Hand.
|19|Cole sah mich an. Seine dunklen Augen waren fast schwarz. Ich wusste nicht, was er dachte.
Merton sagte: »Bisher gehen die Nachforschungen so gut voran, wie zu erwarten, aber es gibt noch eine Menge zu tun. Die Spurensicherung ist sehr zuversichtlich, etwas zu finden, und das Ermittlungsteam arbeitet sich noch durch Dutzende Zeugenaussagen. Wir tun alles, was in unserer Macht steht, um herauszufinden, was passiert ist. Aber wir müssen bestimmte Abläufe einhalten und ich fürchte, solche Dinge brauchen ihre Zeit.«
»Wie viel Zeit?«, fragte meine Mutter.
Merton schürzte die Lippen. »Das ist schwer zu sagen…«
»Wo ist sie jetzt?«
»Wie bitte?«
»Rachel – wo ist sie?«
Merton zögerte. »Ihre Leiche… der Leichnam Ihrer Tochter befindet sich im Gewahrsam der Untersuchungsbehörde.«
»Sie liegt in einer Behörde?«
»Nein, nein…« Merton schüttelte den Kopf. »Sie wird natürlich in einer Leichenhalle sein. Die Untersuchungsbehörde beschäftigt sich nur mit der Todesursache und der Obduktion…«
»Wann können wir sie zurückhaben?«
»Wie bitte?«
Mum beugte sich auf ihrem Stuhl vor. »Ich will meine Tochter zurück, Mr Merton. Sie ist seit drei Tagen tot. Ich will sie nach Hause bringen und beerdigen. Sie sollte nicht allein sein an einem Ort, den sie nicht kennt. Sie hat schon genug durchgemacht. Noch mehr davon hat sie wirklich nicht verdient.«
Einen Moment wusste Merton nicht, was er sagen sollte. Er sah |20|Mum an, warf einen Blick auf Cole, dann wandte er sich wieder meiner Mutter zu. »Ich verstehe Ihre Bedenken, Mary, doch ich fürchte, so einfach geht das nicht.«
»Wieso nicht?«
»Nun, es müssen alle möglichen praktischen Gesichtspunkte in Erwägung gezogen werden.«
»Zum Beispiel?«
»Zunächst einmal die gerichtsmedizinischen Untersuchungen. Einige davon sind höchst komplex und zeitaufwendig. Ich verstehe, dass es ziemlich quälend ist, an so etwas zu denken, aber durch Rachels Leichnam können wir eine Menge Erkenntnisse gewinnen. Er kann viel darüber aussagen, was wirklich geschehen ist. Und wenn wir erst einmal wissen, was geschehen ist, haben wir eine viel bessere Chance, auch herauszufinden, wer es getan hat.«
Der Tote Mann hat es getan, dachte ich. Es war der Tote Mann. Den werdet ihr nie mehr finden.
»Um es einfach zu sagen«, fuhr Merton fort, »der Untersuchungsrichter wird den Leichnam Ihrer Tochter erst freigeben, wenn er überzeugt ist, dass die sterblichen Überreste nicht mehr für weitere Untersuchungen gebraucht werden. Unglücklicherweise kann das einige Zeit dauern, gerade solange noch niemand des Mordes beschuldigt wird. Sobald jemand angeklagt ist, haben nämlich die Anwälte das Recht, eine zweite, unabhängige Obduktion zu beantragen. Wenn das erledigt ist, wird der Untersuchungsrichter im Allgemeinen die Leiche freigeben. Wenn allerdings niemand angeklagt ist, die Polizei aber davon ausgeht, in absehbarer Zeit einen möglichen Täter zu finden, wird der Untersuchungsrichter den Leichnam zurückhalten in der Erwartung, dass |21|eine zweite Obduktion erforderlich wird.« Merton sah meine Mum wieder an. »Tut mir leid, dass das alles so kompliziert ist, aber ich fürchte, es können drei bis vier Monate vergehen, ehe man den Leichnam Ihrer Tochter freigeben wird.«
»Und wenn man ihren Mörder findet?«, fragte Cole. »Wie lang dauert es dann?«
Merton sah ihn an. »Auch das ist schwer zu sagen… aber klar, je eher wir herausfinden, wer es war, desto schneller können wir Rachels Leiche freigeben.«
Cole sagte nichts darauf, sondern nickte nur.
Merton senkte den Blick kurz auf die Blätter, dann nahm er seine Lesebrille ab und rieb sich die Augen. »Ich weiß, das ist eine schreckliche Zeit für Sie alle«, sagte er, »aber ich kann Ihnen versichern, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun werden, Ihnen zu helfen, mit dem Verlust fertig zu werden.« Er unterbrach sich für einen Moment, dann fuhr er fort: »Wenn Sie irgendwelche Probleme in Hinblick auf Ihren Glauben…«
»Auf unseren was?«, fragte Mum.
»Glauben… Bräuche…«
»Wovon reden Sie?«
Merton schaute wieder auf seine Unterlagen. »Ihr Mann«, sagte er zögernd und warf einen kurzen Blick in die Seiten. »Barry John…?«
»Baby-John«, verbesserte ihn Mum. »Was ist mit ihm?«
»Er gehört doch… zum fahrenden Volk, glaube ich.« Merton schaute verlegen. »Ist das richtig so, fahrendes Volk? Oder heißt es Roma?« Er lächelte unbehaglich. »Tut mir leid, ich weiß nicht, was Ihre Leute vorziehen–«
»Er ist ein Zigeuner«, sagte Mum ganz unumwunden. »Was hat |22|das damit zu tun?«
»Na ja, ich dachte… ich meine, ich weiß, dass es in manchen Kulturen bestimmte Glaubensregeln in Sachen Beerdigung gibt…« Seine Stimme verlor sich und er sah zu Mum hin, in der Hoffnung, sie würde ihm helfen. Doch das hätte er sich sparen können. Sie sah ihn bloß an. Verunsichert zuckte er die Schultern. »Tut mir leid, ich wollte Sie nicht beleidigen oder irgendwie… Ich versuche nur zu verstehen, warum Sie Ihre Tochter so schnell beerdigen wollen.«
Mum starrte ihn an. »Mein Mann ist Zigeuner – ich nicht. Er sitzt im Gefängnis, wie Ihnen sicher bekannt ist – ich nicht. Ich will meine Tochter beerdigen, weil sie tot ist, das ist alles. Sie ist meine Tochter. Sie ist tot. Ich möchte sie nach Hause bringen und sie ihre Ruhe finden lassen. Ist das so schwer zu verstehen?«
»Nein, natürlich… tut mir leid–«
»Und wenn Sie schon so besorgt sind um meinen Mann«, fügte sie noch hinzu, »warum geben Sie ihm dann keinen Sonderurlaub?«
»Ich fürchte, das liegt in der Entscheidung der Gefängnisleitung. Wenn die der Meinung ist, dass er ein Risiko darstellt–«
»John ist kein Risiko.«
Merton hob die Augenbrauen. »Er sitzt eine Strafe wegen Totschlag ab, Mary.«
Plötzlich stand Cole auf. »Komm, lass uns gehen, Mum. Diesen Scheiß müssen wir uns nicht länger anhören. Ich hab dir ja gleich gesagt, das ist vergeudete Zeit.«
Merton konnte sich nicht beherrschen, er starrte Cole jetzt mit offener Wut an. »Wir tun unser Bestes. Wir versuchen herauszufinden, wer Ihre Schwester ermordet hat.«
|23|Cole sah auf ihn herab und antwortete ganz ruhig: »Sie kapieren es einfach nicht, oder? Es ist uns egal, wer sie umgebracht hat. Sie ist tot. Es ist nicht wichtig, wer es getan hat oder warum und wie – sie ist tot. Tot ist tot. Nichts kann daran etwas ändern. Nichts. Das Einzige, was wir wollen, ist sie beerdigen. Das ist alles, was wir noch tun können – sie nach Hause bringen und weitermachen mit unserem Leben.«
Auf dem Heimweg sagte Cole kein Wort und Mum war zu müde und ausgelaugt, um zu reden. Deshalb sog ich, während wir in den vertrauten Seitenstraßen durch den milchigen Mai-Sonnenschein gingen, die Stille auf und ließ meine Gedanken wandern – zu dem, was ich wusste, und zu dem, was ich nicht wusste.
Ich wusste, dass der Tote Mann Rachel umgebracht hatte.
Ich wusste nicht, wer er war oder warum er es getan hatte. Aber ich wusste, er war tot.
Ich wusste nicht, warum er tot war.
Und ich wusste nicht, was das bedeutete.
Mum oder Cole hatte ich bisher nichts davon erzählt und ich wusste auch nicht, wann ich es tun würde und ob überhaupt.
Ich wusste auch nicht, was das bedeutete.
Aber das Wichtigste, das ich nicht wusste, war, was ich wegen Rachel fühlte. Nach der Nacht hinten in dem Mercedes, als ich nur Schwärze und sonst nichts empfunden hatte, waren alle möglichen Gefühle in meinen Kopf und mein Herz gedrungen, von denen ich einige noch gar nicht gekannt hatte. Mir war schlecht, ich war leer und voller Lügen. Ich wollte jemanden hassen, aber ich wusste nicht, wen. Ich war überall und nirgendwo. Ich hatte mich verloren.
|24|Als wir nach Hause kamen, ging Cole gleich hinauf in sein Zimmer, ohne ein Wort zu sagen. Ich folgte Mum in die Küche und machte uns Tee, danach setzten wir uns gemeinsam an den Tisch und horchten auf die gedämpften Geräusche aus Coles Zimmer. Gleichmäßige Schritte, das Aufziehen von Schubladen, das Wiederschließen…
»Er will nach Dartmoor, stimmt’s?«, sagte ich zu Mum.
»Wahrscheinlich.«
»Findest du, das ist eine gute Idee?«
»Ich weiß es nicht, Schatz. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob es eine Rolle spielt, was ich finde. Du weißt, wie er ist, wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat.«
»Was, glaubst du, hat er vor?«
»Herausfinden, wer es war, vermute ich.« Sie sah mich an. »Er will rauskriegen, wer Rachel umgebracht hat, damit wir sie nach Hause bringen können.«
»Bist du sicher, das ist das Einzige, was er vorhat?«
»Nein.«
Ich sah mich in der Küche um. Sie war schon immer mein Lieblingsraum. Sie ist groß und alt und warm und es gibt viel anzuschauen. Alte Fotos und Postkarten, Bilder, die wir gemalt haben, als wir klein waren, Porzellanenten, mit Blumenmustern bemalte Teller, Vasen und Krüge, Hängepflanzen in einem großen Erkerfenster…
Ich betrachtete das hereinströmende Sonnenlicht.
Ich wünschte mir, es würde nicht so hereinströmen.
»Willst du, dass ich mitgehe?«, fragte ich Mum.
»Das wird er nicht wollen.«
|25|»Ich weiß.«
Sie lächelte mich an. »Wohler wäre mir schon, wenn du mit ihm fährst.«
»Und wie steht’s mit dir?«, fragte ich. »Kommst du allein hier zurecht?«
Sie nickte. »Im Moment ist das Geschäft ja ziemlich ruhig. Und Onkel Joe kommt bestimmt mal für ein paar Tage her und kümmert sich um alles.«
»Das Geschäft habe ich nicht gemeint.«
»Ich weiß.« Sie berührte meinen Arm. »Ich werd es schon schaffen. Wird mir vielleicht sogar guttun, mal eine Weile allein zu sein.«
»Bist du sicher?«
Sie nickte wieder. »Melde dich aber – okay? Und halt ein Auge auf Cole. Pass auf, dass er keine Dummheiten macht.« Sie sah mich an. »Er hört auf dich, Ruben. Er vertraut dir. Ich weiß, er zeigt es nicht, aber er tut es trotzdem.«
»Ich werd auf ihn aufpassen.«
»Und sieh zu, dass er dich freiwillig mitnimmt. Das würde alles viel einfacher machen für euch beide.«
Ich wusste, das würde ich nicht hinkriegen, aber ich versuchte es trotzdem.
Als ich sein Zimmer betrat, saß er auf dem Bett und rauchte eine Zigarette. Er trug ein T-Shirt und Jeans und seine dunkle Jacke lag über seinem kleinen Lederrucksack auf dem Boden.
»Hi«, sagte ich.
Er nickte mir zu.
|26|Ich warf einen Blick auf seinen Rucksack. »Willst du wohin?«
Er sagte: »Die Antwort lautet Nein.«
»Nein was?«
»Nein, du kannst nicht mitkommen.«
Ich ging hinüber und setzte mich neben ihn. Er schnippte Zigarettenglut in den Aschenbecher auf dem Nachttisch. Ich lächelte ihn an.
»Es bringt nichts, mich so anzusehen«, sagte er. »Ich werde meine Meinung nicht ändern.«
»Ich hab dich bis jetzt doch noch gar nichts gefragt.«
»Glaubst du, du bist der Einzige, der Gedanken von anderen Leuten lesen kann?«
»Du kannst keine Gedanken lesen«, antwortete ich. »Du kannst ja noch nicht mal die Zeitung lesen.«
Er warf mir einen Blick zu, dann rauchte er weiter seine Zigarette. Ich betrachtete sein Gesicht. Das mache ich gern. Sein Gesicht ist gut anzuschauen – siebzehn Jahre alt, dunkle Augen, entschlossen und klar. Es ist ein Gesicht, das tut, was es sagt. Das Gesicht von einem Teufelsengel.
»Du wirst mich brauchen«, sagte ich zu ihm.
»Was?«
»Du brauchst jemanden, der auf dich aufpasst in Dartmoor.«
»Mum braucht jemanden, der auf sie aufpasst.«
»Und warum gehst du dann weg?«
»Ich hole Rachel zurück. Das ist meine Art, auf Mum aufzupassen. Deine ist es, hierzubleiben.« Er sah mich an. »Ich kann nicht mit ihr reden, Rube. Ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll. Ich muss irgendwas tun.«
Ein Funke von Gefühl zeigte sich kurz auf seinem Gesicht und |27|einen Augenblick empfand ich auch etwas, doch ehe ich wusste, was es war, hatte er sich schon wieder im Griff. Er war gut darin, solche Dinge beiseitezuschieben. Ich sah zu, wie er seine Zigarette ausmachte und vom Bett aufstand.
»Wie willst du es machen?«, fragte ich.
»Was machen?«
»Rausfinden, was passiert ist.«
»Weiß ich noch nicht… mir fällt schon was ein.«
»Wo willst du übernachten?«
Er zuckte die Schultern. »Irgendwas findet sich immer.«
»Wie willst du hinkommen?«
»Mit dem Zug.«
»Wann fährst du?«
»Wenn ich fertig bin. Noch was?«
»Ja. Warum willst du nicht, dass ich mitkomme?«
»Ich hab dir doch schon gesagt–«
»Ich bin nicht blöde, Cole. Ich weiß, wann du lügst. Du weißt so gut wie ich, dass Mum niemanden braucht, der bei ihr bleibt. Was ist der wahre Grund, dass du mich nicht dabeihaben willst?«
Er ging hinüber zu einem Tisch am Fenster, schnappte sich ein paar Sachen und verstaute sie in seinem Rucksack. Eine Weile fummelte er noch dran rum – zubinden, aufbinden, wieder zubinden–, dann starrte er den Fußboden an, doch schließlich drehte er sich um und sah mich an. Ich weiß nicht, ob er irgendwas sagen wollte oder nicht, denn ehe er es tun konnte, klingelte unten das Telefon.
Wir wandten uns beide zur Tür um und horchten angestrengt. Das Klingeln endete und wir hörten das leise Gemurmel von Mums Stimme.
|28|»Ist das Dad, mit dem sie spricht?«, fragte Cole.
»Klingt so.«
»Ich muss mit ihm reden, bevor ich verschwinde.«
Er nahm seinen Rucksack und steuerte auf die Tür zu.
»Dann bis später«, sagte ich.
»Ja.«
Er ging hinaus, ohne sich noch mal umzudrehen.
Ich machte mir keine Sorgen. Ich wusste, was er tun würde.
Während Cole am Telefon mit Dad sprach, checkte ich ein paar Dinge im Internet und packte schnell einige Sachen zum Anziehen in eine Tasche. Dann stellte ich mich ans Fenster und wartete.
Nach einer Weile kam Cole aus dem Haus und lief über den Autofriedhof zu einem gestapelten Turm alter Fahrzeuge. Er hatte seine Jacke an und trug den Rucksack bei sich. Er zog einen Schlüssel aus seiner Tasche und öffnete den Kofferraum von einem ausgebrannten Volvo, der ganz unten in dem Turm steckte. Nach einem kurzen Blick über die Schulter beugte er sich vor und kramte in der hintersten Ecke des Kofferraums. Er brauchte nicht lange, bis er gefunden hatte, wonach er suchte. Irgendwas steckte er in seinen Rucksack, etwas anderes in seine Jackentasche, danach reckte er sich, schloss den Kofferraum, verließ den Hof und machte sich auf den Weg, die Straße hinunter.
Ich wartete, bis er außer Sicht war, dann schnappte ich mir meine Tasche und ging nach unten in die Küche. Mum wartete schon auf mich.
»Hier«, sagte sie und gab mir 200Pfund aus ihrem Portemonnaie. »|29|Das ist alles an Bargeld, was ich im Augenblick habe. Meinst du, das reicht?«
»Cole hat doch jede Menge«, erklärte ich ihr.
»Gut. Weißt du, welchen Zug er nimmt?«
»Er hat’s nicht gesagt, aber der nächste nach Plymouth fährt um 11.35Uhr, also wird er wohl den nehmen.« Ich steckte die Geldscheine in meine Tasche. »Wie geht’s Dad?«
»Ganz okay. Er lässt dich grüßen.« Sie schaute nach der Uhr. Es war Viertel vor elf. Sie kam herüber und nahm mich in den Arm. »Besser, du gehst jetzt.«
»Bist du sicher, dass du zurechtkommst?«
Sie wuschelte mir durchs Haar. »Mach dir um mich keine Sorgen. Versuch einfach, Cole aus dem schlimmsten Ärger herauszuhalten. Und sieh zu, dass ihr beiden wieder heil zurückkommt – okay?«
»Ich tu, was ich kann.«
Die Sonne schien noch, als ich den Autofriedhof verließ und die Straße hinunterlief. Ich überlegte, wie wohl das Wetter in Dartmoor sein würde. Ich überlegte, wie alles in Dartmoor sein würde.
Ein schwarzes Taxi hielt am Ende der Straße. Ich wartete, bis der Fahrgast ausstieg, dann stieg ich hinten ein und bat den Fahrer, mich zur Paddington Station zu bringen.
|30|Drei
Die Straßen um Paddington Station herum waren total verstopft. Bis ich aus dem Taxi gestiegen war, eine Fahrkarte gekauft und mich auf der Suche nach dem richtigen Bahnsteig durch die Bahnhofshalle geschlängelt hatte, war es fast fünf nach halb zwölf. Ich stieg ein, als der Schaffner gerade sämtliche Türen schloss. Der Zug war gut besetzt, aber nicht überfüllt. Ich wartete, während sich die anderen Fahrgäste sortierten – sich Plätze suchten, ihr Gepäck verstauten, ziellos auf und ab liefen–, und als der Zug den Bahnsteig verlassen hatte, fing ich an, nach Cole zu suchen.
Der Zug war lang, und während ich gemächlich durch die Waggons lief, begann ich plötzlich über Dad nachzudenken.
Einmal hatte er mir erzählt, das Erste, woran er sich erinnern könne, sei, wie er neben einem Wassertrog stand und einem Pferd beim Trinken zuschaute. Das war es. Das war seine allererste Erinnerung – wie er auf eigenen Füßen im hohen Gras einer Wiese stand und einem Pferd beim Trinken aus einem Trog zusah. Das hat mir immer gefallen. Ich dachte, es muss wirklich schön sein, so was im Kopf zu haben.
|31|Dad hat uns immer gern Geschichten aus seiner Kindheit erzählt. Ich glaube, mit dem Erzählen kamen für ihn die guten Erinnerungen zurück. Er war geboren und aufgewachsen in einem Wohnwagen aus Aluminium – oder Caravan, wie er ihn nannte–, in dem er mit seinen Eltern und zwei größeren Brüdern wohnte. »Es war der schönste Caravan auf dem ganzen Platz«, erzählte er uns stolz. »Schicke kleine Kotflügel, eine dreifach verstärkte Tür, ein Schornstein aus Chrom mit so einer Kappe obendrauf…« Jedes Mal fing er dann an zu lachen und erinnerte sich an immer mehr Details – die Paraffinlampe, die an der Decke hing, den bemalten Herd, den soliden Esstisch aus Eiche, den Nippes seiner Mutter…
Manchmal erinnerte er sich auch an Dinge, über die es nichts zu lächeln gab, zum Beispiel an die Nacht, als eine Gruppe von Einheimischen den Wohnwagen anzündete, während Dad und seine Familie schliefen, oder wie sein Vater, wenn er betrunken war, ihn manchmal mit einem breiten Ledergürtel schlug, der mit Metallringen besetzt war. Ich fragte mich oft, ob darin der Grund lag, dass Dad ein Bare-Knuckle-Boxer geworden war, jemand, der in Wettkämpfen mit der bloßen Faust zuschlägt – nur um es seinem Vater oder den Einheimischen oder irgendwem sonst heimzuzahlen, der ihm als Kind Schmerzen zugefügt hatte. Aber ich wusste, dass ich wahrscheinlich falsch lag. Es war viel einfacher. Wie Dad immer sagte: Zigeuner sind zum Kämpfen geboren, das steckt ihnen im Blut.
Schließlich fand ich Cole im allerletzten Wagen des Zuges. Er saß |32|allein an einem Tischplatz und starrte mit leerem Blick durchs Fenster. Er sah mich nicht an, als ich durch den Waggon auf ihn zukam, aber ich wusste, dass er meine Anwesenheit bemerkt hatte. Ich spürte, wie er mich beobachtete. Er ignorierte mich weiter, bis ich durch den ganzen Waggon durch war und direkt neben ihm stehen blieb. Aber selbst da sagte er nichts, sondern wandte nur den Kopf und warf mir einen langen, trägen Blick zu.
»Alles okay?«, sagte ich lächelnd.
Er antwortete nicht.
Ich nickte zu dem leeren Platz gegenüber von ihm. »Sitzt da jemand?«
Sein Gesicht blieb leer, seine Augen mürrisch und hart. Ich wusste, was er empfand. Es war das Gleiche wie damals, als wir noch klein waren und ich ihm überallhin folgte – ich war ständig im Weg, ging ihm auf die Nerven, ließ ihn nicht einen Moment allein. Er wollte nicht, dass ich wie eine Klette an ihm hing, denn meistens hatte er nichts Gutes im Sinn gehabt und wollte mich nicht mit reinziehen. Er konnte sich zwar nie überwinden, so etwas auszusprechen, aber er war immer besorgt um mich und hatte schreckliche Angst, mir könnte etwas zustoßen.
Als ich mich jetzt ihm gegenüber hinsetzte, wusste ich, dass er genau dies empfand. Er wollte mich nicht dabeihaben, weil er wusste, er würde sich Ärger einhandeln. An sich kümmerte ihn das nicht weiter, aber wenn ich dabei war, war das etwas anderes.
»Scheiße«, sagte er schließlich.
Ich lächelte ihn wieder an.
Er schüttelte den Kopf und sah aus dem Fenster.
Ich zuckte die Schultern und blickte mich in dem Waggon um. Er war etwa halb voll. Die anderen Fahrgäste waren alle ziemlich |33|still – sie lasen Bücher oder Zeitschriften, unterhielten sich mit leiser Stimme oder starrten stumm aus dem Fenster. Ich überlegte, wo sie wohl hinfuhren und was sie tun würden, wenn sie ankämen… und dann überlegte ich, ob sie sich wohl die gleichen Fragen über mich stellten.
»Wir müssen bald in Reading sein«, sagte Cole zu mir. »Da kannst du aussteigen.«
»Ich steig nicht aus.«
Er sah mich an. »Das ist kein Vorschlag, Rube, du tust, was ich sage. Du steigst in Reading aus.«
»Ja? Und was willst du machen, wenn ich nicht aussteige? Mich vom Sitz zerren und wegtragen? Mich raus auf den Bahnsteig werfen?«
»Wenn’s sein muss.«
»Ich fang an zu schreien, wenn du das machst. Dann glauben die Leute, du willst mich entführen. Die Schaffner halten den Zug an und rufen die Polizei, dann wirst du eingesperrt.« Ich lächelte ihm ins Gesicht. »Das willst du doch nicht, oder?«
Er holte tief Luft und seufzte. »Weiß Mum Bescheid, dass du hier bist?«
»Natürlich weiß sie Bescheid. Ich lass sie doch nicht einfach allein, ohne ihr was zu sagen, oder?«
»Hat sie gesagt, du sollst mir folgen?«
»Nein.«
»Aber sie hat nicht versucht, dich davon abzuhalten.«
»Sie macht sich Sorgen um dich. Sie weiß, wie du bist.«
»Ja? Und wie bin ich?«
»Du erinnerst sie an Dad.«
»Was soll das heißen?«
|34|»Du weißt genau, was das heißt. Sie will nicht, dass du so endest wie er.«
»Na ja…«
»Ach komm, Cole«, sagte ich strahlend. »Das klappt schon. Ich kann dir helfen.«
»Ich brauch keine Hilfe.«
»Ich seh zu, dass du keinen Ärger kriegst.«
»Ich krieg sowieso keinen. Ich will mich doch nur umschauen und ein paar Fragen stellen.«
»Was denn für Fragen?«
Er seufzte wieder. »Weiß ich noch nicht.«
»Ich bin gut im Fragenausdenken.«
Er verdrehte die Augen. »Allerdings.«
»Und wenn es ums Denken geht«, fügte ich hinzu, »sind zwei Köpfe sowieso besser als einer.« Ich grinste ihn an. »Vor allem, wenn einer davon deiner ist.«
Er sah mich böse an. Es reichte ihm, er gab auf. Er schüttelte wieder den Kopf und fasste in seine Tasche nach Zigaretten.
»Du darfst hier drinnen nicht rauchen«, erklärte ich ihm und deutete auf das Zeichen am Fenster.
Er sah das Schild an, sah mich an, dann schob er die Zigaretten zurück in die Tasche.
»Scheiße«, sagte er.
Danach ließen wir eine Weile locker. Cole saß nur da und schaute aus dem Fenster und ich saß da und teilte sein Schweigen. Meine Empfindungen waren jetzt bei ihm und ich spürte, dass Dad in seinem Herzen war. Es war ein gutes Gefühl, gut und stark, es machte, dass ich mich sicher fühlte. Aber genauso spürte ich dieses Fehlen, |35|das Mum vorher erwähnt hatte. Diese Leere, das, was weder Dad noch Cole zu haben schienen – ihnen fehlte die Angst um sich selbst, um das eigene Leben. Ich wusste, es war eine notwendige Leere, so eine Art kaltblütige Entschlossenheit, die man manchmal braucht, um in der Welt zurechtzukommen. Aber ich wusste auch, was passieren konnte, wenn diese Leere alles beherrschte, und es machte mir Angst, genau das in Cole zu spüren.
Ich empfand auch mit, wie er über Rachel nachdachte. Er war sich nicht bewusst, dass er über sie nachdachte, denn er hatte die letzten drei Tage über nichts anderes nachgedacht und seine Gedanken funktionierten inzwischen schon automatisch. Wie Atmen. Wie Laufen. Wie Leben. Als er jetzt über sie nachdachte, dachte er mit etwas, das er gar nicht spürte. Er dachte mit dem Innersten seiner Sinne. Es dachte für ihn. Suchte die Dunkelheit ab, versuchte sie zu finden, versuchte ihr Bild in sein Gedächtnis zu rufen – ihre Augen, ihr Haar, die Art, wie sie einmal gelacht und die Welt zum Leuchten gebracht hatte…
Aber es half nichts. Alles war zu weit weg. Die Bilder kamen nicht mehr zurück. Das Einzige, was er jetzt vor Augen hatte, war der nackte Leichnam eines Mädchens, das er nicht kannte.
Er sah Rachel nicht mehr vor sich.
Ich überlegte, ob es das war, was ihn antrieb.
Als der Zug durch Exeter und weiter Richtung Plymouth fuhr, veränderte sich die Landschaft allmählich. Die braune Erde wurde rot, aus Ziegelstein wurde Granit und das Sonnenlicht schien seine Helligkeit zu verlieren. Traurig wirkende Berge tauchten in der Ferne auf, warfen kalte graue Schatten über die am Fenster vorbeigleitenden Wiesen und ließen alles düster und leer |36|erscheinen.
»Das hier ist echt weit weg von unserer Canleigh Street«, sagte ich zu Cole.
»So verschieden ist es auch wieder nicht«, murmelte er. »Bloß eine andere Gegend.«
»Findest du?«
Er wandte sich vom Fenster ab und reckte seinen Nacken. »Wie spät ist es?«
Ich schaute auf meine Uhr. »Halb drei. In einer halben Stunde müssten wir in Plymouth sein.«
Cole reckte sich wieder. »Ich hab nachgedacht…«
»Ja?«
Er sah mich an. »Über Rachel.« Er rieb sich die Augen. »Das Mädchen, bei dem sie war – Abbie Gorman. Weißt du irgendwas über sie?«
»Ich dachte, du kennst sie. Sie war mit Rachel zusammen auf der Schule. Die waren nur ein paar Klassen über dir, oder?«
»Ich war nicht so furchtbar oft in der Schule. Und selbst wenn, du weißt ja, wie’s auf der Schule ist – ein paar Klassen sind eine Ewigkeit. Rachel hätte in der Schule doch nie mit mir geredet. Nur über ihre Leiche. Komm schon, Rube – du musst was über Abbie wissen. Du hast doch immer mit ihr über ihre Freunde und so was geredet.«
Ich zögerte einen Moment und wartete, ob er merkte, was er da gerade gesagt hatte – von wegen ›nur über ihre Leiche‹. Aber zum Glück schien es ihm nicht aufzufallen. Also erzählte ich ihm, was ich über Abbie wusste.
»Sie hat früher auf diesem riesigen Grundstück am Mile End gewohnt. Rachel hat sie auf der Junior School kennengelernt, |37|dann sind sie zusammen auf die Secondary School gewechselt. Ich denke nicht unbedingt, dass sie beste Freundinnen waren, aber sie waren echt viel zusammen. Abbie kam ziemlich oft zu uns nach Hause. Ich glaube, ein paar Mal ist sie sogar über Nacht geblieben.« Ich sah Cole an. »Bist du sicher, dass du dich nicht an sie erinnerst?«
Er schüttelte den Kopf. »Wie ist sie?«
»Ich weiß nicht genau. Hab nur ein-, zweimal mit ihr geredet. Sie schien ganz okay – ganz nett, hübsch, ein bisschen tough…«
»Was meinst du mit tough?«
»So als ob sie selbst auf sich aufpassen könnte. Verstehst du… sie hatte so was an sich.«
»Wie Rachel?«
»Ja… wenn ich drüber nachdenke, ist sie Rachel auch sonst ziemlich ähnlich. Gleiche Größe, gleiche Figur, gleiche Haarfarbe, gleiche Gesichtsform. Sie hätten Schwestern sein können.«
Cole fuhr sich mit den Fingern durch die Haare. »Wieso ist sie in Dartmoor gelandet?«
»Ihre Mutter hat da gelebt. Abbie ist bei einer Tante aufgewachsen oder so. Keine Ahnung, warum. Vor ein paar Jahren bekam ihre Mum Krebs und Abbie ging aus London weg und nach Dartmoor, um für sie zu sorgen. Sie muss damals sechzehn oder siebzehn gewesen sein, glaub ich. Dann hat sie diesen Jungen aus dem Dorf kennengelernt – keine Ahnung, wie er heißt. Als ihre Mutter starb, ist er bei ihr eingezogen und ein paar Monate später haben sie dann geheiratet. Rachel ist zur Hochzeit hingefahren – erinnerst du dich nicht?«
Cole schüttelte wieder den Kopf.
»Doch, bestimmt«, sagte ich. »Sie hatte dieses cremefarbene |38|Kleid an, einen riesigen Hut auf und so weiter – daran musst du dich doch erinnern. Als sie zurückkam, hat sie uns die ganzen Fotos gezeigt und das Video…« Plötzlich merkte ich, wie Cole sich über sich selbst ärgerte, dass er sich nicht erinnerte, also wechselte ich das Thema. »Guck, gleich sind wir da.« Ich deutete durch das Fenster hinaus auf die Ausläufer einer grauen Stadt. Cole tat so, als würde er gucken, aber ich wusste, es interessierte ihn nicht. Sein Gesicht war wieder tot. Nicht dass ihn das cremefarbene Kleid oder Rachels riesiger Hut, die Hochzeitsfotos oder das Video kümmerten – er war nur traurig, dass er einen Moment vergessen hatte, in dem sie glücklich gewesen war. Er war dabei gewesen und hatte ihn doch verpasst.
Der Moment war für ihn verloren.
Wir stiegen aus dem Zug und gingen durch den Bahnhof zum Taxistand. Es gab eine lange Schlange, aber kein Taxi. Ich folgte Cole zum Ende der Schlange und sah ihm zu, wie er sich eine Zigarette anzündete.
»Du solltest damit aufhören«, sagte ich.
»Ich sollte vieles«, antwortete er, stieß den Rauch aus und warf mir einen Blick zu.
Ein Taxi rollte an uns vorbei und hielt am Anfang der Schlange. Eine Frau mit einem Gepäckwagen voller Koffer belud das Taxi und stieg ein. Der Wagen fuhr los und die Schlange schob sich vorwärts.
»Dann schickst du mich also nicht zurück?«, sagte ich zu Cole.
»Ich tu’s, wenn du nicht aufhörst zu quasseln.«
Das war zwar nicht unbedingt eine Einladung, aber da der Satz von Cole kam, war er so ziemlich das Beste, was ich erwarten |39|konnte. Cole war noch immer nicht begeistert, doch anscheinend hatte er kapiert, dass er nicht viel gegen mich unternehmen konnte, solange ich fest entschlossen war, bei ihm zu bleiben. Und außerdem mochte er es ja auch, mit mir zusammen zu sein. Das war schon immer so gewesen. Er würde es zwar nie zugeben, aber ich spürte es – tief in seinem Innern vergraben.
Er hatte auch noch jede Menge anderes vergraben – aber das meiste saß so tief, dass keiner von uns wusste, was es eigentlich war.
Damit hatte ich kein Problem.
Solange wir zusammen waren, reichte mir das.
Ich hielt den Mund und meine Gedanken bei mir.
Eine halbe Stunde später saßen wir endlich im Heck eines schwarzen Taxis und der Fahrer fragte uns, wo wir hinwollten. Ich sah Cole an und überlegte, ob er darüber wohl nachgedacht hatte.
»Polizeirevier«, antwortete er dem Fahrer.
»Welches?«
»Was?«
»Zu welchem Polizeirevier wollen Sie?«
Cole zögerte. Er hatte nicht darüber nachgedacht.
»Breton Cross«, erklärte ich dem Fahrer.
Er nickte mir zu und fuhr los, während ich mich zurücklehnte und aus dem Fenster sah. Cole sagte ungefähr eine Minute lang nichts.
Schließlich meinte er: »Wahrscheinlich glaubst du jetzt, das beweist irgendwas, oder?«
»Was denn?«, fragte ich unschuldig.
»Du brauchst gar nicht so selbstzufrieden zu gucken. Irgendwann |40|wäre ich auch hingekommen. Es hätte eben ein bisschen länger gedauert, das ist alles.«
»Stimmt«, sagte ich.
»Woher weißt du überhaupt, zu welchem Polizeirevier wir wollen?«
»Ich hab im Internet nachgeguckt. Breton Cross ist das Hauptrevier. Da sitzt der Beamte, der für Rachels Fall zuständig ist. Und zu dem wollen wir doch, oder?«
Cole sah mich an. »Wie heißt er?«
»Pomeroy. Er ist Detective Chief Inspector.«
Cole nickte. Fast hätte er Danke gesagt, aber dann erinnerte er sich, wer er war, und nickte nur einfach. Ich sah aus dem Fenster und erlaubte mir ein verstohlenes Lächeln.
Das Polizeirevier Breton Cross war ein fünfstöckiges Gebäude, das aussah, als ob es in Scheiße getaucht worden wäre. Weiß der Teufel, was für eine Farbe das sein sollte. Es war das, was herauskommt, wenn man alle Farben eines Malkastens zusammenmischt. Scheißfarben eben.
Cole bezahlte den Taxifahrer, wir gingen ein paar Stufen hinauf und traten durch eine Reihe von Türen in den Empfangsbereich. Es war nicht viel los. Eine betrunkene Frau mit strähnigen Haaren, die einen langen Nylonmantel trug, saß auf einem Stuhl, doch von ihr abgesehen war alles leer.
Ich folgte Cole zu dem glasverkleideten Auskunftsschalter. Der Mann dahinter – ein fetter Alter in dünnem weißem Hemd – tat sehr beschäftigt. Er schrieb etwas schrecklich Wichtiges in eine |41|