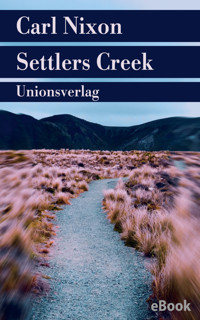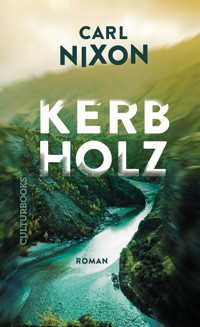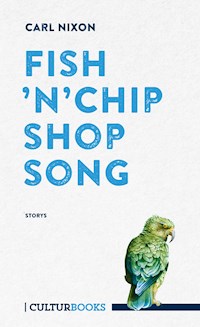14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der dritte Roman von Carl Nixon führt weit in der Zeit zurück: zu einem Maimorgen im Jahr 1919, an dem die Krankenschwester Elizabeth Whitman auf dem Weg zu ihrer Arbeit ist. Ein Wagen hält neben ihr, und der Fahrer überreicht ihr einen Brief, der ihr Leben verändern wird. Zu der Zeit wohnt sie mit ihrem 4jährigen Sohn Jack äußerst beengt bei ihren Eltern; Jacks Vater, den sie während des Kriegs in London geheiratet hat, wird seit zwei Jahren vermisst. Der Brief enthält das Angebot, einen sehr wohlhabenden Mann zu pflegen, der mit einer Kopfverletzung aus dem Krieg zurückgekehrt ist; sie zögert lange, als sie erkennt, um welche Verletzung es sich handelt: Paul Blackwell hat sein Gedächtnis verloren, weiß nicht, wer oder wo er ist. Langsam, ganz langsam gewinnt sie sein Vertrauen, vor allem dadurch, dass sie ihm Geschichten erzählt. Und sie erzählt ihrem Sohn eine Geschichte, ein Märchen besser: Der Ballonfahrer. Es handelt von einem Mann, der in exotischen Ländern wilde Abenteuer erlebt – und der nicht wiederkehren wird. Durch die Kraft der Erzählung soll ihr Sohn den Verlust vermittelt bekommen, vielleicht ist das für ihn leichter zu ertragen als die harten Fakten. Der Roman zeigt, was Geschichten vermögen, und beginnt mit derjenigen eines alten Mannes, der Carl Nixon bittet, seine Geschichte aufzuschreiben, beziehungsweise die seiner Eltern: Elizabeth Whitman und Lucky Newman. Ein berührender, intelligenter Roman über die Kraft des Erzählens und wie uns Geschichten helfen können, eine eigene Identität zu finden und die Beziehungen untereinander zu vertiefen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über das Buch
Der dritte Roman von Carl Nixon führt weit in der Zeit zurück: zu einem Maimorgen im Jahr 1919, an dem die Krankenschwester Elizabeth Whitman auf dem Weg zu ihrer Arbeit ist. Ein Wagen hält neben ihr, und der Fahrer überreicht ihr einen Brief, der ihr Leben verändern wird.
Zu der Zeit wohnt sie mit ihrem 4-jährigen Sohn Jack äußerst beengt bei ihren Eltern; Jacks Vater, den sie während des Kriegs in London geheiratet hat, wird seit zwei Jahren vermisst. Der Brief enthält das Angebot, einen sehr wohlhabenden Mann zu pflegen, der mit einer Kopfverletzung aus dem Krieg zurückgekehrt ist; sie zögert lange, als sie erkennt, um welche Verletzung es sich handelt: Paul Blackwell hat sein Gedächtnis verloren, weiß nicht, wer oder wo er ist. Langsam, ganz langsam gewinnt sie sein Vertrauen, vor allem dadurch, dass sie ihm Geschichten erzählt.
Und sie erzählt ihrem Sohn eine Geschichte, ein Märchen besser: Der Ballonfahrer. Es handelt von einem Mann, der in exotischen Ländern wilde Abenteuer erlebt – und der nicht wiederkehren wird. Durch die Kraft der Erzählung soll ihr Sohn den Verlust vermittelt bekommen, vielleicht ist das für ihn leichter zu ertragen als die harten Fakten.
Der Roman zeigt, was Geschichten vermögen, und beginnt mit derjenigen eines alten Mannes, der Carl Nixon bittet, seine Geschichte aufzuschreiben beziehungsweise die seiner Eltern: Elizabeth Whitman und Lucky Newman.
Ein berührender, intelligenter Roman über die Kraft des Erzählens und wie uns Geschichten helfen können, eine eigene Identität zu finden und die Beziehungen untereinander zu vertiefen.
»Eine grandiose Erfahrung ist dieses Buch« Elmar Krekeler, Die Welt über »Settlers Creek«.
»Complex narrative, beautiful prose and compelling characters make this book absolutely sing.« Radio New Zealand
»I was literally hooked from the first eight words... It was just wonderful, storytelling at its most sublime ... I’m going to do the unheard of for me and turn around and read it again.« Vanda Symon
Über den Autor
Carl Nixon
Lucky Newman
Roman
Impressum
eBook-Ausgabe: © CulturBooks Verlag 2015
Gärtnerstr. 122, 20253 Hamburg
Tel. +4940 31108081, [email protected]
www.culturbooks.de
Alle Rechte vorbehalten
Die Originalausgabe, The Virgin and the Whale, erschien 2013 bei Vintage, Random House New Zealand, Auckland, New Zealand.
© Carl Nixon 2013
Printausgabe: © Weidle Verlag 2015
Lektorat: Angelika Singer, Kim Keller
Korrektur: Anna Lehmacher
Umschlaggestaltung: Magdalena Gadaj
eBook-Herstellung: CulturBooks
Erscheinungsdatum: 01.04.2015
ISBN 978-3-944818-89-4
Für Rebecca, Alice und Fenton.
Wir alle haben unsere Geschichten. Wir finden uns in ihnen, erfinden uns durch sie. Wenn wir aber die Geschichten sind, die wir erzählen, sollten wir sie sorgsam auswählen. James Orbinski
Jeder von uns hat eine Lebensgeschichte, eine Art innere Erzählung, deren Gehalt und Kontinuität unser Leben ist. Wenn wir etwas über jemanden erfahren wollen, fragen wir: »Wie lautet seine wirkliche, innere Geschichte?« Oliver Sacks
Der Anfang
Anfang Mai 2008 bekam ich einen Anruf von einem Mann mit einer ausgesprochen angenehmen Stimme. Ich nenne ihn hier MN. Er nannte seinen Namen und sagte, er habe unlängst meinen ersten Roman, Rocking Horse Road, gelesen. Da ihm das Buch gut gefallen hatte, meinte er, ich sei vielleicht daran interessiert, die Geschichte seiner Familie zu schreiben. Nun ist eines der Hauptärgernisse im Leben eines Schriftstellers das Ansinnen komplett unbekannter Menschen, man möge doch bitte ihre Lebensgeschichte aufschreiben. Diese Leute meinen, man lande einen todsicheren Bestseller, wenn sich nur jemand findet, der das alles »zu Papier bringt«. MN war eher zurückhaltend und umriß die Geschichte nur kurz. Ein Satz berührte mich tief. Ich erinnere mich wörtlich daran: »Meine Mutter hat sich unsterblich in einen Mann ohne Gedächtnis verliebt.«
Obwohl noch immer eher abwehrend, willigte ich doch ein, mich ein paar Tage später in einem Café im Stadtzentrum mit ihm zu treffen. Ich kam zu früh und setzte mich an einen Tisch, von dem aus ich die Eingangstür im Blick hatte. MN trat ein, ein großer, hagerer Mann, der leicht vornübergebeugt ging. Sein Gesicht war braungebrannt, dicke Haarbüschel wuchsen über seinen Ohren. Er trug ein dunkelblaues Jackett und eine gestreifte Krawatte. Ich schätzte ihn auf etwas über Achtzig (tatsächlich war er damals schon neunzig).
Er bestand darauf, mich zum Kaffee einzuladen, und erzählte dann, daß seine Frau und er sich nunmehr ganz in ihr Ferienhaus an der Küste zurückgezogen hatten, etwa eine Autostunde nördlich. Inzwischen aber mache seine Frau sich große Sorgen, die Klimaerwärmung könne den Meeresspiegel ansteigen lassen. Er selbst glaube nicht, daß es zu seinen Lebzeiten noch dazu kommen werde. Er war Bauingenieur gewesen, hatte 45 Jahre lang für die Stadtverwaltung gearbeitet, zumeist beim Brücken- und Straßenbau.
Ich mochte MN auf Anhieb. Er beeindruckte mich durch seine altmodischen Umgangsformen und die nachdenkliche Art, wie er meine Fragen beantwortete. Er führte die Geschichte, die er mir am Telephon erzählt hatte, weiter aus, und ich machte mir ein paar Notizen. Die Wahrheit ist, daß ich, kaum hatten wir unseren Kaffee ausgetrunken, also nach etwa 20 Minuten, an seiner Angel hing.
Ich verabredete mich in den folgenden Monaten mehrmals mit MN. Seine Frau und er kamen regelmäßig in die Stadt, um ihre drei erwachsenen Kinder, die sieben Enkel und seit neuem auch die erste Urenkelin zu besuchen. Gewöhnlich richtete er es so ein, daß ihm ein oder zwei Stunden blieben, um mich zu treffen. Jetzt war ich es, der ihn sprechen wollte; oft rief ich ihn auch an, um Fragen zu stellen, die ich zwischen unseren Begegnungen formuliert hatte.
Falls ich je Zweifel an der Wahrheit seiner Geschichte gehabt hatte, zerstreuten sich diese, als er bei unserem zweiten Treffen, das bei mir zu Hause stattfand, ein Bündel Dokumente mitbrachte, von denen einige aus der Zeit des Ersten Weltkriegs stammten. Ungefähr ein Dutzend Photographien waren dabei, Photokopien von Armee- und Krankenhausakten und die ersten beiden handgeschriebenen Blätter eines unveröffentlichten Kinderbuchs. Am wichtigsten für mich aber war ein langer Brief seiner Mutter an MN von 1969 – da war sie neunundsiebzig und starb noch im selben Jahr. Das alles bildete das Gerüst der Geschichte, die Sie nun lesen werden.
Auf MNs Wunsch habe ich die Namen aller beteiligten Personen geändert. Er bestand darauf, daß weder er noch seine Frau, noch die Familie irgendwie in den Fokus der Öffentlichkeit geraten dürften. Bis zu einem gewissen Grad habe ich auch die Orte des Geschehens fiktionalisiert, obwohl die Stadt Mansfield und vielleicht auch das Anwesen Woodbridge für diejenigen, die mit der Gegend vertraut sind, erkennbar sein könnten. Auch wenn ich gezwungen war, einiges selbst zu erschließen und anderes auszuschmücken, um Löcher in der Geschichte zu füllen, lagen doch das Grundgerüst der Erzählung und eine wirklich überraschende Anzahl an Details am Tag des ersten Telephongesprächs mit MN schon vor mir.
Leider hat die Fertigstellung des Buches länger gedauert, als ich zuerst geglaubt hatte. Eine passende Erzählerstimme und die Struktur für das Buch zu finden bedurfte einiger Experimente, und es gab auch manchen Fehlstart. In drei verschiedenen Phasen habe ich sogar das ganze Projekt zur Seite gelegt, weil ich überzeugt war, in einer Sackgasse gelandet zu sein, also weder das Talent noch die Geduld zu besitzen, den Roman zu Ende zu bringen. Jedesmal aber hat mich meine Faszination von MNs Geschichte zum Weiterschreiben gebracht. Die Verzögerung hatte jedoch auch ganz pragmatische Gründe: Ich mußte andere Projekte abschließen, die meinen Lebensunterhalt finanzierten. Im übrigen sind, wie jeder Romanautor bestätigen wird, Fehlstarts, Digressionen, Unterbrechungen und allgemeine Prokrastination ganz gewöhnliche Begleitumstände beim Entstehen eines Buches.
MN hat die ersten Fassungen des Manuskripts noch gelesen und meiner eigentümlichen Herangehensweise an seine Familiengeschichte seinen Segen gegeben. Von Anfang an wollte er, daß ein Roman daraus würde und kein Sachbuch. Deshalb hatte er sich an mich gewandt, einen Roman- und Bühnenautor, statt an einen Historiker.
Leider sind MN und seine Frau im Winter 2011 innerhalb weniger Wochen verstorben. Ich bedauere sehr, daß er die endgültige Fassung des Buches, das Sie nun in der Hand halten, nicht mehr gesehen hat. Ich vertraue darauf, daß sie seine Zustimmung gefunden hätte.
Ich hoffe, MNs Geschichte wird Sie ebenso faszinieren wie mich, als ich sie zum ersten Mal gehört habe.
Carl Nixon Christchurch, März 2013
Eins
Wie anfangen?
Das ist ein ewiges Problem. Seit die ersten Lagerfeuer mühsam die bedrohlichen Schatten des Waldes in Schach hielten, haben sich die Geschichtenerzähler mit der Frage herumgeschlagen, welche Kombination aus Laut und Bedeutung sie in den Feuerschein treten lassen sollten. Welche Worte warf man den gespannten Gesichtern vor?
Oder, in einer neueren Entwicklung: Welche Krakel aus Druckerschwärze führen die Flotte dunkler Konturen an, wenn sie sich in Reih und Glied durch die stillen weißen Ozeane zwischen den Buchdeckeln bewegen?
Gesprochen oder geschrieben, es müssen die ersten Worte jedenfalls stark genug sein, alles auf sie Folgende zu ziehen.
Es war einmal. Das hat sich bewährt. Aber ich denke, jetzt und hier wäre es nicht das Richtige.
Im Anfang war. Zweifellos der älteste und wirkmächtigste Anfang.
Ich will Ihnen eine Geschichte erzählen. Nein. Viel zu abgenutzt.
Einfach mit einer Erklärung der Zusammenhänge anzufangen mag zwar nicht hip sein, ist aber zweckdienlich.
Die Handlung spielt in einer Kleinstadt im Jahr 1919. Es ist die drittgrößte Metropole eines Landes, das früher eine Kolonie Großbritanniens war und jetzt noch zum Commonwealth gehört. In unserer Geschichte nennen wir sie Mansfield.
Die Stadt wurde von einem ihrer Gründer nach seinem Heimatort in Nottinghamshire benannt. Wie fast immer hatte das Gebiet, auf dem die Stadt entstehen sollte, bereits einen anderen Namen. In der Sprache eines Stammes dunkelhäutiger und tätowierter Menschen, die hier seit zahllosen Generationen leben, bedeutete der Name einen Überfluß an Nahrungsmitteln, verbunden mit dem Wort für einen aus Flachs gewobenen Korb. Das feuchte Tiefland und die Lagune wimmelten von Flundern, Heringen und Aalen. Ein Schlaraffenland von Krustentieren und Geflügel. Ort des überquellenden Proviantkorbs ist eine Rohübersetzung, bei der allerdings einige Nebenbedeutungen und kulturelle Assoziationen unter den Tisch fallen.
Den meisten Kolonisatoren blieb der Name völlig unbekannt.
Am Tage seiner Umbenennung war der Ort Mansfield für die bleichgesichtigen Neuankömmlinge nicht mehr als eine Ansammlung provisorischer Hütten nahe einer sumpfigen Mündung zweier Flüsse. Unfruchtbar. Ödland. Einige Siedler hielten es für so unattraktiv, daß sie am Ende einer mehrwöchigen strapaziösen Überfahrt sofort wieder die Segel setzten und sich zu anderen Landstrichen aufmachten.
Im Jahr 1919 ist der Sumpf trockengelegt, und man hat die beiden Flüsse mit Dämmen eingefaßt. Mansfield entwickelt sich zu einer Boomtown. Der Hafen ist der umsatzstärkste des Landes. Weizen, Gerste, Wolle, tiefgefrorenes Lamm- und Hammelfleisch, alles, was in der nunmehr fruchtbaren Ebene, die sich bis zu den Bergen im Westen erstreckt, wächst und gedeiht, wird so schnell wie möglich ins Mutterland England verschifft.
Die Einwohner der Stadt sind mehrheitlich von solider britischer Abstammung: im wesentlichen Engländer, dazu einige Schotten. (Diese Siedler sahen es als Glücksfall an, daß die Iren die Gegend fast vollständig mieden.) Die meisten sind entweder Einwanderer oder die Kinder von Einwanderern. Sie betrachten noch immer das Vereinigte Königreich als ihre Heimat.
Der Stamm der Eingeborenen war nie sehr groß gewesen und wurde nun durch Masern und Grippe fast vollständig ausgerottet. 1919 sieht man kaum mehr ein braunes Gesicht in Mansfield. Dieses Fehlen wird von den meisten Bürgern für einen der größten Vorteile ihrer Stadt gehalten, ebenso wie die Qualität des Grundwassers, die gut befestigten Straßen, die öffentliche Beleuchtung und die frühe großflächige Versorgung mit Straßenbahnen sowie dem Telephon von Mr. Bell. Auch das Abwassersystem funktionierte bestens. Die Lagune mit ihren Gezeiten erwies sich als praktische Deponie für den Abfall; sie wird zweimal täglich geleert.
Vermutlich genügt es zur Charakterisierung der Stadt völlig, wenn man das Klischee zitiert, Mansfield sei die »englischste Stadt außerhalb Englands«. Wenn das Bilder eines schmalen, von Kopfweiden eingerahmten Flusses wachruft, von neugotischen Backsteingebäuden und weißgekleideten Männern beim Cricket auf millimetergenau geschnittenen Rasenflächen, vielleicht noch einem zentralen Platz mit anglikanischer Kathedrale – Sie wären ziemlich nahe an der Wirklichkeit. Verdammt nahe sogar. Es gibt ähnliche Dörfer und Städte überall auf der Welt: in Australien, Neuseeland, Kanada, auch Südafrika hat ein paar davon, etwa Durban.
Eine der interessantesten Attraktionen im Mansfield dieser Zeit ist sein Wal. Der »Mansfield-Wal«, wie er genannt wird, ist unglücklicherweise kein lebendes Exemplar. (Das wäre was gewesen, vielleicht dargeboten in einer dafür abgetrennten Zone des Hafenbeckens!) Die Stadt besitzt das vollständige Skelett eines Balaenoptera musculus.
Es war 1908 vom Museum erworben worden, also etwa ein Jahrzehnt zuvor. Die damalige Regierung steuerte gerne 200 Pfund zum Erwerb und zur Unterbringung des Exponats bei. Weitere 300 Pfund kamen durch private Spenden zusammen.
Der Blauwal war bereits verendet, als er an einem abgelegenen Strand auf der anderen Seite des Landes angespült wurde. Vier Männer brauchten bei täglich zwölf Stunden Arbeit einen ganzen Monat, um das stinkende, blasige Fleisch, die Muskeln und Sehnen wegzuhacken, von den Knochen abzuschaben und zu verkochen. Die blankgeriebenen Knochen wurden dann per Frachter und Eisenbahn nach Mansfield geschafft. Sie wurden am Bahnhof auf Pferdekarren verladen und zum Museum gebracht, wo man sie mit äußerster Präzision wieder zum Skelett zusammensetzte, wozu man Löcher in die Knochen bohrte, um sie mit Draht aneinander zu befestigen.
Das Skelett maß über dreißig Meter in der Länge, wenn man die übliche Methode der Längenmessung bei Walen anwendet, also eine gerade Linie zieht zwischen der Spitze des Kiefers und der Kerbe in der Schwanzflosse, die das Ende der Wirbelsäule markiert.
Kopflänge: 6,40 m
Länge der »Hand«: 3,65 m
Breite der Schwanzflosse: 6,40 m
Es überrascht nicht, daß sich die Museumsräume als zu klein erwiesen, ein solches Monstrum aufzunehmen.
Also wurde ein langer Wellblechschuppen neben das Museum in den Botanischen Garten gesetzt. (Wellblech! Das klassische Baumaterial der Kolonien; stark, leicht, billig, stapelbar, für fast jedes Klima geeignet. Sieht sogar gut aus – mit ein bißchen Glück schon eine Generation später.)
Der Schuppen, eigentlich eine nach drei Seiten geöffnete Halle, grenzt an der Südseite an die Mauer des Museums, nahe am Haupteingang zum Botanischen Garten, und ist von der Nelson Avenue aus sichtbar. Von der Stahlkonstruktion hängt der neun Tonnen schwere Wal an dicken Ketten in der Luft.
Am Tag der offiziellen Enthüllung des Walskeletts, dem 23. März 1909, berichtete die Mansfield Press: »Tausende waren herbeigeströmt und füllten die Wal-Halle wie die angrenzenden Museumsräume.«
Der Grund für das rege Interesse war, daß es sich zu der Zeit um das weltweit größte Walskelett in Museumsbesitz handelte. Das erfüllte nicht nur die Bürger der Stadt mit Stolz, sondern die gesamte Nation nahm daran Anteil. Der »Mansfield-Wal« schaffte es sogar in so illustre Zeitungen wie die Times und die Washington Post. »Unser Wal« machte Mansfield weltberühmt.
Aber (es gibt immer ein Aber) ...
Hier, am Anfang unserer Geschichte im Jahr 1919, liegt das Kriegsende erst ein paar Monate zurück. Während die Bürger Mansfields ängstlich über den Ozean nach ihren Männern, Verlobten, Söhnen und Brüdern schauten, die in Europa kämpften, ist Regenwasser unter das Wellblechdach gedrungen. Die Menschenmengen haben sich längst zerstreut. Die einstmals schneeweißen Knochen sind grau geworden. Die Drahtverbindungen haben zu rosten begonnen und teefarbene Flecken um die Bohrlöcher hinterlassen. Der Schaden ist an den zahlreichen Gelenken der Flossen am deutlichsten. Flechten haben ein Heim im Südteil der Kieferknochen gefunden (6,30 m).
Nur Auswärtige und Kinder bleiben noch stehen, um die fast unvorstellbare Größe der Kreatur zu bestaunen. Für alle anderen aber hatten die Gewohnheit und die Betäubung durch die Schrecken des Krieges das riesige Skelett zwar nicht unsichtbar werden lassen, es aber ziemlich nahe an diesen schrecklich einsamen Zustand gebracht.
Zwei
Greifen wir also nach dem Zufallsprinzip einen Tag dieses Jahres heraus – obwohl natürlich in einer guten Geschichte nichts dem Zufall überlassen wird; alles ist genauestens bedacht – sagen wir also: 9. Mai 1919.
Elizabeth Whitman geht durch den York Park. Sie ist noch knapp zehn Minuten entfernt vom Museum und dem langen Schutzdach, unter dem der Wal hängt. Es ist kurz vor acht Uhr morgens. Elizabeth trägt eine grau-weiß gestreifte Schwesterntracht und ihren eigenen dicken Wollmantel darüber. Ihr dichtes kastanienbraunes Haar ist straff nach hinten zu einem Knoten gekämmt, keine Locke wagt sich hervor. Sie kommt aus einem kleinen Haus einer Arbeitersiedlung im Nordwesten der Stadt; dort wohnt sie mit ihren Eltern und ihrem vierjährigen Sohn Jack. Sie ist auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle im Krankenhaus. Man darf sie sich ruhig mit raschen Schritten vorstellen, den Schritten einer Krankenschwester, für die es immer etwas zu tun gibt auf Station, irgend jemand braucht plötzlich dringend etwas.
Elizabeth folgt dem Kiesweg am Ufer des Stratford River um den Park herum, wo sich die Weiden tief über das seichte Wasser beugen. Wir schauen ihr zu, wie sie die Brücke erreicht und überquert, die den Osteingang zum Park bildet. Sie ist in der Nelson Avenue angekommen, nahe dem Stadtzentrum. Auf der anderen Straßenseite stehen Privathäuser, ein kleines Hotel und der Universitätsclub. Fahrräder und Straßenbahnen auf dem Fahrdamm. Nach der Brücke wendet sie sich nach Süden. Jetzt geht Elizabeth an den Mauern der privaten Fachhochschule für Jungen vorbei, wo zwei Flötenvögel auf dem frischgemähten Rasen Wache halten. (Aufgrund seiner Herkunft und der wirtschaftlichen Gegebenheiten wird ihr Sohn diese Schule nie besuchen; das weiß sie.) Etwas später, knapp hundert Schritte, steht sie vor der Fassade und dem Säulenportal des Museums. Etwa zwanzig Meter weiter ist sie bereits innerhalb des schmiedeeisernen Zauns mit seinen Lilienornamenten, der die Ostgrenze des Botanischen Gartens bildet. Wenn sie den Kopf leicht nach links wendet, wird sie zwangsläufig den Wal sehen.
Aber nein, den Gefallen tut sie uns nicht. Sie blickt starr geradeaus.
Elizabeth geht diesen Weg an jedem Werktag, egal ob es regnet oder die Sonne scheint, bei Wind und sogar Hagel (in Mansfield schneit es nur ganz selten), aber niemals wirft sie auch nur einen flüchtigen Blick auf das Rekordskelett des Balaenoptera musculus.
Der Mai liegt in diesem Teil der Welt im Herbst. Elizabeth spürt die Wärme der Morgensonne, hüllt sich aber enger in ihren Mantel, wenn sie durch die vielen Schattenzonen geht. Ein Ostwind versucht, sich durch die diversen Schichten ihrer Kleidung zu fressen, obwohl der Himmel sich strahlend blau von Horizont zu Horizont erstreckt. Die Platanen zu beiden Seiten der Straße haben schon fast alle Blätter verloren. Der Wind hat sie an den Eisengittern zu ockerfarbenen Dünen aufgehäuft. Nichts, gar nichts davon nimmt sie wahr.
Warum nicht? Warum ist Elizabeth Whitman so distanziert, so unwillig, irgend etwas an sich heranzulassen? Jemand, der Wettermetaphern schätzt, würde vielleicht sagen, daß sich selbst an diesem strahlend hellen Tag eine dunkle Wolke über ihrem Kopf zusammenballt. Sie ist mit ihren Gedanken ganz woanders; buchstäblich auf der anderen Seite der Erde. Ich behalte den Anlaß dafür aus Spannungsgründen momentan noch für mich. Es liegt im Interesse des Geschichtenerzählers, dem Leser den Mund wäßrig zu machen – und genau deshalb lasse ich zumindest eine Zeitlang alles in der Schwebe.
Sehr viel näher als die andere Seite der Erde, nämlich auf der anderen Straßenseite, gegenüber dem Botanischen Garten, liegt die Universität. Wie so vieles in dieser Stadt – die Bedeutung der Flurbezeichnungen kann Ihnen nicht entgangen sein – ist auch die Steinfassade der Universität von Mansfield nach Einrichtungen gestaltet, die ebenfalls weit entfernt sind. Auf ihrem Weg zur Arbeit kommt Elizabeth an Platonschen Höhlenschatten der großen Universitäten von Oxford und Cambridge vorbei. Derjenige, der die Originale kennt, sieht sie in den steinernen Kreuzgängen und Innenhöfen. Eine Kopie des Trinity College hier, ein Plagiat von Christ Church dort. Es gibt weitere Anklänge in den Spitzbögen der neogotischen Fenster oder den dämonischen Wasserspeiern, die aus den Schatten von oben herabgrinsen. Sie müssen sich nur wesentlich neuere und wesentlich kleinere Gebäude darunter vorstellen. Die Universität von Mansfield wurde relativ schnell gebaut, in Jahrzehnten und nicht Jahrhunderten und mit den beschränkten Mitteln, die einer Stadt in den Kolonien zur Verfügung standen.
Stellen Sie sich eine Ideenskizze vor, die eingepackt und verschickt wurde; Fertigteile, die ohne das richtige Werkzeug zusammengesetzt wurden; ein Buch, das nur so ungefähr in eine andere Sprache übersetzt wurde. Mit ihren engen Kreuzgängen und niedrigen Turmspitzen, ihrem verkümmerten Observatorium und kleinen Innenhof kann die Universität nur zeigen, wonach sie eigentlich gestrebt hat. Es ist genauso, wie wenn man die Cousine einer Freundin trifft. Einen Augenblick lang denkt man, man kennt sie, um dann festzustellen, daß man sich vertan hat. Sie ist weder so souverän noch so hübsch wie die Freundin, die man immer heimlich verehrt hat.
An diesem Morgen überquert eine Gruppe Studenten vor Elizabeth die Straße. Zehn Jahre früher wäre sie viel größer gewesen, doch die Zahl der an dieser Universität Lehrenden und Lernenden ist durch den Krieg stark dezimiert worden, es gibt sehr viel weniger Vorlesungen. Zu dieser frühen Uhrzeit trödeln die wenigen eingeschriebenen Studenten noch faul herum. Sie würdigen Elizabeth keines Blicks. Eine Krankenschwester auf dem Weg zur Arbeit ist im Zentrum von Mansfield ein so alltäglicher Anblick wie das schwebende Skelett eines Blauwals.
Drei
Der aufmerksame Leser erinnert sich vielleicht, daß Elizabeth einen vierjährigen Sohn hat. Sie hat auch einen Ehemann. Oder besser: Sie hatte einen Ehemann; hier, am Beginn unserer Geschichte, gibt es noch unterschiedliche Auffassungen darüber, welches Tempus wir benutzen sollten. Jene dunkle Wolke über Elizabeth auf ihrem Weg zum Krankenhaus an diesem Herbstmorgen des Jahres 1919 hat nämlich ihren Ursprung darin, daß ihr Mann, Jonathan Edward Whitman, den sie Johnny nennt, von seinem Kriegseinsatz in Frankreich nicht zurückgekehrt ist.
Der Erste Weltkrieg endete am 11. November 1918; offiziell in der elften Stunde des elften Tags des elften Monats – ein zu poetisches Ende für das vierjährige Schlachten. Jonathan Whitman steht auf der Vermißtenliste. Zuletzt gesehen wurde er am 4. November, als er mit drei Kameraden aufbrach, um in einem Wäldchen bei Le Quesnoy nach Verwundeten zu suchen. Kurz darauf geriet das Gebiet unter heftiges Artilleriefeuer der Deutschen, die den Ort besetzt hielten. Seither gab es kein Lebenszeichen von Leutnant Whitman und seinen drei Begleitern.
Der Fall von Jonathan Whitman und seiner Frau Elizabeth ist keineswegs einzigartig; ganz im Gegenteil. In Europa und dem British Empire hat der Krieg Hunderttausende Halbwitwen und Fastwaisen geschaffen. In einigen Regionen gibt es ebenso viele Vermißte wie Gefallene. Im Krieg werden Menschen zu Spielzeug, das unters Sofa oder ganz nach hinten in die Schublade rollt. Sie geraten in ein Loch in der Fußleiste oder in Abflußrohre und verschwinden auf Nimmerwiedersehen.
In der Hauptstadt, eine Tagesreise mit dem Zug nach Norden von Mansfield aus, hat man VERMUTLICH GEFALLEN auf Jonathan Whitmans Akte im Kriegsministerium gestempelt. Die Großbuchstaben in dicker schwarzer Tinte lassen das Wort »vermutlich« als Euphemismus erscheinen.
Während wir weiterhin Elizabeth auf ihrem Weg zum Krankenhaus folgen, können wir aus der Haltung ihrer Schultern, dem erhobenen Kinn, der Entschlossenheit ihrer Bewegungen schließen, daß diese Umstände sie nicht völlig mutlos gemacht haben. Wir dürfen sogar spekulieren, daß Elizabeth noch immer einen Funken Hoffnung in sich trägt – eine Kerzenflamme, die sie gegen einen immer schärfer werdenden Wind schützt.
Vier
Ein Auto bremst scharf und hält neben Elizabeth an. 1919 waren Autos noch selten, und man mußte reich sein, um eines zu besitzen. Zum Glück ist Mansfield sehr eben auf einem trockengelegten Sumpf gebaut. Die meisten Einwohner nutzen darum klaglos das Fahrrad oder die Straßenbahn.
Ohne innere Beteiligung stellt Elizabeth sachlich fest, daß die Autotür schwarzglänzend wie ein Mistkäferflügel ist. Sie sieht ihr Spiegelbild darin und fährt sich instinktiv mit der Hand über die Haare.
Sie ist schon ein paar Schritte weitergegangen, als sie jemanden ihren Namen rufen hört.
»Mrs. Whitman. Mrs. Whitman!«
Sie bleibt stehen, wendet den Kopf und sieht, wie sich der Fahrer mühsam aus dem engen Sitz hinter dem Steuer schält. Er hebt eine Hand, während er noch einmal ihren Namen ruft. Eine Gruppe von Fabrikarbeiterinnen auf Fahrrädern schießt unter lautem Klingeln knapp an der aufgerissenen Wagentür vorbei.
Der Fahrer ist groß, sein längliches, schmales Gesicht erinnert an ein Pferd, etwa den Equus ferus caballus (zufällig besitzt das Museum ein vollständiges Skelett, das kaum 50 Meter entfernt in der Haupthalle zu besichtigen ist). Mit ein paar langen Schritten ist der Mann zu ihr getreten. Elizabeth stellt fest, daß seine Hose und Jackett eine Art Uniform bilden, doch keine militärische.
»Mrs. Whitman, bitte entschuldigen Sie meine Aufdringlichkeit! Erinnern Sie sich an mich? Martin Templeton. Ich habe Jonathan im Krieg kennengelernt und ihn in London im Krankenhaus besucht.«
Elizabeth erinnert sich schemenhaft an einen Mann, der verlegen im Flur wartete, bis Johnny vorbeigeschoben wurde.
»Ich glaube, ich erinnere mich. Wie geht es Ihnen?«
»Ganz gut, danke. Tut mir leid, daß ich Sie hier auf der Straße so überfalle, ist eigentlich nicht meine Art. Aber ich habe einen Brief an Sie von der Dame, für die ich arbeite, Mrs. Blackwell.«
Sie schüttelt den Kopf. »Tut mir leid, ich kenne keine Mrs. Blackwell.«
»Der Brief ist aber ganz bestimmt für Sie. Ich sollte ihn persönlich im Krankenhaus für Sie abgeben. Ich war auf dem Weg dorthin, als ich Sie hier auf der Straße gesehen habe. So ein Zufall!«
»Ja. Worum geht es denn?«
Er zuckte die Achseln. »Keine Ahnung. Die Blackwells reden nicht mit mir über ihre Angelegenheiten.«
Solche Zusammentreffen passieren in einer Kleinstadt wie Mansfield andauernd. Wenn man 1919 durch die Straßen geht, trifft man zwangsläufig jemanden, einen Bekannten, Freund oder Verwandten. Jemanden, der jemanden kennt, den man kennenlernen will, dafür zu bezahlen, diesem vorgestellt zu werden, ist somit völlig absurd.
Martin Templeton greift in seine Jackettasche und gibt Elizabeth einen Umschlag. Das Papier ist so dick und uneben, daß es sie an menschliche Haut erinnert.
»Es tut mir so leid wegen Jonathan.« Sein Blick streift kurz ihr Gesicht und senkt sich dann auf den Boden vor seinen Füßen.
Elizabeth hört das in allen möglichen Variationen, und jede Woche, die ohne Nachricht vergeht, werden es mehr. »Schrecklich, das mit Ihrem Mann!«, »Was werden Sie jetzt anfangen?«, »Es muß furchtbar sein für Ihren Sohn, wie kommt er damit zurecht?«, »Der Krieg war entsetzlich, wir alle müssen damit fertigwerden, nicht wahr, meine Liebe?«
Sie nickt. »Danke. Jonathan wird bislang nur vermißt.«
Sein Pferdegesicht zuckt, als hätte sich eine Fliege darauf niedergelassen. »Ja, natürlich.« Ganz offensichtlich weiß er nicht, wie er mit dieser weiblichen Ausweichtaktik umgehen soll.
Zum ersten Mal bemerkt Elizabeth jetzt, daß dem Mann rechts drei Finger und Teile der Handfläche fehlen. Er begegnet ihrem Blick und hebt unwillkürlich die Hand.
»Eine Granate im Graben.«
»Oh!«
»Nicht wirklich schlimm. Habe viel Schlimmeres gesehen.«
»Ich auch.«
»Wenigstens war damit mein Einsatz beendet. Konnte nach Hause zurück.«
»Ist offenbar gut verheilt«, sagt sie. »Wer immer das operiert hat, verstand etwas von seinem Fach.«
»Das haben die Schwestern in London auch gesagt.«
»Sie haben Glück gehabt, daß Sie nicht noch mehr Splitter abgekriegt haben, als das Ding explodiert ist.«
Er grinst. »Ich war derjenige, der das Scheißding schmeißen sollte. Entschuldigen Sie meine Ausdrucksweise. Aber vor lauter Aufregung habe ich es ein bißchen zu lange in der Hand behalten.«
»Immerhin haben Sie noch den Daumen. Das ist viel wert.«
»Da haben Sie verdammt recht.« Er macht eine Greifbewegung mit dem Daumen und seinem einzigen Finger. »Im Krankenhaus haben sie mich ›Die Krabbe‹ genannt.« (Ein Mann mit Pferdegesicht und Krabbenhand: Martin Templeton ist ein gefundenes Fressen für jeden viktorianischen Tierpräparator.)
Elizabeth lächelt. Sie erinnert sich an einen jungen Soldaten in dem Londoner Krankenhaus, in dem sie zu Anfang des Kriegs gearbeitet hat. Seine Zimmergenossen nannten ihn »Captain Ahab«. Später in Longhurst tauften sie einen »Hawkeye«.
»Danke jedenfalls für den Brief.«
»Keine Ursache. Ich gehe jetzt besser. Hat mich gefreut, Sie wiederzusehen.«
»Mich auch.«
Sie schaut ihm nach, wie er sich hinter das Steuerrad der schwarzen Limousine zwängt, er faltet sich dabei zusammen wie einen Liegestuhl. Er startet den Motor und fährt los, die Fahrräder vor ihm weichen zur Seite wie kleine Fische vor einem Hai.
Elizabeth steht noch immer mit dem Umschlag in der Hand auf dem Bordstein und schaut in die Ferne. Das tut sie seit einiger Zeit immer öfter. Sie weiß nicht, wie lange sie da schon steht. Erst ein kalter Windstoß, der die Blätter zu ihren Füßen aufwirbelt, holt sie in die Gegenwart zurück.
Sie verstaut den Brief in der Manteltasche und setzt ihren Weg zum Krankenhaus fort. In zehn Minuten beginnt ihre Schicht.
Fünf
Mrs. P. Blackwell
Woodbridge House, West Ilam, Mansfield
Sehr geehrte Mrs. Whitman,
ich möchte mich gerne mit Ihnen treffen, um eine wichtige Angelegenheit zu besprechen. Das kann zu unser beider Vorteil sein. Ich erwarte Sie am Samstag, den 17. Mai, um 9 Uhr. Wenn Ihnen der Termin recht ist, holt Sie mein Chauffeur Mr. Templeton, den Sie ja bereits kennen, pünktlich um 8:30 Uhr ab.
Bitte bestätigen Sie den Termin postwendend.
Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen.
Mit freundlichen Grüßen
Die Unterschrift ist unleserlich, wie mit einer Tätowiernadel tief in das dicke Papier gestochen.
Elizabeth legt das Blatt sorgfältig wieder zusammen und steckt es in den Umschlag, aus dem ein strichfeiner Duft von Lavendel aufsteigt. Sie greift nach ihrer Teetasse, doch ist der Tee noch zu heiß. Immerhin wärmt die Tasse ihre kalten Hände. Aus dem Fenster des Schwesternzimmers im zweiten Stock sieht sie im Norden die Baumwipfel des York Parks. Unter ihr genießen etwa ein halbes Dutzend Patienten am Flußufer die Morgensonne. Einige stehen herum, zwei sitzen in Rollstühlen mit Decken über den Knien.
Eine Kollegin, Kitty Sullivan, eine kleine Frau mit dicken Brillengläsern und Hüften wie ein Brauereipferd – ihre eigenen Worte –, legt Elizabeth eine Hand auf die Schulter.
»Was hast Du, Lizzy?«
»Nichts, warum?«
»Du siehst besorgt aus. Gibt es schlimme Nachrichten?«
»Nein. Gar nichts.« Elizabeth hat sich daran gewöhnt, daß alle Schwestern in ihrem Gesicht nach Hinweisen forschen, ob sie die Nachricht von Johnnys Tod erhalten hat. »Es ist nur eine Einladung, jemanden zu besuchen, eine Mrs. Blackwell. Offenbar wohnt sie draußen in Ilam.«
Kittys Augen weiten sich hinter den dicken Gläsern. »Oho! Da bist du ja endlich in die richtigen Kreise geraten.«
»Ich kenne sie nicht. Wovon redest du?«
»Du mußt doch von den Blackwells gehört haben.«
»Ich erinnere mich nicht.«
»Doch, bestimmt. Das ist eine der ganz alten Familien, noch von den ersten Schiffen und so. Sie sind steinreich.«
»Verstehe. Ich habe aber trotzdem keine Ahnung, was sie von mir will.«
»Vielleicht hast du in Europa einen ihrer Verwandten gepflegt, und jetzt will sie sich persönlich bei dir bedanken?«
»Ich hatte nie einen Patienten namens Blackwell.«
»Dann bleibt es ein Rätsel. Wie aufregend!«
Elizabeth stellt ihre Tasse im Spülbecken ab. »Ja, das ist wohl so. Ich werde mir jetzt aber nicht den Kopf darüber zerbrechen.« Sie sieht auf ihre Uhr. »Ich muß los. Und bitte, Kitty, ich möchte, daß das unter uns bleibt.«
»Klar, du kennst mich doch.«
Sie kennt Kitty Sullivan tatsächlich und weiß daher, daß noch am selben Tag das ganze Krankenhaus von ihrem Treffen mit Mrs. Blackwell erfahren wird.
Elizabeth geht ins Erdgeschoß und betritt das Gewirr von Korridoren. Das Krankenhaus ist ziemlich leer. Kaum zu glauben, daß die Grippeepidemie erst im vergangenen November auf ihrem Höhepunkt war. In Mansfield gab es zwar nicht ganz so viele Tote wie in der Hauptstadt, wo die meisten der auf den Truppentransportern zurückkehrenden Soldaten von Bord gingen und das Virus einschleppten. Dennoch waren damals alle Betten belegt gewesen. Viele Patienten lagen auf Matratzen oder Bahren auf dem Flur. Für die schlimmsten Fälle konnten die Schwestern nicht viel tun. Sie mußten machtlos zusehen, wie scheinbar kräftige, gesunde Männer und Frauen innerhalb weniger Stunden starben. Aber das hielt das Personal nicht davon ab, bis zum Umfallen zu arbeiten – manchmal buchstäblich!
Elizabeth war in der dritten Novemberwoche selbst erkrankt. Von einem Augenblick zum nächsten hatte sie sich so schwach gefühlt, daß sie nicht mehr stehen konnte. Fünf Tage lag sie zu Hause mit hohem Fieber im Bett, nur von ihrer Mutter gepflegt. Sie schwitzte und delirierte, und allein ihrem eisernen Willen war es zu verdanken, daß sie nach fünf Tagen bereits wieder arbeitete. Zwei ihrer Kolleginnen und ein Arzt hatten weniger Glück gehabt; sie wurden schnell und ohne große Zeremonie beerdigt.
Als Elizabeth auf Station sechs eintrifft, begrüßt sie der übliche Chor über die Grammophonmusik hinweg.
»Guten Morgen, Schwester!«
»Schaut mal, wer da ist!«
»Haben Sie Zeit für ein Schwätzchen mit einem alten Haudegen?«
Sie geht von Bett zu Bett, stellt Fragen und macht sich in Gedanken Notizen, wo Verbände zu wechseln sind, wo Medikamente verabreicht werden müssen, wem es besser und wem schlechter geht. Gefreiter Cooper ist durch Senfgas fast erblindet. Elizabeth setzt sich zu ihm und liest ihm einen Brief seiner jungen Frau vor. Sie lebt auf der Farm der Coopers zusammen mit ihren Schwiegereltern. Als Elizabeth zu Ende gelesen hat, gibt sie Cooper den Brief. Er faltet ihn sehr sorgfältig zusammen.
»Danke.«
»Keine Ursache.«
Während des Kriegs war der gesamte Nordflügel dem ständigen Zustrom von Verwundeten aus Europa vorbehalten gewesen. Die meisten von ihnen sind jedoch inzwischen nicht mehr da. Nur Station sechs bleibt noch für Soldaten mit therapieresistenten Verletzungen oder Krankheiten offen. Patienten mit Kriegszittern sind in die psychiatrische Anstalt Sunnyside im Osten der Stadt eingewiesen worden. Die Patienten auf Station sechs haben zumeist komplizierte Verwundungen oder Amputationen, Krampfzustände oder Fieberanfälle.
Die Mehrzahl der Soldaten ist bereits in die früheren Berufe und Lebensumstände zurückgekehrt. Die Regierung möchte so schnell wie möglich Normalität schaffen. Nach den Jahren im Krieg sind die Männer plötzlich keine Schützen, Pioniere, Sanitäter oder Kanoniere mehr. Keine Hauptmänner, Unteroffiziere, Feldwebel oder Gefreite. Sie sollen nun reibungslos in ihre alten Rollen als Ehemänner und Väter, Bauern, Elektriker, Bäcker, Bankbeamte, Lehrer, Kürschner und Schneider zurückkehren; und damit haben sie plötzlich alle denselben Rang. Selbst einige Majore und Generäle sind jetzt schlicht Fred oder Rob, der Kerl von nebenan, der mal irgendwas bei der Armee war. Nachdem sie die schmale Gangway vom Truppentransporter heruntergegangen waren, lösten sie sich in der Menge der Wartenden auf. Legten die Dienstgrade ab wie die Uniformen. Und zogen an, was sie wollten.
Laß den Krieg hinter dir, und schau in die Zukunft. Solche Slogans hat man ihnen beigebracht. Und sie versuchen, danach zu leben.
Also warum zittern ihnen die Hände? Was ist denn daran so schwer, den Hemdknopf zu schließen? Warum wachen sie mitten in der Nacht auf, weil ihr Herz rast? Die Kinder fangen an zu weinen, wenn der Vater sie grundlos anschreit.
Schwierig genug, der Frau zu erklären, wie es war – und wie es immer noch ist. Man will sie nicht belasten. Was nützt es, über diese vergangenen Greuel zu reden? Oder über die guten Zeiten, die es ja auch gab.
Die Männer auf Station sechs sind samt und sonders in Elizabeth verliebt. Nicht etwa, weil sie toll aussieht. Da sind andere Schwestern attraktiver. Auch nicht, weil sie so liebevoll mit ihnen umgeht; eher das Gegenteil ist der Fall.
Elizabeth sieht ihre Patienten als das, was sie sind: Männer ohne Augen, Arme, Beine, Lungen, Nieren – in diversen Kombinationen, mal schlimmer, mal weniger schlimm. Sie sind verstümmelt, innerlich gebrochen, Krüppel.
Vielleicht denken Sie, das ist ein Fehler von ihr. Eine Krankenschwester sollte liebevoll sein. Müßte Elizabeth ihre Patienten nicht als das sehen, was sie waren: vollständige, aktive Menschen? Und als das, was sie wieder sein könnten: wertvolle Mitglieder einer Gesellschaft, die sich neu konstituieren will und muß?
So etwa reden die Mütter und Frauen, wenn sie die Patienten auf Station sechs besuchen. Wenn sie ihren Sohn oder Mann anschauen, dann vermeiden sie es tunlichst, einen Blick auf den Armstumpf zu werfen oder auf das Laken, das unterhalb der Hüfte keine Konturen mehr erkennen läßt. Sie tun so, als sähen sie den Gummischlauch nicht, der irgendwo aus dem Krankenhauspyjama austritt und unter dem Bett verschwindet. Die Besucher reden immer von den guten Zeiten vor dem Krieg. Und von der goldenen Zukunft.
Elizabeth aber lebt nur in der Gegenwart. Sie spricht mit ihren Patienten nie von der Vergangenheit oder macht ihnen Hoffnung auf die Zukunft. Ihre Arbeit als Krankenschwester in Europa und Afrika hat sie das gelehrt. Statt dessen massiert sie Stümpfe, um die Durchblutung anzuregen. Sie verbindet infizierte Wunden, ohne einen Kommentar dazu abzugeben. Sie reibt Salbe in trockene, rissige Haut, die gebrannt hat. Sie ist pragmatisch und tüchtig. Aber nicht liebevoll.
Ihre emotionslose Art hilft den Patienten ebenso wie die eigentliche Pflege.
Tatsächlich wollen die Männer auf Station sechs keine liebevolle Zuwendung. Tag für Tag blicken sie vom Gipfel ihrer Situation auf die Ebene der liebevollen Zuwendung herab. Sie wissen, daß sie ans Land der Herablassung, gar der Verachtung grenzt. Sie wissen, die Hauptstadt der Ebene der liebevollen Zuwendung ist eine ausgebrannte Metropole namens Mitleid.
Sechs
Man könnte die Kriegsführung anhand eines einzigen Parameters studieren, nämlich der Entwicklung der Geschwindigkeit.
In der Physik ist Geschwindigkeit definiert als Veränderungsrate eines Körpers im Raum. Sie wird allgemein in Meter pro Sekunde gemessen.
Das ist eine einigermaßen trockene Definition und paßt schlecht zum Geschichtenerzählen. Ich habe sie nach einiger Überlegung zitiert, weil sie die entscheidende Rolle spielte für zahllose Menschen, die tot oder sterbend auf Gallipoli lagen, an der Somme und bei Passchendaele. Aus der Distanz betrachtet, kann auch trockener Physik eine Emotionalität anhaften.