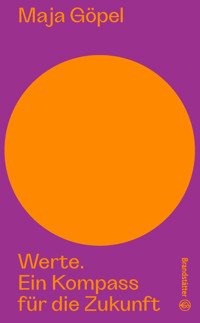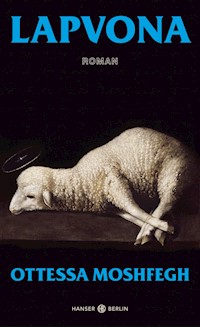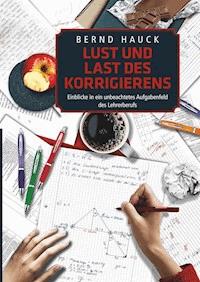
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Klassenarbeiten sind ein zentrales Element unserer Schulrealität – die Geschehnisse rund um ihre Korrektur jedoch vollziehen sich insbesondere für Eltern und Schüler weitgehend im Verborgenen. Was „erleben“ korrigierende Lehrkräfte und welche psychosozialen Prozesse treiben sie an und um? Mit der Hinwendung zu den verschiedenen Facetten der alltäglichen Korrekturarbeit von Lehrern und Lehrerinnen möchte das vorliegende Buch nicht nur eine Lücke in der pädagogischen Fachliteratur schließen, sondern informative und vergnügliche Lektüre-Erlebnisse auch für ein breiteres Publikum ermöglichen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 93
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieses Buch widme ich den vielen tollen
Schülerinnen und Schülern, die ich an
verschiedenen Gesamtschulen
unterrichten durfte.*
*
Integrierte Gesamtschule Franz' sches Feld,
Braunschweig;
Integrierte Gesamtschule Peine
Vorwort
Wie gehen die Lehrkräfte im Alltag mit dem Widerspruch um, die Korrekturarbeit trotz ihrer offenkundig zweifelhaften pädagogischen Sinnhaftigkeit, des enormen Zeitaufwands sowie ihrer praktischen Folgenlosigkeit für die Lernentwicklung der Schüler dennoch immer wieder neu erledigen zu müssen?
Als Lehrer für Deutsch und Politik habe ich inzwischen sicherlich mehrere tausend Klassenarbeiten und Klausuren korrigiert. Die Korrekturarbeit habe ich dabei fast immer als belastend und fordernd, oft aber auch als interessant, aufschlussreich und anregend empfunden.
Der Titel „Lust und Last des Korrigierens" soll diese Ambivalenz meiner Korrekturerfahrungen zum Ausdruck bringen und neugierig machen auf eine Reise in die Erfahrungswelt korrigierender Lehrerinnen und Lehrer.
Sie, liebe Leserinnen und Leser, finden im vorliegenden Buch sowohl essayhafte Texte mit wissenschaftlichem Anspruch wie auch nicht ganz ernst zu nehmende satirische Exkurse über mehr oder minder kuriose Aspekte der Korrekturarbeit.
Gemeinsam ist allen Texten der Anspruch, die Korrekturarbeit konsequent aus der Perspektive der agierenden Lehrkräfte, ihrer Arbeitsstrategien, Befindlichkeiten und Emotionen zu analysieren.
Informationen zu meinem gleichnamigen Veranstaltungs- und Lesungsprojekt finden Sie unter:
www.lust-und-last-des-korrigierens.de
Kontakt: [email protected]
Inhalt
Vorwort
Einleitung
Die Klassenarbeit als Ritual Einblicke in die Geschichte der Korrekturarbeit
Blick hinter die Kulissen (I) Die Farbe Rot: Schülerängste und erkrankte Lehrer
„Wer korrigiert denn da?“ Korrekturarbeit im Spiegel empirischer Untersuchungen
Korrigieren: Monotone Sisyphusarbeit oder spannende Entdeckungsreise?
Blick hinter die Kulissen (II) Die Lehrkraft als Polizist und Detektiv
Zeitmanagement oder: Nach der Klausur ist vor der Klausur
Die Klassenarbeit als Blackbox: Riskantes Spiel mit offenem Ausgang
Blick hinter die Kulissen (III) Nicht witzig: Hinterlassenschaften
Gefangen! Über den schwierigen Umgang mit einem nicht einlösbaren Anspruch
Blick hinter die Kulissen (IV) „Machen Sie das eigentlich gerne?" Beunruhigende Einblicke in die Psyche der Korrigierenden
„Gott oder Kumpel?" Der steinige Weg der Notenfindung
„So ein blöder Fehler!" Über die emotionalen Seiten des Korrekturprozesses
Blick hinter die Kulissen (V) Orte und Ambiente
Versuch, eine ketzerische Frage zu beantworten
Der „Fehlerengel" - über die neue Lust am Korrigieren
Ein Reisebericht aus Absurdistan: Korrekturarbeit im Zeitalter des Zentralabiturs
Versuch eines Fazits
Statt eines Nachworts: Ein Fallbeispiel als Plädoyer für die Abschaffung benoteter Klassenarbeiten
Literatur
Lust und Last des Korrigierens
Einleitung
Warum ein Buch über das Korrigieren?
In der Selbstwahrnehmung von Lehrerinnen und Lehrern stellt die Korrekturarbeit neben dem Kerngeschäft des Unterrichts sowie seiner Vor- und Nachbereitung die quantitativ umfänglichste Teilaufgabe ihres professionellen Handelns dar. Eine im Auftrag der Bertelsmann-, Bosch-, Mercator- und Telekom-Stiftung durchgeführte repräsentative Befragung unter Lehrkräften der Sekundarstufe I aus dem Jahr 2015 kommt zu dem Ergebnis, dass pro Schulwoche fünf Stunden der Arbeitszeit von durchschnittlich 42,8 Stunden für das Korrigieren von Schülerarbeiten verwendet werden (Braunschweiger Zeitung 2016).
Auch im öffentlichen Bewusstsein gehört das Bild der im häuslichen Arbeitszimmer vor einem Heftstapel sitzenden, Klassenarbeiten einsammelnden oder korrigierte Hefte austeilenden Lehrkraft zum festen Repertoire unserer durch autobiographische Erfahrungen und filmische Inszenierungen geprägten Vorstellungswelt über den Lehrerberuf.
Um so erstaunlicher ist, dass das Thema „Korrigieren" in der pädagogischen Fachliteratur kaum vorkommt und sowohl in der ersten wie auch in der zweiten (praxisbezogenen) Phase der Lehrerausbildung eine eher randständige Rolle spielt. Offenbar gehen alle Beteiligten unausgesprochen davon aus, dass entgegen dem in den letzten Jahrzehnten vorherrschenden Trend zur Verwissenschaftlichung und Professionalisierung der Arbeit von Lehrerinnen und Lehrern die Korrekturtätigkeit keiner spezifischen Schulung und kritisch-reflexiven Durchdringung bedarf.
Dabei böte allein der Begriff „Korrektur" bereits Anlass zu kritischen Nachfragen:
Der Fachbegriff „Korrigieren" ist im pädagogischen Diskurs semantisch positiv besetzt, denn er verweist auf die Existenz eines sinnvollen Zirkels aus Fehlerdiagnose, Einsicht in die Fehlerursachen und daraus resultierenden Lernanstrengungen und -fortschritten der Schülerinnen und Schüler.
Im Hausaufgabenformat der 'Berichtigung' einer Klassenarbeit materialisiert sich gleichsam die Hoffnung auf die positiven pädagogischen Effekte dieser durch die Korrekturarbeit der Lehrkräfte initiierten Lernzirkel.
Auch die für die Korrekturarbeit eingesetzten nicht unerheblichen Zeitressourcen legitimieren sich im Bewusstsein der im schulischen Handlungskontext agierenden Menschen (Lehrkräfte, Eltern, Schüler, Kultusbürokratie) vordergründig durch diesen Glauben an die gleichsam heilsame, nämlich nachweisbare Lernfortschritte bewirkende Funktion korrigierter Klassenarbeiten.
Im Mittelpunkt der Korrekturpraxis steht aber etwas ganz Anderes: Klassenarbeiten werden korrigiert, um sie zu bewerten! Der Korrekturvorgang erfüllt also weniger die Aufgabe der Feststellung von Wissens- und Kompetenzdefiziten oder gar der Organisation von Lernfortschritten für Schülerinnen und Schüler. Über die Vergabe von Noten und in deren Konsequenz Abschlüssen und Berechtigungen ist die Korrektur von Klassenarbeiten vielmehr primär Ausdruck der Selektionsfunktion der Schule als gesellschaftlicher Institution.
Die allgemein verbreitete Dominanz des Begriffs „Korrigieren" gegenüber der eigentlich zutreffenderen Formulierung „Bewerten" sollte vor diesem Hintergrund Anlass zu ideologiekritischen Betrachtungen sein und erhebliche Zweifel am pädagogischen Sinn und Ethos der vorherrschenden Korrekturpraxis aufkommen lassen.
Die enge Verzahnung des Korrigiervorgangs mit Prozessen der Leistungsmessung und -bewertung öffnet den Blick auf weitere interessante Aspekte des Themas:
Im Akt der Korrektur, der in die Vergabe einer Note mündet, manifestiert sich nämlich der Herrschaftsanspruch der einzelnen Lehrkraft gegenüber Schülern und Eltern. Zwar führen erlassliche und curriculare Vorgaben, ein für alle einsehbarer Erwartungshorizont sowie lerngruppenübergreifende Parallel- oder zentrale Vergleichsarbeiten zu einer weitgehend standardisierten und damit objektiven Bewertungspraxis – dennoch eröffnet jede Korrektur einer Schülerarbeit Handlungs- und Interpretationsspielräume, die der korrigierenden Lehrkraft Entscheidungen abverlangen bzw. ermöglichen, die innerhalb einer gewissen Bandbreite der Notenskala unterschiedliche Bewertungen zulassen.
Psychologisch betrachtet erwächst die im Titel behauptete „Lust" am Korrigieren vor allem aus diesen Handlungs- und Bewertungsoptionen, die (bewusst oder unbewusst) Bedürfnisse nach Machtausübung befriedigen und dem eigenen Tun Bedeutsamkeit und gesellschaftliche Anerkennung verleihen.
Eine positive Einstellung gegenüber der Korrekturtätigkeit entwickeln viele Lehrkräfte aber auch noch aus einem anderen Grund: Im Unterschied zum Unterrichten, das in das Korsett des in 45-Minuten-Sequenzen getakteten Stundenplans eingepasst ist und deshalb ein hohes Maß an Fremdbestimmung, Zeitdruck und Stress mit sich bringt, ist die Korrekturarbeit (wie auch die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts) weitgehend aus dem alltäglichen Schulbetrieb ausgelagert.
Die Lehrkräfte können also im Rahmen der durch Erlasse vorgegebenen maximalen Korrekturzeiten (meist werden Zeiträume von zwei bis drei Wochen bis zur Rückgabe vorgeschrieben) selbst über ihre Arbeitszeit bestimmen. Bis zur Verbreitung von Home-office-Zeiten in der digitalisierten Arbeitswelt der Gegenwart stellte diese persönliche Verfügungsgewalt über die eigene Arbeitszeit ein Alleinstellungsmerkmal dar, das in der Vergangenheit meist nur freiberuflich Tätige für sich in Anspruch nehmen konnten.
Die mit der Korrekturarbeit verbundene relative Zeitautonomie wird aber teuer erkauft: Ein Stapel von durchschnittlich 25 bis 30 Klassenarbeiten ist für die meisten Lehrkräfte zunächst einmal ein bedrohliches Sinnbild für auf Erledigung wartende monotone Arbeit; und die Freude über einen durchkorrigierten Stapel wird durch die Erkenntnis „nach der Klassenarbeit ist vor der Klassenarbeit" gedämpft und lässt nicht selten das depressiv stimmende Gefühl entstehen, als korrigierende Lehrkraft eine Sisyphusarbeit verrichten zu müssen. Erschwerend kommt hinzu, dass der notwendige Zeitaufwand für die Korrektur einer Klassenarbeit nicht exakt vorhersehbar ist und weder objektiv erfasst noch bei der Festlegung der insgesamt zu erbringenden Arbeitsleistung in irgendeiner Weise berücksichtigt wird. Denn die Arbeitszeitverordnungen für Lehrkräfte differenzieren bei der Festlegung der sich zwischen 23 und 28 Wochenstunden bewegenden verschiedenen Unterrichtsdeputate einzig nach Schulformen, nicht aber nach unterrichteten Fächern mit ihrem extrem unterschiedlichen Korrekturaufwand.
Was auf der Ebene der subjektiven Wahrnehmung Gefühle von ungerechter Behandlung und Überlastung hervorruft, führt unter bildungsökonomischen Aspekten betrachtet zu der Frage nach den Kosten der Korrekturarbeit im Verhältnis zu ihrem gesellschaftlichen Nutzen.
Es liegt im Wesen der Korrekturtätigkeit und im Beamtenstatus der Lehrkräfte begründet, dass sich deren Kosten nur schwer ermitteln, geschweige denn exakt beziffern lassen: Egal, ob eine Lehrkraft drei, fünf oder zehn Stunden für die Korrektur einer Klassenarbeit aufwendet – der zeitliche Umfang ihrer sonstigen dienstlichen Verpflichtungen wie auch ihre Bezahlung bleiben gleich!
Im Rückgriff auf die Mehrarbeitsvergütungsordnung des Bundes lassen sich aber Kosten zwischen 150 Euro für einen Klassensatz Klausuren in der Sekundarstufe I und beachtlichen 120 Euro für eine einzelne Abiturprüfungsklausur errechnen.
Angesichts dieser Beträge stellt sich die schon thematisierte Frage nach dem pädagogischen Sinn des Korrigierens angesichts chronisch knapper Kultushaushalte sowie nicht realisierter qualitativer Verbesserungen im Bildungsbereich auch unter dem Aspekt der Ressourcensteuerung im Schulwesen mit großer Vehemenz.
Vor dem Hintergrund dieser grundlegenden berufssoziologischen und bildungsökonomischen Fragen werden in den nachfolgenden Kapiteln aber vor allem die verschiedenen Facetten der alltäglichen praktischen Korrekturarbeit von Lehrerinnen und Lehrern untersucht:
Was 'erleben' korrigierende Lehrkräfte und welche psychosozialen Prozesse treiben sie an und um?
Klassenarbeiten sind nach wie vor ein zentrales und prägendes Element unserer Schulwirklichkeit - die Geschehnisse rund um
ihre Korrektur jedoch vollziehen sich eher im Verborgenen. Das vorliegende Buch möchte Einblicke in diesen ganz besonderen Mikrokosmos der Arbeits- und Gedankenwelt korrigierender Lehrkräfte ermöglichen.
Meine Hoffnung ist, dass sich Lehrerinnen und Lehrer mit ihren eigenen Korrekturerfahrungen in meinen Darstellungen und Analysen wiederfinden können und Eltern sowie Schüler der Korrekturarbeit von Lehrkräften nach der Lektüre dieses Buches vielleicht ein wenig Verständnis- und damit auch respektvoller begegnen.
Die Klassenarbeit als Ritual Einblicke in die Geschichte der Korrekturarbeit
Das Ritual 'Klassenarbeit' gründet auf einer relativ schlichten pädagogischen Überlegung:
Die Lernenden machen Fehler. Die Lehrenden markieren diese. Die Schüler erkennen und korrigieren ihre Fehler und vermeiden sie so in der Zukunft.
Diese den sogenannten Korrekturzyklus konstituierende Abfolge von Arbeits- und Lernschritten lässt sich bis in die frühe Geschichte des deutschen Schulwesens zurückverfolgen, als ein schlecht bezahlter Lehrer oft mehr als 50 Kinder verschiedener Jahrgangsstufen gleichzeitig in einem Raum (mehr schlecht als recht) zu unterrichten hatte (vgl. Walz 1988).
Vor dem Hintergrund dieser Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte kann allerdings nicht von einer organisierten und professionellen Korrektur von Schülerarbeiten ausgegangen werden; Korrekturarbeit war eher ein oberflächliches und parallel zum Unterricht durchgeführtes beiläufiges 'Durchsehen' von schriftlichen Arbeitsergebnissen sowie von Strafarbeiten einzelner Schülerinnen und Schüler. Korrigiert in diesem eingeschränkten Sinne wurden vor allem die Ergebnisse grundlegender reproduktiver Übungen etwa im Zuge des
Erwerbs der Schriftsprache, wie es exemplarisch in der Autobiographie eines preußischen Volksschullehrers beschrieben wird:
Dieser lehnt die damals gängige körperliche Züchtigung der Heranwachsenden in seiner Klasse ab: „denn die Kinder strengten sich doch so ordentlich an und lernten so schön schreiben, daß es eine Lust war, die Arbeit durchzusehen!"
(zitiert nach Walz 1988, S. 171).
Historisch betrachtet zielte die Korrekturarbeit zunächst ausschließlich darauf ab, die Arbeitsergebnisse der Schüler oberflächlich zu kontrollieren und den Lernenden Fehler mit dem Ziel ihrer Korrektur und Vermeidung in der Zukunft aufzuzeigen.
Erst mit dem Aufbau eines staatlichen Schulsystems im 18. und 19. Jahrhundert, parallel zum Aufstieg des Bürgertums, erhielt die Korrektur von systematisch in den Schulbetrieb integrierten schriftlichen Leistungsüberprüfungen die heute dominierende Funktion als Instrument der Messung und vor allem Bewertung von Schülerleistungen.
Dieser Bedeutungszuwachs schulischer Bewertungsprozesse erklärt sich sozialgeschichtlich aus dem „Ersatz des Geburtsscheins" durch Leistungsnachweise der Schule (Hamann 1986, S. 156):
„Für die Schule des 18. Jahrhunderts wurde folgenreich, daß sie immer mehr zu einem Instrument des modernen Staates im Kampf politischer Gewalten und zur Erfüllung staatspolitischer Zwecke bzw. Aufgaben wurde (Schule als Politikum). Sodann fällt ihre immer stärker sich herauskristallisierende Funktion als Mittel der Modernisierung und Differenzierung der sich entfaltenden bürgerlichen Gesellschaft auf (Bildungsmerkmale als Voraussetzung sozialer Ranghöhe bzw. sozialen Aufstiegs)." (Hamann 1986, S. 80)
Die fortschreitende Instrumentalisierung schulischer Bildungsprozesse für die Zwecke der sozialen Allokation nach der Auflösung der geburtsständischen Gesellschaftsordnung prägte vor allem das Gymnasium. Diese Schulform wurde zur zentralen Drehscheibe zur Vergabe insbesondere höherwertiger sozialer Positionen: