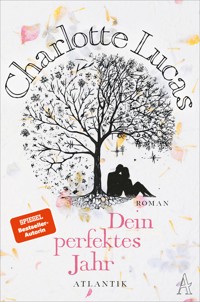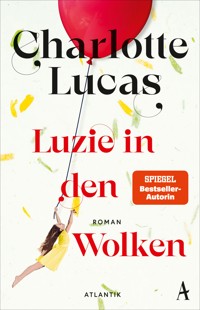
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantik
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gabriel Bach, ein ausgebrannter Bestsellerautor in der Krise, sitzt an der Elbe, als ein roter Luftballon vorbeifliegt, an dem ein Zettel befestigt ist. Darauf steht: »Liber Got, mein Papa ist bei dir im Himell - kannst du mir nicht bite einen neuen schikken? Von ganzem Hertzen, deine Luzie in den Wolken.« Als Gabriel diese Worte liest, kommt ihm zum ersten Mal seit Langem wieder eine Idee, die eine Lawine von Ereignissen in Gang setzt, die nicht nur sein eigenes, sondern auch das Leben von Luzie und ihrer Mutter Miriam völlig auf den Kopf stellen wird ... Charlotte Lucas' neuer Roman erzählt eine große Geschichte von den unerwarteten Wegen, die zur Liebe führen können – überraschend, liebenswert, unvergesslich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 649
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Charlotte Lucas
Luzie in den Wolken
Roman
Für Luzie, Eric, Rebecca und Markus
Und für Nadja. Vor allem für Nadja.
Wir alle, die wir träumen und denken, sind Hilfsbuchhalter. […] Wir führen Buch und erleiden Verluste.
Fernando Pessoa (1888–1935)
Prolog
Dienstag, 17. September, abends
Er hatte schon fast das Wasser berührt, da wurde der rote Luftballon von einer Windböe erfasst und von ihr wieder hoch in den Himmel gerissen. So taumelte er weiter Richtung Nordwesten, drehte sich um die eigene Achse und verlor dann am Elbstrand erneut an Höhe. Langsam sank er zu Boden, streifte einige der schwarzen Steine am Ufer und verfing sich wenige Meter später in einem Busch.
»Guckt mal, da ist was gelandet!« Einer der acht Jugendlichen – fünf Jungs und drei Mädchen –, die unweit der Strandperle ein kleines Lagerfeuer entfacht hatten, um bei Bier und Musik den neunzehnten Geburtstag eines der Mädchen zu feiern, sprang auf. Er lief zu dem roten Ballon, befreite ihn aus den Zweigen und kam damit zu seinen Freunden zurück.
»Guckt euch das mal an!« Er ließ sich auf der großen Picknickdecke nieder und zeigte allen die Postkarte, die mit einer Kordel gebunden an dem Luftballon hing. Die Schrift darauf war krakelig. Eines der Mädchen schnappte sich die Karte und las dann laut vor.
Liber Got, mein Papa ist bei dir im Himel – kanst du mir bitte einen neuen schikken?
Von ganzem Hertzen, deine Luzie in den Wolken
Kurz schwiegen sie alle betroffen.
»Die müssen wir zurückschicken«, sagte das Mädchen, das vorgelesen hatte. »Da steht noch, dass das ein Ballonwettbewerb ist.« Sie tippte auf den kleinen Text, der unter der Rücksendeadresse stand. »Hier, ein Spielzeugladen namens ›Mikado‹, da muss sie wieder hin.«
»Machen wir gleich morgen!«, erklärte einer der Jungs, der das Mädchen sehr gern mochte. Dann nahm er den Ballon und schob ein Stück der Kordel unter eine Ecke des Bierkastens, den sie mit an den Strand geschleppt hatten.
Sie hörten weiter Musik, tranken, quatschten und lachten – und irgendwann, von den Jugendlichen unbemerkt, rutschte die Kordel unter dem Kasten hervor, sodass der Ballon davontreiben konnte. Ein kleiner Windstoß reichte aus, um ihn weiter in Richtung Blankenese zu tragen.
Als sie zwei Stunden später das Feuer löschten, alle Flaschen und den Müll ihrer Feier aufsammelten, entdeckten sie, dass der Luftballon mitsamt Karte verschwunden war.
»Wie schade!«, rief eines der Mädchen aus. »Er ist weg.«
»Den wird jemand anderes finden«, wurde sie von einem der Jungs getröstet, der dabei einen Arm um ihre Schulter legte.
»Hoffentlich«, sagte das Mädchen.
»Ja«, stimmte ihr die Freundin zu, die vorhin den Text auf der Karte vorgelesen hatte. »Und hoffentlich findet die kleine Luzie auch einen neuen Papa.« Alle nickten zustimmend.
Dann stapften sie über die steilen und beschwerlichen Stufen, die vom Strand aus bergauf führten, hoch zur Elbchaussee, wo ihre Autos parkten. Dass die Treppe den Namen »Himmelsleiter« trug, fiel keinem von ihnen auf.
Montag, 16. September
Gabriel
An einem Montagvormittag im September wurde Gabriel Bach klar, dass er etwas verloren hatte. Es war kein Ding oder eine Sache, weder vermisste er seine Brille noch seinen Autoschlüssel oder sein Portemonnaie. Nein, das alles war es nicht. Gabriel Bach saß an seinem Schreibtisch, blickte hinaus auf die Elbe, wo sich zwei dicke Containerschiffe langsam ihren Weg stromabwärts bahnten, und bemerkte zu seinem großen Entsetzen, dass ihm etwas ganz Wesentliches fehlte: ein Grund.
Seit den frühen Morgenstunden hockte er hier vor seinem Notebook mit leerem Word-Dokument auf dem Bildschirm und hatte sich – wie bereits in den vergangenen sechs Wochen – felsenfest vorgenommen, endlich mit seinem neuen Roman zu beginnen. Aber: nichts. Da war nichts. Weder in seinem Kopf noch in seinem Herzen, nirgends ein Gedanke, ein Satz oder auch nur ein einziges Wort. Gabriel Bach war leer.
Vor einer Stunde hätte er einen wichtigen Termin bei seinem Verleger Jonathan N. Grief gehabt, um mit ihm sowie mit Lektorat, Marketing und Vertrieb über sein nächstes Projekt zu sprechen. Neun Bücher hatte Gabriel bisher bei Griefson & Books veröffentlicht, zwei unter seinem richtigen Namen, sieben unter dem Pseudonym »Henri Fjord«. Ein Name, der gleichzeitig hanseatisch anmuten und die Sehnsucht nach den endlosen Weiten Skandinaviens wecken sollte.
Der Plan ging auf, von seinem letzten Roman waren allein im deutschsprachigen Raum über 800000 Exemplare verkauft worden, noch dazu war er in vierundzwanzig Ländern erschienen. Die Presse nannte ihn mittlerweile den »deutschen Nicholas Sparks«, und wenn Gabriel Bach nicht so furchtbar traurig gewesen wäre, wäre er aus dem Lachen gar nicht mehr herausgekommen.
Sein Handy, das neben dem Computer auf dem Schreibtisch lag, klingelte, und auf dem Display stand Jonathans Name. Wenn Gabriel sich nicht verzählt hatte, war dies der elfte Anruf seines Verlegers im Verlauf der letzten Stunde, und das Gebimmel klang in seinen Ohren von Mal zu Mal schriller. Nach dem fünften Klingeln sprang die Mailbox an, auf der bereits zehn Nachrichten von Jonathan darauf warteten, von Gabriel abgehört zu werden.
Er stand auf, ließ das Telefon liegen und nahm stattdessen seine zerfledderte Ausgabe von Fernando Pessoas Das Buch der Unruhe aus der obersten Schreibtischschublade. Schon seit Jahren trug er es immer bei sich. Weil die fiktiven Aufzeichnungen des Hilfsbuchhalters Bernardo Soares, die der portugiesische Autor sich erdacht hatte, entgegen dem Titel das Einzige waren, was Gabriel angesichts der emotionalen Abwärtsspirale, in der er sich mit fortschreitendem Alter immer häufiger und heftiger verfing, wenigstens ein bisschen zur Ruhe brachte. Und heute – heute hatte er diesen Trost nötiger als jemals zuvor, denn gefühlt hatte er die Talsohle nicht nur erreicht, sondern endgültig durchschlagen.
Mit dem Buch unterm Arm stieg er die knarzende Holztreppe hinunter und stolperte am untersten Absatz fast über Tavor, der ein unwilliges Knurren von sich gab, sich aber nicht vom Fleck rührte. Gabriels in die Jahre gekommener schwarzer Flat Coated Retriever suchte sich mit treffsicherem Instinkt stets solche Plätze für seine ausgedehnten Nickerchen aus, an denen die größte Wahrscheinlichkeit bestand, sein Herrchen zu Fall zu bringen. Gabriel zischte ihm ein mahnendes »Benzo« zu, woraufhin er zumindest kurz mit den Ohren zuckte.
Als Sprössling eines B-Wurfs war Benzo sein offizieller Name, genauer gesagt sogar Benzodiazepin, was der Züchter, dem Gabriel den Hund vor zwölf Jahren abgekauft hatte, weder verstanden noch lustig gefunden hatte; vermutlich weil er in Sachen Betäubungsmittelgesetz nicht ganz firm war und im Gegensatz zu Gabriel noch nie in ein derart lautes Tosen des Lebensmeers geraten war, dass es sich nur noch mit starken Beruhigungsmitteln in Schach halten ließ.
Gabriel jedenfalls war der Name schon damals überaus passend erschienen, denn bereits als Welpe hatte Benzo im Vergleich zu seinen Geschwistern eine derartige Trägheit an den Tag gelegt, dass man schon von Sedierung sprechen konnte. Mit den Jahren war es naturgemäß nicht besser geworden, irgendwas in Benzos System schien keine Ahnung davon zu haben, dass er ein Hund war, der von Natur aus gern stundenlang draußen herumtollen wollte. Und deshalb eben Benzo – oder in der Koseform Tavor.
Dass Benzo noch dazu schwarz war, hatte für Gabriel zunächst keine größere Bedeutung gehabt. Aber mittlerweile wusste er nur zu genau, was Winston Churchill mit seinem »schwarzen Hund«, dem dunklen Kumpan gemeint hatte.
»Los, alter Junge!« Er beugte sich hinunter und kraulte seinem Hund den flauschigen Nacken, woraufhin Tavor sich sehr, sehr langsam erhob und seinem Herrchen zur Haustür nachtrottete. Gabriel nahm die graue Windjacke vom Garderobenhaken und zog sie über, dann schlüpfte er in seine ausgelatschten Sneakers, ohne sich die Mühe zu machen, die Schnürsenkel zu öffnen. Anschließend betrachtete er sich im Spiegel über dem kleinen Vintage-Tischchen, das ihm als Ablage für Schlüssel, Portemonnaie und Post diente.
Ein müdes Gesicht blickte ihm entgegen. Ein müdes, fahles Gesicht mit graublondem Dreitagebart und blassblauen geröteten Augen. Die vielen Sommersprossen, die sich über Stirn, Nase und Wangen zogen, waren nur noch traurige Erinnerungen an Zeiten, in denen es mal die eine oder andere Frau in seinem Leben gegeben hatte, die ihm zärtlich mit einer Hand darübergestreichelt und sie als »niedlich« bezeichnet hatte. Gabriels ebenfalls graublonde Haare hätten bereits seit längerem sowohl einen Schnitt als auch eine Wäsche vertragen können. Kurzerhand griff er in seiner Jackentasche nach der schwarzen Wollmütze mit dem St.-Pauli-Totenkopf und setzte sie sich auf.
Berufsjugendlich. So hatte ihn einmal eine frühere Freundin oder Affäre, oder wie auch immer man es bezeichnen wollte, genannt. Irgendwann kurz nach seinem achtunddreißigsten Geburtstag und seinem ersten Bestseller. Da hatte sie im Hinblick auf seine ausgebeulten Jeans, seine Turnschuhe und die Longsleeves mit den farblich abgesetzten Ärmeln darauf hingewiesen, dass es für einen Mann, »der bald in die besten Jahre kam«, und »in seiner Position« vielleicht angemessen wäre, sich etwas seriöser zu kleiden.
Damals hatte Gabriel laut gelacht und erwidert, er als Kreativer könne herumlaufen, wie er wolle, er sei schließlich weder im Aufsichtsrat einer Bank noch in irgendeiner anderen Branche tätig, die das Tragen von Anzug, Schlips und rahmengenähten Budapestern vorschrieb.
Gerade in diesem Augenblick wünschte er sich allerdings nichts sehnlicher als genau so einen Posten. Einen Job, den er einfach würde verrichten können, Monat für Monat, Woche für Woche und Tag für Tag. Irgendetwas, das ihn genug auslastete, um nicht über sich selbst nachdenken zu müssen, für das es aber nicht notwendig war, sein Herz daran zu hängen. Ein Herz, in dem ein großes, düsteres und alles verschlingendes Loch klaffte.
Noch einmal hörte er das Handy klingeln, das er oben in seinem Büro zurückgelassen hatte. Er warf einen letzten Blick in den Spiegel, zog sich die Mütze etwas tiefer ins Gesicht und verließ zusammen mit Tavor sein Haus, ohne die Tür abzuschließen. Es war ihm egal, ob jemand etwas stahl. Er hatte sowieso nichts mehr zu verlieren, weltliche Besitztümer waren ihm gleichgültig geworden.
Draußen wurde er umgehend von einer Böe erfasst, die ihm den Sand des Elbstrands in die Augen trieb. Schützend hielt er sich eine Hand vors Gesicht und stapfte hinunter zu einer der Bänke am Ufer. Er nahm Platz und legte sein Buch neben sich auf das verwitterte Holz, während Tavor sich kraftlos in den Sand plumpsen ließ, um sein Nickerchen fortzusetzen. Gedankenverloren betrachtete Gabriel das rot-weiße Unterfeuer, das vor ihm wie ein Mahnmal aus den Fluten der Elbe ragte.
Wenn er nachts aus dem Fenster schaute, konnte er diesen Leuchtturm sehen, und in den vielen schlaflosen Nächten, in denen er wie ein Gefangener durch sein kleines Kapitänshaus am Blankeneser Strandweg geirrt war, hatte er ihn wieder und wieder stumm angefleht, ihm den richtigen Weg zu weisen, weil er selbst schon längst seinen Kurs verloren hatte. Der meterhohe Turm hatte beharrlich geschwiegen, natürlich hatte er das, und dabei lediglich mit einem grellen Lichtstrahl ziellos in die Ferne geblinkt.
Gabriel beugte sich vor, stützte sich mit den Ellbogen auf den Knien ab und verbarg das Gesicht in beiden Händen. So verharrte er eine Minute oder auch eine Stunde lang, im Wind sitzend auf dieser Bank, und kämpfte gegen den nahezu übermächtigen Drang an, aufzustehen und den Kopf gegen einen der graphitschwarzen Steine zu schlagen, die entlang des Wassers zu einem Schutzwall aufgeschichtet worden waren.
Das laute Tuten eines Schiffshorns ließ ihn wieder aufblicken, ein Hochhaus von Kreuzfahrtdampfer pflügte Richtung Mündung durch die Wellen, an Deck Heerscharen von winkenden Passagieren, die zu den Klängen monumentaler Auslaufmusik ihre Reise von Hamburg nach sonst wohin antraten. Da müsste man mitfahren, schoss es Gabriel durch den Kopf. Nicht weil ihn die Fahrt mit einem Luxusliner auch nur ansatzweise reizte. Nein, da hielt er es ganz mit seinem US-Kollegen David Foster Wallace, der vor Jahren seine Kreuzfahrterfahrung in einem herrlichen Buch mit dem Titel Schrecklich amüsant – aber in Zukunft ohne mich zu Papier gebracht hatte und dessen Beschreibungen den Rückschluss zuließen, das sei nur etwas für Masochisten.
Was Gabriel allerdings an der Vorstellung, selbst auf einem solchen Ozeanriesen einzuchecken, ungemein reizte, war der Gedanke, dass nur ein kleiner Sprung über die Reling vonnöten wäre, um ihn für alle Zeiten von sämtlichen Qualen zu erlösen. Aber das würde er, wenn er ehrlich zu sich war, nicht fertigbringen. Auch das unterschied ihn von David Foster Wallace.
Eine Weile sah er dem Schiff noch nach, beobachtete, wie es mit stampfenden Motoren auf den Horizont zusteuerte. Aus den Augenwinkeln bemerkte er etwas Grünes, das der Wind über den Strand flattern ließ. Eilig sprang er auf und erwischte gerade noch einen Zipfel der leeren Chipstüte, die eine Sekunde später auf der Elbe davongetrieben wäre. Er ging ein paar Meter zu dem roten Abfallbehälter mit dem sinnigen Aufdruck »Hast du auch Dreck am Stecken?«, stopfte die Plastikverpackung hinein und erfreute sich etwa 0,02 Sekunden lang an dem heroischen Gefühl, die Welt ein kleines bisschen besser gemacht zu haben.
Dann ließ er die Schultern wieder hängen, ging zurück zu Hund und Bank, setzte sich und griff nach seinem Buch. Er schlug es dort auf, wo die Seiten zufällig auseinanderfielen, und begann zu lesen. In der Hoffnung, seinem wunden Herzen damit ein wenig Linderung zu verschaffen.
»Hier steckst du also!«
Montag, 16. September
Miriam
Mein geliebter Schatz,
gestern hast du mich zum glücklichsten Menschen der Welt gemacht: Du hast unserer kleinen Luzie das Leben geschenkt! Luzie, unser ganz persönlicher Schrecken der Straße, ich bin schon sooooo neugierig, wie dieses kleine Menschlein mal wird. Kommt sie nach mir? Chaotisch, launisch und immer etwas verpeilt? Oder nach dir? Wunderbar, grandios und überirdisch schön! 💕
Ich bin wirklich ein absoluter Hornochse, dass ich jetzt gerade im Zug sitzen und zu einem Job fahren muss, statt bei euch zu sein (allerdings konnte ja niemand ahnen, dass unsere Maus es so eilig hat und sich ganze sechs Wochen früher auf den Weg macht, um ihre großartige Mama kennenzulernen). Heute Nacht bin ich zurück und kann es kaum erwarten, meine kleine Familie wieder in die Arme zu schließen!
Mein Herz, während der Kerl hinter mir schrecklich laut und wichtig in sein Handy brüllt, möchte ich dir schreiben, dass ich dich aus vollem Herzen liebe. Dich und unsere kleine »Lucy in the Sky«, die uns der Himmel geschenkt hat. Ich liebe, liebe, liebe euch, das wird sich niemals ändern, und ich …
Miriam Petersen lehnte sich in ihrem Stuhl zurück und massierte sich mit beiden Händen den schmerzenden Nacken. Sie hatte gehofft, das Lesen in den Mails, die Patrick ihr früher geschrieben hatte, könnte ihre unendliche Traurigkeit heute ein wenig lindern. Aber leider war das Gegenteil der Fall: Während sie den Blick über die soeben gelesenen Zeilen wandern ließ, fühlte es sich an, als würde sie innerlich zerbrechen.
Heute Morgen, bevor sie in ihren Laden gefahren war, hatte Miriam an Patricks Grab auf dem Friedhof Diebsteich gestanden. Immer noch fassungslos über seinen Tod, immer noch nicht begreifend, dass ihr Freund einfach nicht mehr da war. Seit fast drei Jahren schon nicht mehr, seit er mit über hundertachtzig Stundenkilometern auf der Autobahn zwischen Hannover und Hamburg gegen einen Brückenpfeiler gekracht war. Patrick war auf der Stelle tot gewesen. Der kleinste Trost für Miriam, immerhin hatte er nicht leiden müssen.
Aber ihr restliches Leben, das musste Miriam nun ohne ihn verbringen. Musste ohne ihn alt werden. Musste es allein und ohne ihn schaffen, musste weiter funktionieren, egal, was war und was noch kommen würde. Schon für Luzie musste sie das. Oft war sie der einzige Grund, der Miriam überhaupt noch aufrecht hielt, der sie jeden Tag weitermachen ließ, und wenn es auch noch so schwer war. Würde es ihre Tochter nicht geben, Miriam hätte nicht mit Sicherheit sagen können, ob sie selbst überhaupt noch da wäre oder ob sie Patrick nicht aus Verzweiflung gefolgt wäre.
Pathetische Gedanken, das wusste sie. Doch heute früh, an Patricks Grab stehend, da hatte sie sich dieses Pathos erlaubt. Hatte dort gestanden, hatte geweint und gleichzeitig versucht, ihm in möglichst fröhlichem Tonfall von Luzies Geburtstag zu berichten, den sie gestern mit ihren drei Freundinnen Alissa, Nika und Luna gefeiert hatte. Endlich sieben, endlich nicht mehr die Einzige in ihrer Klasse, die noch sechs war!
Allerdings auch das erste Mal, dass Luzie morgens nicht mit zum Friedhof hatte kommen wollen, weshalb Miriam erst heute früh und ohne ihre Tochter zu Patrick gefahren war. Kurz war sie über Luzies Weigerung schockiert gewesen, aber Alissas Mutter Rebecca – Becka –, die gleichzeitig Miriams beste Freundin und Luzies Patentante war, hatte sie beruhigt, während sie gemeinsam das Wohnzimmer für die kleine Feier mit Girlanden geschmückt hatten.
»Sie ist eben kein Kleinkind mehr, sondern bald ein großes Mädchen, das so sein will wie alle anderen auch und nicht immer nur ›die ohne Papa‹«, hatte ihre Freundin erklärt.
»Ja, kann sein«, hatte Miriam erwidert – und dabei einen dicken Kloß im Hals verspürt, weil Beckas Bemerkung ihr sofort eine Erinnerung ins Gedächtnis gerufen hatte: Erst vor wenigen Wochen war Luzie nach dem Unterricht weinend zu ihr in den Laden gerannt gekommen, hatte ihre kleinen Arme um den Hals ihrer Mutter geschlungen und sich ganz fest an sie gedrückt. Fast zwanzig Minuten hatte Miriam gebraucht, um ihre Tochter so weit zu beruhigen, dass sie ihr hatte erzählen können, was passiert war; ob sie sich in der Klasse mit jemandem gestritten oder ob sie sich beim Spielen auf dem Schulhof wehgetan hatte.
Und, ja, Luzie war verletzt worden. Allerdings nicht körperlich. Unter Tränen und nur stockend hatte sie ihrer Mutter erklärt, dass jedes Kind bis zur nächsten Woche als Hausaufgabe auf einer großen Pappe eine Collage zusammenkleben musste. Mit dem Titel »Meine Familie und ich« sollten die Kinder ihren Stammbaum erstellen. Mit Fotos von sich, ihren Eltern, Geschwistern, Großeltern, Onkeln, Tanten und wer sonst noch alles zur Familie gehörte.
»Und ich bin die Einzige in der Klasse, die keinen Papa hat!«, hatte ihre Tochter derart verzweifelt geschluchzt, dass Miriam am liebsten sofort ihr Handy gegriffen und Luzies Lehrer Herrn Dr. Krüger angerufen hätte. Um ihn zu fragen, ob er eigentlich noch ganz dicht sei, Aufgaben zu verteilen, die Kinder verletzten oder gar demütigten. Gut, in diesem speziellen Fall offenbar nur das eine, nämlich IHRE Luzie.
Miriam hatte sich zusammenreißen müssen, um sich ihren innerlichen Furor Luzie gegenüber nicht anmerken zu lassen. Und ein Anruf bei Dr. Krüger hätte rein gar nichts gebracht. Denn an Luzies Grundschule in Eppendorf – Patrick hatte die Gegend oft als »bourgeoise Blase« bezeichnet, die mit der wirklichen Welt »da draußen« kaum Überschneidungen hatte – war die vermeintlich heile Hetero-Ehe genauso der Standard wie der SUV und Mini-Cooper auf der hauseigenen Einfahrt vor der Stadthaus-villa.
Na gut, das war vielleicht auch ein wenig übertrieben. Nicht alle von Luzies Klassenkameraden wurden morgens vom Chauffeur zur Schule gebracht und mittags wieder abgeholt, die meisten waren genau genommen »Normalos« wie sie und Becka (ihre Freundin war von Tim, dem Vater ihrer zwei Kinder Alissa und Eric, sogar geschieden – shocking!). Aber trotzdem hatte Luzies Traurigkeit Miriam derart aus der Fassung gebracht, dass sie darüber beinahe ihre Beherrschung verloren und den Klassenlehrer zur Rede gestellt hätte.
Stattdessen aber hatte sie ihre weinende Tochter weiter fest im Arm gehalten. Hatte sie getröstet, ihr über den Kopf gestreichelt und gesagt: »Du hast einen Papa! Er ist nur nicht mehr hier unten bei uns, sondern irgendwo da oben in den Wolken. Und von dort aus passt er jeden Tag auf dich auf.«
»Dann kann ich also ein Foto von Papa auf meine Pappe kleben?«, hatte Luzie, immer noch schluchzend, wissen wollen.
»Aber natürlich kannst du das! Das musst du sogar!«
»Okay.« Luzie hatte noch einmal kurz geschnieft und sich mit dem Ärmel ihres Sweatshirts den Rotz von der Nase gewischt – und dann hatte sie ihre Mutter angelächelt, als wäre rein gar nichts passiert.
»Miri?« Beckas Stimme hatte sie aus ihrer Erinnerung zurückgeholt. »Alles okay bei dir?«
»Äh, ja«, hatte sie gestottert. »Warum?«
»Du hast jetzt zwei Minuten lang nichts gesagt und ins Leere gestarrt.«
»Oh«, sie hatte sich geräuspert, »ich musste gerade nur an diese blöde Sache mit dem Familienstammbaum denken. Weißt du, als Luzie so geweint hat.«
»Tut mir leid!«, hatte ihre Freundin erschrocken ausgerufen. »Das wollte ich nicht!«
»Ist ja nicht deine Schuld«, hatte Miriam sie beruhigt und sich an einem schiefen Lächeln versucht. »Du bist ja nicht der Idiot, der den Kindern die Aufgabe gegeben hat.«
»Das war aber auch wirklich total daneben!« Becka hatte dabei energisch den Kopf geschüttelt. »So was von lebensfremd! Alissa hat ja kaum alle Fotos der Menschen, die sie als ihre Familie betrachtet, auf diese blöde Pappe geklebt bekommen!« Vor vier Jahren, ein paar Monate nachdem Rebecca und ihr Mann bewundernswert harmonisch auseinandergegangen waren, hatte Tim eine neue Frau kennengelernt. Katrin hatte ebenfalls zwei Kinder aus erster Ehe, Käthe und Liesbeth, die fast im gleichen Alter wie Alissa und Eric waren.
Da Becka und Tim sich für das sogenannte Wechselmodell entschieden hatten, bei dem die Kinder in der einen Woche bei ihrer Mama, in der anderen bei ihrem Papa lebten, betrachteten sich alle vier Kinder als Geschwister. Schließlich wuchsen sie miteinander auf, also hatten auch Katrin, Käthe und Liesbeth auf Alissas Collage ihren Platz gefunden. Und Katrins Eltern, Alissas »Bonus«-Oma und -Opa. »Ich meine«, hatte Becka lachend gesagt, »Katrins Exmann hat mittlerweile auch wieder eine neue Partnerin, die sogar drei Kids hat. Und deren Ex vielleicht auch und dessen Ex ebenfalls und …« Sie hatte die Augen verdreht. »Wenn man das mal weiterspinnt – so große Pappen gibt’s ja gar nicht!«
Miriam hatte gelacht. Oder es wenigstens versucht. Denn während Rebeccas Leben tatsächlich fast ein bisschen überbevölkert war, gab es bei ihr nur Luzie und sie. Ihre Eltern und die von Patrick lebten zwar noch, aber Miriams in Cuxhaven, und Patricks hatten sich vor Jahren einen lang gehegten Traum erfüllt und waren nach Spanien ausgewandert. »Tja«, hatte sie sich an einem leichten Tonfall versucht, »so ist es halt, getrennte Eltern sind ja mittlerweile eher der Standard, vor allem in Großstädten.«
»Offensichtlich nicht, wenn es nach Herrn Dr. Krüger geht.«
»Nö«, hatte sie ihrer besten Freundin zugestimmt. »Und verwitwet – davon hat der noch nie was gehört!«
»Eine Unverschämtheit aber auch von dir und Patrick, wie konntet ihr nur?« Nun musste Becka lachen.
Sofort waren Miriam die Tränen in die Augen geschossen, und sie hatte versucht, sie mit einem vorgetäuschten Niesen vor Rebecca zu verbergen. Aber es war ihr nicht gelungen.
»Tut mir leid, Süße!«, hatte Becka sich zum zweiten Mal innerhalb weniger Minuten entschuldigt. »Das war jetzt mehr als unsensibel und daneben von mir.«
»Kein Problem!«, hatte Miriam ihre Freundin beruhigt. »Ich weiß ja, wie du es meinst.«
Und das wusste sie auch. Wenn es einen Menschen gab, der immer liebenswürdig, geduldig und großzügig war, dann war es Becka. Und sie hatte ein riesiges Herz für Kinder, manchmal benahm sie sich fast selbst wie eins: Für Luzies Ehrentag hatte sie eigens – und vermutlich in stundenlanger Arbeit – eine dreistöckige Geburtstagstorte kreiert und mit kleinen Meer-JUNGFRAUEN aus Marzipan dekoriert.
Das Wort hatte Becka beim Überreichen des Kuchens genau so ausgesprochen. Mit Betonung auf »Jungfrau«, weil das Luzies Sternzeichen war und Rebecca als Hobbyastrologin unerschütterlich an die Kraft der Sterne im Allgemeinen und die des Mondes im Besonderen glaubte. Die Tatsache, dass Luzie vor sieben Jahren nicht wie geplant um den 1. November herum, sondern wesentlich früher geboren worden war, hatte Becka gefeiert wie ein Rudel betrunkener Fußballfans den Sieg der deutschen Nationalmannschaft. Weil dem »armen Kind« damit das »Schicksal eines Lebens als Skorpion, geradezu ein Joch!«, erspart geblieben war.
Becka hatte damals nicht ahnen können, wie unbarmherzig das Schicksal stattdessen vier Jahre später zuschlagen würde. Da hatten auch die Sterne und der Mond nicht mehr helfen können, nicht einmal das gesamte Universum.
»Lucy in the sky with diamonds«, summte Miriam leise vor sich hin, während sie nun am Computer den Ordner mit ihren privaten Fotos öffnete und ihren Blick über die Bilder wandern ließ, die Beckas Exmann Tim, ebenso wie Patrick Fotograf, wenige Tage nach Luzies Geburt von ihnen geschossen hatte.
Sie alle drei – Luzie, Patrick und Miriam –, eine vor Glück strahlende kleine Familie, auf der Hollywoodschaukel in ihrem früheren Garten, in das warme und weiche Licht eines Spätsommertags getaucht. Dann ein Foto von Patrick und Luzie, Nase an Nase auf dem Bett liegend, ihre Tochter einen Arm in die Luft gestreckt und mit geballtem Fäustchen, als würde sie dem Himmel damit zeigen wollen, wie viel Kraft und Leben in ihr steckten.
»Lucy in the sky with diamonds …« Fast jeden Abend hatten Patrick oder Miriam ihrer Tochter diesen alten Beatles-Hit vorgesungen und ihr erklärt, dass das ein Lied über sie war. Über das kleine Mädchen, das ihnen quasi wie aus den Wolken in den Schoß gefallen war.
Keine drei Jahre alt war Luzie gewesen, als sie ihren Vater beim Schlaflied mit empörter Miene unterbrochen und zum ersten Mal korrigiert hatte. »Luzie!«, hatte sie krakeelt. »Luzie, nicht Lusssie!« Das tat sie bis heute, verbesserte jeden, der es wagte, ihren Namen falsch auszusprechen. Lächelnd erinnerte Miriam sich daran, wie Patrick damals entschuldigend beide Hände gehoben hatte. »Okay, okay, meine kleine Luuuttzie in den Wolken!« Und dann hatte er für den Refrain einfach einen neuen Text erfunden, um ihn seiner Tochter vorm Schlafengehen vorzusingen: »Luzie in den Wolken, mit Sternen …«
Dass die Übersetzung des Titels nicht ganz korrekt war (und der Song angeblich eine Hymne auf die Droge LSD), hatten sie beide Luzie gegenüber für sich behalten – allerdings hatte Miriam das Lied seit Patricks Tod kein einziges Mal mehr für ihre Tochter singen können.
Picture yourself in a boat on a river
With tangerine trees and marmalade skies
Somebody calls you, you answer quite slowly
A girl with kaleidoscope eyes
Leise und zaghaft stimmte Miriam die erste Strophe an, doch ihre Stimme brach bereits mit Ende der vierten Zeile heiser ab, und sie spürte, wie ihr eine Träne über die Wange kullerte. Es war nicht nur die abgrundtiefe Traurigkeit, die sie stimmlos gemacht hatte. Viel schlimmer war die Wut. Die Wut über das, was geschehen war. Und die Frage nach dem Warum. Diesem Warum, auf das sie wohl niemals eine Antwort finden würde. Warum? Warum war Patrick …?
Die Türglocke ertönte. Eilig klappte Miriam ihr Notebook auf dem Ladentresen zu, wischte sich einmal hektisch übers Gesicht und räusperte sich zweimal, ehe sie den Kopf hob und lächelnd hinüber zum Eingang sah.
Montag, 16. September
Gabriel
Er zuckte zusammen, als Jonathan Grief sich neben ihm auf die Bank fallen ließ, so schwungvoll, dass die morschen Holzlatten knackten.
»Ich versuche seit zwei Stunden, dich zu erreichen«, teilte ihm sein Verleger mit und musterte ihn verärgert aus seinen Armin-Mueller-Stahl-blauen Augen. »Ich dachte schon, es wäre etwas passiert! Wir hatten um 14 Uhr einen Termin.«
»Ich weiß«, entgegnete Gabriel, klappte das Buch zu und legte es auf seinen Schoß. »Es ging nicht.«
»Was ging nicht?«
»Der Termin ging nicht, meine ich. Ich konnte nicht kommen.«
»Bist du krank?« Jonathans Miene schlug ins Sorgenvolle um. »Warum hast du nicht angerufen?«
»Das konnte ich auch nicht.«
»Du konntest nicht anrufen?«
»Nein.«
Nun wirkte sein Verleger irritiert. »Was ist denn los mit dir?«
»Nichts. Nichts ist los mit mir.« Gabriel seufzte und kickte mit der rechten Schuhspitze ein paar kleine Steinchen fort. »Das ist es ja gerade.«
»Gabriel«, Jonathan rückte ein Stück näher und legte ihm eine Hand auf die Schulter, was ihn zusammenfahren ließ. »Erzähl mir einfach, was dich bedrückt. Ich bin doch nicht nur dein Verleger, sondern auch dein Freund.«
Einen Moment lang zögerte Gabriel, senkte den Blick auf das Buch und dachte darüber nach, mit welchen Worten er Jonathan erklären könnte, was in seinem Inneren vor sich ging. Tatsächlich war Jonathan Grief sein Freund oder wenigstens so etwas in der Art.
Auf alle Fälle war er jemand, der immer an ihn geglaubt hatte. Jahrelang und unerschütterlich, auch am Anfang, als seine ersten beiden Romane alles andere als Kassenschlager gewesen waren. Mehr noch, gemeinsam mit seinem Geschäftsführer Leopold und dem Lektorat hatte er Gabriel geholfen, sich künstlerisch neu auszurichten und seine erzählerische Kraft so zu entfalten, dass er sich schließlich vom Nischenschriftsteller zum Publikumsliebling entwickelt hatte, der heute ein sorgenfreies Leben voller materieller Annehmlichkeiten führen konnte. Und der seine literarischen Ambitionen dabei dennoch nicht hatte verraten müssen.
Oder wenigstens nicht komplett. Der Vergleich mit Nicholas Sparks war schließlich nicht auf seinem Mist gewachsen. Ebenso wenig wie der Name Henri Fjord, unter dem er seit dieser Neuausrichtung veröffentlichte. Sein klangvolles Pseudonym war die Idee einer neunzehnjährigen Verlagspraktikantin gewesen. Gabriel verdankte Griefson & Books und Jonathan eine Menge – und umso schwerer fiel es ihm, seinen Verleger nun enttäuschen und ihm mitteilen zu müssen, dass er keinen weiteren Roman mehr schreiben würde. Weil er es schlicht nicht konnte.
»Hat es dir die Sprache verschlagen?«, wollte Jonathan wissen.
»Hier«, entgegnete Gabriel, nahm das Buch von seinem Schoß, schlug es auf, hielt es seinem Verleger unter die Nase und deutete auf eine Stelle. »Lies das. Dann weißt du, wie es mir geht.«
»Gabriel, ich …«
»Mach es bitte einfach. Treffender kann ich selbst es nicht formulieren.«
»Okay.« Jonathan griff nach dem Buch und fing dann an, laut vorzulesen. »Ich lebe immer in der Gegenwart. Die Zukunft kenne ich nicht. Die Vergangenheit gehört mir nicht mehr. Die eine lastet auf mir wie die Möglichkeit zu allem, die andere wie die Wirklichkeit von nichts. Ich habe weder Hoffnungen noch Sehnsüchte.« Er sah fragend auf. »Was soll ich damit anfangen?«
»Lies weiter!«, forderte Gabriel ihn auf.
»Ich weiß wirklich nicht …«
»Bitte!«
Kopfschüttelnd wandte Jonathan sich wieder der Textstelle zu. »Da ich weiß, was mein Leben bis heute war – so viele Male und in so vielem das Gegenteil dessen, was ich mir gewünscht hatte –, was kann ich da mutmaßen über mein morgiges Leben? Einzig, dass es sein wird, was ich nicht vermute, was ich nicht will und was mir von außen zustößt, bisweilen selbst durch mein eigenes Zutun. Da ist nichts in meiner Vergangenheit, an das ich mich erinnerte und mir vergeblich wünschte, es gäbe dafür eine Wiederholung. Ich war immer nur eine Spur, ein Trugbild meiner selbst. Meine Vergangenheit ist all das, was ich nicht zu sein vermochte.«
»Bis dahin«, unterbrach Gabriel seinen Verleger, der daraufhin das Buch sinken ließ. »Verstehst du jetzt?«
»Ja.« Jonathan nickte langsam. »Ich verstehe, dass du offenbar in einer ziemlichen Krise steckst.«
»Es ist weit mehr als eine Krise. Ich bin Bernardo Soares.«
Sein Verleger schüttelte den Kopf. »Bist du nicht. Das ist eine Kunstfigur von Fernando Pessoa, die es nie gegeben hat.«
»Dann fühle ich mich eben nur so wie er.«
»Schlimm genug«, entgegnete Jonathan und runzelte die Stirn. »Vielleicht hast du eine leichte Depression. Was kein Wunder ist, wenn du«, er gab ihm seine Lektüre zurück, »so was hier liest.«
»Falsch«, widersprach Gabriel. »Ich bin nicht depressiv, weil ich das lese. Ich lese das, weil ich depressiv bin.«
»Wie auch immer, das ist die berühmte Frage nach der Henne und dem Ei.« Jonathan seufzte und sah ihn nachdenklich an. »Wie kann ich dir denn helfen?«
»Gar nicht.«
»Das glaube ich nicht.«
»Ich glaube es für dich mit.«
»Gabriel!« Erneut legte er ihm eine Hand auf die Schulter und lächelte aufmunternd. »Sieh dich doch an! Du stehst mitten im Leben und hast alles, was ein Mensch sich nur wünschen kann. Deine Leser lieben dich, du badest regelrecht in Bewunderung und Anerkennung.« Er stand auf und fing an, vor der Bank auf und ab zu gehen. Aufgrund seiner imposanten Größe von über einem Meter neunzig musste Gabriel den Kopf nun in den Nacken legen, um ihn direkt ansehen zu können. »Dein Haus da drüben«, dozierte er weiter und deutete auf die kleine Backsteinvilla, »weißt du noch, wie du immer zu mir gesagt hast, du würdest davon träumen, irgendwann auch an der Elbe zu wohnen?«
»Ja, ich erinnere mich.«
»Na, siehst du!« Triumphierend riss Jonathan beide Arme in die Höhe und ließ sie dann wieder fallen, wobei seine Hände links und rechts gegen seine Oberschenkel klatschten.
»Ich sehe, dass es darum im Leben nicht geht«, erwiderte Gabriel.
»Worum geht es nicht?« Erneut setzte Jonathan sich neben ihn und musterte ihn abwartend.
»Darum eben. Um meinen Erfolg oder mein Haus oder meinen SUV oder mein Segelboot in Dänemark. Das ist alles absolut unwichtig und spielt überhaupt keine Rolle.«
»Seit wann das denn?«
»Schon immer. Ich habe es nur lange Zeit nicht begriffen, aber mittlerweile wird es mir immer klarer.« Er lachte bitter auf. »Ich meine, das ist doch alles Schwachsinn! Mein Boot kann ich ohne Skipper nicht mal segeln, weil ich keinen Schein habe. Seit zwei Jahren dümpelt es unbenutzt auf seinem Liegeplatz in Sonderborg herum oder steht im Winterlager – warum habe ich mir dieses blöde Ding eigentlich gekauft? Weil ich dachte, dass so was dazugehört, wenn man erfolgreich ist? Hat das auch nur das Geringste mit Glück zu tun?«
»Sollen wir dir einen Segelschein finanzieren?«, schlug Jonathan vor. »Das ist kein Problem!«
»Nein!«, fuhr er ihn an. »Verstehst du nicht, was ich meine? Das sind alles nur rein materielle Dinge. Aber darum geht’s doch nicht!«
»Gabriel«, Jonathans Tonfall wurde leicht mahnend, »natürlich stimme ich dir zu, dass die wirklich wichtigen Dinge andere sind. Ich meine, da muss ich ja nur bei mir selbst anfangen!« Er ließ ein fröhliches Lachen erklingen. »Bevor ich Hannah getroffen habe, war ich das Paradebeispiel eines orientierungslosen Mannes.«
»Im Gegensatz zu dir habe ich keine Hannah.«
»Aber das ist doch nun wirklich kein Problem!«, stellte er fest. »Du kannst dich schließlich nicht über mangelnde Angebote beklagen. Wenn ich allein daran denke, wie die Damen bei deinen Lesungen an deinen Lippen hängen, das ist ja schon nicht mehr normal!«
»Du übertreibst.« Gegen seinen Willen und seine derzeitige Seelenlage fühlte Gabriel sich kurz geschmeichelt.
»Tue ich nicht!« Nun bekam Jonathans Tonfall etwas Eifriges. »Was ist denn zum Beispiel mit dieser Natascha, die mit dir bei unserem Empfang auf der Leipziger Buchmesse war? Die war doch äußerst attraktiv und wirkte auch sonst sehr sympathisch, triffst du die nicht mehr?«
»Nadine«, korrigierte er ihn. »Und, nein, ich treffe sie nicht mehr, es war auch nichts Ernstes.«
»Du könntest ja aber …«
»Jonathan«, unterbrach er ihn. »Es ist schön, dass du mit deiner Frau so glücklich bist. Aber du kannst mir glauben: Mir steht der Sinn absolut nicht nach einer Beziehung. Ich halte es ja mit mir selbst fast nicht aus, da kann ich mich kaum einem anderen Menschen zumuten.«
»Das ist doch Unsinn! Wer hat dir denn die Idee in den Kopf gepflanzt?«
Gabriel zuckte mit den Schultern. »Wohl ich selbst. Aber ich habe nun mal nur eine einzige Wirklichkeit, und das ist die, die sich in meinem Kopf abspielt.«
»Dann lass mich dir sagen, dass das nicht die Wirklichkeit ist, sondern nur dunkle Hirngespinste.« Jonathan nickte, als wolle er seinen Worten damit Nachdruck verleihen. »Morgen wird schon alles wieder ganz anders aussehen.«
»Was kann ich schon mutmaßen über mein morgiges Leben?«, zitierte Gabriel erneut seinen Lieblingsschriftsteller.
»Jetzt lass doch bitte mal diesen blöden Portugiesen beiseite!«
»Aber er hat recht!«, begehrte Gabriel auf. »Jeder von uns hofft auf das Morgen. Nur um am nächsten Tag festzustellen, dass das Gestern, das Vergangene, wieder nicht unsere Erwartungen erfüllt hat.«
»Dein Pessimismus ist ja nicht auszuhalten.«
»Hab ich doch gesagt. Ich bin nicht auszuhalten.«
»Nicht du als Person«, korrigierte Jonathan ihn und versetzte ihm mit dem Ellbogen einen sanften Rempler in die Seite. »Nur deine derzeitige Sicht auf die Dinge.« Er machte eine kurze Pause. »Lass mich dir da doch bitte raushelfen!«
»Jonathan, es ist sehr aufmerksam von dir, dass du extra hergekommen bist, um mich zu suchen. Und ich weiß es auch sehr zu schätzen, dass du mich aufmuntern willst. Aber glaub mir, es hat keinen Sinn.« Er senkte den Blick, betrachtete erneut seine Schuhspitzen und fügte mit leiser Stimme hinzu: »Gar nichts hat noch Sinn.«
Sein Verleger schwieg einen Moment, ehe er, ebenfalls leise, etwas entgegnete. »Du stellst dir also die große Frage nach dem Sinn, ist es das?«
Gabriel nickte. »Und die Abwesenheit einer Antwort macht mich verrückt. Die Antwort darauf, was das alles soll. Wozu existieren wir? Warum tun wir das, was wir tun? Wozu kämpfen wir uns Tag für Tag durch ein Leben, das letztlich für jeden von uns sowieso unausweichlich auf den Tod zugeht?« Er sah wieder auf, betrachtete Jonathan fast flehend. »Kannst du mir das sagen?«
Er zuckte mit den Schultern. »Um auf dem Weg dahin so glücklich wie möglich zu sein, denke ich.«
»Tja«, Gabriel lachte bitter auf, »und wenn man dann eines Tages feststellt, dass man unterwegs ständig falsch abgebogen ist und nun am Ende einer Sackgasse steht?«
»Wo bist du denn bitte falsch abgebogen? Du hast doch alles richtig gemacht!«
»Leider nein«, widersprach er. »Eher das Gegenteil ist der Fall.«
»Das musst du mir genauer erklären.«
»Kann ich nicht.«
»Kannst du oder willst du nicht?«
Gabriel lächelte schwach. »Du darfst es dir aussuchen.«
»Ich bitte dich! Was sollen diese kryptischen Andeutungen? Steckst du in irgendwelchen Schwierigkeiten?«
»Nein, gar nicht.« Gegen seinen Willen musste Gabriel fast lachen. »Ich stecke in keinen Schwierigkeiten, bei mir ist alles wun-der-bar!«
»Hast du was genommen?« Nun taxierte Jonathan ihn argwöhnisch.
»Macht es den Eindruck?«
»Ehrlich gesagt, ja.«
»Ich kann dich beruhigen, ich habe weder was genommen noch etwas getrunken.«
»Hm.« Ratlosigkeit zeichnete sich auf dem Gesicht des Verlegers ab, ihm schien nichts mehr einzufallen, was er noch sagen könnte.
Eine Weile starrten beide Männer schweigend aufs Wasser, sodass es auf Außenstehende wirken musste, als hingen sie einfach nur ihren Gedanken nach. Zwei Kameraden, die wortlos den feuchten Windböen trotzten, wie Cowboys an einem flackernden Lagerfeuer.
»Was hältst du davon, wenn du das alles einfach aufschreibst?«, schlug Jonathan nach ein paar Minuten vor.
»Was soll ich aufschreiben?«
»Deine Gedanken und Gefühle halt.«
»Wer soll das denn lesen wollen?«
»Leute wie du.« Grinsend deutete er auf Das Buch der Unruhe.
»Ich möchte meine Leser nur ungern in den Suizid treiben.«
»Das wird schon nicht passieren.«
Gabriel schüttelte den Kopf. »Nein, das halte ich für keine gute Idee.« Er warf ihm einen unglücklichen Blick zu. »Meine Fans erwarten von mir etwas anderes.«
»Umso besser! Dann schreib was anderes!«
»Das kann ich aber nicht«, entgegnete er und sah wieder zu Boden. »Ich will einfach nicht mehr.«
»Was meinst du damit?« Schlagartig klang Jonathan alarmiert.
»Das, was ich sage: keine Bücher mehr, ich habe nichts mehr zu sagen oder zu schreiben.« Er machte eine kurze Pause. »Wie seinerzeit Karl Kraus: Ich bleibe stumm; und sage nicht, warum.«
»Wenn du noch einen einzigen toten Schriftsteller zitierst, scheuer ich dir eine!«
»Die Lebenden bringen nur selten etwas Schlaues zu Papier.«
»Totaler Humbug!«
»Na gut, stimmt. Aber ich … ich habe nur selten etwas Schlaues geschrieben.«
»Soll ich dir mal aus der Presseabteilung sämtliche Kritiken über deine Romane schicken lassen? Oder die Leserbriefe und -mails?«
»Nein!«, rief Gabriel aus und hob abwehrend die Hände. »Bloß das nicht! Es ist eben …« Nun war er es, der aufstand, zweimal vor der Bank auf und ab marschierte, ehe er direkt vor Jonathan stehen blieb und ihn mit finsterer Miene betrachtete. »In meinen Büchern ist nichts Wahrhaftiges, verstehst du?«
»Nein«, erwiderte Jonathan. »Das verstehe ich tatsächlich nicht. Du schreibst schließlich Fiktion und keine Tatsachenbe-richte.«
»Ja«, Gabriel lachte zynisch auf. »Ich lasse mich über die ganz großen Gefühle aus, obwohl ich innerlich taub und abgestorben bin.«
»Immerhin: Pathos hast du noch ganz gut drauf«, machte sein Verleger einen etwas hilflosen Scherz.
»Das meine ich ganz ernst! Ich komme mir vor wie ein Lügner, wie ein Blinder, der über Farben spricht. Ich meine, mal ehrlich«, er nahm wieder Platz, »meine längste Beziehung, wenn man sie denn überhaupt so nennen kann, hat gerade mal zwei Jahre gehalten. Und ausgerechnet mich nennen sie den deutschen Nicholas Sparks? Das ist doch absurd!«
»Sebastian Fitzek massakriert in seinen Büchern einen Menschen nach dem nächsten, ohne tatsächlich mal einen ermordet zu haben.«
Gabriel zog die Augenbrauen in die Höhe. »Bist du dir da so sicher?«
»Nein«, gab Jonathan grinsend zurück, »nicht ganz.«
»Siehst du!«
Sein Verleger lachte auf, dann räusperte er sich. »Lass uns bitte mal ganz konkret reden. Du weißt, dass wir fürs nächste Jahr einen neuen Titel von dir fest eingeplant haben und du dafür unterschrieben hast?«
Gabriel nickte. »Ja, natürlich weiß ich das.«
»Und dir ist auch klar, dass es für den Verlag eine ziemliche Katastrophe wäre, wenn du nichts lieferst?«
»Auch das weiß ich.« Er schluckte schwer. »Aber was soll ich tun? Ich kann ja schlecht etwas aus mir rausprügeln, wenn da nichts ist.«
»Wenn da noch nichts ist«, warf Jonathan ein, »du solltest dir ein bisschen mehr Zeit geben.«
»Das hab ich doch!«, begehrte Gabriel auf. »Seit Wochen sitze ich jeden Tag an meinem Schreibtisch und starre auf mein Notebook. Aber mein Hirn ist genauso leer wie der Bildschirm.«
»Eine ganz normale Schreibblockade, so was kommt vor.«
»Nein«, er schüttelte den Kopf. »Das ist es ja, was ich dir zu erklären versuche. Es ist …«
»Ich habe das alles verstanden«, unterbrach Jonathan ihn. »Trotzdem denke ich, dass du einfach Erholung brauchst.«
»Erholung?«, wiederholte Gabriel ungläubig. »Von was denn? Ich sitze hier tagein, tagaus, trage keine Verantwortung für irgendwen oder irgendwas, wenn ich mal«, er deutete auf den dösenden Hund, »von Tavor absehe, dem ich zweimal am Tag was zu fressen hinstelle und den ich hin und wieder vor die Tür scheuche. Ansonsten kann ich tun und lassen, was ich will. Wenn ich keine Lust habe aufzustehen, bleibe ich liegen, gucke im Bett Netflix, treibe mich bei Facebook rum oder lese in Onlinemagazinen. Zweimal pro Woche kommt meine Putzfrau, räumt auf und macht meine Wäsche, zum Essen gehe ich ins Restaurant oder lasse mir was liefern.«
»Eben hast du noch behauptet, du würdest seit Wochen an deinem Schreibtisch sitzen.«
»Tue ich ja auch! Aber es kommt eben nichts dabei rum. Jedenfalls nichts, wovon ich mich erholen müsste.«
»Jeder Denkprozess ist Schwerstarbeit.«
»Mein Freund«, nun war es an Gabriel, seinem Verleger eine Hand auf die Schulter zu legen, »dein Verständnis ehrt dich, aber ich fürchte, ich muss dich bitten, mich aus meinen Verträgen zu entlassen.«
»Was?« Jonathan starrte ihn entsetzt an und sprang von der Bank auf, als hätte ihn eine Krabbe in den Allerwertesten gepikt.
»Die Vorschüsse zahle ich natürlich zurück«, schob Gabriel eilig hinterher.
»Darum geht es doch nicht!« Jonathan war sämtliche Farbe aus dem Gesicht gewichen. »Es geht um deine Leser, die auf dich zählen, auf Henri Fjord! Es geht um den Verlag, um die Mitarbeiter!«
»Mach es mir bitte nicht schwerer, als es sowieso schon ist.«
»Doch, mein Lieber«, gab sein Verleger zurück, »natürlich mache ich es dir schwer, das ist mein Job.« Er schnappte hörbar nach Luft. »Du bekommst von mir jede Unterstützung, die du brauchst, du musst es einfach nur sagen.«
»Ich denke, dass …«
»Wenn du willst, kannst du im Verlag schreiben, dann fällt dir hier nicht so die Decke auf den Kopf«, schnitt Jonathan ihm das Wort ab und ratterte hastig weitere Vorschläge herunter. »Ich stelle Frau Dr. Künne von sämtlichen anderen Aufgaben frei, dann kann deine Lektorin rund um die Uhr für dich da sein, wenn du willst. Von mir aus organisieren wir dir einen Co-Autor, mit dem du arbeiten kannst. Ganz diskret und inoffiziell natürlich, das versteht sich von selbst. Wir könnten den Titel zur Not auch um ein Programm ins übernächste Frühjahr verschieben, das wäre …«
»Nein«, würgte Gabriel ihn energisch ab. »Begreifst du es nicht? Ich – will – und – kann – nicht – mehr!«
»Bitte!« Wie zum Gebet legte Jonathan die Hände flach gegeneinander und bedachte Gabriel mit einem Blick, der die Steine der Schutzwälle am Elbufer zum Erweichen bringen könnte. »Das kannst du mir nicht antun!«
»Ich will’s ja auch nicht«, sagte er und klang dabei unendlich erschöpft. »Nur fällt mir kein anderer Ausweg ein.«
»Bitte!«, beharrte sein Verleger. »Ich bitte dich inständig! Du musst schreiben, das ist sonst eine Katastrophe!«
»Was wäre denn, wenn mich ein Bus überfahren hätte?«, begehrte Gabriel auf. »Oder ich läge an einer Herz-Lungen-Maschine? Dann müsstet ihr auch damit leben, dass von mir erst einmal kein neuer Titel kommt.«
»Stimmt«, gab Jonathan ihm recht. »Aber du liegst nicht an einer Herz-Lungen-Maschine.«
»Doch«, widersprach er. »Ich liege an einer seelischen Herz-Lungen-Maschine!«
»Was für ein schönes Bild!« Jonathan klang aufrichtig begeistert. »Merk dir das unbedingt für dein nächstes Buch!«
»Es gibt kein nächstes Buch!«
»Okay, okay!« Sein Verleger hob beschwichtigend die Hände, wanderte noch einmal auf und ab und setzte sich dann wieder neben ihn. »Lass mich einen Vorschlag machen: Wir warten zwei Monate, und wenn es dir dann noch immer so geht wie heute, lösen wir die Verträge auf.«
»Denkst du, das bringt was?«
»Das weiß ich nicht. Allerdings ist es einen Versuch wert, ehe du die Flinte komplett ins Korn wirfst.« Er betrachtete ihn so eindringlich, so verzweifelt, dass Gabriel ein unangenehmes Kribbeln durch und durch ging. »Wie ich schon sagte: Wir im Verlag brauchen dich, du bist einer unserer wichtigsten Autoren. Der wichtigste eigentlich.«
»Hm«, er dachte einen Moment lang nach, ehe er langsam und auch nur widerwillig nickte. »In Ordnung. Zwei Monate. Besser noch: bis Weihnachten.«
»Das sind über drei Monate.«
»Dann eben nicht.«
»Doch, doch!«, ruderte Jonathan zurück. »Bis Weihnachten, kein Problem, das machen wir! Das wird großartig!« Er klatschte vor Begeisterung in die Hände.
»Aber mach dir keine allzu großen Hoffnungen«, dämpfte Gabriel umgehend die Freude seines Verlegers. »Ich kann mir nicht vorstellen, dass mir innerhalb der nächsten Wochen etwas einfällt, das sich lohnt, aufgeschrieben zu werden.«
»Das werden wir dann ja sehen«, entgegnete Jonathan und lächelte dabei so gut gelaunt, als hätte sein Autor ihm soeben ein dreißigseitiges und fertig ausgearbeitetes Exposé für einen Jahrhundertroman vorgelegt, den er nur noch herunterschreiben musste.
»Ja, werden wir.«
Jonathan klopfte ihm mit einer Hand auf den Oberschenkel. »Entspann dich einfach, dann wird die Inspiration schon kommen. Ist ja meistens so. Wenn man nicht damit rechnet, macht es auf einmal ›bling‹!«
»Bling«, wiederholte Gabriel mit einem sarkastischen Unterton.
»Ich muss jetzt auch mal los«, sagte der Verleger und erhob sich. »Aber ich ruf dich morgen an.«
»Ja, ist gut.«
»Also dann«, Jonathan hob zum Abschied die Hand, dann stapfte er durch den Sand nach oben zur Straße.
Zurück blieb Gabriel. Auf dieser Bank mit seinem zerfledderten Buch. In kompletter Ratlosigkeit. War ihm schon seit Wochen schwer ums Herz, kam es ihm jetzt vor, als hinge ihm ein Betonklotz in den Eingeweiden. Denn er wusste, dass er Jonathan und den gesamten Verlag enttäuschen würde. So, wie er in den entscheidenden Momenten seines Lebens schon immer eine Enttäuschung gewesen war. Für sich. Und für andere.
Montag, 16. September
Miriam
Ein Paar hatte ihr Geschäft betreten, gemeinsam mit zwei kleinen Jungs im Alter von etwa sechs und drei Jahren. Alle vier hanseatisch blond und sonnengebräunt, als wären sie soeben nach einem längeren Törn von ihrer Segeljacht gehüpft. Miriam schätzte die Eltern auf Ende dreißig oder Anfang vierzig – und angesichts der teuren Markenklamotten, in denen sowohl die Frau als auch der Mann und die Kinder steckten, hatte sie den Eindruck, dass sie sich in der Tür geirrt haben mussten. Was wollte diese Designerfamilie bei ihr?
Sie hatte einen geübten Blick dafür, wie Menschen sich kleideten, nicht zuletzt durch ihre langjährige Tätigkeit als PR-Assistentin bei einem – mittlerweile insolvent gegangenen – Hamburger Label für Kindermode. Und diese Leute hier – die gehörten eindeutig in die Kategorie »teuer und neu«. Auf gar keinen Fall das typische Publikum in »Miriams Krümelkiste – Secondhand für Kids«, solche Leute trieben sich eher in den exklusiven Boutiquen am Eppendorfer Baum oder am Neuen Wall herum und kauften dort Kinderjäckchen, die so viel kosteten, dass »normale« Menschen für dasselbe Geld eine Woche in den Urlaub fahren könnten.
Miriams Laden hingegen befand sich in einer Seitenstraße in Lokstedt. Der Stadtteil, den Immobilienmakler gern noch als »schickes Eppendorf« bezeichneten, obwohl er de facto jenseits des Universitätsklinikums lag, das die magische Grenze zwischen den beiden Vierteln zog. Sie hatte die Verkaufsfläche mit drei winzigen Büroräumen, einem WC mit Dusche und einer kleinen Kitchenette zum Schnäppchenpreis von neun Euro warm je Quadratmeter ergattert, nachdem Becka, die Miriam zu der Verhandlung mit dem Eigentümer begleitet hatte, den Ausdruck einer Hamburger Liegenschaftskarte vorgelegt hatte, die bewies, dass sein Objekt in Lokstedt lag. Lokstedt! Nix Eppendorf! Und da sich offenbar auch kein anderer gefunden hatte, der mit fünfzehn oder sechzehn Euro zuschlagen wollte, hatte Miriam das Objekt bekommen.
Für ihre Zwecke war die Raumaufteilung perfekt: Von den drei kleinen Zimmern nach hinten raus war eines für Luzie, in dem sie nach der Schule Hausaufgaben machen und spielen konnte, eines diente als Lager, und für das dritte, das mit der Tür zum Innenhof, suchte Miriam per Aushang gerade noch einen Untermieter, der einen Arbeitsplatz brauchte. Und der vielleicht auch mal im Laden die Stellung halten könnte, wenn sie selbst kurz zur Schule, mit Luzie zum Arzt oder sonst etwas erledigen musste.
Sie fühlte sich wohl in der Krümelkiste – aber natürlich entsprach ihr Laden weder bezüglich Lage noch Außenfassade den Shops, in die Menschen mit Tod’s an den Füßen jemals über die Schwelle traten.
»Guten Tag!«, begrüßte sie die Familie trotzdem freundlich und erhob sich von ihrem Barhocker hinterm Tresen, um zu signalisieren, dass sie zur Beratung bereit war.
»Wir wollen uns nur mal umsehen«, entgegnete die hochgewachsene Frau und machte sich prompt daran, die erste Kleiderstange zu inspizieren. Sie trug eine elegante Hochsteckfrisur, da flog kein einziges Härchen frei herum. Faszinierend. Miriam hatte den Kampf gegen ihre widerspenstige schwarze Mähne bereits vor Jahren aufgegeben und knödelte sie meistens mit einem Haargummi auf dem Kopf zusammen, was mal mehr, mal weniger gelungen aussah. Verstohlen musterte sie sich in dem kleinen Schminkspiegel, der rechts in dem Regal neben ihrer Kasse stand. Heute eher weniger.
»Ich muss mal kurz telefonieren, Schatz«, sagte der Mann zu seiner Frau und war eine Sekunde später wieder nach draußen entschwunden. Dort begann er, mit seinem Handy am Ohr vor dem großen Schaufenster auf und ab zu wandern.
»Hm«, antwortete die Blondine abwesend nickend, während sie mit gerunzelter Stirn ein rosafarbenes Patchworkkleidchen in Größe achtundsechzig vom Bügel nahm und gegen das Licht hielt, das von der Straße aus ins Geschäft fiel.
»Jungssachen habe ich hier drüben«, erklärte Miriam von ihrer Position aus und deutete in die rechte Ecke ihres Geschäfts. »Und ab Größe achtundneunzig hängt dann alles dort.« Sie zeigte auf den Ständer direkt vorm Tresen.
»Ich suche etwas für die Tochter von Freunden«, antwortete die Frau und zog nun den Reißverschluss des Kleidchens prüfend auf und wieder zu. An ihrem rechten Ringfinger blitzte ein Klunker auf, von dem Miriam für den Bruchteil einer Sekunde regelrecht geblendet war. Und sie wurde gegen ihren Willen traurig und sogar ein bisschen neidisch. Musste das denn sein? Musste ausgerechnet in ihre düstersten Gedanken Familie »Rich & Happy« hereinspazieren? Die hatte doch jemand gecastet und ihr absichtlich auf den Hals gehetzt, damit sie sich nicht nur mies, sondern obermies fühlte!
»Ludwig, Julius«, sagte die Frau zu ihren Söhnen, während sie noch immer den Reißverschluss des Kleidchens malträtierte, »ihr könnt da drüben ein bisschen spielen.« Mit diesen Worten beugte sie sich hinunter und schob ihre Kinder sachte in Richtung des großen Regals auf der linken Seite, in dem sich zahlreiche Spielzeuge türmten. Sofort stürmten die Jungs los und fingen an, unter lautem Gelärme und Geklapper alles von den Brettern zu fegen, was Miriam dort dekoriert hatte.
»Äh«, entfuhr es Miriam, »das ist eigentlich …«
»Wie bitte?« Die Frau sah fragend auf und bedachte sie mit einem Blick, der den Vorstandsvorsitzenden eines Milliardenkonzerns zum Schweigen gebracht hätte. Eisblaue Augen, Miriam fühlte sich regelrecht durchbohrt.
»Gar nichts«, entgegnete sie stotternd, »ich …«
Doch die Frau hörte ihr schon gar nicht mehr zu, sondern beschäftigte sich erneut mit dem Reißverschluss.
Miriam nahm wieder auf ihrem Hocker Platz und fühlte sich seltsam kraftlos. Warum hatte sie die Kundin nicht auf den laminierten Zettel am Spielzeugregal hingewiesen, der eigentlich nur für Menschen zu übersehen war, die eine gelbe Armbinde mit drei schwarzen Punkten trugen nicht zu übersehen war?
Liebe Kundinnen und Kunden! Bitte passt ein wenig auf eure Kinder auf. Gern darf das Spielzeug angesehen und in die Hand genommen werden, aber bitte nicht alles auf einmal rausräumen. Leider geht häufig etwas kaputt oder ist später nicht mehr vollständig. Vielen Dank, eure Krümeline!
Doch, sie hätte zu der Kundin etwas sagen müssen. Aber sie hatte sich nicht getraut. Ob es an den eisblauen Augen lag oder daran, dass Miriam ihr Aliasname, den Becka sich für sie ausgedacht hatte, mit einem Mal absolut bescheuert vorkam, sodass sie die Frau nicht auch noch explizit darauf aufmerksam machen wollte, wusste sie nicht. Eher Zweiteres. Krümeline! Sie war achtunddreißig Jahre alt und stellte sich auf die gleiche Stufe mit Tiffy aus der Sesamstraße!
»Sagen Sie«, unterbrach die Frau ihre Gedanken, »das hier scheint mir aber einige Gebrauchsspuren zu haben.« Sie hielt das Kleidchen empor, nun wirkte sie irritiert.
»Na ja«, gab Miriam zurück und stand wieder auf, »ist eben secondhand.«
»Secondhand?« Die Kundin hängte den Bügel so schnell zurück, als wäre der Stoff mit einem biochemischen Kampfstoff eingenebelt worden.
»Japp«, bestätigte Miriam und drückte dabei den Rücken durch. »Steht auch dran. Krümelkiste, Secondhand für Kids.«
»Oh.« Die Blondine rückte einen Schritt von der Kleiderstange ab. »Das muss ich übersehen haben.«
»Alle Sachen hier sind sauber und ohne Mängel«, versicherte Miriam eilig und wunderte sich gleichzeitig über ihren entschuldigenden Tonfall. Sie klang fast, als würde sie sich schämen.
»Ludwig, Julius«, rief die Frau, ohne die zweite Information auch nur eines Kommentars zu würdigen, »kommt, wir müssen los!«
Ehe Miriam sie noch darum bitten konnte, die Spielzeugtrümmer ihrer Söhne wieder zurückzuräumen, war die Frau mitsamt ihrem Nachwuchs nach draußen geeilt. Dort sagte sie etwas zu ihrem Mann, der kurz das Handy vom Ohr nahm. Er grinste breit, das konnte Miriam sogar aus der Entfernung durchs Schaufenster erkennen. Dann legte er einen Arm um seine Gattin, und mit der Gelassenheit von Leuten, die an einem Montagnachmittag alle Zeit der Welt haben, schlenderten sie los und waren wenige Augenblicke später entschwunden.
Zurück blieb Miriam mit einem unerfreulich gedemütigten Gefühl.
Montag, 16. September
Gabriel
Vielleicht ist es an der Zeit, und ich sollte die einmalige Anstrengung unternehmen und mein Leben betrachten. Ich sehe mich inmitten einer unermesslichen Wüste. Ich rede von dem, was ich gestern, literarisch gesprochen, war, und versuche, mir zu erklären, wie ich dahingekommen bin.
Er klappte das Buch von Pessoa zu und erhob sich von seiner Bank. Blickte noch einmal hinaus aufs Wasser, der Wind ließ Wellen mit kleinen Schaumkronen über die Elbe tanzen. Mit einem Ruck zog er sich die Mütze vom Kopf, schloss die Augen und spürte, wie ihm Sekunden später eine Böe die Haare zerzauste. Sein Leben. Und die Frage, wie er dahingekommen war.
»Komm, Tavor«, sagte er und sah zu seinem Hund, der sich in Zeitlupengeschwindigkeit erhob. Gemeinsam trotteten sie zurück zum Haus. Nach einem kleinen Nickerchen würde er sich bestimmt besser fühlen.
Montag, 16. September
Miriam
Langsam ließ sie ihren Blick durch den Laden wandern, sah sich ratlos in der Krümelkiste um und versuchte, ihr Geschäft mit den Augen eines Menschen zu betrachten, der es zum ersten Mal betrat.
Vom herumfliegenden Spielzeug abgesehen war es wirklich schön und aufgeräumt hier. Die angebotene Secondhandware hing sorgfältig nach Größe, Geschlecht und Art sortiert (Jacken, Hosen, Kleider) auf weißen Holzbügeln an glänzenden Chromständern, und jedes der Teile war absolut top in Schuss und natürlich sauber. Darauf legte Miriam beim Ankauf großen Wert, sie nahm nichts, was in den Container gehörte. Tatsächlich musste man bei den meisten ihrer Sachen schon ganz genau hinsehen, um zu erkennen, dass es sich um bereits getragene Kleidung handelte.
Zwar bezahlte sie beim Ankauf »nur« Flohmarktpreise, aber ein Großteil der Dinge, die man ihr anbot, war so gut wie neuwertig. Oft waren die Leute einfach nur froh, ihren Krempel unkompliziert loszuwerden, ein bisschen was in Sachen Nachhaltigkeit zu tun, dabei einen kleinen Schnack mit Miriam zu halten und vielleicht sogar das eine oder andere Teil noch günstig mitzunehmen.
Sie sah sich weiter um, konnte aber nichts entdecken, was auch nur ansatzweise Anstoß erregen könnte, weil es den Eindruck eines Grabbeltischs vermittelte. In einem Regal direkt hinter der Eingangstür standen sehr gepflegte Kinderschuhe von Größe neunzehn bis fünfunddreißig in Reih und Glied, Kleinkram wie Bodys, Socken, Strumpfhosen, Unterwäsche, Mützen, Schals und Badesachen fanden die Kunden gut übersichtlich, ebenfalls nach Größe geordnet, in transparenten Aufbewahrungskisten. Das war praktisch und ansehnlich zugleich.
Neben Kleidung hatte Miriam meistens auch noch einiges an Zubehör im Angebot: Mal war ein fast fabrikneuer Kinderwagen dabei, es gab Babyschalen und Autositze, Heizstrahler, Wickeltaschen, bruchsicheres Melamin-Geschirr, Schulranzen, Tretroller, Schaukeln, Schlittschuhe, Fahrradhelme, Rucksäcke und, und, und. Nein, die Krümelkiste musste sich hinter ihren wohlhabenden Cousinen und Cousins am Neuen Wall in der Hamburger Innenstadt wahrlich nicht verstecken, zumindest was das Sortiment betraf.
Gemeinsam mit Becka hatte Miriam ihr kleines Reich vor einem halben Jahr liebevoll eingerichtet. Tagelang hatten sie in Eigenregie rumgeräumt und renoviert, hatten jede Wand in einem anderen Pastellton gestrichen, und sogar die einzelnen Regalbretter waren bunt lackiert. Ringsum an den Wänden verliefen zwei Zierbordüren mit lustigen Zirkusfiguren, einmal auf der Augenhöhe von Erwachsenen, einmal so, dass kleine Kinder sie gut im Blick hatten.
Becka hatte es sich natürlich nicht nehmen lassen, bei der Gestaltung der Räumlichkeiten sehr genau auf die Feng-Shui-Gesetze zu achten, weshalb der Verkaufstresen mit der Kasse hinten links in der Ecke stand – laut Rebecca der Platz, der für »Reichtum« sorgt. Welche Feng-Shui-Regeln für den restlichen Laden galten, hatte Miriam vergessen – außer dass ausgerechnet der Raum hinten rechts, für den sie einen Untermieter suchte, bisher leer stand. Alles in allem wirkte die Krümelkiste wie eine hübsche Puppenstube mit vielen niedlichen Details: Zwischen den Pullover- oder T-Shirt-Stapeln hockten Stofftiere wie ein rosafarbener Drache, ein Nilpferd oder ein Plüschhund mit treuem Blick und langen Schlappohren, in der Mitte des Raums baumelte ein Mobile aus Papierschmetterlingen von der Decke, und den Vorhang, mit dem Miriam eine Ecke als Umkleide abgetrennt hatte, hatte Becka aus bedrucktem Leinen genäht, das die beliebtesten Disneyfiguren zeigte. Eine Nische daneben hatten sie in sonnigem Gelb angemalt und dort eine Wickelkommode mit weicher Auflage aufgestellt. In den Schubladen des Schränkchens befanden sich neben Feuchttüchern und Babycreme noch Windeln von Größe eins bis sechs, sie hatten wirklich an alles ge-dacht.
Alle zwei bis drei Wochen dekorierte Miriam das Schaufenster um und präsentierte dort ihre jeweiligen Klamotten-Highlights – sie hatte nicht nur Kleidung von H&M, Zara und den üblichen Verdächtigen, sondern auch mal ein Hemd von Ralph Lauren oder einen Kinder-Trenchcoat von Burberry (sie war fast hintenübergefallen, als sie im Netz nach dem Neupreis dafür gesucht hatte, um zu entscheiden, was er bei ihr kosten sollte). In die zwei weißen Regale mit jeweils neun Fächern stellte Miriam absichtlich Dinge, die bei den lieben Kleinen Begehrlichkeiten wecken konnten.
Eigens dafür kaufte sie im Großhandel Neuware ein, denn es war ja eine Binsenweisheit, dass man mit Speck Mäuse fing: Flummis in Neonfarben, Stickerhefte, Wasserspritzpistolen, Glitzertattoos, Matchboxautos, Knete, Lego & Playmobil, Schleich-Figuren, Riesenseifenblasen, Accessoires zum Verkleiden und anderer Schnickschnack sowie in zwei von den Fächern Glasschalen mit etwas Süßkram wie Esspapier, Fruchtgummi, Lakritze, Brausepulver oder Schaumzuckerwaffeln.
Das bisschen »Lockstoff« hielt sie für legitim, schließlich sollten auch Kinder Lust haben, ihre Eltern in die Krümelkiste zu begleiten. Okay, hin und wieder wurden Eltern von ihrem Nachwuchs hereingezerrt. Aber das war ja nun keine Strategie, mit der andere Läden nicht ebenfalls arbeiteten.
Bei dem Gedanken fiel Miriam ein, dass sie Luzie hoch und heilig versprochen hatte, heute zwei Stunden früher zu schließen, um mit ihr zu Mikado zu gehen. Das einzige Spielzeuggeschäft in der Gegend schickte jedem Kind, das dort für seinen Geburtstag eine Geschenkekiste einrichtete, an seinem Ehrentag eine Postkarte mit Glückwünschen und der Aufforderung vorbeizuschauen, weil es dann eine Überraschung gäbe. Und natürlich musste Luzie, nachdem sie am Samstag die Karte erhalten hatte, heute unbedingt, unbedingt, un-be-dingt zu Mikado, um ihr Präsent abzuholen!
Miriam seufzte tief, ging zu dem Regal, vor dem das verstreute Spielzeug auf dem Boden herumlag, und fing an, es wieder zusammenzusetzen und zurückzuräumen. Sie wich nur ungern von den Öffnungszeiten der Krümelkiste ab, denn jeder Kunde, der vor einer verschlossenen Tür stand, war unter Umständen ein verlorener Kunde. Außerdem brannte ihr die verhasste Buchhaltung unter den Nägeln, und sie hatte sich gestern – wie so oft – fest vorgenommen, heute endlich mal damit anzufangen, ein bisschen Ordnung in ihre Zettelwirtschaft zu bringen, weil es montags im Laden meistens sehr ruhig zuging.