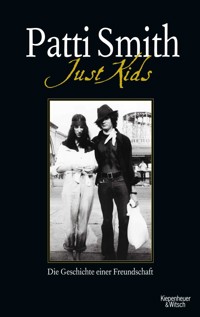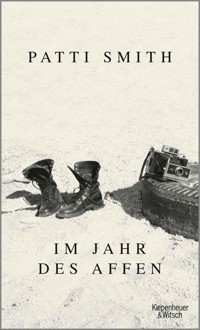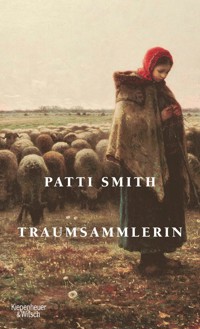9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Endlich: Die Fortsetzung von »Just Kids« ist da! In »M Train« erzählt Patti Smith von ihrer Ehe mit Fred Sonic Smith, von ihren Lieblingsbüchern und von Dingen und Menschen, die sie im Laufe ihres Lebens verloren hat und die dadurch für sie nur an Bedeutung gewonnen haben. Patti Smith nimmt den Leser mit in unzählige Cafés auf der ganzen Welt, in denen sie schreibt, malt, Listen komponiert und nachdenkt. Über alte Zeiten, über die Gegenwart und über die Bücher, die sie gerade liest oder dringend wieder lesen muss. Bis zu 14 Tassen Kaffee trinkt man mit ihr pro Tag und schweift dabei zusammen mit ihr durch ihr Leben, von den 1980er-Jahren bis heute. Es geht auf spektakuläre Reisen, z.B. nach Französisch-Guyana auf den Spuren von Genet oder zu den Gräbern seelenverwandter Künstler (Sylvia Plath, Rimbaud, Frida Kahlo). Immer wieder kommt Patti Smith auf für sie wichtige Autoren zurück: auf Murakami, Bolaño, Wittgenstein und Bulgakow. Jede Geschichte ist gespickt mit kleinen Besonderheiten: Begegnungen, Gegenständen, Bildern, die Patti Smith wie kaum eine andere auratisch aufzuladen versteht. Eine wunderbare Meditation über das Reisen, über kreatives Schaffen und die hohe Kunst der Kontemplation. Mit zahlreichen von Patti Smith aufgenommenen Polaroidfotos.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 270
Veröffentlichungsjahr: 2016
Sammlungen
Ähnliche
Patti Smith
M Train
Erinnerungen
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Patti Smith
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Patti Smith
Patti Smith ist Musikerin, Dichterin, Performance-Künstlerin, Malerin und Fotografin. Ihr erstes Album »Horses« mit einem Coverfoto von Robert Mapplethorpe schrieb Musikgeschichte. 2007 wurde sie in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. 2010 erschien ihr Buch »Just Kids«, das in den USA mit dem National Book Award ausgezeichnet wurde. Außerdem erschienen von ihr »Die Traumsammlerin«, »M Train«, »Hingabe« und »Im Jahr des Affen«.
Brigitte Jakobeit lebt in Hamburg und überträgt seit 1990 englischsprachige Literatur ins Deutsche, u.a. Werke von William Trevor, Alistair MacLeod, Audrey Niffenegger und Jonathan Evison.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Auf ihre unnachahmliche Weise erzählt Patti Smith von ihrem Leben, von ihrem Ehemann, ihren Kindern und von Dingen und Menschen, die sie im Laufe ihres Lebens verloren hat und die dadurch für sie noch mal an Bedeutung gewonnen haben.
Patti Smith nimmt den Leser mit in unzählige Cafés auf der ganzen Welt, in denen sie schreibt, malt, Listen komponiert und nachdenkt. Über alte Zeiten, über die Gegenwart und über die Bücher, die sie gerade liest oder dringend wieder lesen muss. Bis zu vierzehn Tassen Kaffee trinkt man mit ihr pro Tag und schweift dabei zusammen mit ihr durch ihr Leben, von den 1980er-Jahren bis heute. Es geht auf spektakuläre Reisen, z.B. nach Französisch-Guyana auf den Spuren von Jean Genet oder zu den Gräbern seelenverwandter Künstler wie Sylvia Plath, Arthur Rimbaud oder Frida Kahlo. Überhaupt kommt Patti Smith immer wieder auf die Literatur zurück, auf für sie wichtige Autoren: Murakami, Bolaño, Wittgenstein und Bulgakow. Jede Geschichte ist gespickt mit kleinen Besonderheiten: Begegnungen, Gegenständen, Bildern, die Patti Smith wie kaum eine andere auratisch aufzuladen versteht. Eine wunderschöne Meditation über das Reisen, über kreatives Schaffen und die hohe Kunst der Kontemplation. Mit zahlreichen von Patti Smith gemachten Fotos.
„M Train ist das Schönste, das Patti Smith je geschaffen hat.“ The New York Times
„Geradezu schmerzhaft schön … eine Ballade über all die Verluste, die Zeit, Zufall und Umstände mit sich bringen … Smith hat ein wunderbares Gespür für den Klang und die Magie der Worte.“ The New York Times
Inhaltsverzeichnis
Widmung
1. Kapitel
Café ’Ino
Umschalten
Tierkekse
Der Floh saugt Blut
Keinen Pfifferling
Uhr ohne Zeiger
Der Brunnen
Wheel of fortune
Wie ich Mister Aufziehvogel verlor
Sandy
Vecchia Zimarra
Mu (nichts)
Sturmluftdämonen
Ein Traum von Alfred Wegener
Straße nach Larache
Abgeschrittene Erde
Wie Linden tötet, was sie liebt
Tal der verlorenen Dinge
Mittagsstunde
Für Sam
ES IST NICHT SO LEICHT, über nichts zu schreiben.
Genau das sagte ein Cowboy, als ich das Bild eines Traums betrat. Irgendwie schön und äußerst lakonisch balancierte er zurückgelehnt auf einem Klappstuhl, und sein Stetson streifte die bräunliche Außenwand eines einsamen Cafés. Ich sage einsam, denn sonst war da offenbar nichts, nur eine alte Zapfsäule und ein verrosteter Trog mit wenig Wasser, das eine Kette aus Pferdefliegen zierte. Außer ihm war auch niemand in der Nähe, aber das schien ihn nicht zu stören; er zog sich einfach die Hutkrempe über die Augen und redete weiter. Es war ein Silverbelly-Open-Road-Modell, wie Lyndon Johnson es früher trug.
– Aber wir machen weiter, fuhr er fort, und hegen alle möglichen verrückten Hoffnungen. Auf ein Quäntchen Selbsterkenntnis, darauf, das Verlorene zu retten. Es ist eine Sucht, wie Einarmige Banditen oder Golf.
– Es ist viel leichter, über nichts zu reden, sagte ich.
Er ignorierte mich nicht völlig, antwortete mir aber auch nicht.
– Das jedenfalls ist meine unbedeutende Meinung.
– Du bist kurz davor, das Spiel aufzugeben, und willst die Schläger in den Fluss werfen, aber dann hast du’s raus, der Ball rollt geradeaus ins Loch, und die Münzen fallen in deine umgedrehte Mütze.
Die Sonne fing den Rand seiner Gürtelschnalle und warf einen schimmernden Lichtstrahl auf die verlassene Ebene. Ein schriller Pfiff ertönte, und als ich nach rechts trat, sah ich seinen Schatten, der eine ganze Reihe weiterer Spitzfindigkeiten aus einem völlig anderen Winkel von sich gab.
– Ich bin schon mal hier gewesen, stimmt’s?
Er saß nur da und starrte auf die Ebene.
Mistkerl, dachte ich. Er ignoriert mich.
– Hey, sagte ich, ich bin keine Tote, kein vorbeigehender Schatten. Ich bin aus Fleisch und Blut.
Er zog ein Notizbuch aus seiner Tasche und fing an zu schreiben.
– Du könntest mich wenigstens ansehen, sagte ich. Schließlich ist das mein Traum.
Ich trat näher. Nah genug, um zu sehen, was er schrieb. Sein Notizbuch war bei einer leeren Seite aufgeschlagen, und vier Worte nahmen plötzlich Gestalt an.
Nein, es ist meiner.
– Also, ich will verdammt sein, murmelte ich. Ich schirmte meine Augen ab, stand da und folgte der Richtung seines Blicks – Staubwolken, Pick-up, Steppenhexe, weißer Himmel – so ziemlich nichts.
– Der Schriftsteller ist ein Zugführer, sagte er gedehnt.
Ich wanderte davon und ließ ihn die gedankliche Achterbahnfahrt allein zu Ende führen. Worte, die nachhallten und dann verschwanden, als ich in meinen eigenen Zug stieg, der mich vollständig angezogen in meinem zerwühlten Bett absetzte.
Ich öffnete die Augen, stand auf, wankte ins Badezimmer und spritzte mir rasch etwas kaltes Wassers ins Gesicht. Dann schlüpfte ich in meine Stiefel, fütterte die Katzen, griff meine Wollmütze und meinen alten schwarzen Mantel und ging hinaus in Richtung der oft genommenen Straße, über die Avenue zur Bedford Street und in ein kleines Café in Greenwich Village.
© Fred Smith
Café ’Ino
Vier Ventilatoren drehen sich an der Decke.
Im Café ’Ino sind nur der mexikanische Koch und ein Junge namens Zak, der mich mit meiner gewohnten Bestellung aus Vollkorntoast, einer kleinen Schale Olivenöl und schwarzem Kaffee versorgt. Mit Mantel und Mütze setze ich mich in meine Ecke. Es ist neun Uhr früh. Ich bin der erste Gast. Bedford Street, während die Stadt zum Leben erwacht. An meinem Tisch, flankiert von der Kaffeemaschine und dem vorderen Fenster, kann ich ungestört allein sein und mich meiner eigenen Welt überlassen.
Ende November. Das kleine Café ist irgendwie kalt. Warum drehen sich dann die Ventilatoren? Wenn ich sie lange genug anstarre, dreht sich ja vielleicht auch mein Verstand.
Es ist nicht so leicht, über nichts zu schreiben.
Ich höre die gedehnte, herrische Stimme des Cowboys und schreibe seinen Satz auf eine Serviette. Wie kann einen jemand im Traum auf die Palme bringen und dann so dreist sein, einen weiter zu belästigen? Am liebsten würde ich ihm widersprechen, aber nicht nur mit einer scharfen Erwiderung, sondern durch eine Tat. Ich betrachte meine Hände. Ich bin mir sicher, ich könnte endlos über nichts schreiben. Wenn ich nur nichts zu sagen hätte.
Nach einer Weile bringt mir Zak noch einen Kaffee.
– Heute bediene ich dich zum letzten Mal, sagt er feierlich.
Er macht den besten Kaffee in der Gegend, darum stimmt mich das traurig.
– Warum? Gehst du woandershin?
– Ich eröffne ein Strandcafé an der Promenade in Rockaway Beach.
– Ein Strandcafé! Was sagt man dazu, ein Strandcafé!
Ich strecke die Beine aus und beobachte Zak bei seiner morgendlichen Arbeit. Er konnte nicht wissen, dass ich früher auch dem Traum von einem eigenen Café nachhing. Wahrscheinlich fing es an, als ich über das Kaffeehausleben der Beats, Surrealisten und französischen Symbolisten las. Wo ich aufwuchs, gab es keine Cafés, aber sie existierten in meinen Büchern und blühten in meinen Tagträumen. 1965 war ich von South Jersey nach New York gekommen, um mich ein bisschen umzusehen, und nichts schien mir romantischer, als in einem Café in Greenwich Village zu sitzen und Gedichte zu schreiben. Schließlich hatte ich den Mut, ins Caffè Dante in der MacDougal Street zu gehen. Eine Mahlzeit konnte ich mir nicht leisten, deshalb trank ich nur Kaffee, aber das störte keinen. An den Wänden hingen Drucke von Gemälden in Florenz und Szenen aus der Göttlichen Komödie. Die Bilder hängen noch heute, verfärbt durch den Zigarettenrauch von Jahrzehnten.
1973 bezog ich in derselben Straße, nur zwei kurze Blocks vom Caffè Dante entfernt, ein luftiges weiß gestrichenes Zimmer mit einer Küche. Ich konnte vorne aus dem Fenster klettern, mich abends auf die Feuerleiter setzen und das Treiben im Kettle of Fish beobachten, eine der Bars, in denen Jack Kerouac verkehrte. Um die Ecke in der Bleecker Street war ein kleiner Stand, wo ein junger Marokkaner frische Brötchen, in Salz eingelegte Anchovis und frische Pfefferminze verkaufte. Ich stand früh auf und kaufte dort ein. Dann kochte ich Wasser, goss es in eine Teekanne mit Pfefferminze und trank den ganzen Nachmittag Tee, rauchte ein bisschen Haschisch und las Erzählungen von Mohammed Mrabet und Isabelle Eberhardt.
Damals gab es das Café ’Ino noch nicht. Ich saß im Caffè Dante an einem niedrigen Fenster, das auf die Ecke einer schmalen Gasse blickte, und las Mrabets Das Strandcafé. Ein junger Fischverkäufer namens Driss trifft einen zurückgezogen lebenden, unangenehmen Kauz, dem ein sogenanntes Café mit nur einem Tisch und einem Stuhl an einem felsigen Strandabschnitt in der Nähe von Tanger gehört. Die träge Atmosphäre um das Café nahm mich so in Bann, dass ich nichts sehnlicher wünschte, als darin zu verweilen. Wie Driss träumte ich davon, einen eigenen Laden aufzumachen. Ich dachte so oft daran, dass ich ihn fast betreten konnte: das Café Nerval, eine kleine Oase, in der Literaten und Reisende einen schlichten Zufluchtsort finden könnten.
Ich stellte mir fadenscheinige Perserteppiche auf Böden mit breiten Dielen vor, zwei lange Holztische mit Bänken, ein paar kleinere Tische und einen Ofen zum Brotbacken. Jeden Morgen würde ich die Tische mit aromatischem Tee einreiben, wie man es in Chinatown macht. Keine Musik, keine Speisekarten. Nur Stille, schwarzer Kaffee, Olivenöl, frische Pfefferminze, Vollkornbrot. Fotos schmückten die Wände: ein melancholisches Porträt vom Namenspatron des Cafés und ein kleineres Bild vom verzweifelten Dichter Paul Verlaine in seinem Mantel, zusammengesunken vor einem Glas Absinth.
1978 hatte ich dann ein wenig Geld und konnte die Kaution für den Mietvertrag eines eingeschossigen Hauses in der East Tenth Street zahlen. Früher war es ein Schönheitssalon gewesen, der jetzt bis auf drei weiße Deckenventilatoren und mehrere Klappstühle leer stand. Mein Bruder Todd überwachte die Reparaturarbeiten, und wir strichen die Wände weiß und wachsten die Holzfußböden. Zwei große Oberlichter durchfluteten den Raum mit Licht. Unter ihnen saß ich mehrere Tage an einem Kartentisch, trank Kaffee aus dem Deli und plante meine nächsten Schritte. Ich bräuchte Geld für eine neue Toilette, eine Kaffeemaschine und weißen Musselin für die Fenster. Praktische Dinge, die gewöhnlich in der Musik meiner Fantasie verschwanden.
Am Ende musste ich mein Café aufgeben. Zwei Jahre zuvor hatte ich in Detroit den Musiker Fred Sonic Smith kennengelernt. Eine unerwartete Begegnung, die langsam den Kurs meines Lebens veränderte. Meine Sehnsucht nach ihm durchdrang alles – meine Gedichte, meine Songs, mein Herz. Wir durchlitten eine Parallelexistenz und pendelten zwischen New York und Detroit, kurze Rendezvous, die immer in qualvollen Trennungen endeten. Ich plante gerade, wo ein Waschbecken und eine Kaffeemaschine installiert werden sollten, als Fred mich beschwor, nach Detroit zu kommen und mit ihm zu leben. Nichts schien wichtiger, als bei meinem Liebsten zu sein, den ich bald heiraten sollte. Ich verabschiedete mich von New York und den damit verbundenen Ambitionen, packte die wichtigsten Sachen und ließ alles andere zurück – und verlor infolgedessen meine Kaution und mein Café. Es war mir egal. Die einsamen Stunden, die ich, überflutet vom Glanz meines Traums und Kaffee trinkend, an dem Kartentisch verbracht hatte, genügten mir.
© Fred Smith
Ein paar Monate vor unserem ersten Hochzeitstag sagte Fred, wenn ich ihm verspräche, ihm ein Kind zu schenken, würde er vorher mit mir an jeden Ort der Welt fahren, egal wohin. Ohne zu zögern, entschied ich mich für Saint-Laurent-du-Maroni, eine Grenzstadt im Nordwesten von Französisch-Guayana, an der südamerikanischen Küste des Atlantischen Ozeans. Ich hatte mir schon lange gewünscht, die Ruinen der französischen Strafkolonie zu sehen, zu der man einst Schwerverbrecher verschiffte, ehe man sie weiter zur Teufelsinsel brachte. Im Tagebuch eines Diebes hatte Jean Genet Saint-Laurent als heiligen Boden und die dort eingesperrten Häftlinge mit andächtigem Mitgefühl beschrieben. Er sprach von einer Hierarchie unantastbarer Kriminalität, einer männlichen Heiligkeit, die in den schrecklichen Weiten von Französisch-Guayana zu vollster Blüte kam. Er hatte die Leiter zu ihnen erklommen: Besserungsanstalt, Gelegenheitsdieb und dreifacher Verlierer; doch nach seiner Verurteilung wurde das von ihm so hoch geschätzte Gefängnis wegen unmenschlicher Zustände geschlossen, und die letzten lebenden Insassen wurden nach Frankreich zurückverfrachtet. Genet saß seine Zeit im Zuchthaus von Fresnes ab und beklagte bitterlich, dass er niemals die von ihm angestrebte Größe erreichen würde. Am Boden zerstört, schrieb er: Man hat mich meiner Infamie beraubt.
© Patti Smith
Genet wurde zu spät verurteilt, um der Bruderschaft anzugehören, die er in seinem Werk verewigt hatte. Er musste außerhalb der Gefängnismauern bleiben wie der lahme Junge in Hameln, dem man den Eintritt ins Kinderparadies verweigerte, weil er zu spät gekommen war.
Mit siebzig war er Berichten zufolge bei schlechter Gesundheit und würde wahrscheinlich niemals selbst auf die Teufelsinsel kommen. Ich stellte mir vor, ihm Erde und Gestein von dort mitzubringen. Fred amüsierte sich zwar oft über meine abenteuerlichen Ideen, doch über diese selbst gestellte Aufgabe machte er sich nicht lustig. Er stimmte ohne Einwand zu. Ich schrieb einen Brief an William Burroughs, den ich seit meinen frühen Zwanzigern kannte. William, der Genet nahestand und ebenfalls eine romantische Ader hatte, versprach mir zu helfen, die Steine zum richtigen Zeitpunkt zu überbringen.
In Vorbereitung auf die Reise verbrachten Fred und ich unsere Tage in der Öffentlichen Bibliothek von Detroit und studierten die Geschichte von Surinam und Französisch-Guayana. Wir freuten uns darauf, einen Ort zu erforschen, den wir beide nicht kannten, und wir planten die ersten Etappen unserer Reise: Die einzig verfügbare Route war ein kommerzieller Flug nach Miami, dann brachte uns eine lokale Fluglinie über Barbados, Granada und Haiti schließlich nach Surinam. Wir müssten uns den Weg zu einer Ortschaft außerhalb der Hauptstadt suchen und dort per Boot den Maroni River nach Französisch-Guayana überqueren. Wir planten unsere Schritte bis spät in die Nacht. Fred besorgte Landkarten, Kakikleidung, Travellerschecks und einen Kompass, schnitt sein langes, dünnes Haar ab und kaufte ein Französisch-Wörterbuch. Wenn er sich einer Sache annahm, betrachtete er sie von allen Seiten. Genet las er allerdings nicht. Das überließ er mir.
Fred und ich flogen an einem Sonntag nach Miami und blieben für zwei Nächte in einem Motel, dem Mr. Tony’s. Es gab einen kleinen, knapp unterhalb der Decke festgeschraubten Schwarz-Weiß-Fernseher, den man mit 25-Cent-Stücken füttern musste, damit er funktionierte. Wir aßen rote Bohnen in Little Havana und besuchten Crocodile World. Der kurze Aufenthalt bereitete uns auf die extreme Hitze vor, die uns bald erwarten würde. Unsere Reise zog sich lange hin, da in Granada und Haiti alle Passagiere das Flugzeug verlassen mussten, während der Frachtraum auf Schmuggelware durchsucht wurde. Schließlich landeten wir im Morgengrauen in Surinam; eine Handvoll junger, mit Automatikwaffen ausgerüsteter Soldaten wartete, während man uns in einen Bus trieb, der uns in ein überwachtes Hotel brachte. Der erste Jahrestag eines Militärputsches, der die demokratische Regierung am 25. Februar 1980 stürzte, stand drohend bevor: ein Jubiläum nur wenige Tage vor unserem eigenen. Wir waren die einzigen Amerikaner, und sie versicherten uns ihres Schutzes.
Nach ein paar Tagen in der mörderischen Hitze der Hauptstadt Paramaribo fuhr uns ein Führer in die 150 Kilometer entfernte Ortschaft Albina am westlichen Flussufer zur Grenze nach Französisch-Guayana. Der pinkfarbene Himmel war von Blitzen durchzogen. Unser Führer fand einen jungen Mann, der uns in einer Piroge, einem langen Einbaum, über den Maroni River bringen wollte. Da wir vorausschauend gepackt hatten, waren unsere Taschen gut zu handhaben. Wir stießen uns bei leichtem Regen ab, der sich schnell zu einem heftigen Wolkenbruch steigerte. Der Junge gab mir einen Regenschirm und warnte uns davor, die Finger ins Wasser um das tief liegende Holzboot zu halten. Plötzlich sah ich, dass es in dem Fluss von kleinen schwarzen Fischen wimmelte. Piranhas! Er lachte, als ich meine Hand rasch zurückzog.
Nach ungefähr einer Stunde setzte uns der Junge am Fuß einer matschigen Böschung ab. Er zerrte seine Piroge an Land und ging zu einigen Arbeitern, die unter einem über vier Holzpfählen gespannten schwarzen Öltuch Schutz suchten. Unsere Verwirrung schien sie zu amüsieren, und sie wiesen in Richtung der Hauptstraße. Während wir uns eine rutschige Anhöhe hochquälten, ging der aus einem Gettoblaster schwebende Calypso-Rhythmus von Mighty Swallows Soca Dance in dem beharrlichen Regen unter. Völlig durchnässt stapften wir durch die leere Ortschaft und suchten schließlich in der anscheinend einzigen Bar Zuflucht. Der Barmann servierte mir Kaffee, Fred bestellte ein Bier. Zwei Männer tranken Calvados. Der Nachmittag verstrich, während ich mehrere Tassen Kaffee trank und Fred sich in gebrochenem Französisch-Englisch mit einem wettergegerbten Mann unterhielt, der über die Schildkrötenreservate in der Nähe wachte. Als der Regen nachließ, erschien der Besitzer des dortigen Hotels und bot seine Dienste an. Dann tauchte eine jüngere, mürrischere Version auf, um unsere Taschen zu tragen, und wir folgten den beiden auf einem verschlammten Pfad einen Hügel hinunter zu unserer neuen Unterkunft. Wir hatten kein Hotel gebucht, und dennoch erwartete uns ein Zimmer.
© Fred Smith
Das Hôtel Galibi war spartanisch, aber gemütlich. Auf einer Kommode standen eine kleine Flasche mit verdünntem Cognac und zwei Plastikbecher. Erschöpft schliefen wir, während der wieder einsetzende Regen gnadenlos auf das gewellte Blechdach trommelte. Als wir aufwachten, erwarteten uns zwei Schalen mit Kaffee. Die Morgensonne war heiß. Ich legte unsere Sachen zum Trocknen auf die Terrasse. Ein kleines Chamäleon verschmolz mit Freds kakifarbenem Hemd. Ich legte den Inhalt unserer Taschen auf einen kleinen Tisch. Eine welkende Landkarte, feuchte Quittungen, zerstückeltes Obst, Freds immer präsente Plektren.
© Patti Smith
Gegen Mittag fuhr uns ein Bauarbeiter zu den außerhalb gelegenen Ruinen des Straflagers von Saint-Laurent. Ein paar verirrte Hühner scharrten im Dreck, und ein umgestürztes Fahrrad lag da, sonst schien niemand in der Nähe zu sein. Unser Führer trat mit uns durch einen niedrigen Steinbogen und verschwand dann einfach. Das Gelände hatte etwas von einer tragikumwitterten stillgelegten Goldgräberstadt – einer Stadt, in der man Menschen gebrochen und ihre Hüllen auf die Teufelsinsel deportiert hatte. Fred und ich liefen in alchemistischem Schweigen umher und achteten darauf, die anwesenden Geister nicht zu stören.
Auf der Suche nach den richtigen Steinen trat ich in die Einzelzellen und untersuchte die verblichenen Graffiti an den Wänden. Haarige Eier, Schwänze mit Flügeln, das wichtigste Organ von Genets Engeln. Nicht hier, dachte ich, noch nicht. Ich sah mich nach Fred um. Er hatte sich durch hohes Gras und zugewucherte Palmen geschlagen und einen kleinen Friedhof entdeckt. Ich sah ihn vor einem Grabstein mit der Aufschrift Sohn, deine Mutter betet für dich. Er stand lange da und blickte in den Himmel. Ich ließ ihn allein, inspizierte die Nebengebäude und entschied mich schließlich für den Erdboden der Massenzelle, um die Steine zu sammeln. Es war ein feuchtkalter Ort von der Größe eines Flugzeughangars. Schwere, verrostete Ketten waren in den Wänden verankert, erhellt von schmalen Lichtkegeln. Dennoch war ein Hauch von Leben zu spüren: Dung, Erde und eine Vielzahl krabbelnder Käfer.
Ich grub ein paar Zentimeter tief und suchte Steine, die vielleicht von den harten Fußschwielen der Häftlinge oder den derben Stiefelsohlen der Wärter gepresst worden waren. Sorgsam wählte ich drei aus und steckte sie mit den daran haftenden Erdbrocken in eine große Gitanes-Streichholzschachtel. Fred gab mir sein Taschentuch, um mir den Schmutz von den Händen zu wischen, dann schüttelte er es aus und machte daraus ein Säckchen für die Streichholzschachtel. Er legte es in meine Hände – der erste Schritt, um sie irgendwann in die Hände von Genet zu legen.
Wir blieben nicht lange in Saint-Laurent. Wir fuhren ans Meer, durften jedoch die Schildkröten-Schutzgebiete wegen der Laichzeit nicht betreten. Fred hielt sich oft in der Bar auf und unterhielt sich mit den Männern. Trotz der Hitze trug er immer ein Hemd und eine Krawatte. Die Männer begegneten ihm ohne Ironie und schienen ihn zu respektierten. Diese Wirkung hatte er oft auf andere Männer. Ich begnügte mich damit, auf einer Kiste vor der Bar zu sitzen und die leere Straße entlangzustarren, die ich nie gesehen hatte und vermutlich nie wieder sehen würde. Auf derselben Strecke wurden einst die Gefangenen zur Schau gestellt. Ich schloss die Augen und stellte mir vor, wie sie ihre Ketten in der glühenden Hitze schleppten, grausame Unterhaltung für die wenigen Einwohner einer staubigen, verlassenen Stadt.
Auf dem Weg von der Bar zum Hotel sah ich weder Hunde, spielende Kinder noch Frauen. Die meiste Zeit blieb ich für mich. Manchmal sah ich das Dienstmädchen durchs Hotel huschen, ein barfüßiges Mädchen mit langem dunklem Haar. Sie lächelte und gestikulierte, sprach aber kein Englisch, immer in Bewegung. Sie räumte unser Zimmer auf, holte unsere Kleider aus dem Innenhof, wusch und bügelte sie. Aus Dankbarkeit schenkte ich ihr eins meiner Armbänder, eine Goldkette mit einem vierblättrigen Kleeblatt. Bei unserer Abreise sah ich es an ihrem Handgelenk.
In Französisch-Guayana gab es keine Züge, überhaupt keinen Schienenverkehr. Der Typ aus der Bar hatte uns einen Fahrer besorgt, der sich wie ein Statist in The Harder They Come gebärdete. Er trug eine Fliegersonnenbrille, schiefe Mütze und ein Hemd mit Leopardenmuster. Wir vereinbarten einen Preis, für den er uns die 268 Kilometer nach Cayenne bringen wollte. Er fuhr einen ramponierten hellbraunen Peugeot und bestand darauf, dass unsere Taschen bei ihm auf dem Beifahrersitz blieben, da im Kofferraum normalerweise Hühner transportiert würden. Auf der Route Nationale fuhren wir durch den anhaltenden Regen, unterbrochen von flüchtigem Sonnenschein, und hörten Reggaemusik auf einem ständig rauschenden Radiosender. Als der Empfang ganz versiegte, legte der Fahrer eine Kassette von einer Band namens Queen Cement ein.
Hin und wieder knotete ich das Taschentuch auf und betrachtete die Gitanes-Streichholzschachtel mit der Silhouette einer Zigeunerin, die mit ihrem Tamburin in einer indigoblau gefärbten Rauchwolke posierte. Aber ich öffnete sie nicht. Ich stellte mir einen kurzen triumphalen Augenblick vor, wenn ich Genet die Steine übergeben würde. Fred hielt meine Hand, während wir stumm durch dichte Wälder fuhren, vorbei an kleinen, stämmigen Amerindios mit breiten Schultern, die auf ihren Köpfen geschickt Leguane balancierten. Wir kamen durch kleine Gemeinden wie Tonate, die nur aus ein paar Häusern und einem einen Meter achtzig großen Kruzifix bestanden. Wir baten den Fahrer anzuhalten. Er stieg aus und untersuchte seine Reifen. Fred fotografierte das Schild, auf dem Tonate, 9 Einwohner stand, und ich sprach ein kurzes Gebet.
Wir hegten keine besonderen Wünsche oder Erwartungen. Die wichtigste Mission war erfüllt, wir hatten kein endgültiges Ziel, keine Hotelreservierungen; wir waren frei. Als wir uns Kourou näherten, spürten wir plötzlich eine Veränderung. Wir kamen in ein Militärgebiet und stießen auf einen Kontrollpunkt. Der Ausweis des Fahrers wurde geprüft, und nach einem unendlich langen Schweigen bedeutete man uns auszusteigen. Zwei Polizisten durchsuchten das Auto und fanden im Handschuhfach ein Schnappmesser mit einer kaputten Feder. Das kann nicht so schlimm sein, dachte ich, doch dann klopften sie auf den Kofferraum, und unser Fahrer wurde sichtlich nervös. Tote Hühner? Vielleicht Drogen. Sie umkreisten den Wagen und fragten ihn nach den Schlüsseln. Er warf sie in eine seichte Schlucht und wollte türmen, wurde aber schnell zu Boden gerungen. Ich warf Fred einen Blick aus den Augenwinkeln zu. Als junger Mann hatte er Ärger mit dem Gesetz gehabt und war immer vorsichtig im Umgang mit Behörden gewesen. Er ließ sich nichts anmerken, und ich folgte seinem Beispiel.
Sie öffneten den Kofferraum. Drinnen lag ein Mann, etwa Anfang dreißig, zusammengerollt wie eine Schnecke in einem rostbraunen Haus. Er hatte entsetzliche Angst, als sie ihn mit einem Gewehr anstießen und ihm befahlen auszusteigen. Wir wurden alle in die Polizeiwache getrieben, in getrennte Räume gebracht und auf Französisch verhört. Ich konnte so gerade die einfachsten Fragen beantworten, und Fred, der in einem anderen Raum saß, unterhielt sich mit Brocken von Bar-Französisch. Plötzlich tauchte der Kommandant auf, und wir wurden ihm vorgeführt. Er war breitbrüstig, mit dunklen, traurigen Augen und einem buschigen Schnurrbart, der sein vergrämtes, sonnengebräuntes Gesicht dominierte. Fred schätzte die Lage mit einem einzigen Blick ab. Ich schlüpfte in die Rolle der fügsamen Frau, denn in diesem zweifelhaften Anhang der Fremdenlegion befand ich mich definitiv in einer Männerwelt. Schweigend beobachtete ich, wie die menschliche Schmuggelware nackt und gefesselt abgeführt wurde. Fred wurde in das Büro des Kommandanten zitiert. Er drehte sich um und sah mich an. Bleib ruhig, war die Botschaft, die er mir aus seinen hellblauen Augen telegrafierte.
© Patti Smith
Ein Offizier brachte unsere Taschen herein, und ein anderer, der weiße Handschuhe trug, wühlte ihren Inhalt durch. Ich saß da und hielt das Taschentuchsäckchen. Ich war froh, dass ich es nicht abgeben musste, denn für mich hatte es als Gegenstand bereits eine Heiligkeit erlangt, die den zweiten Platz hinter meinem Ehering einnahm. Ich spürte zwar keine Gefahr, ermahnte mich aber, den Mund zu halten. Ein Vernehmer brachte mir schwarzen Kaffee auf einem ovalen Tablett mit einer blauen Schmetterlingsintarsie und trat in das Büro des Kommandanten. Ich konnte Freds Profil sehen. Nach einer Weile kamen sie heraus. Allem Anschein nach war die Stimmung gut. Der Kommandant umarmte Fred auf Männerart, und wir wurden in einen Privatwagen gesetzt. Wir sagten beide nichts auf der Fahrt in die Hauptstadt Cayenne, die am Ufer des Mündungsgebiets des Cayenne River lag. Der Kommandant hatte Fred die Adresse eines Hotels gegeben. Wir wurden am Fuß eines Hügels abgesetzt – Endstation. Es ist irgendwo da oben, sagte er, und wir trugen unsere Taschen die Steinstufen hinauf, die zu unserer nächsten Unterkunft führten.
– Worüber habt ihr zwei geredet?, fragte ich.
– Das kann ich dir nicht genau sagen, er hat nur Französisch gesprochen.
– Und wie habt ihr euch verständigt?
– Cognac.
Fred schien tief in Gedanken versunken.
– Ich weiß, du machst dir Sorgen um das Schicksal des Fahrers, sagte er, aber das liegt nicht in unseren Händen. Er hat uns in große Gefahr gebracht, und meine Sorge galt am Ende nur dir.
– Aber ich hatte keine Angst.
– Ja, sagte er, genau deshalb war ich besorgt.
© Patti Smith
Das Hotel war nach unserem Geschmack. Wir tranken französischen Brandy aus der Papiertüte und schliefen eingehüllt in mehrere Moskitonetze. In den Fenstern waren keine Scheiben – weder in unserem Hotel noch in den Häusern unten. Keine Klimaanlage, nur der Wind und sporadischer Regen brachten Erleichterung von der Hitze und dem Staub. Wir lauschten den Coltrane-artigen Schreien mehrerer Saxofone, die aus den Betonhäusern schwebten. Am Morgen erkundeten wir Cayenne. Der Marktplatz ähnelte einem Trapez, war schwarz-weiß gekachelt und mit hohen Palmen gesäumt. Es war Karneval, was wir nicht gewusst hatten, und die Stadt völlig ausgestorben. Das Rathaus, ein weiß gestrichenes Gebäude im französischen Kolonialstil des neunzehnten Jahrhunderts, war wegen des Feiertags geschlossen. Eine scheinbar verlassene Kirche stach uns ins Auge. Als wir das Tor öffneten, blätterte Rost auf unsere Hände. Wir warfen Münzen in eine alte Kaffeedose mit dem Logo The Heavenly Coffee, die für Spenden am Eingang stand. Staubmilben zerstoben in Lichtstrahlen und formten einen Heiligenschein über einem Engel aus leuchtendem Alabaster; hinter herabgestürzten Trümmerstücken lagen Heiligenikonen, unkenntlich unter Schichten von dunklem Lack.
© Patti Smith
Alles schien in Zeitlupe zu fließen. Obwohl wir Fremde waren, blieben wir unbemerkt. Männer feilschten um den Preis für einen lebenden Leguan, der mit seinem langen Schwanz um sich schlug. Überfüllte Fähren fuhren zur Teufelsinsel. Calypsomusik plärrte aus einer Mammutdisco in Form eines Gürteltiers. Ein paar kleine Souvenirstände mit identischem Angebot: dünne, rote Decken, hergestellt in China, und metallicblaue Regenmäntel. Aber zumeist gab es Feuerzeuge, alle möglichen Feuerzeuge mit Bildern von Papageien, Raumschiffen und Männern der Fremdenlegion. Eigentlich hielt uns nichts in dieser Stadt, und so überlegten wir, ein Visum für Brasilien zu beantragen, und ließen uns von einem mysteriösen Chinesen namens Dr. Lam fotografieren. Sein Studio war voll mit großformatigen Kameras, kaputten Stativen und Reihen von Kräutermedizin in großen Glasflakons. Wir nahmen unsere Visa-Fotos, blieben aber, als wären wir verzaubert, bis zu unserem Hochzeitstag in Cayenne.
Am letzten Sonntag unserer Reise feierten Frauen in bunten Kleidern und Männer mit Zylinderhüten das Ende des Karnevals. Zu Fuß folgten wir ihrer provisorischen Parade und landeten in Rémire-Montjoly, einer Gemeinde im Südosten der Stadt. Die Feiernden zerstreuten sich. Rémire war ziemlich verlassen, und ich stand mit Fred da, verwundert über die Leere der langen, geschwungenen Strände. Es war ein perfekter Tag für unser Jubiläum, und ich dachte unwillkürlich, es wäre der perfekte Ort für ein Strandcafé. Fred lief voraus und pfiff einem Hund hinterher, dessen Herrchen nirgends zu sehen war. Als Fred einen Stock ins Wasser warf, holte ihn der Hund. Ich kniete mich in den Sand und skizzierte mit dem Finger einen groben Plan für mein imaginäres Café.
Ein verwinkelter Raum mit dunklen Nischen, ein Glas Tee, ein aufgeschlagenes Tagebuch und ein runder Metalltisch, ausbalanciert mit einem leeren Zündholzheftchen. Cafés. Le Rouquet in Paris, Café Josephinum in Wien, Bluebird Coffeeshop in Amsterdam, Ice Café in Sydney, Café Aquí in Tucson. Wow Café in Point Loma, Caffe Trieste in North Beach, Caffé del Professore in Neapel, Café Uroxen in Uppsala, Lula Café in Logan Square und Café Zoo im Berliner Bahnhof.
Das Café, das ich nie verwirklichen, die Cafés, die ich nie kennen werde. Als könnte er meine Gedanken lesen, bringt Zak mir wortlos noch eine Tasse.
– Wann willst du dein Café eröffnen?, frage ich ihn.
– Wenn das Wetter besser wird, hoffentlich zum Frühlingsanfang. Ein paar Kumpel und ich. Wir müssen noch einige Sachen regeln, und wir brauchen etwas mehr Kapital für die Ausstattung.
Ich frage ihn, wie viel, biete an zu investieren.
– Bist du sicher?, fragt er leicht überrascht, denn eigentlich kennen wir uns nicht sehr gut, nur durch unser tägliches Kaffeeritual.
– Klar, ganz sicher. Ich wollte auch mal ein Café haben.
– Du bekommst für den Rest deines Lebens Kaffee umsonst.
– So Gott will, sage ich.
Ich sitze vor Zaks unvergleichlichem Kaffee. Oben rotieren die Ventilatoren und ahmen die vier Richtungen einer Wetterfahne nach. Starke Winde, kalter Regen oder Regengefahr; eine drohende Abfolge unheilvoller Wetterlagen, die mein ganzes Wesen unterschwellig durchdringen. Ohne es zu merken, gleite ich in ein leichtes, schwelendes Unwohlsein. Keine Depression, eher ein Hang zur Melancholie, die ich in der Hand drehe wie einen kleinen Planeten, überzogen von Schatten, unmöglich blau.
Umschalten
Ich steige die Treppe hinauf in mein Zimmer mit seinem Oberlicht, einem Arbeitstisch, einem Bett, der Navyflagge meines Bruders, eigenhändig von ihm gebündelt und verschnürt, und einem kleinen, mit einem fadenscheinigen Laken drapierten Sessel in der Ecke am Fenster. Ich ziehe meinen Mantel aus, es ist Zeit weiterzumachen. Ich habe einen schönen Schreibtisch, arbeite aber lieber im Bett, wie eine Genesende in einem Gedicht von Robert Louis Stevenson. Ein optimistischer, an Kissen gelehnter Zombie, der Seiten von somnambulen Früchten gebiert – nicht ganz reif oder überreif. Manchmal schreibe ich direkt in meinen kleinen Laptop und sehe schuldbewusst zum Regal, auf dem meine Schreibmaschine mit ihrem alten Farbband neben einem obsoleten Textcomputer von Brother steht. Eine anhaltende Loyalität hält mich davon ab, die beiden zu verschrotten. Dann liegen da viele Notizbücher, deren Inhalt ruft – Geständnis, Offenbarung, endlose Variationen desselben Paragraphen –, und Stapel von Servietten mit hingeschmierten unverständlichen Texten. Verkrustete Tintenfässer, Schreibfedern, Ersatzpatronen für längst verschwundene Füller, Druckbleistifte ohne Minen. Strandgut einer Schriftstellerin.
Roberto Bolaños Stuhl, Blanes, Spanien © Patti Smith
Ich schenke mir Thanksgiving und schleppe mein Unwohlsein durch den Dezember, mit einer ausgedehnten Phase selbst auferlegter Einsamkeit, leider ohne aufhellende Wirkung. Morgens füttere ich die Katzen, packe stumm meine Sachen und mache mich auf den Weg über die Sixth Avenue ins Café ’Ino, sitze an meinem gewohnten Tisch in der Ecke und tu so, als würde ich schreiben oder ernsthaft schreiben, mit den mehr oder minder gleichen zweifelhaften Resultaten. Ich meide soziale Verpflichtungen und plane aggressiv, die Feiertage allein zu verbringen. Am Heiligabend überreiche ich den Katzen Mäusespielsachen mit Katzenminze, gehe ziellos hinaus in die verwaiste Nacht und lande schließlich nahe dem Chelsea Hotel in einem Kino, das im Spätprogramm Verblendung zeigt. Ich kaufe mein Ticket, hole mir im Deli an der Ecke einen großen schwarzen Kaffee und eine Tüte Bio-Popcorn und mache es mir hinten im Kino auf meinem Platz gemütlich. Nur ich und zwanzig andere Müßiggänger, angenehm isoliert von der Welt, die ihrer eigenen Art von Festtagsstimmung frönen, ohne Geschenke, ohne Christkind, ohne Lametta oder Mistelzweige, nur ein Gefühl vollkommener Freiheit. Ich mochte die Ästhetik des Films. Ich hatte die schwedische Fassung bereits ohne Untertitel gesehen, kannte die Bücher aber nicht und konnte jetzt also dem Plot folgen und mich in der öden schwedischen Landschaft verlieren.