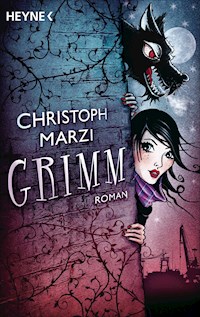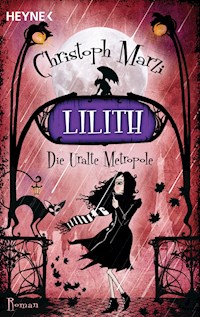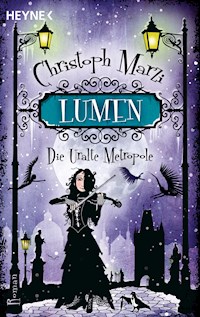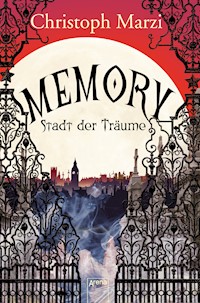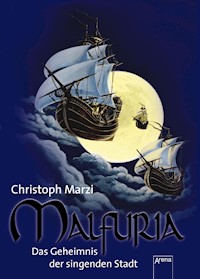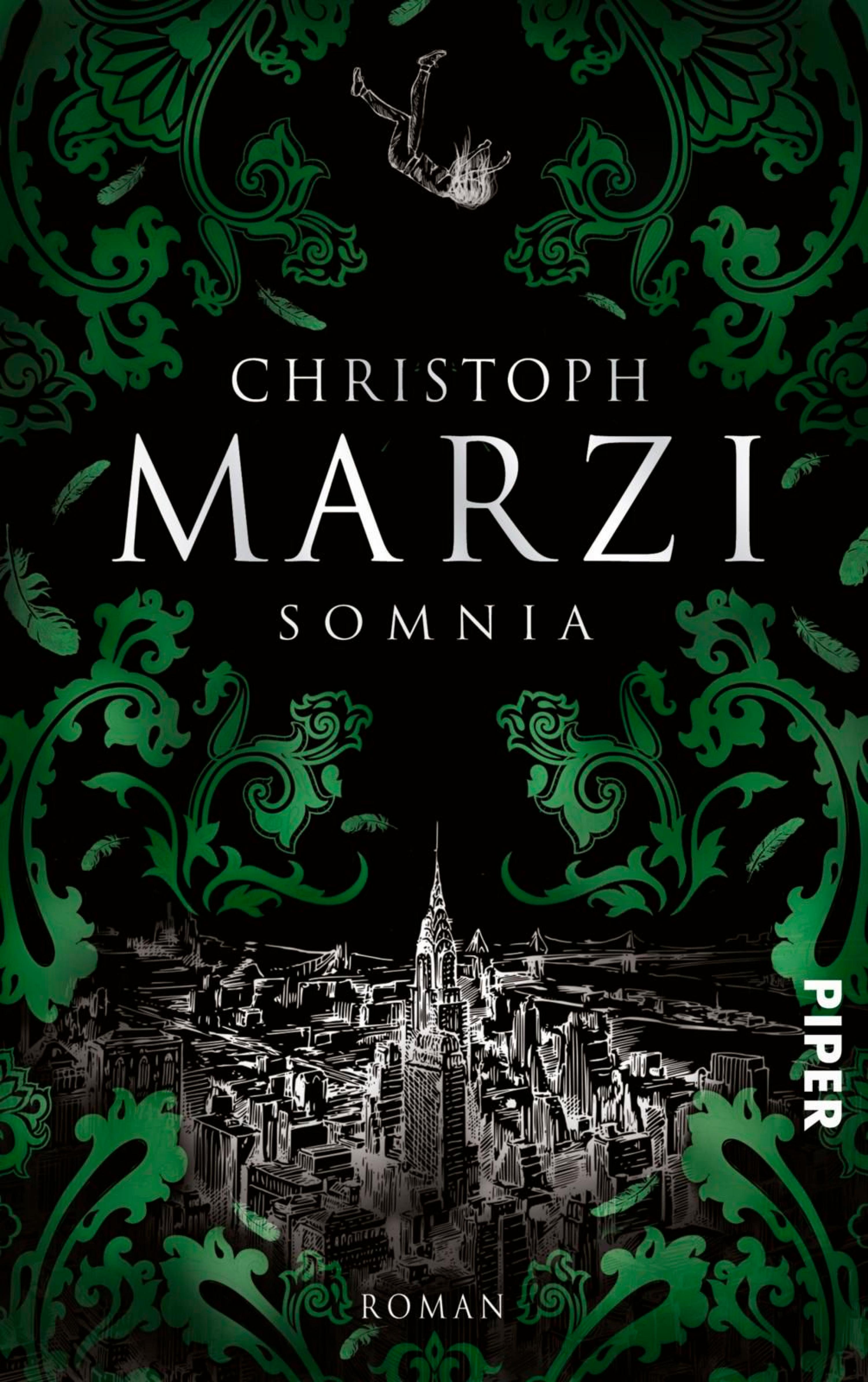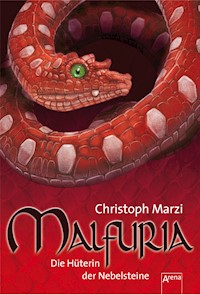
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arena
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Malfuria
- Sprache: Deutsch
Catalina Soleado kann die Welt verändern - mit einem einzigen Federstreich. Doch ihre Gabe ist gefährlich. In einem Barcelona, in dem die Schatten die Macht übernommen haben, machen magische Buchstabenwesen, wispernde Mosaikschlangen und fliegende Galeonen Jagd auf das Mädchen. Während ihr Gefährte Jordi den Kampf aufnimmt, muss Catalina in Malfuria, dem wirbelnden Sturm aus Rabenfedern, über die Meere fliegen. Dort trifft sie auf ein uraltes Geheimnis...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 323
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Titel
Christoph Marzi
Malfuria
Die Hüterin der Nebelsteine
Impressum
Erste Veröffentlichung als E-Book 2012 © 2007 Arena Verlag GmbH, Würzburg Umschlagillustration: Ralf Nievelstein ISBN: 978-3-401-80018-9 www.arena-verlag.de
Für Steffen
Prolog
Selbst die Stille hielt furchtsam den Atem an. Noch immer wurde die Asche vom Wind über die schroffen Klippen getragen, wie schon so viele Tage zuvor, sanft schwebende Tintenspritzer im Abendrot. In den Wellen, dort unten am Strand, spiegelten sich die Umrisse des Schiffes, das nur zu einem Zweck hierhergekommen war. Es hatte die vermummte Frau zur Insel gebracht.
Kassandra Karfax war hier, um die Hexe zu finden.
Alle hatten sie ihr gesagt, Nuria Niebla sei tot. Verbrannt mit all ihren Karten, angezündet von eigener Hand. Die Finsterfalter hatten es ihr nachts zugeflüstert. Doch sie hatten sich getäuscht.
Regungslos stand Kassandra Karfax vor den Überresten des kleinen Steinhauses, das Nuria gehört hatte. Das Dach, windschief und löchrig, war schon seit Tagen in sich zusammengestürzt. Knorrig wie die Gerippe toter Tiere reckten sich die verkohlten Balken in den Abendhimmel. Kein Pergament hatte diesem Inferno entrinnen können.
Hier also hatte sie gelebt, hier hatte sie sich versteckt gehalten, all die Jahre lang. Doch nun war das Dorf den Flammen zum Opfer gefallen und in den Ruinen der Häuser lebten jetzt Schatten, die ein Heim in den Körpern der wenigen Überlebenden gefunden hatten. Tief in den Kellern verbargen sie sich vor der Sonne, die bald untergegangen sein würde.
Kassandra rührte sich noch immer nicht.
Hinter ihrem Rücken zerrten die Eistreter, die anstelle von Gesichtern bunt grinsende Harlekin-Masken trugen, einen jungen Mann durch die weiße Asche der Feuersbrunst. Kassandra hörte, wie der Mann sich wehrte, sie konnte seine Furcht förmlich riechen. Er stöhnte auf, als ihn die Eistreter zu Boden warfen, wo er kniend verharrte, bis sich die Reisende ihm zuwenden würde.
Die Reisende…
Das war der Name, den sie sich selbst gegeben hatte.
Kassandra Karfax war die Reisende.
Eine Frau war sie gewesen, schön und faszinierend. Jetzt war sie ein Abbild, schal wie Papier und doch voller Leben. Die Künstlerin von damals hatte sich selbst neu erschaffen und die Meere der Zeit überwunden. Sie hatte gemalt, wovon andere nur in ihren Träumen heimgesucht werden: La Reina de la Sombra, die Schöne, die bunteste Farben zu schlucken vermochte. Sie hatte die Schattenkönigin gemalt. Ferne Länder hatte sie bereist, gemeinsam mit La Sombria, weite Ebenen aus Nacht und Nie, wo Finsternis erblühte und das Licht nur ein Traum war, den keiner richtig zu deuten vermochte. Dann war sie zurückgekehrt, während sie die Welt im Glauben ließ, schon seit Hunderten von Jahren tot zu sein.
Andere hatten derweil die Geschicke der Familie Karfax gelenkt, doch sie, die dunkle, schöne Reisende, hatte über das, was all die Jahre über geschehen war, gewacht.
Sie hatte Pläne geschmiedet und Verbündete gefunden.
Die Zeit war da. Endlich!
»Sag mir«, flüsterte sie, »wirst du reden?« Sie drehte sich um.
Der Mann, der hinter ihr im Dreck kniete, zitterte am ganzen Leib. Den Kopf hielt er gesenkt, als könne ihn das retten. Wirr hing ihm sein Haar ins Gesicht.
»Du tust gut daran, mich nicht anzusehen«, sagte Kassandra und ihre Stimme war alt und süß wie Rosenblätter, die der Wind zu Boden weht.
Der Mann, auf den die Eistreter in den Ruinen eines Hauses gestoßen waren, schwieg. Außer ihm hatten sie keine Menschenseele im Dorf vorgefunden. Sie alle fürchteten sich vor dem, was in den Tiefen der Gebäude lauerte.
»Was hast du hier verloren, an diesem trostlosen Ort?« Kassandra trat einen Schritt auf ihn zu.
»Ich habe früher in diesem Dorf gelebt.«
»Und warum bist du zurückgekehrt?«
»Die Neugierde hat mich getrieben. Ich wollte…«
Sie gebot ihm zu schweigen. Es interessierte sie nicht. Das nicht.
Der Harlekin zischte etwas und Kassandra Karfax, deren Gesicht sich im Schatten einer tiefen Kapuze verbarg, seufzte.
»Was hast du gesehen?« Sie streckte den Arm aus und berührte die Stirn des Mannes mit ihren langen Fingern. »Was ist mit der alten Frau geschehen, die hier gelebt hat?« Sie sprach den Namen aus wie eine ansteckende Krankheit: »Nuria Niebla, so hat sie sich genannt, nicht wahr?«
»Sie ist verbrannt«, stammelte der Bauer.
Kassandra Karfax sah hinüber zu den Klippen und weiter auf die Küstenlinie. Die Bucht von Xarraca, Nuria Nieblas Zuflucht, hatte sich verändert. Es gab Strände, wo vorher nur Klippen gewesen waren. Und Klippen, wo einmal Häfen erbaut worden waren.
»Der Arxiduc ist mit einem fliegenden Schiff zur Insel gekommen«, stammelte der Mann. »Er hat alles zerstört.«
Kassandra machte eine wegwerfende Handbewegung. Sie wusste, wer das Feuer gelegt hatte. Auch das war nicht von Bedeutung. »Wann sind die Flammen erloschen?«
»Eine ganze Nacht und einen ganzen Tag lang haben sie gewütet.«
»Alle Feuer?«
Er nickte.
Kassandra Karfax konnte die kalte Asche riechen, die vom Wind davongetragen wurde.
Wo waren die Pergamente? Darum, nur darum ging es. War alles zu Asche zerfallen? Karten, Tand, Nuria selbst?
Nein, das wollte sie nicht glauben. Das konnte sie nicht glauben.
»Hast du Raben gesehen?«
»Sie sind alle fort«, sagte der Mann. »Früher gab es viele Raben hier in der Gegend.« Er zitterte am ganzen Leib. Die eisige Kälte, die von den Eistretern ausging, schnitt ihm in die Haut.
»Wie sahen die Feuer aus?«
Der Mann zögerte, nur kurz.
Schnell wie ein Schattenriss wirbelte Kassandra zu ihm herum. »Rede!«, zischte sie ungeduldig und trat mit der Stiefelspitze in den Staub. »Du hast die Frage verstanden!«
»Sie waren groß, diese Feuer«, antwortete er schnell. »Alles haben sie verzehrt, alles.«
»Gab es Flammen, die über die Erde gewandert sind?«
»Das Feuer war wie ein Sturm und es war überall. Bis zu den Klippen hat es gewütet.«
Kassandra Karfax hatte genug gehört.
Bis zu den Klippen…
Nachdenklich blickte sie aufs Meer hinaus. Dorthin, wo die Galeone über dem feinen Sandstrand schwebte.
Die Geschichte, dachte sie, darf sich nicht wiederholen. Sie betrachtete den Bauern, der vor ihr kniete. Der Wicht war so ahnungslos.
Viele, viele Jahre zuvor hatten sich die Kartenmacherinnen an einem Ort namens Malfuria vereint und die Bemühungen der Schatten, eine Stadt nach ihren Wünschen zu gestalten, vereitelt. Die Hexen hatten die Stadt, deren Namen heute niemand mehr kannte, von den Landkarten getilgt und der alten Welt ein neues Gesicht gegeben.
Aber für diese Freveltat hatten sie einen Preis zahlen müssen. Alle, außer Nuria Niebla. Die listige Vettel hatte schon damals mehr Weitsicht als die anderen Hexen bewiesen und sich nicht nach Malfuria begeben. Nur deswegen war ihrer Tochter nichts zugestoßen: Sarita, die ihrerseits ein Mädchen geboren hatte.
Nuria Niebla. Sarita Soleado. Und das Mädchen. Catalina.
Einzig diese drei besaßen das Talent, das Antlitz der Welt zu verändern. Sie waren die letzten der Kartenmacherinnen, die noch lebten. Und es war ihr Talent, das sie so gefährlich machte.
Kassandra Karfax streckte die Hand aus. Sie hatte erfahren, weswegen sie hergekommen war. Es war genug.
»Sieh mich an.«
Der junge Bauer hob den Kopf und blickte sie an, eine vermummte Gestalt, deren Gesicht sich im Schatten einer Kapuze verbarg. Seine Lippen bebten und Tränen rannen ihm über das schmutzige Gesicht.
Langsam, behutsam, wie ein geflüstertes Versprechen, zog Kassandra ihre Kapuze zurück.
Das, was der junge Mann dann sah, brachte ihn im Aufflackern eines Funkenschlags um den Verstand. Sein Schrei, in dem der Wahnsinn tobte, fand kein Ende mehr und hallte selbst dann noch über die zackigen Klippen bis weit hinaus aufs offene Meer, als die Morgenröte den kommenden Tag ankündigte und die Reisende sich längst auf den Weg nach Barcelona gemacht hatte.
Über die Wolken, über die See
Als das Mädchen erwachte, blickte es in ein Paar schmale Katzenaugen, golden wie das Harz, das mittags auf den knorrigen Pinienzweigen am Montjuic im Sonnenschein glänzte. Fast war ihm, als könne es den Wind über dem Rauschen des Meeres hören.
Catalina Soleado streckte sich schlaftrunken, als sei sie selbst eine Katze. Sie gähnte und strich sich durch die vielen struppigen Zöpfe, die dringend neu geflochten hätten werden müssen.
»Wer bist du?«, fragte sie das geschmeidige kleine Tier mit dem Fell aus Samt und Federn, das direkt vor ihr saß. Der Kater legte den Kopf schief und schnurrte.
Und in diesem Moment kehrte alles zurück.
Die Furcht und der Schmerz, die Sehnsucht und der Verrat.
Catalina war nicht mehr in Barcelona und der Kater, der neben ihr stand, hatte die Straßen der singenden Stadt noch nie gesehen.
Der Wind draußen vor dem Fenster war nicht El Cuento, ihr Freund, mit dem sie sprechen konnte.
Und den Raum, in dem sie sich befand, hatte sie noch nie zu Gesicht bekommen.
Alles um sie herum begann sich zu drehen und Catalina schloss für einen Moment die Augen. Sie dachte an El Cuentos verrückte oder abenteuerliche Geschichten, von denen er behauptet hatte, sie würden alle der Wahrheit entsprechen. Aber wie hätte sie jemals wissen können, dass sie selbst einmal in eine von ihnen hineingeraten würde? Und doch war es so passiert.
Es waren wirbelnde Rabenfedern gewesen, die Catalina inmitten des Chaos in der Sagrada Família umschlungen und hierhergebracht hatten. Sie erinnerte sich an eine alte Frau, Agata la Gataza, die sie empfangen hatte, und an eine junge Frau, die wie eine Zigeunerin aussah. An eine Tasse süßen, warmen Tee, den sie getrunken hatte. Doch dann –
Was war dann passiert?
Malfuria. Das war der Name dieses Orts – jetzt wusste sie es wieder. Der Sturm namens Malfuria war nach Barcelona gekommen, hatte die junge Kartenmacherin aufgenommen und vor einem schlimmeren Schicksal bewahrt.
Aber Jordi war nicht bei ihr gewesen.
Plötzlich kam Leben in Catalina. Was war mit Jordi geschehen? War Malfuria nach Barcelona zurückgekehrt, um ihrem Freund und Gefährten beizustehen, wie Catalina es von der alten Frau gefordert hatte?
Sie sprang auf die Füße, die genauso schwarz und dreckig waren wie ihre zerrissene Hose, und sah sich hastig um.
Der Raum, in dem sie sich befand, war nicht besonders groß. Warme Sonnenstrahlen fanden ihren Weg durch ein einzelnes rundes Fenster. Ein verhuschter Wind wehte zögerlich winzige Federn über den Teppich, der den hölzernen Boden mit verschlungenen Mustern bedeckte. El Cuento war es nicht, das konnte sie riechen. Bis auf die Decke, auf der sie geschlafen hatte, und den kleinen schwarzen Kater war das Zimmer leer.
Catalina entfuhr ein leises Stöhnen. Sie erinnerte sich daran, wie sich Jordis und ihr Weg getrennt hatten, weil er sie hatte beschützen wollen. Er war es gewesen, der ihre Flucht überhaupt möglich gemacht hatte. Und während er in Barcelona um sein Leben kämpfte, war sie einfach eingeschlafen!
Wie viel Zeit seit ihrer Ankunft verstrichen war, das vermochte sie nicht zu sagen. Eine Stunde vielleicht, womöglich ein ganzer Tag? Als sie hierhergekommen war, da war es jedenfalls genauso hell gewesen wie jetzt auch.
Verzweifelt blickte sie sich nach einer Tür um, doch es gab keine. Es gab nur das runde Fenster in diesem winzig kleinen Raum.
Keine Tür, keinen Ausweg.
Catalina holte tief Luft. Hatte man ihr nicht gesagt, dass Agata la Gataza, die Hüterin von Malfuria, eine mächtige und gerechte Hexe sei? Dass sie ihr helfen würde?
Stattdessen sperrte man sie hier ein, in diesem Raum ohne Türen, und überließ sie einfach sich selbst. So hatte sie sich Malfuria nicht vorgestellt!
Sie lief auf die kreisrunde Fensteröffnung zu und schon beim ersten Schritt spürte sie, wie der warme Boden unter ihren nackten Füßen vibrierte. Alles war fremd, nichts war ein Zuhause.
»Jordi Marí«, flüsterte sie, als könne schon allein der Klang dieses Namens einen Zauber bewirken. »Wo bist du? Bist du hier?« Der schnurrende Kater strich ihr an den Beinen entlang, als wolle er sie besänftigen.
Dann trat sie auf das Fenster zu, schaute hinaus. Taumelte, schrie fast auf vor Schreck oder Verwunderung – oder beidem.
Weit, unendlich weit unter ihr glitt das Meer dahin. Es waren kleine Schiffe zu erkennen, deren Segel winzige Dreiecke waren, in den azurblauen Weiten ausgesetzt wie Farbtupfer. Strahlend weiße Wolkenberge schoben sich vor ihren Blick und warfen Schatten hinab aufs Wasser, das bis zum Horizont reichte.
»Wir sind über den Wolken.« Catalina hielt sich mit beiden Händen an der Wand fest und konnte den Blick nicht lösen von dem, was sie da sah. Erneut trat sie vor, um vorsichtig aus dem Fenster nach unten zu schauen. »Das ist so hoch!«
Der Kater zu ihren Füßen war gänzlich unbeeindruckt von dem, was sie gerade gesagt hatte.
Sie erkannte Rabenfedern, die dicht an dicht einen Wirbel formten, der bis zur Erde reichte. Oder täuschte sie sich? Wenn das Licht einen anderen Weg durch die Wolken nahm, schien der Sturm mit einem Mal hoch über der See zu schweben.
Catalina kniff die Augen zusammen und suchte den Horizont ab, doch wohin sie ihren Blick auch schweifen ließ, von der singenden Stadt war keine Spur mehr zu entdecken.
Nur das endlose Meer, hell und leer und ganz anders als alles, was sie in Barcelona gesehen hatte. Die Schatten waren dort selbst in die entlegensten Winkel gekrochen, während die Harlekins mit ihren Eismasken Jagd auf die Menschen machten und die singende Stadt immer dunkler geworden war.
Dort hatte sie Jordi zuletzt gesehen. Er hatte ihre Verfolger abgelenkt und sich damit den Mächten gestellt, von denen er genauso wenig verstand wie Catalina selbst. Schatten, die zum Leben erwachten. Finsternis, die atmete.
Catalina spürte, wie ihr Herz schneller schlug und die Panik in ihr hochkochte.
Hilflos schlug sie mit der Faust gegen die Wand, die aus dichten Federn und kleinen Steinchen zu bestehen schien. Für einen kurzen Augenblick nur glaubte sie zu erkennen, dass die Steinchen vor ihrer Faust zurückwichen und die Rabenfedern sich schützend wie Blätter um sie legten.
Alles kam ihr mit einem Mal so eng vor. Sie war gefangen an einem uralten Ort, der hoch oben am Himmel stürmte.
Du musst ruhig bleiben, beschwor sie sich. Vielleicht war Malfuria schon vor Stunden nach Barcelona zurückgekehrt und hatte Jordi gerettet, ebenso wie er Catalina in letzter Sekunde vor ihrem Schicksal bewahrt hatte.
Aber wenn Jordi hier war, warum hatte man ihn nicht zu ihr gelassen? Sie ballte die Faust. »Wo seid ihr denn alle?«, schrie sie, so laut sie konnte. Erneut schlug sie gegen die Wand, mit aller Kraft, die sie aufbringen konnte. Dann sah sie den Kater an. »Oder gibt es nur dich?«
Erwartungsgemäß schwieg der Kater. Er sah sie an, mit diesen güldenen Katzenaugen, die alles denken konnten und doch nichts verraten würden.
Dafür schloss sich das Fenster vor ihr, einfach so und ganz von allein. Die Steinchen und Federn flossen ineinander und es wurde dunkler im Raum.
An der Decke des Zimmers aber bewegte sich etwas.
Catalina wich zur Seite, um besser sehen zu können, was da oben vor sich ging. Der Kater lief ihr mit Samtpfoten über die nackten Füße.
Ein flinker Strudel aus bunten Mosaikplättchen bildete sich an der Decke, wirbelte die Steinchen und Federn und Stücke von Holz wild durcheinander, bis ein breiter Trichter entstand, aus dem ein Lampion aus Papier hervorquoll. Chinesische Schriftzeichen und indische Zeichnungen verzierten das Papier, das zu einem Ballon aufgebläht war, in dessen Mitte eine Kerze loderte.
Das alles passierte so schnell, dass Catalina nicht einmal bemerkte, wie sich eine Lücke in der Wand hinter ihrem Rücken öffnete.
Plötzlich berührte sie jemand am Arm.
Catalina wirbelte herum und blickte in das Gesicht der jungen Frau, die wie eine Zigeunerin aussah. Ihr langes pechschwarzes Haar fiel ihr weit über die Schultern und war von bunten Bändern durchzogen. Der Rock, dessen Muster wie gesungene Lieder und erzählte Geschichten aussahen, reichte ihr bis zu den nackten Füßen.
Makris de los Santos. Die junge Frau, die ihr den süßen Tee gegeben hatte, kurz bevor sie eingeschlafen war.
»Die Späher sind zurückgekehrt«, sagte die Zigeunerin. »Sie haben Kunde gebracht.«
Catalina interessierte sich nicht für irgendwelche Späher.
»Wo ist Jordi?«, verlangte sie zu wissen. »Und warum habt ihr mich eingesperrt?«
Makris lächelte traurig. »Du hättest jederzeit gehen können.«
Wütend trat das Mädchen auf sie zu. »Wohin denn? Wir befinden uns in den Wolken!«
Die Zigeunerin zuckte mit den Schultern. »Über den Wolken, über der See.«
Catalina funkelte sie an. »Vielen Dank auch. Als hätte ich das nicht selbst gemerkt.« Sie holte tief Luft. »Was ist mit Jordi? Wo zum Teufel steckt er?«
Dort, wo eben noch eine Tür gewesen war, schloss sich die Wand mit einem raschelnden Geräusch und ein Meer von Farnen ergoss sich über den Boden.
»Du hast im Schlaf von ihm gesprochen.« Makris de los Santos ging auf ein Fenster zu, das sich neu geformt hatte. Der filigrane Silberschmuck an ihren Hand- und Fußgelenken klimperte.
Catalina stieß ein so wütendes Fauchen aus, dass der Kater sie vorwurfsvoll ansah. »Ich habe dir eine einfache Frage gestellt! Und ich will auf der Stelle eine Antwort haben, mit der ich etwas anfangen kann!« Sie stampfte mit dem Fuß auf und spürte, wie ihre Zehen ein Stück weit in den Boden einsanken.
Makris blieb vor dem Fenster stehen, doch sie wandte sich nicht zu Catalina um. »Die Späher haben es berichtet«, sagte sie. »Barcelona ist mittlerweile Vergangenheit. Wir konnten nicht in die Stadt zurückkehren. Es wäre zu gefährlich gewesen.« Die Zigeunerin löste ein Band aus ihrem Haar und wickelte es sich nachdenklich um den Finger. »La Gataza hat richtig entschieden. Die Schatten sind jetzt überall in der Stadt.«
»Was soll das heißen?« Catalina spürte, wie ihr Herz schneller schlug und ihr Tränen in die Augen schossen. »Was meinst du damit, wir konnten nicht zurückkehren? Sieh mich an! Was ist mit Jordi passiert?« Sie erinnerte sich an den Tee, den man ihr gereicht hatte. Süß hatte er geschmeckt, wie Honig, der etwas verbergen soll. »Da war etwas im Tee!«
»Der Schlaf hat dir gutgetan«, erwiderte Makris de los Santos nur.
»Wie weit?« Catalina starrte sie an. »Wie weit sind wir schon weg?«
Die Fragen in ihr brannten wie Feuer, loderten auf und verschlangen etwas tief in ihr drin, das sie gerade kennengelernt hatte.
Jetzt erst drehte sich Makris zu ihr um und Catalina sah die Antworten in ihren Augen.
Sie öffnete den Mund, wollte die Frau zur Rede stellen, wollte sie anschreien, doch stattdessen kam kein Laut über ihre Lippen. Der Zorn, der eben noch in ihr gewütet hatte, sank in sich zusammen und wurde zu etwas anderem.
»Jordi«, flüsterte sie.
Unter der Brücke in Pla Cerdà hatte sie ihn das letzte Mal gesehen. Sie erinnerte sich, wie er sie geküsst hatte, einfach so, ohne zu fragen. »Bis bald«, hatte er gesagt und war losgelaufen, um ihre Verfolger auf eine falsche Fährte zu locken, damit sie in Sicherheit war.
Es war seine Entscheidung gewesen.
Doch es war ihre Schuld.
»Ich«, sagte sie, »ich hätte ihn nicht zurücklassen dürfen. Ich hätte es einfach nicht zulassen dürfen.«
Makris de los Santos schwieg. Ihre dunklen, geschminkten Augen ruhten auf Catalina wie wunderschöne Monde. »Du solltest nicht dir die Schuld geben«, sagte sie schließlich und berührte die Wand ganz sachte mit dem Finger. »Die Welt da draußen ist seltsam und wir sind wie ausgerissene Federn, die der Wind durch das Leben trägt.« Die Wand, die jetzt ein Geflecht aus Holzstücken und Rabenfedern war, formte erneut ein rundes Fenster, durch das Catalina auf die Wolken hinabschauen konnte, die wie ein Ozean aus Weiß und Watte unter dem Rabenfedernsturm dahinzogen. In den Wolken gab es kleine und große Löcher und tief, tief unten schimmerte das helle Blau des Mediterráneo.
Barcelona, das wusste das Mädchen jetzt, war weit weg. Und im gleichen Atemzug wurde Catalina mit schrecklicher Gewissheit klar, dass Malfuria – egal, was sie tun, sagen oder denken würde – nicht mehr dorthin zurückkehren würde.
»Er lebt«, sagte sie trotzig. »Jordi lebt noch. Ich spüre es.«
Etwas strich ihr über den nackten Fuß, sie sah, dass es der kleine Kater war. Eine Feder löste sich aus seinem Fell und fiel auf ihren Fuß. Ein leiser Windhauch, oder vielleicht war es auch etwas anderes, bewegte sie, Catalina kam es vor, als ob eine Hand sie streichelte.
Sie atmete tief durch. Die Vorstellung, dass Jordi an ihrer Seite sein könnte und es doch nicht war, ließ sie an all das Unausgesprochene zwischen ihnen denken, an das, was sie versäumt hatte, ihm zu sagen.
»Ich wünsche ihm alles Glück.« Makris de los Santos war es, die schließlich das Schweigen brach. Sie suchte gar nicht erst nach dürftigen Trost spendenden Floskeln oder besänftigenden Lügen, wie es Erwachsene normalerweise zu tun pflegen. Nein, sie wünschte ihm einfach nur Glück – und Catalina spürte, dass dieser Wunsch wahrhaftig war.
»Danke«, sagte Catalina niedergeschlagen und doch etwas besänftigt.
»Wofür?«
»Für den Wunsch.« Catalina lächelte, so traurig, wie ihr gerade zumute war.
Jetzt erst wurde ihr bewusst, dass Jordi nicht die leiseste Ahnung haben konnte, was aus ihr geworden war. Er hatte keine Ahnung, dass der treue Rabenkater ihrer Großmutter Catalina dort unter der Brücke aufgespürt und mit sich genommen hatte. Er wusste weder von den Erinnerungen, die in dem glatten Aquamarin geschlummert hatten und nun wieder ihr selbst gehörten, noch von dem Verrat, den Sarita Soleado an ihrer Tochter begangen hatte. Eigentlich, musste sich das Mädchen eingestehen, war Jordi vollkommen unwissend. Ahnungslos. Selbst wenn er es bis zur Kathedrale geschafft und Malfuria mit eigenen Augen gesehen hätte – nichts von alledem hätte einen Sinn für ihn ergeben.
»Ihr habt euch verloren«, sagte Makris de los Santos mit ruhiger und rauchiger Stimme, »doch ist es nicht viel wichtiger, dass ihr euch vorher gefunden habt?«
Catalina schluckte. An die lebendigen Schatten musste sie denken, vor denen sie geflohen war, bis es kein Entkommen mehr gegeben hatte. An den alten Márquez, ihren Lehrmeister, an den Bibliothekar Firnis und all die anderen, in deren Augen die Schatten ein Zuhause gefunden hatten.
Catalina hatte sie nicht retten können, trotz ihrer Gabe. Im Gegenteil – sie war es, die ihnen das Verderben gebracht hatte.
Sie schloss die Augen. Wie gerne würde sie jetzt auf der Mauer sitzen, hoch oben am Kastell de Montjuic, die Füße baumeln und sich von dem Wind Geschichten erzählen lassen. Die Sonne würde ihre Nase kitzeln und die Welt wäre ein schöner Ort.
Catalina öffnete die Augen und das Licht kehrte zurück, die Geräusche. Der Boden unter ihren Füßen wankte, weil sie sich im Auge eines Sturms befand.
»Wo sind wir jetzt?«
»Wie ich es sagte: hoch über den Wolken, hoch über der See.« Makris de los Santos ließ ihren Blick übers Meer gleiten. Aus dem Fenster in der Rabenfederwand strömte warme Luft ins Innere des Raums. Die Zigeunerhexe schnippte mit den Fingern und drehte sich zu dem Mädchen um. Die Öffnung schloss sich wieder.
»Und wohin fliegen wir?«
Makris de los Santos lächelte, und wenn sie das tat, stellte Catalina fest, dann war sie wunderschön. »Die Küste von Xarraca ist unser Ziel, jener Ort, an dem deine Großmutter Nuria gelebt hat.«
Catalina setzte sich auf den Boden und der pechschwarze Kater strich ihr sanft und langsam um die Beine.
»Das ist Miércoles«, sagte Makris de los Santos.
»Ein schöner Name.« Catalina streckte die Hand aus und der Kater kam zu ihr und schmiegte sich an sie.
»Er wurde an einem Mittwoch geboren. In einem Zirkus. Weit weg von Malfuria.«
Das geschmeidige Tier schnurrte und machte einen Buckel, genüsslich.
»Du denkst wirklich, dass es Nuria war, die mir am Schluss geholfen hat?«
»Ja«, erwiderte die Zigeunerhexe. »Die Herrin von Malfuria glaubt, dass deine Großmutter nicht tot ist. Sie muss noch leben. Das, was in Barcelona geschehen ist, kann nur sie getan haben. Und in Xarraca werden wir eine Spur von ihr finden.«
Heiße Tränen traten Catalina mit einem Mal in die Augen. Ihre Großmutter war eine Kartenmacherin, genau wie Catalina auch. Doch wann immer eine von ihnen ihre Kräfte einsetzte, musste sie einen hohen Preis zahlen. Auch Catalina konnte die Welt verändern, indem sie eine Karte zeichnete, die zur Wirklichkeit wurde.
»Wenn man die Veränderungen zeichnet«, sagte Catalina leise, »dann bringt man Unglück über jemanden, der einem am Herzen liegt.« Sie dachte an den Tod ihres Vaters und den Tod des Rabenkaters Ramon. Sowohl ihre Mutter als auch ihre Großmutter waren bereit gewesen, den Preis zu zahlen, der ihnen abverlangt wurde.
Trotzig wischte sie sich die Tränen aus dem Gesicht.
»Alles in Ordnung?«
»Die blöde Heulerei nützt niemandem«, gab Catalina zur Antwort und versuchte, zuversichtlich zu klingen.
»Das Gute und das Böse haben manchmal das gleiche Gesicht«, sagte Makris de los Santos, die Catalinas Gedanken zu erraten schien. »Du glaubst, dass dem Jungen etwas Schlimmes widerfahren ist, weil du die Karte beim Haus der Nadeln verändert hast.«
»Ist es denn nicht so?«
»Du hast vorhin gesagt, dass du etwas spürst. Dass du spürst, dass er am Leben ist.«
»Vielleicht konnte er fliehen. Er kennt sich gut aus in der Stadt.«
»Dann gibt es Hoffnung.«
Catalina versuchte ein Lächeln. »Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er es nicht geschafft hat.«
Makris de los Santos trat neben sie. All die Ringe und Armbänder an ihrem Handgelenk klimperten, als sie dem Mädchen die Hand auf die Schulter legte. »Dann wird es so sein, Catalina.« Sie lächelte, aufmunternd. »Dann wird es wohl so sein.«
»Woher willst du das wissen?« In ihre Stimme mischte sich wieder die Ungeduld und Wut, die eben noch der Niedergeschlagenheit Platz gemacht hatte.
»Ich bin eine Zigeunerhexe und Zigeunerhexen wissen solche Sachen eben.«
Miércoles gähnte und verließ den Raum. Catalina stand auf und ging zur Rabenfedernwand. Man brauchte sie wirklich nur anzufassen und an der Stelle, die man berührt hatte, öffnete sich eine Tür oder ein Fenster – oder etwas ganz, ganz anderes passierte. Fasziniert betrachtete sie das Schauspiel aus der Nähe. Die Wand selbst fühlte sich warm an, irgendwie lebendig. Wie ein Tier, das den Atem kurz anhält, wenn man es streichelt.
Noch immer bewegte sich das Gebilde über die See. Wie eine hohe Windhose, bestehend aus pechschwarzen Rabenfedern, so musste Malfuria für jeden aussehen, der den Sturm vom Boden aus nahen sah. Catalina wollte gar nicht erst darüber nachdenken, in welcher Höhe sich der Sturm jetzt fortbewegte. Weiter vorne, wo die Wolkendecke löchrig wurde und den Blick auf die offene See freigab, kamen zwei große Rabenvögel auf Malfuria zugeflogen.
Makris musterte sie und in ihren Blick mischte sich so etwas wie Neugierde. »Es ist schon lange her, dass eine Hexe das letzte Mal den Rabensturm betreten hat«, sagte sie schließlich.
»Was ist mit dir?« Catalina blickte erstaunt auf. »Du bist doch auch eine.«
»Das Offensichtliche kann täuschen.« Makris de los Santos’ Mondaugen waren jetzt ganz tief und traurig. »Es ist wahr, ich beherrsche Tricks und Kunststücke. Aber echte Magie…« Sie zuckte die Achseln. »Trotzdem hat mich La Gataza zu sich genommen.«
»Wo ist sie? Wo ist die Hüterin von Malfuria?«, fragte Catalina. »Warum ist sie nicht hier, um meine Fragen zu beantworten?«
»Agata wird sich dir zeigen, wenn es an der Zeit ist«, erwiderte Makris. »Nicht vorher. Nicht nachher. Vielleicht bald. Vielleicht später.« Sie schüttelte den Kopf und überall klimperte es.
»Ich verstehe das alles nicht«, sagte Catalina verzweifelt. »Was ist Malfuria? Und wie bist du hierhergekommen, wenn du doch keine Hexe bist?«
»Es ist noch ein weiter Weg bis nach Xarraca, selbst für Malfuria«, erwiderte Makris nachdenklich. »Ich könnte dich herumführen und dir Malfuria zeigen. Und ich könnte dir meine Geschichte erzählen. Möchtest du eine Geschichte hören, Catalina?«
Das Mädchen dachte an Jordi und an Barcelona. Sie dachte an ihren alten Freund, den Wind, und daran, wie sehr sie seine Geschichten immer getröstet hatten. »Wenn du sie mir erzählen willst, ich bin eine gute Zuhörerin.«
Makris de los Santos ging voran.
Eine Rabenfedernwand löste sich auf und eine Wendeltreppe entstand. Catalina folgte der hübschen Hexe, die eigentlich gar keine Hexe war, und während Malfuria über die Wolken und über die See wirbelte, begann Makris de los Santos ihre Geschichte zu erzählen, wie es der Zigeuner Sitte seit alter Zeit war.
Kopernikus
Barcelona war in lähmendem Schweigen gefangen, seit die Schatten die Herrschaft übernommen hatten. Wolken zogen über der Stadt auf und wuchsen zu riesigen Gebilden aus pechschwarzer Nacht an. Hier und da fielen Schatten wie Regentropfen zu Boden, benetzten die Dächer der Häuser und strömten durch die Straßen. Sie krochen aus den dunklen Winkeln, streckten sich nach den verzweifelt fliehenden Menschen und flossen wie eiskalter Spuk in sie hinein, suchten durch Ohren und Nasen und Münder und Augen einen Pfad, der sie den Herzen der Menschen näher brachte. Wo sie die Menschen berührten, da erstarben das Lachen, die Gesänge und die Gespräche.
Selbst die Mosaikeidechsen waren grau geworden und das Klimpern der Steinplättchen, das immer beschwingt und fröhlich angemutet hatte, klang dumpf und schal. Die fliegenden Fische lagen wie vertrocknete Trauben auf dem brüchigen Kopfsteinpflaster. Finsterfalter stürzten sich auf die Menschen und hier und da erblickte man Harlekine, in deren unmittelbarer Nähe die Luft zu frieren begann.
Jordi Marí, der seine Gefühle verloren hatte, stand vor den Trümmern der Sagrada Família und fragte sich, warum er überhaupt hierhergekommen war. Die Kathedrale war nur mehr eine Ruine, in der hungrige Flammen wüteten. Ein Schiff, riesig, schwarz und mit geblähten Segeln, hatte über dem einst so mächtigen Gebäude geschwebt, es war eine Galeone gewesen, an deren Bug ein Name gestanden hatte: Meduza.
Dann war die Kathedrale auseinandergebrochen, als habe jemand Teile von ihr einfach ausradiert. Eine Staubwolke hatte sich über den Dächern von Eixample ausgebreitet und die Sonne verdunkelt. Menschen waren kopflos aus den Häusern geflüchtet, während ein Sturm aus schwarzen Federn mit spitzen Kielen für einen Moment die Trümmer einhüllte, bevor er wieder in Richtung Meer abzog, so plötzlich, wie er aufgetaucht war.
Jordi stand am Placa Verdaguer und suchte nach Antworten. Er war nur ein Junge mit zerzaustem Haar und traurigen Augen aus Mokka. Und er hatte keine Ahnung, wo er eigentlich hingehörte.
Bis hierher war er der fliegenden Galeone gefolgt, seit er sie über den Dächern ausgemacht hatte – aber er wusste nicht mehr, warum er das getan hatte. Seine Hand tat weh und er glaubte sich an ein Tier zu erinnern, das ihn gestochen hatte. Ein Finsterfalter, von denen es nun viele gab in der Stadt.
Seither waren die Menschen ihm ausgewichen, jene, die vor dem Grauen flohen, aber auch jene, die bereits die Schatten in ihren Augen trugen. Schattenaugenmenschen, so nannte Jordi sie. Wie ferngesteuert bewegten sie sich durch die Gassen, nicht Schatten und nicht Mensch.
An sie erinnerte er sich. Auch an seinen Namen. Doch an vieles andere nicht.
Da war eine Melodie, die er vergessen hatte und die einmal beschwingt und voller Leben gewesen sein mochte. Wie ein Geschmack, der längst verblasst ist, war der Klang doch greifbar, konnte er die Noten noch berühren. Doch die Töne waren verloren. Etwas fehlte ihm so sehr, dass es ihm die Kehle zuschnürte und ihm Tränen in die Augen trieb. Aber er hatte vergessen, was es gewesen war.
Ergab das einen Sinn? Oder war dies nur die Art und Weise, wie sich die Leere in eine verletzte Seele einschleicht? Man verspürt eine unermessliche Trauer und weiß nicht einmal, was geschehen ist, und mit jedem Augenblick, der vergeht, stirbt das, woran man sich nicht mehr erinnern kann, ein wenig mehr?
Es fühlte sich grässlich an, so, als habe man ihm das Herz geraubt.
Ein wispernder Windhauch zerzauste ihm das Haar. Vor ihm ragte der abgebrochene Mast der fliegenden Galeone in den Himmel. Die schwarzen Segel waren nur mehr Fetzen, die sich in den steinernen Trümmern verfangen hatten und an denen jetzt Flammenzungen leckten.
Jordi hustete, als ihm erneut Staub ins Gesicht wehte. Die Luft roch nach Feuer und Ruß. Irgendwo schrien Menschen. Nein, nicht irgendwo. Überall!
Ein junger Mann kam aus einem Hauseingang gestürmt, stolperte und stürzte. Sofort rappelte er sich auf und war wieder auf den Beinen, bevor Jordi auch nur überlegen konnte, ob er ihm zu Hilfe eilen sollte.
Verwirrt sah der Mann sich auf dem Platz um. Das dunkle Haar klebte ihm im Gesicht. Plötzlich tauchte eine große Gestalt hinter ihm auf, gekleidet in ein schwarzes Gewand. Die weiße Maske eines Harlekins verdeckte ihr Gesicht. Die Augenschlitze, das konnte Jordi erkennen, waren nicht mehr als schmale Schlitze, in denen die Finsternis wohnte, pechschwarz und eisig kalt.
Jordi fühlte, wie die Angst nach ihm griff, eine Angst, die er sich nicht recht erklären konnte. Instinktiv duckte er sich hinter dem zerbrochenen Mast der fliegenden Galeone.
Der junge Mann rannte über den Platz, doch in seiner Hast stolperte er abermals. Seine Augen waren weit aufgerissen, als er auf das Kopfsteinpflaster stürzte. Der Harlekin kam langsam und ohne Eile hinter ihm her. Es sah aus, als schwebe er, so fließend und anmutig waren seine Bewegungen.
Eine Frau erschien in dem Hauseingang, aus dem der Mann geflohen war. Sie schlug die Hände vor den Mund, als sie den Harlekin sah.
Jordi lugte vorsichtig hinter dem Mast hervor. Was er beobachtete, ließ ihn zurücktaumeln. Seine Hände zitterten.
Aus den Augenschlitzen des Harlekins rannen pechschwarze Schatten und schossen wie dünne Fäden auf den Mann zu, der noch immer am Boden kniete. Sie benetzten sein Gesicht und ein feines Netz aus dünnen tintenartigen Linien kroch ihm über die Wangen. Die Schatten flossen ihm in Ohren, Nase, Mund. Und so fest er auch die Augen schloss, auch dorthin fanden sie ihren Weg.
Da machte der Harlekin auf dem Absatz kehrt und verschwand mit ruhigen Schritten in einer Gasse, als sei er hier nicht weiter vonnöten.
Die Frau, die aus dem Haus gestürmt war, lief auf den Mann zu, der kniend auf dem Kopfsteinpflaster verharrte. Die Schatten schwammen jetzt auch in seinen Augen. Er öffnete den Mund, und als sie dicht vor ihm stand und ihm helfen wollte, da spuckte er ihr ein schwarzes Schattengewächs mitten ins Gesicht.
Die Frau schrie auf, laut und grell, mit einer Stimme, die sich überschlug. Dann krochen die Schatten auch ihr in die Augen.
So vermehren sie sich also, dachte Jordi.
Die beiden Schattenaugenmenschen, die gerade geboren worden waren, erhoben sich und verließen den Platz mit schlurfenden Schritten. Es sah aus, als müssten sie sich jede Bewegung ihres Körpers sorgfältig überlegen.
Was immer sie jetzt auch waren, Menschen konnte man sie nicht mehr nennen.
Benommen schaute Jordi zum Meer hinaus, dessen helles Blau den weiten Horizont berührte. Der seltsame Sturm, der die Kathedrale kurz nach dem Absturz der fliegenden Galeone umhüllt hatte, war nur noch eine Silhouette am Horizont.
Der Junge unterdrückte ein verzweifeltes Stöhnen. Wenn er noch nicht einmal wusste, wer er wirklich war, wie sollte er dann herausbekommen, was hier vor sich ging? Einzig sein Name war ihm geblieben, aber was bedeutete schon ein Name? Doch nicht viel mehr als eine Bezeichnung für eine Hülle, die leblos und leer war.
Woher kamen die Schatten? Was machte sie lebendig? Fest stand, dass sie sich mit einem Mal gegen die Menschen wandten. Was das aber bedeutete, das konnte Jordi nicht sagen.
Plötzlich erklang dicht hinter ihm ein ersticktes Fluchen, gefolgt von einem Krachen, als die Trümmer der Galeone sich ineinanderschoben.
Jordi schaute sich um. Hinter ihm, mitten aus den Trümmerteilen, die ehemals zum Bug der Galeone gehört haben mochten, ragten Stufen in den Himmel, breite, verwitterte Steinstufen. Verwundert stellte Jordi fest, dass sie einst zur Kathedrale heraufgeführt hatten. Eine schier unermessliche Kraft hatte die Steinbrocken bis hierhin geschleudert.
Auf der obersten Stufe stand ein Mensch.
Oder zumindest sah die in einen Ledermantel gehüllte Gestalt aus wie ein Mensch.
Hinter langem schwarzem Haar, das in wirren Strähnen herunterhing, erkannte Jordi eine Brille mit dunklen Gläsern, die grün im Licht der sanft schwindenden Sonne schimmerten.
Jordis Blicke folgten dem Mann, während er jetzt die Stufen hinabtaumelte, bis nach unten, wo er auf die Knie sank und am Boden verharrte.
Jordi hielt den Atem an. Er hatte gesehen, was die Schatten anzurichten vermochten. Hatten sie den Mann bereits befallen? Trug er deswegen die Brille?
Lauf weg, solange du noch kannst, schoss es ihm durch den Kopf. Doch seine Beine gehorchten nicht. Etwas hielt ihn an seinem Platz hinter dem zerbrochenen Mast, als wäre er dort festgewachsen.
Der Mann in Schwarz, der sich in hektischer Eile den Ledermantel vom Körper streifte und achtlos im Dreck liegen ließ, stöhnte auf und dann wurde das Stöhnen zu einem Schrei, der tief und verzweifelt in der Hitze flimmerte. Die Brille fiel zu Boden und blieb unbeachtet dort liegen.
Und im gleichen Moment sah Jordi es wieder.
Dichte Schatten, schwarz wie Pech, flossen dem Mann aus den Augen. Wie finsterer Sirup tropften sie zu Boden.
Der Mann schrie erneut auf und krümmte sich. Wie ein Hund rollte er sich im Dreck umher. Schattenspritzer benetzten die Stufen und flossen in die Ritzen zwischen den Steinen.
Jordi biss sich auf die Unterlippe. Es musste doch etwas geben, um dem Mann helfen zu können – um ihm irgendwie beizustehen! Er wollte nicht einfach zuschauen, das war falsch! Aber was konnte er gegen diese Wesen ausrichten?
Plötzlich kam ihm ein Einfall. Das, was hier passierte, sah tatsächlich genauso aus wie das, was der Harlekin dem jungen Mann angetan hatte. Doch war es jetzt nicht der umgekehrte Vorgang? Die Schatten flossen dem Mann aus den Augen hinaus, nicht hinein!
Der Mann stöhnte abermals, ein Ton, der Jordi durch Mark und Bein ging, und nun zögerte er nicht länger.
Eilig rannte er zu den Stufen hinüber. Die Schattenspritzer flossen in alle Richtungen davon.
»Ruhig«, flüsterte Jordi und kniete sich neben den Mann. Aber er wagte es nicht, ihn anzufassen.
Es könnte eine Falle sein, dachte er. Ein mieser Trick. Doch gerade, als das Misstrauen ihn wieder zurückweichen lassen wollte, wurde der Mann ruhiger und schlug seine Augen auf.
Sie waren hell und voller Furcht und die Sonnenstrahlen spiegelten sich in ihnen. Jordi hatte keine Erklärung dafür, aber er wusste, dass jemand, der so viel Licht in seinem Blick bewahrte, nicht böse sein konnte.
»Es ist kalt.« Der Mann in Schwarz richtete sich auf, sah den Jungen und hustete, als er zu sprechen versuchte. »Wer bist du?«
»Jordi«, sagte Jordi nur. »Jordi Marí.«
»Ich bin Kopernikus«, erwiderte der Mann mit schwacher Stimme. Er trug Stiefel mit kunstvollen Schnallen an den Seiten. »Ich war an Bord des Schiffes, als es abgestürzt ist.«
Jordi musterte ihn ungläubig. Er dachte daran, mit welcher Gewalt die fliegende Galeone in die Kathedrale gestürzt war. »Und das habt ihr überlebt?«, fragte er misstrauisch.
»Das Glück war mir hold.« Kopernikus schaute sich unruhig um, wachsam und nachdenklich. Dann plötzlich schnellte er vor und packte Jordi fest an den Schultern. »Kennst du den Weg zum Hafen, Junge?« So unvermittelt kam diese Frage, dass Jordi kaum reagieren konnte. Der Fremde schüttelte ihn unsanft. »Sag schon, die Zeit läuft uns davon!« Ein neuer Hustenanfall ließ ihn schweigen.
»Es tut mir leid«, entschuldigte er sich sofort, »aber sie sind so kalt.« Er rieb sich erschöpft die Augen. »Ich meine die Schatten. Sie sind wie Eisregen.« Er wirkte durcheinander, schloss die Augen und riss sie dann wieder auf. »Nie wieder will ich die Finsternis sehen müssen.«
»Ich weiß den Weg dorthin«, sagte Jordi und wunderte sich selbst über seine Worte. »Hinunter zum Hafen, meine ich.«